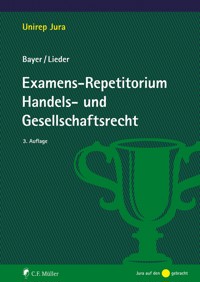
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Repetitorium: - Der wesentliche Stoff des HGB für die Zivilrechtsklausur. - So kommen die handels- und gesellschaftsrechtlichen Vorschriften in der Klausur vor. - Von Prüfern anschaulich aufgearbeitet und im Uni-Repetitorium praktisch erprobt.Das Examens-Repetitorium zum Handelsrecht und Gesellschaftsrecht ist mit seiner Vielzahl an anschaulichen Fällen aus dem Repetitorium für Handels- und Gesellschaftsrecht an der Friedrich-Schiller-Universität Jena entstanden, das von beiden Autoren über viele Semester durchgeführt und stetig fortentwickelt wurde. Gemäß seinem Zuschnitt als universitäres Repetitorium richtet sich das Werk an den Examenskandidaten, der innerhalb überschaubarer Zeit eine sichere Orientierung in den zum Pflichtfachstoff gehörenden Teilen des Handelsrechts und des Gesellschaftsrechts anhand von Fällen sucht. Mit Blick auf die unterschiedlichen Anforderungen dieses Prüfungsfachs in den einzelnen Bundesländern wurde eine bewusste Selektion des Prüfungsstoffes vorgenommen. Behandelt werden die examensrelevanten Teile des Handelsrechts und des Personengesellschaftsrechts. Im Kapitalgesellschaftsrecht liegt ein Schwerpunkt auf der Gründung und der Haftung der juristischen Person. Aus den genannten Gebieten des Handelsrechts und des Gesellschaftsrechts wurden die klassischen Probleme, deren Kenntnis im Examen in allen Fällen vorausgesetzt wird, mit aktuellen Fragestellungen kombiniert und anhand von zahlreichen, beispielhaften Fällen aufgearbeitet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Examens-Repetitorium Handels- und Gesellschaftsrecht
von
Dr. Walter Bayerem. o. Professor an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
und
Dr. Jan Lieder, LL.M. (Harvard)o. Professor an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
3., neu bearbeitete Auflage
www.cfmueller.de
UNIREP JURA
Herausgegeben von Prof. Dr. Mathias Habersack
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <https://portal.dnb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-6647-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 6221 1859 599Telefax: +49 6221 1859 598
www.cfmueller.de
© 2025 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des e-Books das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Der Verlag schützt seine e-Books vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Vorwort
Das vorliegende Buch ist aus dem Repetitorium für Handels- und Gesellschaftsrecht an der Friedrich-Schiller-Universität Jena hervorgegangen, das von beiden Autoren über viele Semester durchgeführt und stetig fortentwickelt wurde. Im Rahmen der Neuauflage ist das Werk moderat ausgebaut und insgesamt auf den Stand von Januar 2025 gebracht worden. Die für den Pflichtfachbereich relevanten höchstrichterlichen Entscheidungen wurden dabei ebenso berücksichtigt wie examensrelevante Beiträge aus der Ausbildungsliteratur. Besonderes Augenmerk lag auf der umfassenden Überarbeitung der Passagen zum Personengesellschaftsrecht, das durch das MoPeG (Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrecht vom 10.8.2021, BGBl. I, S. 3436) tiefgreifende Änderungen erfahren hat. Einzelne Kapitel mussten daraufhin neu konzipiert und zum Teil völlig neu geschrieben werden. Darüber hinaus hat das Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG) vom 5.7.2021 (BGBl. I, S. 3338) Anpassungen im Handelsregisterrecht erforderlich gemacht.
Gemäß seinem Zuschnitt als universitäres Repetitorium richtet sich das Werk an den Examenskandidaten, der innerhalb überschaubarer Zeit eine sichere Orientierung in den zum Pflichtfachstoff gehörenden Teilen des Handels- und Gesellschaftsrechts sucht. Das Buch eignet sich allerdings auch zur Vor- und Nachbereitung der grundständigen Vorlesungen zum Thema. Mit Blick auf die unterschiedlichen Zuschnitte dieses Prüfungsfachs in den einzelnen Bundesländern wurde von uns eine bewusste Selektion des Prüfungsstoffes vorgenommen. Behandelt werden die examensrelevanten Teile des Handelsrechts und des Personengesellschaftsrechts. Im Kapitalgesellschaftsrecht liegt ein Schwerpunkt auf der Gründung und der Haftung der juristischen Person.
Aus den genannten Gebieten haben wir die klassischen Probleme, deren Kenntnis im Examen in jedem Fall vorausgesetzt wird, mit aktuellen Fragestellungen kombiniert und anhand einer Vielzahl von Beispielsfällen aufgearbeitet. Mit dieser Ausrichtung fügt sich das Buch nahtlos in die hergebrachte Konzeption der Reihe UNIREP JURA ein.
Wir danken Herrn Franz Schmelzing vom Freiburger Lehrstuhl für eine kritische Durchsicht des gesamten Werkes.
Kritik und Anregungen erreichen uns am besten per E-Mail ([email protected] und [email protected]).
Jena und Freiburg im Breisgau, im März 2025
Walter Bayer
Jan Lieder
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Literatur
§ 1Gegenstand und Bedeutung des Handelsrechts
I.Konzeption der lex lata1 – 3
II.Bedeutung des Handelsrechts und Verhältnis zum Bürgerlichen Recht4, 5
III.Fortentwicklung zum (Sonder-)Außenprivatrecht der Unternehmen?6, 7
IV.Rechtsvergleichung und Harmonisierung des Handelsrechts8, 9
§ 2Kaufmannseigenschaft
I.System der §§ 1–6 HGB12 – 23
1.Istkaufmann12
2.Kannkaufmann13
3.Formkaufmann14 – 19
4.Fiktivkaufmann20 – 23
II.Der Grundtatbestand des § 1 HGB24 – 36
1.Betrieb eines Gewerbes25 – 33
2.Ausnahme: Kleingewerbe34 – 36
III.Scheinkaufmann37 – 50
1.Grundlagen und Dogmatik37
2.Tatbestandsvoraussetzungen38 – 41
3.Rechtswirkungen42 – 50
§ 3Publizität des Handelsregisters
I.Grundlagen51 – 58
1.Publizität durch das Handelsregister51, 52
2.Eintragungspflichtige und eintragungsfähige Tatsachen53 – 57
3.Deklaratorische und konstitutive Wirkungen der Eintragung58
II.Negative und positive Publizität des Handelsregisters gem. § 15 HGB59 – 139
1.Negative Publizität gem. § 15 I HGB60 – 101
a)Normzweck und dogmatische Struktur60 – 65
b)Tatbestandsvoraussetzungen66 – 88
c)Rechtsfolgen89 – 101
2.Schutz bei richtiger Eintragung und Bekanntmachung gem. § 15 II HGB102 – 109
a)Wirkung eingetragener und bekanntgemachter Tatsachen gegenüber Dritten102 – 108
b)Verlängerung des durch § 15 I HGB vermittelten Schutzes (§ 15 II 2 HGB)109
3.Positive Publizität gem. § 15 III HGB110 – 139
a)Normzweck und dogmatische Struktur110 – 112
b)Gewohnheitsrechtliche Rechtsscheinhaftung113 – 117
c)Anwendungsbereich und Tatbestandsvoraussetzungen des § 15 III HGB118 – 135
d)Rechtswirkungen136
e)Anwendung auf die eGbR137 – 139
§ 4Übertragung und Vererbung des kaufmännischen Unternehmens
I.Unternehmen und Unternehmensträger140 – 144
II.Die Übertragung des Unternehmens145 – 160
1.Asset deal148 – 154
a)Verpflichtungsgeschäft148 – 153
b)Verfügungsgeschäft154
2.Share deal155 – 160
III.Haftungsregeln gem. §§ 25–28 HGB161 – 206
1.Haftung des Erwerbers bei Firmenfortführung (§ 25 I 1 HGB)161 – 185
a)Überblick161, 162
b)Tatbestandsvoraussetzungen163 – 178
c)Haftungsausschluss (§ 25 II HGB)179, 180
d)Rechtsfolgen181 – 183
e)Forderungsübergang184, 185
2.Haftung des Erben bei Fortführung des Handelsgeschäfts (§ 27 HGB)186 – 195
a)Überblick, Normzweck und Verhältnis zur allgemeinen Erbenhaftung186, 187
b)Tatbestandsvoraussetzungen188 – 191
c)Rechtsfolgen192
d)Haftungsausschluss193 – 195
3.Einbringung eines einzelkaufmännischen Unternehmens in eine Personengesellschaft (§ 28 HGB)196 – 206
a)Gesetzliche Terminologie, praktischer Anwendungsbereich und Normzweck des § 28 HGB196
b)Tatbestandsvoraussetzungen und Abgrenzungen197 – 202
c)Rechtsfolgen203 – 205
d)Haftungsausschluss206
§ 5Handelsrechtliche Stellvertretung
I.Überblick und Terminologie207
II.Prokura208 – 234
1.Erteilung der Prokura209 – 217
2.Umfang der Prokura218 – 224
3.Erlöschen der Prokura225 – 230
4.Missbrauch der Vertretungsmacht durch den Prokuristen231 – 234
III.Handlungsvollmacht235 – 247
1.Begriff und Bedeutung235
2.Erteilung und Erlöschen der Handlungsvollmacht236 – 240
3.Umfang und Grenzen der Handlungsvollmacht241 – 247
IV.Stellvertretung durch Ladenangestellte248 – 257
1.Bedeutung und dogmatische Einordnung249, 250
2.Tatbestand und Rechtsfolge251 – 257
§ 6Allgemeine Vorschriften für Handelsgeschäfte
I.Begriff des Handelsgeschäfts und Differenzierungen259 – 265
II.Schweigen im Handelsverkehr266 – 294
1.Schweigen auf Anträge gem. § 362 HGB267 – 275
2.Schweigen auf ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben276 – 294
III.Handelsbrauch gem. § 346 HGB295 – 297
IV.Wirksamkeit der Abtretung unternehmerischer Forderungen gem. § 354a HGB298 – 306
V.Kontokorrent gem. §§ 355 ff. HGB307 – 312
VI.Gutgläubiger Erwerb beweglicher Sachen gem. § 366 HGB313 – 322
1.Regelungszweck313
2.Gutgläubiger Mobiliarerwerb gem. § 366 I HGB314 – 320
3.Gutgläubiger Erwerb eines gesetzlichen Pfandrechts gem. § 366 III HGB321, 322
VII.Kaufmännisches Zurückbehaltungsrecht gem. § 369 HGB323 – 327
VIII.Weitere handelsrechtliche Abweichungen328 – 333
§ 7Handelskauf, Kommissionsgeschäft, Transportgeschäfte
I.Handelskauf334 – 369
1.Annahmeverzug gem. §§ 373, 374 HGB336 – 340
2.Fixhandelskauf gem. § 376 HGB341 – 345
3.Rügeobliegenheit gem. § 377 HGB346 – 369
a)Beiderseitiges Handelsgeschäft347
b)Ablieferung348
c)Mangel349 – 353
d)Redlichkeit des Verkäufers354
e)Untersuchung355 – 360
f)Mängelrüge361, 362
g)Genehmigungsfiktion bei verspäteter oder nicht ordnungsgemäßer Rüge363, 364
h)Rechtsfolgen einer Falschlieferung365, 366
i)Rechtsfolgen einer Minderlieferung367 – 369
II.Kommissionsgeschäft370 – 397
1.Begriff und systematische Verortung370, 371
2.Kommissionsgeschäft zwischen Kommissionär und Kommittent372 – 376
3.Ausführungsgeschäft zwischen Kommissionär und Drittem377 – 397
a)Forderungen aus dem Ausführungsgeschäft378 – 382
b)Schutz des Kommittenten383 – 391
c)Ausführungsgeschäft392 – 397
III.Transportgeschäfte398 – 402
§ 8Gegenstand des Gesellschaftsrechts, Strukturen und Rechtsformen im Überblick
I.Gesellschaftsrecht als Sonderprivatrecht und als Teil des Wirtschaftsrechts403 – 410
1.Begriff und Bedeutung403, 404
2.Wirtschaftsordnung und Gesellschaftsrecht405
3.Verhältnis zu anderen Rechtsgebieten406 – 410
II.Funktion des Gesellschaftsrechts411 – 415
III.Personengesellschaft/Körperschaft/Kapitalgesellschaft416 – 423
IV.Typenzwang und Typenmischung424, 425
V.Rechtsfähigkeit426 – 433
1.Juristische Personen und Personenhandelsgesellschaften426 – 428
2.Rechtsfähigkeit der BGB-Gesellschaft429 – 433
§ 9Errichtung der Gesellschaft
I.BGB-Gesellschaft434 – 477
1.Gesellschafter434 – 436
2.Gesellschaftsvertrag437 – 475
a)Mindestinhalt und Rechtsnatur437 – 439
b)Gesellschaftszweck440, 441
c)Vertragsschluss442 – 468
d)Auslegung/Vertragsergänzung469 – 471
e)Inhaltskontrolle472, 473
f)Innengesellschaft474, 475
3.Eintragung in das Gesellschaftsregister476, 477
a)Fakultative Eintragung476
b)Eingetragene BGB-Gesellschaft (eGbR)477
II.Offene Handelsgesellschaft (OHG)478 – 485
1.Definition478 – 484
2.Anwendbarkeit der Vorschriften über die BGB-Gesellschaft485
III.Kommanditgesellschaft (KG)486 – 489
1.Definition486
2.Anwendbarkeit der Vorschriften über die OHG und die BGB-Gesellschaft487, 488
3.Handelsregistereintragung489
IV.Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)490 – 530
1.Begriff490 – 492
2.Gesellschaftsvertrag493 – 499
a)Inhalt493 – 498
b)Wirksamkeit499
3.Erbringung der Einlage500 – 506
4.Vorgründungsgesellschaft507 – 514
5.Vorgesellschaft515 – 530
a)Rechtsform eigener Art517
b)Haftungsverfassung518 – 530
aa)Haftung der Vorgesellschaft518 – 521
bb)Haftung der Gesellschafter522 – 526
cc)Handelndenhaftung527 – 530
V.Aktiengesellschaft (AG)531 – 533
1.Begriff531
2.Gründungsverfahren, Satzung, Grundkapital532, 533
§ 10Geschäftsführung und Vertretung
I.Begriff, Abgrenzung und Überblick534 – 537
II.Geschäftsführungsbefugnis und Vertretungsmacht538
III.Geschäftsführung539 – 550
1.BGB-Gesellschaft539 – 543
a)Gesamtgeschäftsführungsbefugnis539
b)Abweichende Regelungen540
c)Notgeschäftsführungsbefugnis541, 542
d)Umfang der Geschäftsführungsbefugnis543
2.OHG544 – 546
3.KG547
4.GmbH548
5.AG549, 550
IV.Vertretung551 – 580
1.BGB-Gesellschaft551 – 565
a)Gesamtvertretungsbefugnis551, 552
b)Abweichende Regelungen553 – 556
c)Umfang der Vertretungsbefugnis557 – 559
d)Einzelfragen560 – 565
2.OHG566 – 572
3.KG573 – 576
4.GmbH577 – 579
5.AG580
V.Entzug der Geschäftsführungsbefugnis und Vertretungsmacht/Abberufung der Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder581 – 589
1.BGB-Gesellschaft581 – 585
2.OHG586, 587
3.GmbH588
4.AG589
VI.Pflichtwidrige Geschäftsführung590 – 594
1.Personengesellschaften590, 591
2.GmbH592, 593
3.AG594
§ 11Verbindlichkeiten der Gesellschaft und Haftung der Gesellschafter
I.Verbindlichkeit der Gesellschaft596 – 601
II.Haftung der Gesellschafter im Außenverhältnis602 – 665
1.BGB-Gesellschaft602 – 634
a)Grundlagen602 – 609
b)Haftungsverhältnis610 – 614
c)Inhalt der Gesellschafterhaftung615 – 625
d)Einreden und Einwendungen626 – 634
2.OHG635, 636
3.KG637 – 655
a)Grundregel637
b)Kommanditistenhaftung638 – 655
aa)Unterscheidung zwischen Haft- und Pflichteinlage638, 639
bb)Haftungsausschluss durch Einlageleistung640 – 642
cc)Wiederaufleben der Haftung643 – 654
dd)Unbeschränkte Haftung vor Eintragung655
4.GmbH656 – 665
a)Kapitalschutz656 – 658
b)Durchgriffsfälle659 – 665
III.Ansprüche zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern sowie der Gesellschafter untereinander666 – 686
1.BGB-Gesellschaft666 – 684
a)Ansprüche der Gesellschafter gegen die Gesellschaft666 – 671
aa)Aufwendungsersatz666 – 668
bb)Anspruch wegen cessio legis669 – 671
b)Ausgleichsanspruch gegen Mitgesellschafter672 – 684
aa)Sozialverbindlichkeiten673 – 677
bb)Gesellschafteransprüche aus Drittgeschäften678 – 684
2.OHG685
3.KG686
§ 12Innenrecht der Gesellschaft
I.Mitgliedschaft687, 688
II.Beiträge689 – 691
III.Gesellschaftsrechtliche Treuepflicht692 – 704
1.Grundlagen692 – 695
2.Fallgruppen696 – 704
IV.Wettbewerbsverbot705 – 708
1.OHG705 – 707
2.KG708
V.Gleichbehandlungsgebot709, 710
VI.Informations- und Kontrollrechte711 – 713
VII.Gesellschafterversammlung714 – 726
1.BGB-Gesellschaft715 – 720
2.Personenhandelsgesellschaften721 – 724
3.AG725
4.GmbH726
VIII.Durchsetzung von Sozialansprüchen727 – 735
1.Actio pro socio727 – 734
2.Bestellung eines besonderen Vertreters735
§ 13Veränderungen im Gesellschafterkreis
I.Beitritt736 – 741
1.GbR736 – 739
2.OHG740
3.KG741
II.Ausscheiden742 – 765
1.GbR742 – 760
a)Gesetzliche Kündigungs- und Ausschlussrechte742 – 746
b)Vertragliche Ausschlussklauseln747 – 752
c)Rechtsfolgen des Ausscheidens753 – 760
2.OHG761 – 764
3.KG765
III.Gesellschafterwechsel766 – 779
1.GbR766
2.OHG767
3.KG768 – 779
a)Haftung des Altkommanditisten771 – 776
b)Haftung des Neukommanditisten777 – 779
IV.Tod des Gesellschafters780 – 798
1.GbR780 – 795
a)Rechtslage ohne vertragliche Regelung781 – 783
b)Einfache erbrechtliche Nachfolgeklausel784, 785
c)Qualifizierte erbrechtliche Nachfolgeklausel786, 787
d)Rechtsgeschäftliche Nachfolgeklausel788 – 790
e)Eintrittsklausel791
f)Haftungsfragen792, 793
g)Testamentsvollstreckung794, 795
2.OHG796, 797
3.KG798
§ 14Fehlerhafte Gesellschaft und Scheingesellschaft
I.Fehlerhafte Gesellschaft799 – 817
1.Dogmatische Grundlagen799 – 802
2.Fehlerhafter Gesellschaftsvertrag803 – 805
3.Vollzug des Gesellschaftsverhältnisses806
4.Kein Verstoß gegen höherrangige Interessen807 – 815
a)Arglistige Täuschung808
b)Geschäftsfähigkeit809 – 811
c)Verstoß gegen §§ 134, 138 BGB, § 1 GWB812
d)Verbraucherschutz813
e)Vertreter ohne Vertretungsmacht814, 815
5.Rechtsfolgen816, 817
II.Scheingesellschaft818 – 838
1.Abgrenzung zur fehlerhaften Gesellschaft818
2.Dogmatische Grundlagen819, 820
3.Schein-GbR821 – 827
4.Schein-OHG828 – 832
5.Schein-KG833 – 838
§ 15Auflösung und Beendigung
I.Auflösungsgründe839 – 841
1.GbR839, 840
2.OHG841
II.Auflösungsfolgen842 – 845
1.GbR842 – 844
2.OHG845
III.Beendigung846
Stichwortverzeichnis
Literatur
Altmeppen, Holger
Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), 11 Aufl., 2023 (zit.: Altmeppen, GmbHG)
BeckOK-BGB
BGB – Beck'scher Online Kommentar, Edition 71, Stand: 1.8.2024 (zit.: BeckOK-BGB/Bearbeiter)
BeckOK-HGB
HGB – Beck'scher Online Kommentar, Edition 44, Stand: 1.10.2024 (zit.: BeckOK-HGB/Bearbeiter)
Bitter, Georg/Heim, Sebastian
Gesellschaftsrecht, 7. Aufl., 2024
ders./Linardatos, Dimitrios
Handelsrecht mit UN-Kaufrecht, 4. Aufl., 2022
Bork, Reinhard
Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 4. Aufl., 2016 (zit.: Bork, BGB AT)
ders./Schäfer, Carsten
Kommentar zum GmbHG, 5. Aufl., 2022 (zit.: Bork/Schäfer/Bearbeiter, GmbHG)
Brox, Hans/Henssler, Martin
Handelsrecht, 23. Aufl., 2020
ders./Rüthers, Bernd/Henssler, Martin
Arbeitsrecht, 20. Aufl., 2020
Bülow, Peter/Artz, Markus
Handelsrecht, 7. Aufl., 2015
Canaris, Claus-Wilhelm
Handelsrecht, 24. Aufl., 2006
Drygala, Tim/Staake, Marco/Szalai, Stephan
Kapitalgesellschaftsrecht, 2012
Ebenroth, Thomas/Boujong, Karlheinz
Handelsgesetzbuch Band 1 (§§ 1-342e), 5. Aufl., 2024, Band 2 (§§ 343-475h), 5. Aufl., 2024 (zit.: Ebenroth/Boujong/Bearbeiter, HGB)
Ensthaler, Jürgen
Gemeinschaftskommentar zum Handelsgesetzbuch mit UN-Kaufrecht, 8. Aufl., 2015 (zit.: GK-HGB/Bearbeiter)
Erman, Walther
Bürgerliches Gesetzbuch, 17. Aufl., 2023 (zit.: Erman/Bearbeiter, BGB)
Fischinger, Philipp S.
Handelsrecht, 3. Aufl., 2023
Flume, Werner
Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts Erster Band: Teil 1: Die Personengesellschaft, 1977 (zit.: Flume, AT I/1), Zweiter Band: Das Rechtsgeschäft, 4. Aufl., 1992 (zit.: Flume, AT II)
Gehrlein, Markus/Born, Manfred/Simon, Stefan
GmbHG, Kommentar, 6. Aufl., 2023 (zit.: Gehrlein/Born/Simon/Bearbeiter, GmbHG)
Grüneberg, Christian
Bürgerliches Gesetzbuch, 83. Aufl., 2024 (zit.: Grüneberg/Bearbeiter)
Grunewald, Barbara/Müller, Hans-Friedrich
Gesellschaftsrecht, 12. Aufl., 2023
Habersack, Mathias/Casper, Matthias/Löbbe, Marc
Großkommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), 3. Aufl., Band 1 (§§ 1–28), 2019; Band 2 (§§ 29–52), 2020; Band 3 (§§ 53–88), 2021 (zit.: Habersack/Casper/Löbbe/Bearbeiter, GmbHG)
Heidel, Thomas/Schall, Alexander
Handelsgesetzbuch, Handkommentar, 4. Aufl., 2024 (zit.: Hk-HGB/Bearbeiter)
Henssler, Martin/Strohn, Lutz
Gesellschaftsrecht, 6. Aufl., 2024 (zit.: Henssler/Strohn/Bearbeiter)
Heymann, Ernst
Handelsgesetzbuch Band 1 (§§ 1–104a), 3. Aufl., 2019 (zit.: Heymann/Bearbeiter, HGB), Band 2 (§§ 105–237), 3. Aufl., 2020 (zit.: Heymann/Bearbeiter, HGB), Band 4/1, (§§ 343–475h), 3. Aufl. (im Erscheinen) (zit.: Heymann/Bearbeiter, HGB), Band 4, (§§ 343–475h), 2. Aufl., 2005 (zit.: Heymann/Bearbeiter, HGB, 2. Aufl.)
Hopt, Klaus J.
Handelsgesetzbuch, 43. Aufl., 2024 (zit.: Hopt/Bearbeiter, HGB)
Hübner, Ulrich
Handelsrecht, 5. Aufl., 2004
Koch, Jens
Aktiengesetz, 18. Aufl., 2024 (zit.: Koch, AktG)
Jauernig, Othmar
Bürgerliches Gesetzbuch, 19. Aufl., 2023 (zit.: Jauernig/Bearbeiter)
Jung, Peter
Handelsrecht, 13. Aufl., 2023
Junker, Abbo
Grundkurs Arbeitsrecht, 23. Aufl., 2024
Kindl, Johann
Gesellschaftsrecht, 2. Aufl., 2019
Kindler, Peter
Grundkurs Handels- und Gesellschaftsrecht, 10. Aufl., 2024
Koch, Jens
Gesellschaftsrecht, 13. Aufl., 2023
ders.
Aktiengesetz, 18. Aufl., 2024
ders.
Personengesellschaftsrecht, 2024 (zit.: Koch/Bearbeiter)
Koller, Ingo/Kindler, Peter/Drüen, Klaus-Dieter
Handelsgesetzbuch, 10. Aufl., 2023 (zit.: Koller/Kindler/Drüen/Bearbeiter, HGB)
Kölner Kommentar zum Aktiengesetz
Zöllner, Wolfgang/Noack, Ulrich (Hrsg.), 3. Aufl., seit 2004 (zit.: KölnKomm-AktG/Bearbeiter)
Kübler, Friedrich/Assmann, Heinz-Dieter
Gesellschaftsrecht, 6. Aufl., 2006
Leipold, Dieter
BGB I: Einführung und Allgemeiner Teil, 11. Aufl., 2022 (zit.: Leipold, BGB AT)
Lettl, Tobias
Handelsrecht, 5. Aufl., 2021
Lutter, Marcus/Hommelhoff, Peter
GmbH-Gesetz, Kommentar, 21. Aufl., 2023 (zit.: Lutter/Hommelhoff/Bearbeiter, GmbHG)
Medicus, Dieter/Lorenz, Stephan
Schuldrecht Besonderer Teil, 18. Aufl., 2018 (zit.: Medicus/Lorenz, Schuldrecht BT)
ders./Petersen, Jens
Allgemeiner Teil des BGB, 12. Aufl., 2024
ders./Petersen, Jens
Bürgerliches Recht, 29. Aufl., 2023
Meyer, Justus
Handelsrecht, 2. Aufl., 2011
Michalski, Lutz/Heidinger, Andreas/Leible, Stefan/Schmidt, Jessica
Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), 4. Aufl., 2023 (zit.: Michalski/Heidinger/Leible/Schmidt/Bearbeiter, GmbHG)
Münchener Kommentar zum Aktiengesetz
Goette, Wulf/Habersack, Mathias/Kalss, Susanne (Hrsg.), Band 1 (§§ 1–75), 6. Aufl., 2024; Band 4 (§§ 179–277), 5. Aufl., 2021 (zit.: MünchKomm-AktG/Bearbeiter)
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch
Säcker, Franz Jürgen/Rixecker, Roland/Oetker, Hartmut/Limperg, Bettina (Hrsg.), Band 1 (§§ 1–240), 9. Aufl., 2021, Band 2 (§§ 241–432), 9. Aufl., 2022, Band 3 (§§ 433-610), 9. Aufl., 2022, Band 4, 1. Halbband (§§ 433-480), 9. Aufl., 2024, Band 4, 2. Halbband (§§ 481-534), 9. Aufl., 2023, Band 7 (§§ 705–853), 9. Aufl., 2024, Band 8 (§§ 854–1296), 9. Aufl., 2023, Band 11 (§§ 1922–2385), 9. Aufl., 2022 (zit.: MünchKomm-BGB/Bearbeiter)
Münchener Kommentar zum GmbH-Gesetz
Fleischer, Holger/Goette, Wulf (Hrsg.) Band 1 (§§ 1–34), 4. Aufl., 2022, Band 2 (§§ 35–52), 4. Aufl., 2023, Band 3 (§§ 53–85), 4. Aufl., 2022 (zit.: MünchKomm-GmbHG/Bearbeiter)
Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch
Drescher, Ingo/Fleischer, Holger/Schmidt, Karsten (Hrsg.), Band 1 (§§ 1-104a), 5. Aufl., 2021, Band 2 (§§ 105-229), 5. Aufl., 2022, Band 3 (§§ 161–237), 4. Aufl., 2019, Band 5 (§§ 343–406), 5. Aufl., 2021 (zit.: MünchKomm-HGB/Bearbeiter)
Neuner, Jörg
Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 13. Aufl., 2023 (zit.: Neuner, BGB AT)
Noack, Ulrich/Servatius, Wolfgang/Haas, Ulrich
Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 23. Aufl., 2022 (zit.: Noack/Servatius/Haas/Bearbeiter, GmbHG)
Oetker, Hartmut
Handelsrecht, 8. Aufl., 2019
ders.
Kommentar zum Handelsgesetzbuch, 8. Aufl., 2024 (zit.: Oetker/Bearbeiter, HGB)
Prütting, Jens/Guntermann, Lisa/Weller, Marc-Philippe
Handels- und Gesellschaftsrecht, 11. Aufl. 2025
Raiser, Thomas/Veil, Rüdiger
Recht der Kapitalgesellschaften, 6. Aufl., 2015 (zit.: Raiser/Veil, Kapitalgesellschaftsrecht)
Röhricht, Volker/Westphalen, Friedrich Graf v./Haas, Ulrich/Mock, Sebastian/Wöstmann, Heinz
Handelsgesetzbuch, 6. Aufl., 2023 (zit.: Röhricht/Graf von Westphalen/Haas/Mock/Wöstmann/Bearbeiter)
Rowedder, Heinz/Pentz, Andreas
Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), 7. Aufl., 2022 (zit.: Rowedder/Pentz/Bearbeiter, GmbHG)
Saenger, Ingo
Gesellschaftsrecht, 6. Aufl., 2023
Schäfer, Carsten
Gesellschaftsrecht, 6. Aufl., 2023
ders.
Das neue Personengesellschaftsrecht, 2022 (zit.: Schäfer/Bearbeiter)
Schlegelberger, Franz
Handelsgesetzbuch, Band V, (§§ 373-382), 5. Aufl., 1982 (zit.: Schlegelberger/Bearbeiter, HGB)
Schmidt, Karsten
Handelsrecht – Unternehmensrecht I, 6. Aufl., 2014 (zit.: K. Schmidt, Handelsrecht)
ders.
Gesellschaftsrecht, 4. Aufl., 2002 (zit.: K. Schmidt, Gesellschaftsrecht)
ders./Lutter, Marcus
Aktiengesetz, Kommentar, 5. Aufl., 2024 (zit.: K. Schmidt/Lutter/Bearbeiter, AktG)
Scholz, Franz
Kommentar zum GmbH-Gesetz, Band 1 (§§ 1-34), 13. Aufl., 2022, Band 2 (§§ 35-52), 13. Aufl., 2024 (zit.: Scholz/Bearbeiter, GmbHG)
Schulze, Reiner
Bürgerliches Gesetzbuch, Handkommentar, 12. Aufl., 2024 (zit.: Hk-BGB/Bearbeiter)
Schwerdtfeger, Armin
Gesellschaftsrecht, Kommentar, 3. Aufl. 2015 (zit.: Schwerdtfeger/Bearbeiter, Gesellschaftsrecht)
Servatius, Wolfgang
Gesellschaft bürgerlichen Rechts, 2023
Soergel, Hans-Theodor
Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Band 3 (§§ 433–515), 12. Aufl., 1991 (zit.: Soergel/Bearbeiter, BGB, 12. Aufl.)
Band 11/1 (§§ 705–758), 13. Aufl., 2011 (zit.: Soergel/Bearbeiter, BGB)
Stilz, Eberhard/Veil, Rüdiger
AktG – beck-online.Großkommentar, Stand: 1.10.2024 (zit.: BeckOGK-AktG/Bearbeiter)
Staub, Hermann
Handelsgesetzbuch, Großkommentar Band 1, Teilband 1 (§§ 1–16), 6. Aufl., 2023; Band 1, Teilband 2 (§§ 17–83), 6. Aufl. 2023; Band 2, Teilband 1 (§§ 84–88a), 6. Aufl., 2021; Band 2, Teilband 2 (§§ 89–104), 6. Aufl. 2021; Band 3 (§§ 105–160), 6. Aufl., 2023; Band 9, 5. Aufl., 2013; Band 4 (§§ 343-382), 4. Aufl., 1983–2004 (zit.: Staub/Bearbeiter, HGB)
Staudinger, Julius von
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, laufende Neubearbeitungen
Steinbeck, Anja
Handelsrecht, 5. Aufl., 2021
Teichmann, Artur
Handelsrecht, 4. Aufl., 2023
Wiedemann, Herbert
Gesellschaftsrecht Bd. I: Grundlagen, 1980, Bd. II: Recht der Personengesellschaften, 2004 (zit.: Wiedemann, Gesellschaftsrecht)
Windbichler, Christine/Bachmann, Gregor
Gesellschaftsrecht, 25. Aufl., 2024
§ 1Gegenstand und Bedeutung des Handelsrechts
I.Konzeption der lex lata
1
Handelsrecht ist das Sonderprivatrecht der Kaufleute.[1] Dies bedeutet: Handelsrecht ist der Teil des Privatrechts, der für Kaufleute Sonderregelungen enthält. Die lex lata knüpft daher nicht „objektiv“ an einen acte de commerce an (wie das französische Recht, vgl. Art. 1 und 632 Code de Commerce von 1807), sondern hat sich für eine „subjektive Anknüpfung“ entschieden: Normadressat handelsrechtlicher Vorschriften ist nach der gesetzlichen Konzeption grundsätzlich nur der Kaufmann.[2] Weitere subjektive Anknüpfungen finden sich im Arbeitsrecht, das maßgeblich an den Arbeitnehmerbegriff anknüpft,[3] sowie im Verbraucherrecht, welches den Verbraucher iSd § 13 BGB in den Mittelpunkt seiner Schutzbemühungen stellt.[4]
2
Allerdings gibt es im HGB vielfältige Ausnahmen von der Anknüpfung an den Kaufmann: Zum einen gelten bestimmte Regelungen auch für nichtkaufmännische Unternehmer – sei es bereits nach dem Wortlaut der lex lata (zB § 383 II HGB), sei es, weil sich die Rechtsentwicklung über die Beschränkungen des historischen Gesetzgebers hinweggesetzt hat (unten Rn. 18). Zum anderen unterliegen bestimmte Sachverhalte bereits dann dem Handelsrecht, wenn nur eine Partei Kaufmann ist (zB § 345 HGB, dazu unten Rn. 265).
3
Der Spezialität des Handelsrechts wird auch im Zivilprozessrecht Rechnung getragen. Mit der Kammer für Handelssachen (KfH), geregelt im Siebenten Titel des GVG (§§ 93–114 GVG), besteht ein auf Handelssachen spezialisierter Spruchkörper, der sich auch in anderen Rechtsordnungen findet.[5] Die am Landgericht eingerichteten Kammern entscheiden nach Maßgabe des § 105 I GVG in der Besetzung mit einem Berufsrichter als Vorsitzendem und zwei ehrenamtlichen Handelsrichtern, die alle gleiches Stimmrecht haben (§ 105 II GVG). Während der Vorsitzende branchenspezifische Kenntnisse im Rahmen seiner Befassung mit Handelssachen iSd § 95 GVG erwirbt, muss es sich bei den Handelsrichtern um Kaufleute, Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer oder vergleichbar am Handelsverkehr beteiligte Personen handeln.
II.Bedeutung des Handelsrechts und Verhältnis zum Bürgerlichen Recht
4
In einer Vielzahl handelsrechtlicher Vorschriften[6] werden Kaufleute strenger (zB Rügeobliegenheit gem. § 377 HGB)[7] oder auch großzügiger (zB Formfreiheit der Bürgschaft gem. § 350 HGB)[8] behandelt als Privatpersonen nach den einschlägigen Regelungen des BGB.[9] Diese Modifikationen haben mehrere Gründe, die miteinander verwoben sind: Kaufleute sind aufgrund ihrer Geschäftsgewandtheit und -erfahrung weniger schutzbedürftig; daher ist es möglich, dem Interesse nach Schnelligkeit und Leichtigkeit des Handelsverkehrs Rechnung zu tragen. So kann einerseits der Spielraum der Privatautonomie erweitert, andererseits aber auch ein Mehr an Sorgfaltspflichten und kaufmännischen Obliegenheiten statuiert werden. Darüber hinaus ist für das Handelsrecht ein gesteigerter Verkehrs- und Vertrauensschutz charakteristisch (Beispiele: § 366 HGB, kaufmännisches Bestätigungsschreiben, gesetzlicher Umfang der Prokura; dazu unten Rn. 208 ff., 276 ff., 313 ff.).[10] Wo es hingegen an handelsrechtlichen Spezialvorschriften und Rechtsfiguren fehlt, kann gem. Art. 2 I EGHGB auf die Vorschriften des BGB zurückgegriffen werden. Es ist gerade dieses Zusammenspiel bürgerlichrechtlicher und handelsrechtlicher Vorschriften, dessen Beherrschung im Referendar-[11] wie auch Assessorexamen[12] verlangt wird.[13]
5
Weiterhin enthält das HGB zahlreiche Organisationsvorschriften, die das Auftreten des kaufmännischen Unternehmens im Rechtsverkehr zum Gegenstand haben, nämlich das Register- (§§ 8 ff. HGB), das Firmen- (§§ 17 ff. HGB) und das Bilanzrecht (§§ 238 ff. HGB). Von ganz besonderer Bedeutung für das Examen sind hier Rechtsprobleme im Zusammenhang mit der Publizität des Handelsregisters (§ 15 HGB, dazu unten Rn. 51 ff.) und der Haftung bei Fortführung eines Unternehmens durch den Erwerber oder Erben gem. §§ 25 ff. HGB (unten Rn. 161 ff.).
III.Fortentwicklung zum (Sonder-)Außenprivatrecht der Unternehmen?
6
Teile der Rechtswissenschaft wollen das Handelsrecht zu einem speziellen Außenprivatrecht der Unternehmen fortentwickeln.[14] Dieser Gedanke ist reizvoll, wenngleich nicht unumstritten.[15] Jedenfalls sind Rechtsfortbildungen durch das geschriebene Recht verschiedentlich Grenzen gezogen, die nur der demokratisch legitimierte Gesetzgeber verschieben kann.[16] Examenskandidaten sind gut beraten, sich im Rahmen der Fallbearbeitung am gesicherten Stand von Rechtsprechung und Lehre zu orientieren.
7
Davon zu unterscheiden ist allerdings die Frage nach der (analogen) Anwendung handelsrechtlicher Vorschriften auf Nichtkaufleute in speziellen Konstellationen.[17] Hierauf wird etwa im Rahmen des kaufmännischen Bestätigungsschreibens (unten Rn. 276 ff.) und für den redlichen Erwerb von beweglichen Sachen nach § 366 HGB (unten Rn. 313 ff.) zurückzukommen sein.
IV.Rechtsvergleichung und Harmonisierung des Handelsrechts
8
Während neben Deutschland und Frankreich auch Spanien, Portugal, Brasilien und Japan durch eine Zweiteilung des Privatrechts in große Kodifikationen des Zivilrechts einerseits und des Handelsrechts andererseits gekennzeichnet sind, existiert in anderen Rechtsordnungen, wie zB in der Schweiz und den skandinavischen Länder[18], kein gesondertes Handelsrecht. Eine dritte Gruppe von Rechtsordnungen, zu der beispielsweise Italien und die Niederlande gehören, verfügte zunächst über ein eigenständiges Handelsrecht, gab diese Zweiteilung im Laufe der Zeit aber wieder auf. Nun verfügen diese Staaten jeweils über ein einheitliches Zivilgesetzbuch, das allerdings auch spezielle materielle Regelungen des Handelsrechts enthält.[19]
9
Bei einem transatlantischen Vergleich wird deutlich, dass die USA über ein einheitliches Handelsrecht verfügt, das die Europäische Union bisher vermissen lässt.[20] Eine gewisse Harmonisierung des europäischen Handelsrechts hat bisher nur im Rahmen von EU-Sekundärrecht, Völkerrecht und einzelnen Übereinkommen stattgefunden. Exemplarisch dafür steht die (frühere) Publizitätsrichtlinie,[21] die sich inzwischen in der konsolidierten Gesellschaftsrechtsrichtlinie (GesRRL)[22] findet[23] und im Zuge der Digitalisierungsrichtlinie I[24] nicht unerhebliche Änderungen erfahren hat (unten Rn. 52); weitere Änderungen werden durch die geplante Digitalisierungsrichtlinie II[25] folgen. Erwähnenswert erscheinen auch die nicht mehr zum Pflichtfachstoff gehörende Handelsvertreterrichtlinie[26] oder auch die in der konsolidierten GesRRL aufgegangene Zweigniederlassungsrichtlinie.[27] Demgegenüber hat die Diskussion über ein Europäisches Handelsgesetzbuch gerade erst begonnen.[28]
§ 2Kaufmannseigenschaft
10
In Klausuren stellt sich die Frage der Kaufmannseigenschaft regelmäßig nur mittelbar, etwa im Rahmen der Prüfung, ob der Kauf „für beide Teile ein Handelsgeschäft“ und deshalb § 377 HGB anwendbar ist.[1] In diesem Zusammenhang kann dann zB auch die Abgrenzung zwischen der OHG – die ein Handelsgewerbe betreibt und Kaufmann ist – und der (nichtkaufmännischen) BGB-Gesellschaft erforderlich werden (ausf. unten Rn. 426 ff., 441, 478 f.). Ein häufiger Fehler ist es, wenn sich Studierende in diesem Fall ohne weitere Überlegung auf § 1 HGB stürzen, diese Vorschrift durchsubsumieren und dabei ihr Lehrbuchwissen loswerden wollen. Eine gute Falllösung zeichnet sich gerade dadurch aus, dass der Bearbeiter die Systematik der §§ 1–6 HGB erkennt und die praktischen Hilfestellungen des Gesetzes in sachgerechter Weise nutzt. So ist es etwa verfehlt, die Kaufmannseigenschaft eines in das Handelsregister eingetragenen Unternehmers mit der Argumentation in Frage zu stellen, er sei nur ein Kleingewerbetreibender (mag dies auch zutreffen) und deshalb gem. § 1 II Hs. 2 HGB nicht Kaufmann; dieses Ergebnis ist wegen § 2 S. 1 HGB, zumindest wegen § 5 HGB unrichtig (unten Rn. 22).
11
Anders ist dagegen zu prüfen, wenn zB in einer Anwaltsklausur die Frage aufgeworfen wird, ob der Mandant, der ein neues Unternehmen gegründet hat, Kaufmann ist und welche Schritte nunmehr einzuleiten sind. Bei dieser Fragestellung steht materiell § 1 HGB im Vordergrund. Wird die Kaufmannseigenschaft bejaht, dann tritt ergänzend die Anmeldepflicht gem. § 29 HGB hinzu (unten Rn. 54). Ähnlich ist das Prüfungsprogramm, wenn etwa eine bislang nicht in das Handelsregister eingetragene vermögensverwaltende Personengesellschaft die Auskunft begehrt, ob sich die persönliche Haftung ihrer Gesellschafter (unten Rn. 482, 602 ff.) durch Umwandlung in eine KG begrenzen lässt: Die Antwort ergibt sich hier aus § 107 I 1 HGB (iVm § 161 II HGB).
I.System der §§ 1–6 HGB
1.Istkaufmann
12
Kaufmann iSd HGB ist nach dem Grundtatbestand des § 1 I HGB, „wer ein Handelsgewerbe betreibt“. Diese gesetzliche Qualifikation ist zwingend; auf die (hier nur deklaratorische[2]) Handelsregistereintragung (unten Rn. 58) kommt es deshalb nicht an. Daher die Bezeichnung: Istkaufmann.[3]
2.Kannkaufmann
13
Dies gilt allerdings gem. § 1 II Hs. 2 HGB nicht für den Kleingewerbetreibenden. Dieser ist jedoch kraft Gesetzes berechtigt, die Kaufmannseigenschaft durch (hier konstitutive[4]) Eintragung in das Handelsregister zu erwerben (§ 2 HGB). Praxisrelevant ist diese Option weniger für den Einzelkaufmann als für die kleingewerbliche Personengesellschaft. Sie ist materiell BGB-Gesellschaft, also Nichtkaufmann (unten Rn. 480). Durch Eintragung kann sie gem. §§ 161 II, 107 I 1 HGB zur KG werden und so die persönliche Haftung ihrer Gesellschafter begrenzen (dazu oben Rn. 11 sowie ausf. unten Rn. 482, 637 ff.). Ein solches Wahlrecht haben auch die land- und forstwirtschaftlichen Unternehmen, die grundsätzlich nicht dem Handelsrecht unterfallen (§ 3 HGB). Da sowohl der Kleingewerbetreibende als auch der Land- und Forstwirt kraft freiwilliger Eintragung die Kaufmannseigenschaft erlangen können, spricht man insoweit vom Kannkaufmann.[5]
3.Formkaufmann
14
Der Vorschrift des § 6 HGB kommt nur eine klarstellende Funktion zu. Sie bestimmt, dass Handelsgesellschaften kraft ihrer Rechtsform Kaufleute sind – daher auch die Bezeichnung Formkaufmann.[6]Abs. 1 bestimmt, dass die Kaufmannsvorschriften auch auf Handelsgesellschaften Anwendung finden. Dies ist eine Selbstverständlichkeit, denn die Rechtsform der Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG und EWIV) hat zur Voraussetzung, dass entweder ein Handelsgewerbe iSv § 1 HGB betrieben wird (§ 105 I HGB) oder die Eintragung im Handelsregister gem. § 107 I HGB erfolgt ist.[7] Die Kapitalgesellschaften (GmbH, AG, KGaA und SE) sind bereits nach ihren eigenen spezialgesetzlichen Regelungen stets Kaufleute.[8] Dies gilt auch dann – und das wird von Abs. 2 nochmals ausdrücklich hervorgehoben –, wenn ihr Unternehmensgegenstand nicht der Betrieb eines (Handels-)Gewerbes ist (§§ 3 I, 278 III AktG, § 13 III GmbHG). So ist insbesondere auch auf Unternehmen der öffentlichen Hand, die in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft organisiert sind, aber kein (Handels-)Gewerbe betreiben, Kaufmannsrecht anwendbar; zweifelhaft ist allein die Anwendung handelsrechtlicher Vorschriften auf öffentliche Unternehmen mit anderer Rechtsform (dazu unten Rn. 28 ff.).
15
Handelt also ein Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, so ergibt sich die Kaufmannseigenschaft unmittelbar aus § 6 II HGB; die Voraussetzungen der §§ 1–3 HGB sind nicht zu prüfen. Dies gilt allerdings nur, wenn bereits die Eintragung im Handelsregister erfolgt ist; auf sog. Vorgesellschaften (zum Begriff unten Rn. 515) findet § 6 II HGB dagegen keine Anwendung.[9] Handelsgesellschaft ist die Vorgesellschaft nur (aber auch stets), wenn sie ein Handelsgewerbe iSv § 1 HGB betreibt.[10]
16
Problematisch ist, ob auch auf die Gesellschafter einer Handelsgesellschaft die Vorschriften über Kaufleute Anwendung finden:
17
Der persönlich haftende Gesellschafter G der X-OHG sowie der Alleingesellschafter-Geschäftsführer A der Y-GmbH haben sich gegenüber dem Lieferanten L für eine Schuld des Unternehmers U per E-Mail verbürgt.
18
Die Übersendung einer Bürgschaftsurkunde durch E-Mail wahrt nicht die gem. § 766 S. 1 BGB geforderte Schriftform (vgl. § 126 BGB).[12] Die Bürgschaft wäre somit nach allgemeinen Regeln aufgrund des Formmangels gem. § 125 S. 1 BGB nichtig.[13] Formlos sind Bürgschaften nach § 350 HGB nur wirksam, wenn sie für G und A Handelsgeschäfte sind. Dies setzt voraus, dass G und A Kaufleute sind (§§ 343, 344 HGB).[14] Kaufmann ist jedoch stets nur der Unternehmensträger selbst, also die Kapitalgesellschaft als juristische Person, aber auch die Personenhandelsgesellschaft (Trennungsprinzip). Daher sind bei streng dogmatischer Betrachtung die Gesellschafter generell nicht Kaufleute. Dies ist für Anlagegesellschafter (Aktionäre oder Kommanditisten[15]) auch allgemein anerkannt. Die Kaufmannseigenschaft wird vom BGH jedoch auch für den Alleingesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH verneint;[16] für den persönlich haftenden Gesellschafter einer OHG oder KG in Übereinstimmung mit einer verbreiteten Literaturauffassung[17] dagegen bejaht.[18]
19
Nach zutreffender Auffassung ist eine Erstreckung des § 350 HGB auf Gesellschafter indes abzulehnen.[19] Der Gesellschafter einer Handelsgesellschaft ist aus rechtsdogmatischer Perspektive betrachtet selbst nicht Kaufmann, weil die Gesellschaft das Handelsgewerbe betreibt, nicht hingegen der Gesellschafter (Trennungsprinzip). Gegen eine Analogie[20] spricht nicht nur die mangelnde Planwidrigkeit der Regelungslücke. Vielmehr fehlt es auch an der Vergleichbarkeit der Interessenlage, weil die persönliche Verpflichtung eines Gesellschafters niemals zum Handelsgeschäft gehört (vgl. § 343 HGB; dazu unten Rn. 259 ff.), selbst wenn sie für eine Gesellschaftsschuld übernommen wird und der Gesellschafter daher dem gleichen gesetzlichen Schuldnerschutz unterstehen muss wie eine Privatperson. Ebenso wenig erscheint es angebracht, den Schutz des § 766 BGB dem geschäftsführenden (Allein-)Gesellschafter einer GmbH – hier A – zu verweigern.[21]
4.Fiktivkaufmann
20
Die Regelung in § 5 HGB resultiert aus dem öffentlichen Glauben an die Richtigkeit des Handelsregisters (unten Rn. 51). Daher ist gegenüber demjenigen, der sich auf die Firmeneintragung beruft, der Einwand ausgeschlossen, das betriebene Gewerbe sei kein Handelsgewerbe. Da diese Rechtsfolge auch zugunsten eines bösgläubigen Dritten und sogar gegenüber dem Unternehmer selbst gilt,[22] handelt es sich nicht um eine Rechtsscheinvorschrift.[23]
21
Problematisch ist seit der Handelsrechtsreform von 1998 die Abgrenzung gegenüber einer Eintragung gem. § 2 HGB. Es stellt sich nämlich die Frage, ob dem § 5 HGB überhaupt noch ein relevanter Anwendungsbereich verbleibt, da mit der (heute zulässigen) Eintragung des kleingewerblichen Unternehmers dieser zum Kaufmann wird (oben Rn. 13) und somit für eine gesetzliche Fiktion – im Gegensatz zur früheren Rechtslage – prima vista kein Bedürfnis mehr existiert. Dieser Befund hat einen heftigen akademischen Streit ausgelöst,[24] der jedoch kaum praktische Bedeutung hat und auch in der Klausurbearbeitung regelmäßig dahinstehen kann.
22
Paradigmatisch ist das Herabsinken des Istkaufmanns zum Kleingewerbetreibenden. Stellt man allein auf das objektive Kriterium der Eintragung ab, ist in Anwendung des § 2 S. 1 HGB die Kaufmannseigenschaft trotz Einschränkung des Geschäftsumfangs zu bejahen.[25] Verlangt man mit der Gegenposition eine positive Ausübung des in § 2 S. 2 HGB niedergelegten Optionsrechts, scheidet die Anwendung des § 2 S. 1 HGB aus und § 5 HGB schützt die berechtigten Interessen des Rechts- und Handelsverkehrs.[26]
23
Es muss ein Gewerbe betrieben werden (zum Begriff unten Rn. 25). Allein die Eintragung eines nichtgewerblichen Unternehmens vermag nach herrschender und zutreffender Auffassung[27] den fiktiven Kaufmannsstatus nicht zu begründen.[28] Denn § 5 HGB fingiert nach seinem klaren Wortlaut – wie § 2 S. 1 HGB (oben Rn. 22) – lediglich, dass das betriebene Gewerbe ein Handelsgewerbe ist. Bei Eintragung eines Unternehmens ohne Gewerbebetrieb kommt zugunsten des gutgläubigen Rechtsverkehrs allerdings § 15 III HGB zur Anwendung (unten Rn. 110).[29]
II.Der Grundtatbestand des § 1 HGB
24
Kaufmann ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt; Handelsgewerbe ist jeder Gewerbebetrieb, es sei denn, dass das Unternehmen nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert.
1.Betrieb eines Gewerbes
25
a) Was ein „Gewerbebetrieb“ ist, definiert das Gesetz nicht. Nach allgemeiner Meinung müssen jedoch folgende Merkmale erfüllt sein:[30]
-
Es muss sich um eine selbstständige Tätigkeit handeln; Anhaltspunkte für die Abgrenzung gibt § 84 I 2 HGB. Maßgeblich ist demnach, ob die Tätigkeit im Wesentlichen frei gestaltet und die Arbeitszeit selbst bestimmt werden kann.
-
Der Gewerbetreibende muss auf dem Markt auftreten und seine Leistungen entgeltlich anbieten. Kein Kaufmann ist also derjenige, der kostenlos Suppe an Arme verteilt[31] oder Briefmarken zur späteren Veräußerung sammelt.[32] Auch das heimliche Spekulieren an der Börse[33] oder die „Verwaltung eigenen Vermögens“ (arg e § 107 I 1 Alt. 2 HGB)[34] ist keine gewerbliche Tätigkeit. Allerdings ermöglicht die Öffnungsklausel des § 107 I 1 Alt. 2 HGB die reine Vermögensverwaltung und die Errichtung von Besitzgesellschaften, wie zB Grundstücksgesellschaften, in der Rechtsform der OHG.[35] Stets muss der Gewerbebetrieb seine Leistung rechtsgeschäftlich am Markt anbieten; die Verwendung öffentlichrechtlich ausgestalteter Handlungsformen scheidet aus.[36]
-
Die Tätigkeit muss planmäßig betrieben werden und auf eine gewisse Dauer angelegt sein; wer nur gelegentlich Geschäfte tätigt, ist nicht Kaufmann.[37] Unschädlich ist dagegen ein eng umgrenzter Zeitraum, ebenso ein Saisonbetrieb (zB Skischule, Strandbar). In der neueren Rechtsprechung umstritten ist der Sachverhalt einer längerfristig angelegten Bau-ARGE: Während solche Arbeitsgemeinschaften nach traditioneller Sichtweise stets als BGB-Gesellschaften qualifiziert wurden[38], wird in neuerer Zeit jedenfalls ein Zusammenschluss zur Errichtung von Großvorhaben als OHG angesehen.[39]
26
b) Als negatives Tatbestandsmerkmal sind aus dem Gewerbebegriff Tätigkeiten künstlerischer, wissenschaftlicher, sportlicher oder freiberuflicher Art auszuscheiden. Hier steht die höchstpersönliche Leistung im Vordergrund, die nicht unter den Gewerbebegriff fällt. Dies ist teilweise gesetzlich angeordnet (s. etwa § 2 II BRAO; § 2 S. 3 BNotO; § 1 II BundesärzteO; § 1 II WiPrO; vgl. weiter § 1 II PartGG)[40] und im Übrigen durch eine gefestigte Rechtstradition im Rang von Gewohnheitsrecht begründet. Auch eine Anwendung des § 5 HGB scheidet nach zutreffender hM aus (oben Rn. 20, 23); in Betracht kommt aber die Anwendung der Lehre vom Scheinkaufmann (unten Rn. 37).
27
Abgrenzungsprobleme treten auf, wenn ein Unternehmer sowohl freiberuflich als auch gewerblich tätig wird: Der Arzt betreibt zusätzlich ein Sanatorium, der Architekt ein Bauträgergeschäft, der Künstler produziert in Serie. Hier ist zu differenzieren: Ist die unternehmerische Tätigkeit organisatorisch getrennt, so werden zwei Unternehmen betrieben, ein freiberufliches und ein gewerbliches.[41] Liegt dagegen keine organisatorische Trennung vor („gemischtes Unternehmen“), so ist nach hM entscheidend, welche Komponente den Schwerpunkt der Tätigkeit bildet.[42]
28
c) Streitig ist, ob der Gewerbebegriff die Absicht der Gewinnerzielung erfordert. Entgegen der früher ganz hM[43] verzichtet heute die hL darauf.[44] Praktische Relevanz hat die Frage hinsichtlich der Kaufmannseigenschaft von öffentlichen Unternehmen, die nicht bereits kraft Rechtsform Kaufmann sind:[45]
29
Die Stadt X betreibt den Schlachthof S als Eigenbetrieb, der nach seiner Satzung keinen Gewinn erzielen soll. Im Rahmen von Geschäftsbeziehungen zur Großschlachterei des G stellt sich die Frage, ob S Kaufmann ist.
30
Entgegen dem OLG Stuttgart[46] kann es für die Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften nicht auf die Gewinnerzielungsabsicht ankommen. Ausreichend ist vielmehr, dass S am Wirtschaftsleben durch das entgeltliche Auftreten am Markt (oben Rn. 25) teilnimmt. Allein der Verzicht auf Gewinn rechtfertigt keine privilegierte Behandlung.[47] Insbesondere ist es mit dem durch das Handelsrecht intendierten Verkehrsschutz unvereinbar, auf rein innerliche Tatsachen abzustellen. Zutreffend hat daher auch der BGH die Kaufmannseigenschaft der damaligen Deutschen Bundesbahn bejaht[48] (heute ist die Deutsche Bahn AG Kaufmann gem. § 6 HGB iVm § 3 I AktG: oben Rn. 14). Demgegenüber ist eine Stiftung des öffentlichen Rechts nicht Kaufmann, solange sie ausschließlich öffentliche Aufgaben erfüllt, da eine Tätigkeit, die allein und herkömmlich mit der Zielrichtung einer öffentlichen Aufgabe betrieben wird, grundsätzlich nicht den Gewerbebegriff erfüllt.[49] Gleiches gilt für einen kommunalen Zweckverband, der sich ausschließlich öffentlichrechtlich ausgestalteter Handlungsformen bedient (oben Rn. 25).[50]
31
d) Die zivilrechtliche Wirksamkeit der vom Unternehmer getätigten Geschäfte ist für das Vorliegen eines Gewerbes nach heute herrschender und zutreffender Lehre nicht erforderlich.[51] So kann etwa auch der Ehevermittler trotz der Unklagbarkeit seiner Entgeltforderung (§ 656 BGB)[52] oder der Kreditwucherer trotz der Sittenwidrigkeit der Darlehen (§ 138 BGB)[53] Kaufmann sein. Die Voraussetzung des „ehrbaren Kaufmanns“ ist dem HGB fremd – anders als dessen Leitbild in den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex.[54] Warum soll etwa der Waffenhändler (vgl. § 134 BGB) vor den Gefahren der mündlich abgegebenen Bürgschaft (vgl. bereits Rn. 18) geschützt werden?[55] Für die hier vertretene Auffassung spricht auch, dass das Fehlen öffentlichrechtlicher Voraussetzungen von § 7 HGB ausdrücklich für unbeachtlich erklärt wird.[56] Dies bedeutet natürlich nicht, dass der Drogenhändler als Kaufmann in das Handelsregister einzutragen wäre; eine verbotene Tätigkeit ist vielmehr von den zuständigen Behörden zu unterbinden.[57]
32
e) Kaufmann ist derjenige, der das Gewerbe im eigenen Namen betreibt. Dies kann zB auch der Pächter des Unternehmensgrundstücks sein. Im Falle der Treuhand ist Kaufmann der Treuhänder (auch der Strohmann), nicht der Treugeber.[58] Im Falle der Stellvertretung ist Kaufmann der Vertretene, nicht der Vertreter; das gilt auch für die Geschäftsführungsorgane einer Handelsgesellschaft (dazu schon oben Rn. 18).[59] Keine Rolle spielt dagegen, auf wessen Rechnung die Geschäfte getätigt werden (zB Kommissionär, § 383 HGB[60]).[61] Auch der beschränkt Geschäftsfähige kann Kaufmann sein, doch ändert dies nichts an der Geltung der §§ 104 ff. BGB.[62] Mit Zustimmung der Eltern kann der Minderjährige allerdings nach § 112 BGB wirksam Rechtsgeschäfte tätigen, die zum Betrieb des Erwerbsgeschäfts gehören. Zur Erteilung der Prokura benötigt der Minderjährige allerdings eine familiengerichtliche Genehmigung (§ 112 I 2 iVm. §§ 1643 I, 1852 Nr. 3 BGB).
33
f) Beginn und Ende der Kaufmannseigenschaft korrespondieren mit der gewerblichen Tätigkeit. Beim Istkaufmann ist die Registereintragung deklaratorisch, so dass es weder auf die Eintragung des Handelsgeschäfts noch auf deren Löschung ankommt (oben Rn. 12). Während die Planung und Errichtung des Handelsgewerbes für sich noch unzureichend sind,[63] genügen nach zutreffender hM Vorbereitungs- und Anlaufgeschäfte, die auf den Betrieb eines in kaufmännischer Art und Weise eingerichteten Gewerbebetriebs gerichtet sind, wie zB der Abschluss von Miet- und Arbeitsverträgen.[64] Umgekehrt können auch Abwicklungsgeschäfte in maßgeblichem Umfang ein Handelsgewerbe begründen, nicht aber die reine Vermögensverwaltung (oben Rn. 25).[65]
2.Ausnahme: Kleingewerbe
34
a) Kleingewerbetreibende sind gem. § 1 II Hs. 2 HGB ex lege keine Kaufleute. Sie können den Kaufmannsstatus nur durch ihre Eintragung in das Handelsregister gem. § 2 HGB erlangen (oben Rn. 13).
35
b) Für die Frage, wann ein in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb erforderlich ist, verweist das Gesetz auf „Art oder Umfang“ der unternehmerischen Tätigkeit. Im Ergebnis nimmt die hM eine Gesamtbetrachtung vor, wobei Kriterien insbesondere die Zahl und Art der Geschäfte, Höhe von Kapital und Umsatz, Zahl der Beschäftigten sowie Vielfalt der Erzeugnisse sind. Entscheidend ist, ob die Anwendung der kaufmännischen Regelungen über Buchführung und Bilanzierung, über Firmenbildung und Mitarbeiterorganisation (Lohnbuchhaltung, Prokura usw.) auf das konkrete Unternehmen sachlich geboten ist; demgegenüber ist die tatsächliche Einrichtung des Gewerbebetriebs ohne Belang. Die Kasuistik der Rechtsprechung ist uneinheitlich.[66] Jedenfalls ab einem Umsatz in Höhe von 500 000 € pro Jahr ist die Schwelle zum Handelsgewerbe überschritten.[67] Auch wenn die Voraussetzungen des § 1 II Hs. 2 HGB im Einzelfall zweifelhaft sein können, bereiten unklare Sachverhalte in einer Klausur regelmäßig kein Problem. Denn nach der negativen Formulierung („es sei denn“) ist zu vermuten, dass ein Gewerbebetrieb „groß“ und daher als Handelsgewerbe zu qualifizieren ist.
36
c) Das bedeutet für die Klausurbearbeitung: Finden sich im Sachverhalt keine Anhaltspunkte, die gegen das Bedürfnis nach einem in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb streiten, ist nach § 1 II HGB das Vorliegen eines Handelsgewerbes und damit die Kaufmannseigenschaft zu unterstellen.[68]
III.Scheinkaufmann
1.Grundlagen und Dogmatik
37
Tritt eine Person, die nicht im Handelsregister eingetragen ist – so dass weder § 2 HGB und § 5 HGB (oben Rn. 13, 20) noch § 15 HGB (unten Rn. 59 ff.) zur Anwendung kommen –, im Rechtsverkehr wie ein Kaufmann auf, obwohl sie kein Handelsgewerbe betreibt, so muss sie sich gegenüber einem Dritten, der auf diesen Rechtsschein vertraut hat, so behandeln lassen, als sei sie Kaufmann.[69] Diese Lehre vom Scheinkaufmann ist ein wichtiger Unterfall der allgemeinen Rechtsscheinhaftung (siehe auch unten Rn. 819).[70] Mit den Bedürfnissen einer zügigen und rechtssicheren Abwicklung von Handelsgeschäften ist es nicht vereinbar, wenn der redliche Vertragspartner jeweils die Kaufmannseigenschaft nachprüfen müsste. Daher müssen sich Personen, die wie Kaufleute am Markt auftreten, im überindividuellen Interesse der Sicherheit und Leichtigkeit des Rechts- und Handelsverkehrs, gegenüber gutgläubigen Dritten auch als solche behandeln lassen. In der Klausur ist an die Fallgruppe des Scheinkaufmanns immer dann zu denken, wenn die Kaufmannseigenschaft nicht auf anderem Wege bejaht werden kann. Die Rechtsfigur ist subsidiär zu §§ 1, 2, 3, 5, 15 HGB und insbesondere für Freiberufler sowie nichteingetragene Kleingewerbetreibende relevant.[71]
2.Tatbestandsvoraussetzungen
38
In der Sache gelten die allgemeinen Rechtsscheingrundsätze[72]:
39
a) Zunächst muss der Nichtkaufmann den Rechtsscheintatbestand in zurechenbarer Weise gesetzt haben, wie zB durch Verwendung von „e.K.“ auf dem Briefbogen oder durch Erteilung einer Prokura, wozu nach § 48 I HGB nur ein Kaufmann berechtigt ist.[73] Demgegenüber ist ein rein tatsächliches, kaufmannstypisches Verhalten, wie zB im Rahmen von Vertragsverhandlungen, in Ermangelung rechtlicher Qualität nicht ausreichend.[74] Der Rechtsscheintatbestand ist dem Nichtkaufmann zurechenbar, wenn er ihn selbst veranlasst hat oder er zumindest für die Veranlassung durch einen Dritten verantwortlich ist. Das setzt kein Verschulden aufseiten des Nichtkaufmanns voraus.[75] Eine Zurechnung kommt auch durch Unterlassen in Betracht, und zwar wenn der Betroffene nachträglich vom nicht veranlassten Rechtsschein Kenntnis erlangt oder zumindest hätte erlangen müssen, aber gleichwohl nicht für die Beseitigung sorgt.[76] Umgekehrt scheidet eine Zurechnung des Rechtsscheins bei Geschäftsunfähigen und beschränkt Geschäftsfähigen nach den allgemeinen Grundätzen der Vertrauenshaftung und des Minderjährigenschutzes aus.[77] Anders als etwa bei § 15 I HGB (unten Rn. 59 ff.) geht hier Minderjährigenschutz stets vor Verkehrsschutz.
40
b) Der zurechenbar gesetzte Rechtsschein muss weiterhin für den Abschluss des Rechtsgeschäfts kausal gewesen sein.[78] Nach allgemeinen Grundsätzen wird die Kausalität vermutet; der Nichtkaufmann muss also darlegen und notfalls beweisen, dass der Dritte im Zeitpunkt seiner Vertrauensdisposition – regelmäßig beim Vertragsschluss – nicht auf den Rechtsschein vertraut hat.[79]
41
c) Schließlich muss der Dritte in Bezug auf die vermeintliche Kaufmannseigenschaft auch gutgläubig gewesen sein. In Anlehnung an § 932 II BGB schadet in diesem Zusammenhang positive Kenntnis und grob fahrlässige Unkenntnis.[80] Zwar sprechen die Wertungen der §§ 173, 405 BGB außerdem für die Einbeziehung bereits einfacher Fahrlässigkeit. Allerdings würde das Schutzanliegen der Rechtsscheinhaftung weitgehend sinnentleert, wäre der andere Teil stets verpflichtet, die Richtigkeit der von einem Vertragspartner getroffenen Angaben zu überprüfen. Schadete also bereits leichte Fahrlässigkeit, mangelte es der Rechtsscheinhaftung an der notwendigen Effektivität, als wirksames Schutzinstrument der Sicherheit und Leichtigkeit des Rechtsverkehrs zu dienen.[81] Der Dritte braucht daher normalerweise keine Nachforschungen über die Kaufmannseigenschaft seines Gegenübers anzustellen. Eine entsprechende Nachforschungsobliegenheit trifft den Dritten nur bei Vorliegen besonderer Verdachtsmomente.[82]
3.Rechtswirkungen
42
a) Umstritten ist auf Rechtsfolgenseite, ob alle handelsrechtlichen Regelungen, die zwingende BGB-Schutzvorschriften abbedingen, auf den Scheinkaufmann Anwendung finden:
43
Der nicht im Handelsregister eingetragene Kleinhandwerker H ist gegenüber seinem Vertragspartner V als Kaufmann H aufgetreten und hat für den Fall der nicht fristgerechten Erfüllung eine hohe Vertragsstrafe versprochen. Da H in Verzug gerät, macht V die Vertragsstrafe geltend. H verlangt Herabsetzung gem. § 343 BGB.
44
Das Herabsetzungsverlangen ist gem. § 348 HGB ausgeschlossen, wenn H Kaufmann ist. Zwar ist H laut Sachverhalt „klein“ und nicht eingetragen, daher weder Istkaufmann (vgl. § 1 II Hs. 2 HGB) noch Kannkaufmann gem. §§ 1 I, II, 2 S. 1 HGB. Allerdings könnte § 348 HGB auf H anwendbar sein, weil er sich aufgrund des zurechenbar gesetzten Rechtsscheins gegenüber dem gutgläubigen V als Kaufmann behandeln lassen muss.[83] Jedenfalls für Kleingewerbetreibende wie H (oben Rn. 13) ist dies anzunehmen,[84] weil es diese Personengruppe selbst in der Hand hat, für das Kaufmannsrecht zu optieren (§ 2 S. 1 HGB) und sich so der zwingenden BGB-Schutzvorschriften zu begeben. Ein Teil des Schrifttums geht sogar noch weiter und lässt – nicht nur bei arglistigem Handeln – die Durchbrechung zwingender BGB-Schutzvorschriften auch bei nichtgewerbetreibenden Scheinkaufleuten zu.[85]
45
b) Der Rechtsschein wirkt stets nur zugunsten des Dritten, nie zugunsten des Scheinkaufmanns[86] (beachte hingegen: die Rechtswirkungen des § 5 HGB gelten auch zugunsten des Fiktivkaufmanns, vgl. oben Rn. 20). Umstritten ist allerdings, ob die Rechtswirkungen des § 366 HGB im Falle des Handelns eines Scheinkaufmanns zulasten des Eigentümers eintreten können:
46
Der eingetragene Kannkaufmann K beschließt, das Sortiment seines Modegeschäfts auf einen anderen Lieferanten umzustellen. Er verschickt deshalb zum Abverkauf auf Geschäftsbriefpapier gedruckte Einladungen an seine besten Kunden. Aufgrund einiger Misserfolge in den Tagen danach beschließt K, sein Geschäft vollständig aufzugeben. Die Löschung der Firma wird wenig später vorgenommen und bekanntgemacht. Als K die Geschäftsabwicklung schon weitgehend abgeschlossen hat, betritt der befreundete G – durch die Einladung angelockt – den Laden, der von der Geschäftsaufgabe jedoch nichts weiß. Aus einem früheren Gespräch weiß G aber, dass K alle Kleidungsstücke vom Lieferanten L unter Eigentumsvorbehalt bezieht, nicht aber, dass wegen großer Außenstände L dem K bereits vor Monaten den Weiterverkauf bis zur vollständigen Zahlung untersagt hat. Gleichwohl verkauft K dem G einen Mantel, für den noch einige Raten ausstehen. Nachdem L davon erfährt, verlangt er von G Herausgabe.
47
Durch die aufschiebend bedingte Übereignung (§§ 929 S. 1, 158 I BGB) scheidet ein Eigentumsverlust des L an K aus, da infolge noch ausstehender Raten die Bedingung der vollständigen Kaufpreiszahlung für den Mantel nicht eingetreten ist. Auch ein gutgläubiger Erwerb des G von K nach §§ 929 S. 1, 932 BGB scheitert, weil G bekannt war, dass K nicht Eigentümer der Ware ist. In Betracht kommt ein redlicher Erwerb nur nach § 366 I HGB, weil G zumindest an die Verfügungsbefugnis des K glaubte (dazu ausf. unten Rn. 313 ff.). Allerdings hatte K seinen Gewerbebetrieb gerade aufgegeben und die Firma war auch im Handelsregister gelöscht, so dass weder § 2 noch § 5 HGB eingreifen. Zwar können auch Abwicklungsgeschäfte eine Kaufmannseigenschaft nach § 1 HGB begründen.[88] Abgesehen davon, dass K die Abwicklung schon weitgehend beendet hatte, erforderte sein Modegeschäft auch keine kaufmännische Einrichtung iSd § 1 II HGB. Umstritten ist nun, ob ein gutgläubiger Erwerb nach § 366 I HGB auch vom Scheinkaufmann in Betracht kommt. Während dies die hM[89] unter Hinweis darauf verneint, dass die nachteiligen Wirkungen des § 366 I HGB hier nicht den Scheinkaufmann treffen, sondern den Eigentümer, der sich das Handeln des Scheinkaufmanns hingegen nicht zurechnen lassen muss, meint die Gegenauffassung[90], dass es für den redlichen Erwerber keinen Unterschied mache, ob der Verfügende tatsächlich Kaufmann sei oder dies nur vorspiegele.
48
Wenn die Gegenauffassung nun auf die subjektive Sichtweise des Erwerbers abstellen will, dann übersieht sie, dass – nach der Lehre vom unwirksamen Rechtsscheinträger[91] – der bloße Anschein für das Vorliegen eines Vertrauenstatbestands als taugliche Legitimationsgrundlage für einen redlichen Erwerb nicht ausreicht. Legitimationsgrundlage für das Eingreifen des § 366 I HGB ist die Eigenschaft des Veräußerers als Kaufmann im Rechtsverkehr. Hier vertraute G auf das bloße Gerede des K, nicht aber auf einen tatsächlich vorliegenden Rechtsscheinträger. Daher muss die von § 366 I HGB intendierte Lösung des Interessenkonflikts – mangels Zurechnung gegenüber dem wahren Eigentümer – zulasten des redlichen G ausfallen.[92]
49
Wie ändert sich die Rechtslage, wenn durch den Antrag des K beim Registergericht nicht seine Firma, sondern versehentlich die des Konkurrenten H gelöscht wird?
50
Hier war K noch fälschlich im Handelsregister als Kaufmann eingetragen. § 5 HGB kommt nicht zur Anwendung, da K im Zeitpunkt der Veräußerung sein früheres Gewerbe nicht mehr ausübte. Das Betreiben des Gewerbebetriebs ist aber Voraussetzung für § 5 HGB: oben Rn. 20. Nach verbreiteter Auffassung muss jedoch der Eigentümer L als Dritter gem. § 15 I HGB die Wirkungen der fehlenden Handelsregistereintragung gegen sich gelten lassen (negative Publizität des Handelsregisters: unten Rn. 59 ff.), obgleich nicht er, sondern der zur Eintragung verpflichtete K Adressat des § 15 I HGB ist.[93] Dieses Ergebnis mag zwar angesichts der Registerpublizität naheliegen. Der Wortlaut des § 15 I HGB ist insofern jedoch klar: Die einzutragende Tatsache kann einem Dritten nur „von demjenigen, in dessen Angelegenheiten sie einzutragen war“, nicht entgegengesetzt werden. Zudem ist auch der Eigentümer Dritter iSd § 15 HGB und dementsprechend stets berechtigt, sich auf die wahre Rechtslage zu berufen. Mithin kann § 366 I HGB auch in dieser Situation nicht zulasten des wahren Eigentümers wirken.[94] Daher gilt § 366 HGB weder für den Scheinkaufmann noch für den im Handelsregister eingetragenen Nichtkaufmann (§ 15 I HGB).
§ 3Publizität des Handelsregisters
I.Grundlagen
1.Publizität durch das Handelsregister
51
Im Interesse des Rechtsverkehrs hat das HGB für Kaufleute eine weitreichende Publizität angeordnet. Sie wird ganz maßgeblich durch das Handelsregister verwirklicht. Eintragungen in das Handelsregister dienen der Sicherheit und Leichtigkeit des Handelsverkehrs, indem die wichtigsten Rechtsverhältnisse von Kaufleuten für jedermann (vgl. § 9 HGB) offengelegt werden (Publizitätswirkung). Zudem werden redliche Teilnehmer des Handelsverkehrs in ihrem Vertrauen auf die Eintragung bzw. Nichteintragung von Tatsachen geschützt (Gutglaubenswirkung).[1] Rechtsprobleme im Zusammenhang mit § 15 HGB sind häufig Bestandteil handels- bzw. gesellschaftsrechtlicher Examensklausuren.[2] Im Mittelpunkt steht dabei die sog. negative Publizität des § 15 I HGB (ausf. unten Rn. 59 ff.).
52
Die Publizitätswirkungen des Handelsregisters sind unionsrechtlich grundiert. Maßgeblich sind die Art. 13 ff. GesRRL, die zuvor in der Publizitätsrichtlinie verankert waren und durch die Digitalisierungsrichtlinie I nicht unerhebliche Änderungen erfahren haben (siehe schon Rn. 9). Diese Änderungen haben zugleich eine Anpassung der nationalen Regelungen über die Publizität des Handelsregisters erforderlich gemacht, die durch das DiRUG[3] namentlich in Bezug auf § 15 III HGB umgesetzt worden sind (dazu näher unten Rn. 110 ff.).[4] Davon abgesehen hat sich die Relevanz des § 15 HGB durch die Schaffung des Gesellschaftsregisters für BGB-Gesellschaften durch das MoPeG[5] weiter erhöht, weil die Publizitätswirkungen des § 15 HGB über die Verweisung des § 707a III BGB auf die Eintragungen in das Gesellschaftsregister erstreckt worden sind.[6]
2.Eintragungspflichtige und eintragungsfähige Tatsachen
53
In das Handelsregister dürfen nur Rechtstatsachen eingetragen werden, die für den Rechtsverkehr von Bedeutung sind und deren Eintragung entweder vom Gesetz – zumeist mit der Formulierung „sind anzumelden“ – oder kraft Rechtsfortbildung durch die Rechtsprechung verlangt werden (eintragungspflichtige Tatsachen). Ausnahmsweise wird eine Eintragung nicht angeordnet, aber zur Vermeidung von Rechtsnachteilen gestattet (eintragungsfähige Tatsachen). Andere Tatsachen – mögen sie auch im Einzelfall oder sogar generell rechtlich bedeutsam sein – dürfen nicht eingetragen werden (eintragungsunfähige Tatsachen), weil andernfalls das Handelsregister unübersichtlich würde und dadurch der Zweck der handelsregisterlichen Publizität gefährdet wäre.[7]
54
Beispiele für eintragungspflichtige Tatsachen sind Firma und Ort der Handelsniederlassung (§ 29 HGB), Erteilung und Erlöschen der Prokura (§ 53 HGB); aus dem Gesellschaftsrecht: die Gründung und Auflösung von OHG bzw. KG sowie jede Veränderung im Gesellschafterkreis (§§ 106 I, II, VI, 141, 162 HGB) und Einschränkungen der gesetzlichen Vertretungsregelung (§ 106 II Nr. 3 HGB); Gründung und Auflösung von GmbH und AG (§§ 7, 65 GmbHG, §§ 36, 263 AktG), die Mitglieder von GmbH-Geschäftsführung[8] bzw. AG-Vorstand (§§ 8, 39 GmbHG, §§ 37, 81 AktG) – aber nicht die Gesellschafter –, die Höhe des Stamm- bzw. Grundkapitals (§ 8 GmbHG, § 37 AktG) sowie gem. §§ 57, 58 GmbHG, §§ 184, 227 AktG auch alle Kapitalveränderungen (dagegen keine Eintragungsfähigkeit des Vermögens einer OHG oder KG).
55
Eintragungspflichtig kraft richterlicher Rechtsfortbildung sind Unternehmensverträge bei der GmbH[9] und kraft extensiver Auslegung des § 10 I 2 GmbHG die – zulässige – Befreiung vom Verbot des Selbstkontrahierens (§§ 181 BGB, 35 III GmbHG).[10]
56
Nur die eintragungspflichtigen Tatsachen werden von den Rechtswirkungen des § 15 I und III HGB erfasst, nicht bereits die eintragungsfähigen Tatsachen.
57
Eintragungsfähig ist zB der mit dem Veräußerer vereinbarte Haftungsausschluss bei der Firmenfortführung gem. § 25 II HGB (unten Rn. 179) und nach hM auch die Anordnung der Testamentsvollstreckung bei der KG.[11]Nicht eintragungsfähig ist hingegen zB die Erteilung einer Handlungsvollmacht oder das Erlöschen der Geschäftsfähigkeit eines organschaftlichen Vertreters.[12]
3.Deklaratorische und konstitutive Wirkungen der Eintragung
58
Hinsichtlich der Wirkungen der Handelsregistereintragung ist zu unterscheiden: Konstitutiv (= rechtsbegründend) wirkt eine Eintragung dann, wenn erst durch die Eintragung die betreffende Rechtstatsache zur Entstehung gelangt. Hauptbeispiel ist die Eintragung des kleingewerblichen Kannkaufmanns gem. § 2 HGB (oben Rn. 34). Gleiches gilt aber auch für die Eintragung von GmbH und AG, die erst ab diesem Zeitpunkt zur juristischen Person werden (vorher: Vorgesellschaft, dazu Rn. 515 ff.). Dagegen hat zB die Eintragung des Istkaufmanns (§§ 1, 29 HGB) oder die Erteilung bzw. der Widerruf der Prokura (§ 53 HGB) nur deklaratorische (= rechtsbekundende) Wirkung. Denn der Istkaufmann ist bereits vor der Eintragung – also unabhängig von ihr – Kaufmann, und auch die Erteilung und der Widerruf der Prokura sind ohne Eintragung wirksam.
II.Negative und positive Publizität des Handelsregisters gem. § 15 HGB
59
Ausgehend von der Funktion des Handelsregisters (Rn. 51) enthält § 15 HGB verschiedene materiellrechtliche Regelungen:
-
Den Schutz Dritter bei Nichteintragung oder Nichtbekanntmachung eintragungspflichtiger Tatsachen (§ 15 I HGB).
-
Die Rechtsfolgen bei richtiger Eintragung und Bekanntmachung von eintragungspflichtigen Tatsachen (§ 15 II HGB).
-
Den Schutz Dritter im Hinblick auf unrichtige Eintragungen eintragungspflichtiger Tatsachen (§ 15 III HGB).
1.Negative Publizität gem. § 15 I HGB
a)Normzweck und dogmatische Struktur
60
Die negative Publizität des Handelsregisters nach § 15 I HGB bezweckt den Schutz des redlichen Rechtsverkehrs: Ist eine im Interesse des Rechtsverkehrs eintragungspflichtige Tatsache nicht in das Handelsregister eingetragen und bekanntgemacht, so kann sich der Anmeldepflichtige gegenüber einem gutgläubigen Dritten auf diese Tatsache nicht berufen.
61
Wird der Widerruf einer Prokura[13] entgegen § 53 II HGB nicht eingetragen und bekanntgemacht, so muss der Inhaber des Handelsgeschäfts trotz materiell wirksamen Widerrufs Rechtsgeschäfte seines bisherigen Prokuristen gegen sich gelten lassen, es sei denn, der Geschäftspartner wusste von dem Widerruf.
62
Trotz Ausscheidens aus der OHG haftet der bisherige Gesellschafter auch für alle Neuverbindlichkeiten gem. § 126 S. 1 HGB,[14] wenn sein Ausscheiden entgegen § 106 VI HGB nicht eingetragen und bekanntgemacht wird.
63
Dogmatisch handelt es sich um einen speziellen Fall der Rechtsscheinhaftung,[15] der an das Unterlassen der gesetzlich vorgeschriebenen Handelsregistereintragung und Bekanntmachung anknüpft. Geschützt wird durch § 15 I HGB das Vertrauen auf das „Schweigen“ des Handelsregisters (daher negative Publizität). Dieser Vertrauenstatbestand (Rechtsschein), der weiter reicht als die allgemeine Rechtsscheinhaftung (zu den einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen des § 15 I HGB unten Rn. 66 ff.), kann vom Anmeldepflichtigen durch Eintragung und Bekanntmachung zerstört werden. Während allerdings in den Fällen 5a und 5b das Vertrauen des Rechtsverkehrs in den Fortbestand der bisherigen Rechtslage geschützt wird, gilt dies im Fall 5c für das Vertrauen in die gesetzliche Rechtslage:[16]
64
A, B und C sind Gesellschafter der ABC-OHG. Im Gesellschaftsvertrag ist vereinbart, dass A von der Vertretung der OHG ausgeschlossen ist; für B und C ist Gesamtvertretung vorgesehen. Diese – nach § 124 I Hs. 2, II 1 HGB zulässige – Regelung kann einem gutgläubigen Dritten D, mit dem A für die OHG ein Rechtsgeschäft abschließt, jedoch nicht entgegengehalten werden, wenn Eintragung und/oder Bekanntmachung (vgl. § 106 II Nr. 3 HGB) unterlassen wurden. Dann kann D auf die gesetzliche Einzelvertretungsmacht eines jeden OHG-Gesellschafters (§ 124 I Hs. 1 HGB) vertrauen und die Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts geltend machen.[17]
65
Jede Änderung der dispositiven Gesetzeslage wirkt hinsichtlich eintragungspflichtiger Tatsachen gutgläubigen Dritten gegenüber nur, wenn Eintragung und Bekanntmachung erfolgt sind.
b)Tatbestandsvoraussetzungen
66
aa) § 15 I HGB erfasst nur eintragungspflichtige Tatsachen, und zwar sowohl deklaratorische als auch konstitutive Tatsachen (oben Rn. 58).[18]
67
bb) Die Fälle 5a–5c betreffen Änderungen der bisherigen Rechtslage (sog. Sekundärtatsachen





























