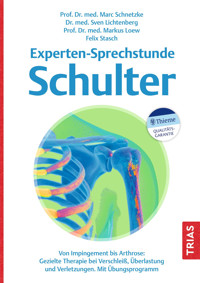
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: TRIAS
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ihre Schulter in guten Händen
Beschwerden am Schultergelenk können viele Ursachen haben z.B. Kalkschulter, Arthrose oder Verletzungsfolgen. Schulterprobleme können langwierig und schmerzhaft sein. Die Experten vom Deutschen Gelenkzentrum in Heidelberg kennen das aus ihrer Sprechstunde. Denn viele ihrer Patientinnen und Patienten stellen sich genau diese Fragen:
- Wie funktioniert mein Schultergelenk überhaupt?
- Was steckt hinter meinen Symptomen und was sind die Ursachen?
- Wie läuft die Diagnostik ab und welche Prognosen gibt es bei meinem Schulterproblem?
- Welche Therapie hilft jetzt am besten?
- Wann ist eine OP sinnvoll und was passiert da genau?
- Welche Übungen lindern meine Schmerzen und verbessern die Rehabilitation?
Die Schulter-Experten klären kompetent über Ihre Erkrankung und alle Therapieoptionen auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Experten-Sprechstunde Schulter
Von Impingement bis Arthrose: Gezielte Therapie bei Verschleiß, Überlastung und Verletzungen. Mit Übungsprogramm
Prof. Dr. med. Marc Schnetzke, Dr. med. Sven Lichtenberg, Prof. Dr. med. Markus Loew, Felix Stasch
60 Abbildungen
Liebe Leserin, lieber Leser,wenn es um die eigene Gesundheit geht, darf man nichts dem Zufall überlassen. „Für eine bessere Medizin und mehr Gesundheit im Leben“: So lautet das Qualitätsversprechen der Marke Thieme. Ärztlich Tätige, Pflegekräfte, Physiotherapeuten oder Hebammen – sie alle verlassen sich darauf, dass sie von Thieme, dem führenden Anbieter von medizinischen Fachinformationen und Services, die entscheidenden Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort bekommen. So können sie die Menschen, die sich ihnen anvertrauen, bestmöglich unterstützen. Auch Sie können sich auf die TRIAS Ratgeber mit dem Thieme Qualitätssiegel verlassen! Diese Informationsangebote helfen Ihnen dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn es um Ihre Gesundheit geht, selbst daran mitzuwirken, gesund zu werden, sich gesund zu erhalten oder das Fortschreiten einer Erkrankung zu vermeiden. Mit einem TRIAS Titel aus dem Hause Thieme überlassen Sie Ihre Gesundheit nicht dem Zufall! Ihr TRIAS Team
Liebe Leserinnen und Leser,
Schulterschmerzen kommen in allen Altersgruppen, auf allen Aktivitätsniveaus und in allen Berufsgruppen vor. 70 % aller Menschen klagen im Laufe ihres Lebens über Schulterschmerzen. Diese können durch Belastung im Beruf oder beim Sport oder einfach durch viel Sitzen hervorgerufen werden. Welche Beschwerden sollte ich ernst nehmen? Wann sollte ich einen Arzt aufsuchen? Was kann ich selbst tun, damit die Beschwerden wieder abklingen? Und ist womöglich ein operativer Eingriff erforderlich? Mit diesem Buch können Sie sich einen fundierten Überblick über die Funktionsweise des Schultergelenks verschaffen, um einschätzen zu können, wann Sie fachliche Hilfe in Anspruch nehmen sollten.
Seit Jahren nehmen die ambulanten Behandlungen von Schulterproblemen zu. Zugleich steigt die Zahl operativer Eingriffe am Schultergelenk kontinuierlich an. Die arthroskopische Versorgung von Problemen des Schultergelenks entwickelte sich in den letzten Jahren zu einer der am häufigsten durchgeführten und erfolgreichsten orthopädischen Operationen weltweit.
Vor einer gezielten Therapie müssen zunächst die Ursachen der Beschwerden festgestellt werden. Woher kommen die Beschwerden? Was führt zu einer Verstärkung der Symptome? Müssen die Beschwerden ärztlich abgeklärt werden? Welche Ursachen für Schulterbeschwerden gibt es überhaupt? Antworten auf diese Fragen finden Sie im vorliegenden Buch. Ist die Ursache erst einmal erkannt, kann ein Therapiekonzept entwickelt werden.
Gerade das Schultergelenk kann gut durch ein gezieltes Training vor Verletzungen oder Überlastungen geschützt werden. Ist bereits eine Funktionsstörung eingetreten, lassen sich manche Probleme durch ein Aufbautraining wieder in den Griff bekommen. Mit den Erklärungen und Übungen in diesem Ratgeber wollen wir Sie dabei unterstützen, dass Ihre Schulter fit bleibt oder wieder wird – als Prävention oder als Rehabilitation nach einer Operation oder Verletzung.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine gute Lektüre!
Ihr Sven Lichtenberg, Markus Loew, Felix Stasch und Marc Schnetzke
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Liebe Leserinnen und Leser,
Das Schultergelenk
Wie funktioniert unsere Schulter?
Struktur des Schultergelenks – einfach erklärt
Die Brustwirbelsäule: „das Erdreich“
Schulterblatt mit Nebengelenken: „das Fundament“ oder „die Basis“
Hauptgelenk mit Schulterdach: „das Haus mit Dach“
Die komplexe Anatomie des Schultergelenks
Das Glenohumeralgelenk
Schultergelenkkapsel
Bizepssehnen
Rotatorenmanschette
Deltamuskel
Schulterblatt-Brustkorb-Gelenk
AC- und SC-Gelenk
Subakromiales Gleitlager
Wie gut kenne ich meine Schulter?
TEST 1: Äußere Kontur des Schultergürtels betrachten
TEST 2: Anatomische Landmarken der Schulter identifizieren
TEST 3: Beweglichkeit der Schulter prüfen
TEST 4: Sehnen der Rotatorenmanschette prüfen
TEST 5: Lange Bizepssehne belasten
TEST 6: Schulterblatt untersuchen
TEST 7: Liegt ein Engpass-Syndrom vor?
Verletzungen und chronische Schmerzen
Verletzung der Schulter
Überlastung der Schulter
Schulter und Sport
Apparative Diagnostik am Schultergelenk
Röntgenaufnahmen
Magnetresonanztomographie (MRT)
Ultraschall (Sonographie)
Computertomographie (CT)
Szintigraphie
Die häufigsten Krankheitsbilder
Probleme mit der Rotatorenmanschette
Impingement-Syndrom
Symptome
Diagnostik
Behandlung
Operation
Nachbehandlung
Ergebnisse und Risiken
Ruptur der Rotatorenmanschette
Symptome
Diagnostik
Behandlung
Operation
Nachbehandlung
Ergebnisse und Risiken
Besonderheit Subscapularissehne
Symptome
Diagnostik
Behandlung
Operation
Nachbehandlung
Ergebnisse und Risiken
Wenn die Rekonstruktion der Rotatorenmanschette nicht mehr möglich ist
Symptome
Diagnostik
Behandlung
Operation
Nachbehandlung
Ergebnisse und Risiken
Nicht reparable Schädigung der Rotatorenmanschette ohne Arthrose
Symptome
Diagnostik
Behandlung
Operation
Nachbehandlung
Ergebnisse und Risiken
Versteckter Troublemaker lange Bizepssehne
Symptome
Diagnostik
Behandlung
Operation
Nachbehandlung
Ergebnisse und Risiken
Kalkablagerungen in der Schulter
Symptome
Diagnostik
Behandlung
Operation
Nachbehandlung
Ergebnisse und Risiken
Bewegungsstörungen in der Schulter
Skapuladyskinesie
Symptome
Diagnostik
Behandlung
Operation
Ergebnisse
Frozen Shoulder
Symptome
Diagnostik
Behandlung
Operation
Nachbehandlung
Ergebnisse und Risiken
Arthrose im Schultergelenk
Symptome
Diagnostik
Behandlung
Operation
Nachbehandlung
Ergebnisse und Risiken
Akute Verletzung der Gelenklippe und deren Folgen
Labrum-Riss
Symptome
Diagnostik
Behandlung
Operation
Nachbehandlung
Ergebnisse und Risiken
Das chronisch instabile Schultergelenk
Symptome
Diagnostik
Behandlung
Operation
Nachbehandlung
Ergebnisse und Risiken
Probleme mit dem Schultereckgelenk
Akute Verletzungen des Schultereckgelenks
Symptome
Diagnostik
Behandlung
Operation
Nachbehandlung
Ergebnisse und Risiken
Das chronisch instabile Schultereckgelenk
Symptome
Diagnostik
Behandlung
Operation
Nachbehandlung
Ergebnisse und Risiken
Arthrose im Schultereckgelenk
Symptome
Diagnostik
Behandlung
Operation
Nachbehandlung
Ergebnisse und Risiken
Bruch des Schultergelenks
Symptome
Diagnostik
Behandlung
Operation
Nachbehandlung
Ergebnisse und Risiken
Therapie und Prävention
Injektionen an der Schulter
Kortison
Hyaluron
Eigenblut
Physiotherapeutische Behandlung
Der Therapiebeginn – das Erstgespräch
Ursachenerforschung und Aufklärung
Überwachung der Wundheilung
Körperliche Untersuchung
Physiotherapeutische Behandlungen an der Therapiebank
Manuelle Lymphdrainage
Wärmetherapie
Manuelle Therapie und aktivierende Übungen
Eigenübungen für das Schultergelenk
Was man vor dem Training wissen sollte
Allgemeines zu den Übungen
Schwierigkeitsstufen
Rehaprinzipien
Bewegungen immer schmerzfrei ausführen
Qualität vor Quantität
Steigerungen
Anpassungen
Rehaübungen – Teilbelastung
• Brustkorbbeweglichkeit im Sitzen
• Die Schultern lockern
•• Wischbewegung auf dem Tisch – Kräftigung des M. deltoideus
•• Staubsauger im Sitzen – Aktivierung der zentrierenden Muskeln
•• Armpendeln im Stehen
•• Aktivierung der Innen- und Außenrotatoren im Sitzen
••• Aktivierung des M. serratus anterior in Rückenlage
••• Beweglichkeitsübung mit dem Handtuch
Rehaübungen – Vollbelastung
• Schulterrollen um den Kopf
•• Erweitern der Außenrotation in Rückenlage
• Überzüge mit dem Stab in Rückenlage
• Cobra – Streckung der Wirbelsäule in Bauchlage
•• Schneeengel in Bauchlage – Aktivierung der Schulterblattmuskeln
••• Push-ups für den M. serratus anterior
• Dynamische Aktivierung der Außenrotation in Seitenlage
•• Fechter in Seitenlage – Kräftigung der Außenrotation
• Dehnung der Außenrotatoren
•• Fechter im Sitzen – Kräftigung der Innenrotation
•• Einsaugen des Gelenkkopfes in der Seitenlage
•• Einfache Schulterzentrierung im Stehen
••• Sehnenkräftigung der Außenrotatoren
• Dehnung Brustmuskulatur am Türrahmen
•• Cobra im Nackengriff
Erhaltungsübungen
• Überzüge mit dem Stab im Sitzen
••• Überzüge mit dem Stab in Bauchlage
• Obere Rumpfrotation in der Seitenlage
• A-Pulls
• T-Pulls
•• Stabilisation im einarmigen Stütz
• Armseitheben
•• Frontdrücken
••• Facepulls
•• Ausrollen der seitlichen Schulterblattmuskeln
•• Ausrollen des Deltamuskels
•• Ausrollen des kleinen Brustmuskels
•• Dehnung der Außenrotatoren – Variante
••• Aufdehnung in die Außenrotation mit Stab
Autorenvorstellung
Sachverzeichnis
Impressum/Access Code
Das Schultergelenk
Das Schultergelenk ist das beweglichste Gelenk des menschlichen Körpers, weshalb es anfällig für Verletzungen und Verschleiß ist.
Wie funktioniert unsere Schulter?
Das Schultergelenk ist ein Kugelgelenk und ermöglicht durch seine komplexe Struktur viele Bewegungen in unterschiedliche Richtungen.
Das Schultergelenk ist ein faszinierendes Gelenk – es ermöglicht uns, unseren Arm um fast 180° seitlich und nach vorne anzuheben sowie die Hand hinter den Körper zu führen. Dies ist etwa für unsere tägliche Hygiene unerlässlich oder auch, um eine Wurfbewegung auszuführen. Was das Schultergelenk jeden Tag leistet, fällt meist erst auf, wenn es nicht mehr richtig funktioniert. Aufgrund seiner enormen Beweglichkeit ist das Schultergelenk im Vergleich zu den anderen großen Gelenken des menschlichen Körpers sehr anfällig für Überlastungen im Alltag oder im Sport – einseitige Belastungen oder Fehlhaltungen können zu Schmerzen im Schulterbereich führen. Um die Gründe dafür zu verstehen, ist es hilfreich, wenn man Aufbau und Funktionsweise des Schultergelenks kennt. Denn eigentlich ist es viel mehr als ein einfaches Gelenk.
Vergleichen wir es mit den Elementen eines Hauses, dem Erdreich, dem Fundament, den Wänden und dem Dach. Entsprechend gehört zu einem Schultergelenk eine kräftige und gerade Brustwirbelsäule (Erdreich), das Schulterblatt mit seinen vielen Gelenk-Verbindungen und Muskeln (das Fundament) sowie das eigentliche aus Kopf und Pfanne bestehende Schultergelenk (die Wände) samt Schulterdach (das Dach).
Struktur des Schultergelenks – einfach erklärt
Das Schultergelenk besteht aus mehreren echten und unechten Gelenken. Das eigentliche Gelenk oder Hauptgelenk, unser »Haus«, ist sehr empfindlich, da es wenig knöcherne Führung aufweist. Es kann somit schnell in eine Schieflage geraten und verrutschen. Daher braucht die Schulter eine ausreichende (muskuläre) Stabilität, um auch bei widrigen Bedingungen einem Sturm standzuhalten. Denn wie auf einem schlechten Erdreich und Fundament kein Haus lange stehen bleibt, so ist auch die Stabilität des Schultergelenks nicht gegeben, wenn einzelne Bestandteile nicht richtig funktionieren.
Die Brustwirbelsäule: „das Erdreich“
Die Brustwirbelsäule als Teil der gesamten Wirbelsäule wird von kräftigen Rückenmuskeln aufgerichtet. Diese bewegen auch das Schulterblatt nach oben, nach unten und zu den Seiten, wenn man sie aktiviert.
1: Aufbau des Schultergelenks
Schulterblatt mit Nebengelenken: „das Fundament“ oder „die Basis“
An der Bewegung des Schulterblatts sind viele Gelenke beteiligt. Hierbei unterscheidet man unechte Gelenke und echte Gelenke. Als unechtes Gelenk fungiert das Gleitlager zwischen Schulterblatt und Brustkorb sowie das Gleitlager zwischen dem Schulterdach und dem Oberarmkopf (subakromiales Nebengelenk). Ein wichtiges echtes Gelenk ist z. B. das Schultereckgelenk, das dafür sorgt, dass sich das Schlüsselbein unabhängig vom Schulterblatt bewegen kann.
Das Schulterblatt stellt mit seinen Gelenk-Verbindungen die Basis für das Hauptgelenk, das eigentliche Schultergelenk, dar und wird von mehreren wichtigen Muskeln, u. a. vom Musculus trapezius (Trapezmuskel), von den Rhomboiden (Rautenmuskeln), vom M. serratus anterior und vom M. latissimus dorsi, geführt. Sie sorgen dafür, dass das Schulterblatt, unser Fundament, stabil ist.
Hauptgelenk mit Schulterdach: „das Haus mit Dach“
Die knöchernen Strukturen, wie das Schulterblatt und das Schulterdach, sowie die umgebenden stabilisierenden Muskeln bewirken, dass der Oberarmkopf (Kugel) in der Mitte der Pfanne des Schulterblatts gehalten wird. Wenn wir den Arm heben möchten, muss sich die Kugel in der Pfanne bewegen. Damit sie jedoch nicht aus dieser herausrollt, wird sie von kleinen Muskeln (der sogenannten Rotatorenmanschette) gehalten; es entsteht ein sogenanntes Rollgleiten. Der wichtigste Motor, um den Arm zu heben, ist der Deltamuskel.
Die komplexe Anatomie des Schultergelenks
Laienhaft sprechen wir von „dem Schultergelenk“. Wie bereits angedeutet, gehören zum Schultergelenk jedoch mehrere Gelenke, insgesamt sind es fünf: drei echte Gelenke und zwei Nebengelenke (Abb. 2): Das eigentliche Schultergelenk, das Schultereckgelenk und das Schlüsselbein-Brustbein-Gelenk bilden dabei echte Gelenke. Als Nebengelenke werden das sogenannte Schulterblatt-Brustkorb-Gelenk und das Gleitlager unter dem Schulterdach bezeichnet. Nur das Zusammenspiel aller fünf Gelenke ermöglicht eine uneingeschränkte Funktion der Schulter.
2: Die fünf Gelenke der Schulter: rechte Schulter in der Ansicht von vorne
3: Artikulierende Skelettelemente eines rechten Schultergelenks
4: Die Gelenkkapsel umgibt das Schultergelenk
5: Die kapselverstärkenden Bänder geben zusätzlich Stabilität
6: eitenansicht einer rechten Schulter mit Darstellung der Schulterpfanne. Die Pfanne ist umgeben von einer Gelenklippe.
7): Darstellung der langen und kurzen Bizepssehne
8: Darstellung der vier Muskeln und dazugehörigen Sehnen der Rotatorenmanschette einer rechten Schulter, von der Seite betrachtet
9: Aktive/dynamische Stabilisatoren des Schultergelenks. Das Gelenk ist stabil, solange der resultierende Kraftvektor aller Muskeln in die Gelenkpfanne gerichtet ist.
Stopp
10: Ansicht des Deltamuskels einer rechten Schulter von vorne
11: von hinten
12: Das Schulterblatt-Brustkorb-Gelenk ist ein Gleitlager zwischen M. serratus anterior und dem M. subscapularis.
13: Das Schulterblatt führt bei der Seitwärtshebung des Arms eine Gleitbewegung im Schulterblatt-Brustkorb-Gelenk durch, um ein Anschlagen des Oberarmkopfes am Schulterdach zu vermeiden.
14: Handgriff nach Codman
15: Das Schulterblatt in der Ansicht von hinten mit den wichtigsten Muskelgruppen für die Stabilisierung des Schulterblatts
16: Seitliche Ansicht mit Darstellung des M. serratus anterior
17: Durch Lähmung oder Schwäche des M. serratus anterior kommt es zu einem Abheben des Schulterblatts.
18: Ansicht von oben mit Darstellung des AC- und SC-Gelenks
19: Frontalschnitt durch das Schultergelenk mit Darstellung der Strukturen des subakromialen Gleitlagers
Das Glenohumeralgelenk
Das zentrale Gelenk ist das eigentliche Schultergelenk (Articulatio humeri oder Glenohumeralgelenk). Es besteht aus dem Oberarmkopf (Caput humeri) und der Schulterpfanne (Glenoid; Abb. 3).
Biomechanisch handelt es sich hierbei um ein Kugelgelenk. Im Unterschied zum Hüftgelenk, ebenfalls ein Kugelgelenk, ist das Schultergelenk jedoch nicht knöchern, sondern muskulär geführt. Das heißt, die Stabilität des Gelenks wird fast ausschließlich durch Muskeln und Bandstrukturen gewährleistet. Die geringe knöcherne Führung des Schultergelenks ermöglicht es uns überhaupt erst, den Arm um fast 180° nach vorne und seitlich anzuheben, ohne dass es zu einer Einengung des Bewegungsspielraumes durch knöcherne Strukturen kommt.
Diese hohe Flexibilität „erkauft“ sich das Gelenk mit einem hohen Risiko für Instabilitäten. Das Glenohumeralgelenk ist von all unseren Gelenken am anfälligsten für eine sogenannte Luxation – also für eine Ausrenkung der Gelenkflächen. Mehr dazu finden Sie im Kapitel über die ▶ Instabilitäten des Schultergelenks.
Schultergelenkkapsel
Die Stabilität des Gelenks wird im Wesentlichen durch umgebende Bänder und Muskeln gewährleistet. Die wichtigste stabilisierende Bandstruktur ist die Schultergelenkkapsel (Abb. 4). Sie ist im Gegensatz zu den Gelenkkapseln anderer Gelenke sehr weit und elastisch, um den großen Bewegungsspielraum der Schulter zu ermöglichen. Das erklärt auch, warum das Schultergelenk nach längerer Schonung oder Ruhigstellung, zum Beispiel nach einer Verletzung, eingesteift ist – die Gelenkkapsel verkürzt sich sehr schnell und muss erst langsam wieder elastisch werden. Die Gelenkkapsel wird durch drei Bänder – die sogenannten glenohumeralen Bänder – verstärkt, um das Gelenk zusätzlich zu stabilisieren (Abb. 5).
Eine weitere sehr wichtige stabilisierende Struktur ist die sogenannte Gelenklippe (Labrum glenoidale). Dies ist ein weichteiliger Ring, der um die knöcherne Schulterpfanne herum liegt (Abb. 6). Die Gelenklippe hat zwei Funktionen: Sie vergrößert zum einen die Gelenkfläche der Pfanne und leistet so einen relevanten Anteil zur Stabilität des Gelenks. Zum anderen legt sich der Ring wie ein Saugnapf um den Oberarmkopf. Dadurch kann ein Unterdruck zwischen dem Kopf und der Pfanne aufrechterhalten und das Gelenk zusätzlich stabilisiert werden. Kommt es daher etwa bei einer Ausrenkung der Schulter zu einer Verletzung der Gelenklippe, führt dies in vielen Fällen zu einer Instabilität des Gelenks (mehr dazu erfahren Sie im Kapitel ▶ Instabilität).
Bizepssehnen
Am obersten Punkt der Gelenklippe (an der sogenannten 12-Uhr-Position) entspringt die lange Bizepssehne (der sogenannte SLAP-Komplex). Sie verläuft durch das Gelenk und verlässt es im Sulcus intertubercularis (Rinne zwischen den beiden Oberarmhöckern). An diesem Übergang wird sie durch ein schlingenartiges Bizeps-Pulley-System (Pulley: Seilrolle) stabilisiert und vor Scherbeanspruchungen geschützt. Danach verläuft sie in Richtung Oberarm zum Bizepsmuskel (Abb. 7). Die kurze Bizepssehne liegt außerhalb des Gelenks und entspringt am Rabenschnabelfortsatz (Processus coracoideus). Die Funktion der langen Bizepssehne wird nach wie vor kontrovers diskutiert. Nach allem, was wir derzeit wissen, hat die lange Bizepssehne nur eine geringe stabilisierende Funktion für das Schultergelenk, die vernachlässigbar ist.
Rotatorenmanschette
Die das Schultergelenk umgebende Muskulatur wird Rotatorenmanschette genannt (Abb. 8). Sie besteht aus vier Muskeln, die wie eine Manschette um das Gelenk herum angelegt sind. Im vorderen Bereich verläuft die Subscapularissehne mit ihrem Muskel. Sie ist für die Drehung des Armes nach innen zuständig. Im hinteren Bereich verlaufen zwei Muskeln: der M. infrapinatus (unterer Grätenmuskel) und M. teres minor (kleiner Rundmuskel), beide sind für die Außendrehung zuständig. Oberhalb des Oberarmkopfes verläuft der M. supraspinatus (oberer Grätenmuskel), der mit der Supraspinatussehne am Oberarmkopf ansetzt. Der Supraspinatus hilft u. a. bei der Seitwärtshebung des Armes.
Diese vier Muskeln zentrieren das Schultergelenk in der Pfanne (Abb. 9) und drücken den Oberarmkopf in sie hinein. Der Ausfall eines oder mehrerer Muskeln der Rotatorenmanschette führt häufig zu einer Dezentrierung der Kugel in der Pfanne. Bei einer chronischen (degenerativen) Schädigung der Supraspinatussehne geschieht dies meist über einen langen Zeitraum und der Oberarmkopf wandert langsam nach oben unter das Schulterdach. Dies kann oft durch die übrigen Muskeln des Schultergürtels kompensiert werden. Eine akute Schädigung einer oder mehrerer Sehnen der Rotatorenmanschette führt meist zu einer erheblichen Störung des Bewegungsablaufes der Schulter.
Deltamuskel
Auf der Rotatorenmanschette liegt der von außen meist gut sicht- und tastbare Deltamuskel, ein elementarer Motor für die Schulterfunktion (Abb. 10 und 11). Der Deltamuskel besteht aus drei Teilen (je einem vorderen, seitlichen und hinteren) und sitzt haubenförmig auf der Rotatorenmanschette (daher wird er auch „Haubenmuskel“ genannt).
Seine Funktion besteht im Wesentlichen darin, den Arm nach vorne und seitlich nach oben zu heben. Ein Ausfall des Deltamuskels führt zu einer massiven Einschränkung der Beweglichkeit im Schultergelenk. Der Arm kann dann oft gar nicht mehr angehoben werden. Die häufigste Ursache stellt dabei eine Schädigung des Nervus axillaris dar, der den Muskel motorisch versorgt. Eine Schädigung dieses Nervs kann unfallbedingt zum Beispiel bei einer Ausrenkung der Schulter oder auch als Folge eines operativen Eingriffes auftreten.
Schulterblatt-Brustkorb-Gelenk
Damit wir das Schultergelenk um 180° heben können, ist eine Drehung des Schulterblatts im Schulterblatt-Brustkorb-Gelenk (sogenanntes skapulothorakales Gleitlager) erforderlich (Abb. 12). Das harmonische Zusammenspiel zwischen den beiden Hauptgelenken ermöglicht die uneingeschränkte Beweglichkeit der Schulter (Abb. 13).
Ist das Schultergelenk und/oder das Schulterblatt-Brustkorb-Gelenk in seiner Funktionsweise gestört, entsteht eine meist schmerzhafte Bewegungseinschränkung der Schulter. Am besten kann man die Funktionsweise des Schulterblatt-Brustkorb-Gelenks nachvollziehen, wenn das Schulterblatt von einer zweiten Person fixiert wird. Versucht man nun, den Arm seitlich hochzuheben, gelingt dies nur bis zur Horizontalen. Damit der Arm höher bewegt werden kann, muss das Schulterblatt im Schulterblatt-Brustkorb-Gelenk gleiten können, um dem Oberarmkopf „Platz“ zu machen. Der sogenannte „Codman-Handgriff“ ermöglicht geübten Untersuchenden bei einer Prüfung des Bewegungsausmaßes zwischen einer Störung im Schultergelenk oder im Schulterblatt-Brustkorb-Gelenk zu differenzieren (Abb. 14).





























