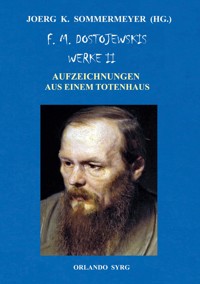
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Orlando Syrg Taschenbuch: ORSYTA
- Sprache: Deutsch
Dostojewski berichtet in seinem zugleich autobiografischen als auch dichterisch überhöhten Werk sachlich und genau das Leben des fiktiven Alexander Petrowitsch Gorjantschikow, wegen Mordes an seiner Frau zu zehn Jahren Zwangsarbeit verurteilt, in einem sibirischen Zuchthaus, inmitten einer aufgezwungenen Gemeinschaft unbußfertiger Sträflinge.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 619
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch
Dostojewski berichtet in seinem zugleich autobiografischen als auch dichterisch überhöhten Werk sachlich und genau das Leben des fiktiven Alexander Petrowitsch Gorjantschikow, wegen Mordes an seiner Frau zu zehn Jahren Zwangsarbeit verurteilt, in einem sibirischen Zuchthaus, inmitten einer aufgezwungenen Gemeinschaft unbußfertiger Sträflinge.
Der Autor
Fjodor Michailowitsch Dostojewski erblickt das Licht der Welt in Moskau am 11. November 1821 als zweites von acht Kindern des aus verarmter Adelsfamilie stammenden, russisch-orthodoxen Arztes, Michail Andrejewitsch Dostojewski, und Marija Fjodorowna, geborene Netschajewa, Tochter eines wohlhabenden Moskauer Kaufmanns. Elementar- und Französischunterricht erteilt ihm die Mutter anhand religiöser Kinderbücher, alsbald unterstützt von einem Diakon. Sobald er lesen kann, verschlingt er sämtliche Bücher, die er kriegen kann, darunter Werke von Puschkin, Scott, und Voltaire wie auch triviale und populäre Dreigroschenhefte. 1833 besucht er Souchards Internat; 1834 das von Tschermak. 1837 stirbt seine Mutter (Tuberkulose); 1839 sein Vater (Schlaganfall). 1838-1843 studiert er an der St. Petersburger Militäringenieurschule, interessiert sich für russische und französische Literatur; Gogol, Hugo, Balzac, Sand (christlicher Sozialismus), aber auch Schiller. Er wird im Ingenieurdepartement angestellt, nimmt 1844 seinen Abschied, um als freier Schriftsteller in St. Petersburg zu wirken. 1845 Bekanntschaft mit dem Kritiker Belinskij (atheistischer Sozialismus). 1846 reüssiert er mit seinem Debütroman »Arme Leute«. 1849 wird er wegen den Umtrieben utopischer Sozialisten um Petrasevskij in St. Petersburg verhaftet, zum Tode verurteilt, aber nach einer Scheinhinrichtung zu viegähriger Zwangsarbeit in Sibirien begnadigt (»Aufzeichnungen aus einem Totenhaus«). Nach Verbüßung im Zuchthaus von Omsk, Soldat im westsibirischen Semipalatinsker Linienregiment; 1855 Offizier. 1857 heiratet er Marija Issajewa, Witwe eines Hauptmanns. Epileptischer Anfall. »Erniedrigte und Beleidigte«. 1859, Abschied vom Militär; er zieht nach Twer. 1860, mittlerweile Christ und Widersacher des atheistischen Sozialismus, Übersiedlung nach St. Petersburg. 1861-1863 Herausgabe der Zeitschrift »Vremja« mit seinem älteren Bruder Michail. Reisen nach England, Belgien, Deutschland, Paris, die Schweiz und Oberitalien. Gefallen am Roulette; Baden-Badener und Wiesbadener Spielbanken. Zeitschrift »Epocha«; Finanznöte. 1864 sterben Ehefrau und Bruder. 1866, »Verbrechen und Strafe« (Schuld und Sühne). 1867 heiratet er Anna Snitkina. Flucht vor Dostojewskis Gläubigem und dem drohenden Schuldturm in die Schweiz und nach Italien; lebt in Dresden. 1868, »Der Idiot«. 1871, Rückkehr nach St. Petersburg. Redakteur des slawophilen »Der Bürger«. »Die Dämonen«. Seit 1873 Herausgeber und einziger Schreiber der Zeitschrift »Tagebuch eines Schriftstellers«. Erkrankung an einem Lungenemphysem; seit 1874 mehrere Therapieversuche in Bad Ems. 1879, »Der Jüngling«. 1880, »Die Brüder Karamasow«. Lungenblutungen verursachen am 9. Februar 1881 Dostojewskis Tod in St. Petersburg.
Der Übersetzer
Alexander Eliasberg, geb. 22. Juli 1878 in Minsk (Russland) - gest. am 26. Juli 1924 in Berlin; seit 1902 in Deutschland. Übersetzer (u. a. Werke von Nikolai Gogol, Alexander Puschkin, Anton Tschechow, Dmitri Mereschkowski, Alexei Nikolajewitsch Tolstoi, Alexei Remisow, Ilja Ehrenburg, Scholem Alejchem, Jizchok Leib Perez), Literarhistoriker, Autographen- und Büchersammler.
Der Herausgeber
Joerg . Sommermeyer (JS), geb. am 14.10.1947 in Brackenheim, Sohn des Physikers Kurt Hans Sommermeyer (1906-1969). Kindheit in Freiburg. Studierte Jura, Philosophie, Germanistik, Geschichte und Musikwissenschaft. Klassische Gitarre bei Viktor v. Hasselmann und Anton Stingl. Unterrichtete in den späten Sechzigern Gitarre am Kindergärtnerinnen- / Jugendleiterinnenseminar und in den Achtzigern Rechtsanwaltsgehilfmnen in spe an der Max-Weber-Schule in Freiburg. 1976 bis 2004 Rechtsanwalt in Freiburg. Zahlreiche Veröffentlichungen. JS (Joerg Sommermeyer) lebt in Berlin und Lahnstein.
Orlando Syrg, Berlin, Neujahr 2024
Inhalt
Über dieses Buch
Der Autor
Der Übersetzer
Der Herausgeber
Aufzeichnungen aus einem Totenhaus
Einleitung
Erster Teil
I
Das tote Haus
II
Die ersten Eindrücke
III [Kaum war M-cki (der Pole, der mit mir gesprochen hatte)]
IV [Es begann die letzte Kontrolle]
V
Der erste Monat
VI [Bei meinem Eintritt ins Zuchthaus besaß ich einiges Geld]
VII
Neue Bekanntschaften – Petrow
VIII
Entschlossene Menschen – Lutschka
IX
Issai Fomitsch – Das Dampfbad- Bakluschins Erzählung
X Das Weihnachtsfest
XI
Die Theateraufführung
Zweiter Teil
I
Das Hospital
II
Fortsetzung
[Die Ärzte machten in den Morgenstunden]
III
Fortsetzung
[Ich kam soeben auf die Strafen]
IV
Akuljkas Mann
(Eine Erzählung)
V
Die Sommerzeit
VI
Die Tiere des Zuchthauses
VII
Die Beschwerde
VIII Die Kameraden
IX
Eine Flucht
X
Der Austritt aus dem Zuchthaus
In Memoriam
Ilse Fischer, gesch. Coillard, geb. Sommermeyer 11. Mai 1944, Brackenheim -14. Mai 2013, Bremen
Liebe Ilse, Me regarder vieillir passionnément
Encore espérer s’amuser de temps en temps Faut tenir Ne rien dire Voilà tout!
JS, 14. Dezember 2023, frei nach Céline, auf der Reise ans Ende der Nacht...
Fjodor Michailowitsch Dostojewski
Aufzeichnungen aus einem Totenhaus
(Zapiski iz mertvogo doma, Vremja, St. Petersburg 1861/1862; Deutsch von Alexander Eliasberg, Volksverband der Bücherfreunde, Wegweiser-Verlag, Berlin 1923)
Einleitung
In den entfernten Gebieten Sibiriens, mitten unter Steppen, Bergen oder unwegsamen Wäldern, findet man ab und zu kleine Städte mit ein- höchstens zweitausend Einwohnern, aus Holz erbaut und unansehnlich, mit zwei Kirchen – die eine in der Stadt und die andere auf dem Friedhof, – Städte, die eher einem größeren Kirchdorf in der Nähe Moskaus als einer wirklichen Stadt gleichen. Sie sind gewöhnlich mit einer genügenden Anzahl von Isprawniks, Assessoren und sonstigen subalternen Beamten versehen. Im Allgemeinen ist der Dienst in Sibirien, trotz der Kälte, für die Beamten außerordentlich behaglich. Es leben da einfache, nicht liberale Menschen, und herrschen alte, festgefügte, von Jahrhunderten geheiligte Sitten. Die Beamten, die mit Recht die Rolle eines sibirischen Adels spielen, sind entweder eingeborene, eingefleischte Sibirier oder sind aus dem europäischen Russland, zum größten Teil aus den Hauptstädten zugezogen, von den Reisevorschüssen, die niemals verrechnet werden, den doppelten Vorspanngeldern und rosigen Hoffnungen auf die Zukunft verlockt. Diejenigen von ihnen, die des Lebens Rätsel zu lösen verstehen, bleiben für immer in Sibirien und fassen dort mit Genuss Wurzeln. Diese bringen später reiche und süße Früchte. Aber die anderen, die leichtsinnigen, die des Lebens Rätsel nicht zu lösen verstehen, haben von Sibirien bald genug und fragen sich mit Qual: »Warum sind wir eigentlich hergekommen?« Sie absolvieren mit Ungeduld die gesetzliche dreijährige Dienstzeit, nach deren Verlauf sie sich sogleich um eine Versetzung bemühen, und kehren heim, auf Sibirien schimpfend und es verspottend. Sie sind im Unrecht. Nicht nur in Ansehung des Dienstes, sondern auch in verschiedenen anderen Hinsichten kann man in Sibirien wohl ein glückliches Leben führen. Das Klima ist vorzüglich; es gibt viele außerordentlich reiche und gastfreundliche Kaufleute und auch viele vermögende Fremdstämmige. Die jungen Mädchen blühen wie die Rosen und sind im höchsten Grade tugendhaft. Das Wildbret fliegt in den Straßen herum und stößt von selbst auf den Jäger. Champagner wird in unnatürlichen Mengen getrunken. Die Ernte ist stellenweise fünfzehnfach ... Es ist überhaupt ein gesegnetes Land. Man muss nur verstehen, seinen Nutzen daraus zu ziehen. Und in Sibirien versteht man sich darauf.
In einem solcher lustigen selbstzufriedenen Städtchen mit der liebenswürdigsten Bevölkerung, die eine unauslöschliche Erinnerung in meinem Herzen zurückließ, lernte ich einen gewissen Alexander Petrowitsch Gorjantschikow kennen, einen Ansiedler, der im europäischen Russland als adeliger Gutsbesitzer geboren, wegen der Ermordung seiner Frau zu Zwangsarbeit zweiter Klasse nach Sibirien verbannt worden war und nach Abbüßung der gesetzlichen zehnjährigen Strafzeit ein stilles und bescheidenes Leben als Ansiedler im Städtchen K. fristete. Eigentlich war er nach einer in der Nähe dieser Stadt gelegenen Dorfgemeinde zuständig, wohnte aber in der Stadt, wo er die Möglichkeit hatte, durch Unterrichtung von Kindern seinen Lebensunterhalt zu verdienen. In den sibirischen Städten trifft man oft als Lehrer solche ehemalige Verbannte; man hat hier keinerlei Vorurteile gegen sie. Sie unterrichten vorwiegend in der französischen Sprache, die im Leben so dringend notwendig ist und von der man, ohne sie, in den entlegenen Gegenden Sibiriens keine Ahnung gehabt hätte. Ich traf Alexander Petrowitsch zum ersten Mal im Haus eines alten verdienten und gastfreundlichen Beamten, Iwan Iwanytsch Gwosdikow, welcher fünf Töchter verschiedenen Alters hatte, die zu den schönsten Hoffnungen berechtigten. Alexander Petrowitsch gab ihnen Unterricht, viermal in der Woche zu dreißig Kopeken in Silber für die Stunde. Sein Äußeres weckte mein Interesse. Er war ein außerordentlich blasser und hagerer Mann, noch nicht alt, von etwa fünfunddreißig Jahren, klein und schwächlich. Er kleidete sich immer sehr sauber und nach europäischer Art. Wenn man mit ihm ein Gespräch begann, so sah er einen außerordentlich durchdringend und aufmerksam an und hörte mit strenger Höflichkeit zu, als sinne er über jedes Wort nach, als sähe er in jeder an ihn gerichteten Frage eine Aufgabe, oder als wolle man ihm irgendein Geheimnis entlocken. Schließlich antwortete er klar und kurz, aber jedes Wort dermaßen abwägend, dass man sich plötzlich aus irgendeinem Grund geniert fühlte und schließlich froh war, wenn das Gespräch ein Ende nahm. Ich erkundigte mich über ihn schon damals bei Iwan Iwanytsch und erfuhr, dass Gorjantschikow ein tadelloses und sittliches Leben führte; sonst würde Iwan Iwanytsch seine Töchter nicht von ihm unterrichten lassen; er sei aber furchtbar menschenscheu, gehe allen aus dem Weg, sei außerordentlich gebildet, lese viel, spreche aber sehr wenig, und es sei außerordentlich schwer, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Andere behaupteten, er sei entschieden verrückt, obwohl sie es im Grunde genommen für keinen so großen Fehler hielten; viele der angesehenen Bewohner der Stadt seien bereit, Alexander Petrowitsch auf die freundlichste Weise zu behandeln, er könne sogar nützlich sein und verstünde Bittgesuche aufzusetzen usw. Man nahm an, dass er anständige Verwandte in Russland habe, die vielleicht nicht zu den unbedeutendsten Menschen gehörten, aber man wusste, dass er seit seiner Verbannung alle Beziehungen zu denselben abgebrochen hatte, kurz, dass er sich selbst schädigte. Außerdem kannten bei uns alle seine Geschichte und wussten, dass er seine Frau im ersten Jahr des Ehelebens aus Eifersucht ermordet und sich dann selbst angezeigt hatte (was das Strafmaß bedeutend gemildert hatte). Solche Verbrechen werden aber stets als Unglücksfälle angesehen und erregen Mitleid. Trotz alledem ging aber der Sonderling allen hartnäckig aus dem Weg und erschien unter Menschen nur, um Stunden zu geben.
Anfangs schenkte ich ihm keine besondere Beachtung, aber er fing mich allmählich zu interessieren an, ich weiß selbst nicht warum. Es war in ihm etwas Rätselhaftes. Mit ihm richtig ins Gespräch zu kommen, war absolut unmöglich. Natürlich gab er auf alle meine Fragen immer Antwort und sogar mit solcher Miene, als hielte er es für seine allererste Pflicht; aber nach seinen Antworten war es mir irgendwie schwer, ihn weiter auszufragen; auch drückte sein Gesicht nach einem solchen Gespräch immer Qual und Ermüdung aus. Ich erinnere mich noch, wie ich einmal an einem schönen Sommerabend mit ihm von Iwan Iwanytsch ging. Plötzlich fiel mir ein, ihn für eine Weile zu mir einzuladen, um eine Zigarette zu rauchen. Ich kann gar nicht beschreiben, was für ein Schrecken sich da auf seinem Gesicht zeigte; er verlor ganz die Fassung, fing an, irgendwelche unzusammenhängende Worte zu stammeln, warf mir plötzlich einen gehässigen Blick zu und rannte in die entgegengesetzte Richtung davon. Ich war sogar erstaunt. Von nun an sah er mich bei jeder neuen Begegnung erschrocken an. Ich beruhigte mich aber nicht; etwas an ihm zog mich an, und etwa vier Wochen später ging ich so ganz ohne jeden Anlass selbst zu Gorjantschikow. Natürlich war es dumm und taktlos von mir. Er wohnte am äußersten Ende der Stadt bei einer alten Kleinbürgerin, die eine schwindsüchtige Tochter hatte; diese hatte aber ein uneheliches Kind, ein etwa zehnjähriges, hübsches und heiteres Mädelchen. Alexander Petrowitsch saß, als ich kam, mit der Kleinen und unterrichtete sie im Lesen. Als er mich erblickte, geriet er in solche Verwirrung, als hätte ich ihn bei einem Verbrechen ertappt. Er verlor alle Fassung, sprang vom Stuhl auf und sah mich starr an. Endlich nahmen wir Platz; er verfolgte aufmerksam jeden meiner Blicke, als witterte er in jedem von ihnen einen besonderen geheimnisvollen Sinn. Ich merkte, dass er misstrauisch war bis zum Wahnsinn. Er sah mich mit Hass an und schien mich fragen zu wollen, ob ich nicht bald weggehen würde. Ich brachte das Gespräch auf unser Städtchen und auf die laufenden Neuigkeiten; er schwieg und lächelte gehässig; es zeigte sich, dass er die allergewöhnlichsten, allen bekannten städtischen Neuigkeiten nicht nur nicht kannte, sondern sich für sie nicht einmal interessierte. Dann sprach ich vom Land, in dem wir wohnten, und von seinen Bedürfnissen; er hörte mir schweigend zu und sah mir so merkwürdig in die Augen, dass ich mich plötzlich dieses Gesprächs schämte. Übrigens gelang es mir fast, ihn durch die neuen Bücher und Zeitschriften, die ich bei mir hatte, in Versuchung zu bringen; sie waren soeben mit der Post angekommen, und ich bot sie ihm noch unaufgeschnitten an. Er warf auf sie einen gierigen Blick, gab aber sofort seine Absicht auf und wies mein Angebot zurück, mit der Ausrede, dass er keine Zeit habe. Endlich verabschiedete ich mich von ihm und fühlte, als ich ihn verlassen hatte, wie mir ein schwerer Stein vom Herzen gefallen war. Ich schämte mich, und es erschien mir außerordentlich dumm, einem Menschen nachzulaufen, der es sich zur Hauptaufgabe gemacht hatte, sich so weit wie möglich von der gesamten Welt zu verstecken. Aber es war einmal geschehen. Ich erinnere mich, dass ich bei ihm fast gar keine Bücher gesehen habe; folglich stimmte es nicht, wenn man sagte, dass er viel lese. Als ich aber ein paar Mal zu einer sehr späten Nachtstunde an seinen Fenstern vorüberfuhr, sah ich in ihnen Licht. Was mochte er treiben, wenn er so bis zur Morgendämmerung aufblieb? Vielleicht schrieb er? Und wenn ja, was mochte er schreiben?
Die Umstände hielten mich an die drei Monate von unserem Städtchen fern. Als ich im Winter zurückkehrte, erfuhr ich, dass Alexander Petrowitsch im Herbst gestorben war, und zwar in voller Einsamkeit, ohne auch nur einmal einen Arzt gerufen zu haben. Im Städtchen hatte man ihn fast gänzlich vergessen. Seine Wohnung stand leer. Ich machte unverzüglich die Bekanntschaft der Wirtin des Verstorbenen, in der Absicht, von ihr zu erfahren, womit sich ihr Mieter eigentlich beschäftigt oder ob er nicht etwas geschrieben habe. Für ein Zwanzigkopekenstück brachte sie mir einen ganzen Korb Papiere, die der Verstorbene hinterlassen hatte. Die Alte gestand mir, dass sie zwei Hefte bereits aufgebraucht hatte. Sie war ein mürrisches und wortkarges Frauenzimmer, aus dem man schwer etwas herausbringen konnte. Über ihren Mieter vermochte sie mir nichts Neues zu erzählen. Nach ihren Worten hatte er fast nie etwas getan und monatelang weder ein Buch aufgeschlagen, noch eine Feder zur Hand genommen; dafür sei er nächtelang in seinem Zimmer auf und ab gegangen und habe über etwas nachgedacht, zuweilen sogar mit sich selbst gesprochen. Er hätte ihre Enkeltochter Katja sehr lieb gewonnen und sei immer freundlich zu ihr gewesen, besonders nachdem er erfahren hatte, dass sie Katja heiße; am Katherinentag sei er stets in die Kirche gegangen und habe eine Totenmesse lesen lassen. Gäste hätte er nicht leiden können; das Haus habe er nur verlassen, um Stunden zu geben; er hätte sogar sie, die Alte, selbst scheel angesehen, wenn sie einmal in der Woche zu ihm gekommen sei, um sein Zimmer ein wenig aufzuräumen, und habe zu ihr in den ganzen drei Jahren fast kein einziges Wort gesprochen. Ich fragte Katja, ob sie sich ihres Lehrers erinnere. Sie sah mich schweigend an, wandte sich dann zur Wand und fing zu weinen an. Also hat es dieser Mensch doch vermocht, in jemand Liebe zu erwecken.
Ich nahm seine Papiere mit und wühlte in ihnen einen ganzen Tag. Drei Viertel davon waren leere unbedeutende Fetzen oder Schreibübungen seiner Schüler. Aber es fand sich auch ein Heft dabei, recht umfangreich, eng vollgeschrieben und unvollendet, vielleicht vom Verfasser selbst aufgegeben und vergessen. Es war eine, wenn auch zusammenhanglose Beschreibung des zehnjährigen Zuchthauslebens, das Alexander Petrowitsch abgebüßt hatte. Stellenweise war diese Beschreibung durch einen anderen Bericht unterbrochen, durch seltsame, schreckliche Erinnerungen, hastig und krampfhaft, wie unter einem Zwang hingeworfen. Ich las diese Bruchstücke einige Mal durch und gewann fast die Überzeugung, dass sie im Wahnsinn geschrieben worden seien. Aber die Zuchthausaufzeichnungen, – »Szenen aus einem toten Hause«, – wie der Autor sie selbst an einer Stelle seines Manuskripts nannte, - erschienen mir nicht ganz uninteressant. Eine gänzlich neue, bisher unbekannte Welt, die Seltsamkeit mancher Tatsachen, einige besondere Bemerkungen über verlorene Menschen – all das fesselte mich, und ich las vieles mit Interesse. Natürlich kann ich mich auch irren. Aber ich wähle zur Probe erst zwei oder drei Kapitel aus; mag das Publikum selbst urteilen ...
Erster Teil
I
Das tote Haus
Unser Zuchthaus lag am Rand der Festung, dicht am Festungswall. Wenn man zuweilen einen Blick durch die Spalten im Zaun auf die Welt Gottes warf, – ob man nicht etwas von ihr sehen könne, – so sah man nur ein Stückchen Himmel und den hohen, von Unkraut überwucherten Festungswall, auf dem Tag und Nacht Wachtposten auf und ab gingen; und man dachte sich dann: Es werden noch ganze Jahre vergehen, und wenn man wieder einmal einen Blick durch eine Spalte im Zaune wirft, wird man den gleichen Wall, die gleichen Wachtposten und das gleiche Stückchen Himmel sehen, nicht den Himmel, der über dem Zuchthaus ist, sondern einen anderen, freien, fernen Himmel. Man denke sich einen großen Hof, zweihundert Schritt lang und hundertfünfzig Schritt breit, von allen Seiten von einem hohen Palisadenzaun in Form eines unregelmäßigen Sechseckes umgeben, d. h. von einem Zaun aus hohen, senkrechten, tief in die Erde eingegrabenen, mit den Kanten fest zusammengefügten, durch Querbalken verstärkten und oben zugespitzten Pfählen; das ist die äußere Umzäunung des Zuchthauses. An der einen Seite dieser Umzäunung ist ein festes Tor angebracht, das immer verschlossen ist und Tag und Nacht von Posten bewacht wird; es wird nur auf besonderen Befehl geöffnet, um die Sträflinge zur Arbeit hinauszulassen. Hinter diesem Tor lag die helle freie Welt, wo Menschen wie Menschen lebten. Aber diesseits der Umzäunung stellte man sich jene Welt als ein unerfüllbares Märchen vor. Hier war eine eigene Welt, die keiner anderen ähnlich sah; hier waren eigene Gesetze, eine eigene Tracht, eigene Sitten und Gebräuche, ein Haus für lebende Tote, ein Leben, wie sonst nirgends, und eigene Menschen. Diesen eigentümlichen Winkel will ich nun beschreiben.
Wenn man in die Umzäunung tritt, so erblickt man innerhalb derselben mehrere Gebäude. Zu beiden Seiten des breiten Innenhofes ziehen sich zwei lange einstöckige aus runden Balken erbaute Flügel hin. Das sind die Kasernen. In ihnen leben die Sträflinge nach Kategorien verteilt. In der Tiefe des Hofes liegt noch ein drittes Haus, ebenfalls aus runden Balken. Es ist die in zwei Betriebe geteilte Küche; weiter liegt noch ein Gebäude, das unter demselben Dache die Keller, Speicher und Schuppen vereinigt. Die Mitte des Hofes ist leer und bildet einen ebenen, ziemlich geräumigen Platz. Hier stellen sich die Sträflinge in Reih und Glied auf, hier findet morgens, mittags und abends die Kontrolle und der Appell statt, manchmal sogar noch einige Mal am Tage, je nach der Gewissenhaftigkeit der Wache und deren Geschicklichkeit im raschen Zählen. Ringsum zwischen den Gebäuden und dem Zaun bleibt noch ein ziemlich großer freier Raum. Hier, hinter den Gebäuden, pflegen diejenigen Sträflinge, die besonders scheu und düster sind, in der arbeitsfreien Zeit, von allen Blicken geschützt, auf und ab zu wandern und ihren Gedanken nachzugehen. Wenn ich ihnen bei ihren Spaziergängen begegnete, betrachtete ich gerne ihre finsteren, gebrandmarkten Gesichter und bemühte mich, ihre Gedanken zu erraten. Es war ein Sträfling darunter, dessen Lieblingsbeschäftigung darin bestand, in der freien Zeit die Palisadenpfähle zu zählen. Es waren ihrer an die anderthalbtausend, und er kannte jeden einzelnen Pfahl ganz genau. Jeder von ihnen bedeutete für ihn einen Tag; jeden Tag zählte er einen Pfahl ab und konnte auf diese Weise nach der Menge der noch nicht abgezählten Pfähle ersehen, wie viel Tage er noch bis zum Ablauf der Straffrist im Zuchthaus bleiben musste. Er freute sich aufrichtig, wenn eine der Seiten des Sechsecks erledigt war. Er hatte noch viele Jahre zu warten, aber im Zuchthause hatte man Zeit, um Geduld zu lernen. Einmal sah ich, wie ein Arrestant, der zwanzig Jahre in der Zwangsarbeit verbracht hatte und nun in die Freiheit gelassen wurde, sich von seinen Kameraden verabschiedete. Es gab Leute, die sich noch erinnerten, wie er zum ersten Mal das Zuchthaus betreten hatte, jung, sorglos, ohne an sein Verbrechen und an die Strafe zu denken. Nun ging er als ergrauter Greis mit düsterem und traurigem Gesicht in die Freiheit. Schweigend machte er die Runde durch alle unsere sechs Kasernen. Beim Eintritt in jede Kaserne, verrichtete er erst ein kurzes Gebet vor den Heiligenbildern, verbeugte sich dann tief vor den Kameraden und bat sie, seiner nicht im Bösen zu gedenken. Ich erinnere mich auch, wie ein Arrestant, ein ehemaliger vermögender sibirischer Bauer eines Abends vor das Tor gerufen wurde. Ein halbes Jahr vorher hatte er die Nachricht erhalten, dass seine frühere Frau sich verheiratet habe, und das hatte ihn sehr betrübt. Nun war sie selbst am Zuchthaus vorgefahren, hatte ihn herausrufen lassen und ihm ein Almosen gereicht. Sie sprachen an die zwei Minuten miteinander, weinten ein wenig und nahmen dann für immer Abschied. Ich sah sein Gesicht, als er in die Kaserne zurückkehrte ... Ja, an diesem Ort konnte man Geduld lernen.
Wenn es dunkelte, wurden wir alle in die Kasernen gebracht und für die ganze Nacht eingesperrt. Es fiel mir immer schwer, aus dem Freien in die Kaserne zurückzukehren. Es war ein langer, niederer Raum, spärlich von Talglichtern erleuchtet, mit einem schweren, stickigen Geruch. Jetzt kann ich nicht begreifen, wie ich darin die zehn Jahre habe aushalten können. Auf der Pritsche hatte ich drei Bretter zu meiner Verfügung, das war mein ganzer Raum. Auf der gleichen Pritsche lagen in unserem Zimmer allein an die dreißig Menschen. Im Winter wurde die Kaserne schon früh geschlossen, und es dauerte an die vier Stunden, bis alle eingeschlafen waren. Bis dahin war aber ein Lärm, ein Geschrei, ein Lachen, ein Geschimpfe, Klirren von Ketten, Qualm und Dunst; ein Gewirr von rasierten Köpfen, gebrandmarkten Gesichtem, gescheckten Kleidern, alles geächtet und gezeichnet ... ja, der Mensch ist eben zäh! Der Mensch ist ein Wesen, das sich an alles gewöhnt, und ich glaube, dass dies die beste Definition für ihn ist.
Wir waren unser im Zuchthaus im Ganzen an die zweihundertfünfzig Mann; diese Zahl blieb fast immer unverändert. Die einen kamen, die anderen büßten ihre Zeit ab und gingen, die dritten starben. Und was für Leute gab es da nicht alles! Ich glaube, jedes Gouvernement, jedes Gebiet Russlands hatte hier seine Vertreter. Es gab auch einige Fremdstämmige, sogar einige Verbannte aus den kaukasischen Bergvölkern. Alle waren nach dem Grad ihrer Verbrechen eingeteilt, folglich auch nach der Zahl der Jahre, die ihnen für ihre Verbrechen zudiktiert waren. Es ist anzunehmen, dass es kein Verbrechen gibt, das hier nicht seinen Vertreter hatte. Den Grundstock der Zuchthausbevölkerung bildeten die zu Zwangsarbeit Verbannten aus dem Zivilstand (die »Zuviel-Verbannten«, wie die Arrestanten selbst das Wort aussprachen). Dies waren Verbrecher, denen alle Bürgerrechte aberkannt waren, von der Gesellschaft ausgestoßene Elemente, mit gebrandmarkten Gesichtern, die von ihrer Ächtung ewig zeugen sollten. Sie kamen zur Zwangsarbeit auf acht bis zwölf Jahre und wurden später in die verschiedenen sibirischen Landgemeinden als Ansiedler verschickt. Es gab auch Verbrecher aus dem Militärstand, die ihre Standesrechte behalten hatten, wie es ja in den russischen Strafkompanien immer der Fall ist. Diese wurden nur für kurze Zeit verbannt, nach deren Ablauf sie wieder dorthin zurückkehrten, woher sie gekommen waren, in die sibirischen Linienbataillone. Viele von ihnen kehrten fast sogleich wegen neuer schwerer Verbrechen ins Zuchthaus zurück, aber nicht mehr auf kurze Zeit, sondern auf zwanzig Jahre. Diese Kategorie Sträflinge nannte man die »Dauersträflinge«. Aber auch die »Dauersträflinge« verloren doch nicht alle Standesrechte. Schließlich gab es noch eine eigene Kategorie der schwersten Verbrecher, vorwiegend aus dem Militärstand, die recht zahlreich waren. Diese bildeten die »Besondere Abteilung«. Aus ganz Russland wurden Verbrecher hergeschickt. Sie hielten sich selbst für lebenslänglich verbannt und kannten die Frist ihrer Zwangsarbeit nicht. Nach dem Gesetz musste ihr Arbeitspensum verdoppelt und verdreifacht werden. Sie waren im Zuchthaus nur »bis zur Einrichtung der schwersten Zwangsarbeit« untergebracht. »Ihr seid nur auf eine Zeit hier, wir aber bleiben ewig«, sagten sie zu den anderen Sträflingen. Später hörte ich, dass diese ganze Kategorie aufgehoben worden sei. Außerdem ist in unserer Festung auch die Zivilabteilung abgeschafft und eine gemeinsame militärische Arrestantenkompanie eingeführt worden. Selbstverständlich wechselte mit diesen Veränderungen auch die Obrigkeit. Also beschreibe ich Geschehnisse der alten Zeit, längst vergangene und vergessene Dinge.
Es liegt schon weit zurück, und ich sehe jetzt alles wie im Traum. Ich erinnere mich noch, wie ich das Zuchthaus zum ersten Mal betrat. Es war an einem Januarabend. Es dunkelte schon, die Leute kamen von der Arbeit zurück und bereiteten sich auf die Kontrolle vor. Ein schnauzbärtiger Unteroffizier machte mir endlich die Tür zu dem seltsamen Haus auf, in dem es mir beschieden war, so viele Jahre zu bleiben, so viele Empfindungen zu kosten, von denen ich, ohne sie am eigenen Leib erlebt zu haben, unmöglich einen Begriff hätte haben können. Ich hatte mir z. B. unmöglich vorstellen können, dass es so schrecklich und qualvoll ist, die ganzen zehn Jahre meines Zuchthauslebens keine einzige Minute allein bleiben zu können. Bei der Arbeit war ich stets mit Begleitmannschaften, in der Kaserne – mit zweihundert Genossen, aber kein einziges Mal, niemals allein! Das ist übrigens nicht das Einzige, woran ich mich habe gewöhnen müssen!
Es gab hier Mörder aus Zufall und berufsmäßige Mörder, Räuber und Räuberhauptleute. Es gab einfache Gauner und Vagabunden, Spezialisten für die verschiedensten Verbrechen. Es gab auch solche, von denen man schwer entscheiden konnte, weshalb sie hergeraten waren. Dabei hatte aber ein jeder seine Geschichte, verworren und schwer wie ein Katzenjammer nach vorhergehendem Rausch. Im Allgemeinen sprachen sie über ihre Vergangenheit wenig, erzählten nicht gern und bemühten sich offenbar, an ihre Vergangenheit nicht zu denken. Ich kannte selbst unter den Mördern Leute, die so lustig waren und sich so wenig Gedanken machten, dass man wetten konnte, ihr Gewissen hätte sie noch niemals gemahnt. Es gab aber auch düstere, fast immer schweigsame Menschen. Von seinem Leben erzählte überhaupt fast niemand, und es war auch nicht üblich, sich dafür zu interessieren: Neugier war hier einfach nicht Mode. Es passierte höchstens einmal, dass einer, einfach um die Zeit totzuschlagen, etwas erzählte, und ein anderer ihm kaltblütig und düster zuhörte. Hier konnte niemand den anderen imponieren. »Wir sind erfahrene Menschen!« sagten sie oft mit einer eigentümlichen Selbstzufriedenheit. Ich erinnere mich, wie ein Räuber einmal im Rausch (es gab im Zuchthaus wohl die Möglichkeit, sich zu betrinken) zu erzählen begann, wie er einen fünfjährigen Jungen ermordet hatte; er hatte ihn vorher mit einem Spielzeug an sich gelockt, dann in einen leeren Schuppen verschleppt und dort abgeschlachtet. Die ganze Kaserne, die bis dahin über seine Scherze gelacht hatte, schrie wie ein Mann auf, und der Räuber musste verstummen; die Kaserne hatte nicht etwa aus Empörung geschrien, sondern nur, weil man »über solche Dinge« nicht reden durfte, weil es nicht Sitte war, »darüber« zu sprechen. Ich will bei dieser Gelegenheit bemerken, dass die Leute wirklich nicht ungelehrt waren, sogar im buchstäblichen und nicht nur übertragenen Sinn dieses Wortes. Sicher mehr als die Hälfte von ihnen verstand zu lesen und zu schreiben. An welchem anderen Ort, wo sich das russische Volk in großen Massen versammelt, könnte man darunter einen Haufen von zweihundertfünfzig Mann finden, von denen die Hälfte zu lesen verstünde? Später hörte ich, jemand hätte aus solchen Daten den Schluss gezogen, der Schulunterricht verderbe das Volk. Dies ist aber eine Täuschung. Es sind hier ganz andere Gründe im Spiel, obwohl es sich nicht leugnen lässt, dass die Schulbildung im Volk Selbstvertrauen zeitigt. Aber das ist durchaus kein Fehler. – Alle Kategorien wurden nach der Kleidung unterschieden. Bei den einen waren die Jacken zur Hälfte dunkelbraun und zur Hälfte grau, ebenso das eine Hosenbein grau und das andere dunkelbraun. Einmal bei der Arbeit betrachtete mich ein kleines Mädel, das den Arrestanten Semmeln feilbot, sehr lange und fing plötzlich zu lachen an. »Pfui, wie hässlich!« schrie sie auf: »Es hat weder graues, noch schwarzes Tuch gereicht!« Es gab auch solche, bei denen die ganze Jacke aus grauem Tuch war, aber mit dunkelbraunen Ärmeln. Auch die Köpfe wurden auf verschiedene Weise rasiert: bei den einen der Länge nach, bei den andern quer.
Auf den ersten Blick konnte man in dieser ganzen seltsamen Familie etwas auffallend Gemeinsames bemerken; selbst die ausgeprägtesten und originellsten Persönlichkeiten, die sich unwillkürlich von den anderen abhoben, gaben sich Mühe, aus dem allgemeinen Ton des ganzen Zuchthauses nicht herauszufallen. Ich will im Allgemeinen sagen, dass alle diese Leute, mit Ausnahme weniger unverwüstlich heiterer Menschen, die infolgedessen allgemeine Verachtung genossen, ein mürrisches, neidisches, furchtbar ehrgeiziges, prahlerisches, empfindliches und auf die äußeren Formen versessenes Volk waren. Die Fähigkeit, über nichts zu staunen, galt hier als die höchste Tugend. Alle hatten hier die fixe Idee, äußerlich Haltung zu wahren. Aber auch der hochmütigste Ausdruck veränderte sich gar nicht selten mit der Schnelligkeit des Blitzes in den kleinmütigsten. Es waren auch einige wirklich starke Naturen dabei, diese gaben sich einfach und natürlich. Aber seltsam! Unter diesen wahrhaft starken Naturen waren einige im höchsten Grad, fast bis zur Krankheit, ruhmsüchtig. Ruhmsucht und jede Äußerlichkeit standen überhaupt auf dem ersten Plan. Die Mehrzahl war außerordentlich verdorben und demoralisiert. Es gab ständig Klatsch und Intrigen; es war eine wahre Hölle. Aber niemand wagte, gegen die inneren Sitten und Gebräuche des Zuchthauses aufzubegehren; alle fügten sich ihnen. Es gab auch scharf ausgeprägte Charaktere, die sich nur mit der größten Anstrengung fügen konnten, sich aber schließlich doch fügten. Es kamen Leute ins Zuchthaus, die es in der Freiheit schon zu toll getrieben und alle Schranken überschritten hatten, sodass sie auch ihre Verbrechen zuletzt gleichsam unbewusst, wie im Rausch verübten, oft aus einer bis zum höchsten Grad gesteigerten Ruhmsucht. Bei uns wurden sie aber sofort zurechtgewiesen, obwohl manche von ihnen vor ihrer Ankunft im Zuchthaus der Schrecken ganzer Dörfer und Städte gewesen waren. Wenn so ein Neuling sich hier umsah, merkte er bald, dass dies nicht der richtige Ort zum Prahlen sei, dass er hier niemand imponieren könne; er demütigte sich allmählich und passte sich dem allgemeinen Ton an. Dieser allgemeine Ton bestand äußerlich aus einem besondern, eigentümlichen Selbstbewusstsein, von dem fast jeder Bewohner des Zuchthauses durchdrungen war; als wäre die Stellung eines verurteilten Zuchthäuslers in der Tat ein Ehrenamt. Keine Spur von Scham und Reue! Es gab übrigens auch eine gewisse, sozusagen offizielle Demut, ein ruhiges Sichbescheiden: »Wir sind verlorene Menschen«, pflegten sie zu sagen, »wir haben nicht verstanden, in Freiheit zu leben und müssen jetzt daher Spießruten laufen.« - »Wir haben auf Vater und Mutter nicht gehört, müssen jetzt auf das Trommelfell hören.« – »Wir wollten nicht mit Gold sticken, müssen jetzt dafür Steine klopfen.« - Dies alles wurde oft als eine Art Moralpredigt, und auch als eine Redensart gesagt, aber niemals ernsthaft. Es waren nur Worte. Kaum einer der Arrestanten gestand sich seine Ruchlosigkeit innerlich ein. Hätte jemand von den Zuchthäuslern versucht, einem andern Arrestanten sein Verbrechen vorzuwerfen, ihn deswegen zu schelten (obwohl es übrigens dem russischen Geist gar nicht entspräche, jemand sein Verbrechen vorzuwerfen), – so würde das Fluchen gar kein Ende nehmen. Was für Meister waren sie aber im Fluchen! Sie fluchten raffiniert, direkt künstlerisch. Das Fluchen war bei ihnen zu einer förmlichen Wissenschaft erhoben; man legte weniger Gewicht auf ein kränkendes Wort, als auf den kränkenden Sinn und Geist; so etwas wirkt aber immer raffinierter und giftiger. Die ewigen Streitigkeiten entwickelten diese Kunst noch mehr. Dieses ganze Volk arbeitete unter dem Stock, folglich war es im Grunde genommen müßig und demoralisiert; wenn einer nicht schon früher demoralisiert war, so wurde er es im Zuchthaus. Alle waren ja nicht nach freiem Willen hergekommen; alle waren einander fremd.
»Der Teufel hat drei Paar Bastschuhe aufgebraucht, ehe er uns alle zusammengebracht hat!« pflegten sie zu sagen, und darum standen Klatsch, Intrigen, Verleumdungen, Neid, Zwietracht und Hass im Vordergrund dieses Höllenlebens. Kein Weib war imstande, so sehr Weib zu sein, wie es manche von diesen Mördern waren. Ich wiederhole, es gab unter ihnen auch starke Charaktere, die gewohnt waren, ihr Leben lang Gewalt zu üben und zu befehlen, abgehärtete und furchtlose Menschen. Solche achtete man unwillkürlich, und sie selbst, wie stolz sie auch auf ihren Ruf waren, gaben sich im allgemeinen Mühe, den anderen nicht zur Last zu fallen; sie ließen sich nie in leere Streitigkeiten ein, benahmen sich mit ungewöhnlicher Würde, waren vernünftig und fast immer der Obrigkeit gehorsam, – nicht aus Prinzip, nicht aus Pflichtgefühl, sondern gleichsam auf Grund eines Vertrags, in der Erkenntnis des gegenseitigen Vorteils. Sie wurden übrigens mit Vorsicht behandelt. Ich erinnere mich noch, wie ein solcher Arrestant, ein furchtloser und zu allem fähiger Mensch, dessen tierische Neigungen der Obrigkeit bekannt waren, wegen irgendeines Verbrechens bestraft werden sollte. Es war an einem Sommertag, während der arbeitsfreien Zeit. Der Stabsoffizier, der nächste und unmittelbare Vorgesetzte des Zuchthauses, kam persönlich auf die Hauptwache, die sich dicht am Tore befand, um der Exekution beizuwohnen. Dieser Major war für die Arrestanten ein seltsam fatales Wesen; er hatte sie so weit gebracht, dass sie vor ihm zitterten. Er war wahnsinnig streng und »stürzte sich über die Menschen«, wie die Zuchthäusler zu sagen pflegten. Am meisten fürchteten sie seinen durchdringenden Luchsblick, dem nichts entging. Er sah alles ohne hinzuschauen. Beim Betreten des Zuchthauses wusste er schon immer, was am anderen Ende desselben los war. Die Arrestanten nannten ihn den »Achtäugigen«. Sein System war aber falsch. Er erbitterte nur die schon ohnehin erbitterten Menschen durch seine rasenden, bösen Handlungen, und wenn er nicht den Kommandanten, einen edlen und verständigen Menschen, der seine wilden Ausbrüche zuweilen milderte, über sich hätte, so hätte er mit seinem Regiment viel Unheil angerichtet. Ich begreife nicht, wie ihm alles so glücklich hat ablaufen können; er hat den Dienst quittiert und ist noch frisch und gesund, obwohl er sich übrigens vor Gericht zu verantworten hatte.
Der Arrestant erbleichte, als man ihn rief. Gewöhnlich legte er sich schweigend und tapfer auf die Bank, empfing stumm die Rutensttafe, erhob sich nach derselben wie aus dem Schlaf erwacht und betrachtete sein Missgeschick kaltblütig und philosophisch. Man behandelte ihn übrigens immer vorsichtig. Aber diesmal hielt er sich aus irgendeinem Grunde für unschuldig. Er erbleichte und brachte es fertig, sich unbemerkt vom Wachsoldaten ein scharfes englisches Schuhmachermesser in den Ärmel zu stecken. Messer und alle scharfen Instrumente waren im Zuchthause strengstens verboten. Durchsuchungen fanden häufig und unerwartet statt, sie waren immer sehr gründlich und die Strafen grausam; da es aber immer schwer ist, bei einem Dieb etwas zu finden, was er verstecken will, und da die Messer und Instrumente im Zuchthaus zu den notwendigsten Gegenständen gehörten, so waren sie trotz der Durchsuchungen nicht auszurotten. Und wenn man einem eins abnahm, so schaffte er sich bald ein neues an. Das ganze Zuchthaus stürzte zum Zaun und blickte mit stockendem Herzen durch die Pfähle. Alle wussten, dass Petrow sich diesmal der Rutenstrafe nicht unterziehen wollen würde und dass dem Major das Ende winke. Aber unser Major setzte sich im letzten Augenblick in den Wagen und fuhr davon, nachdem er den Vollzug der Exekution einem anderen Offizier übertragen hatte. »Gott selbst hat ihn gerettet!« sagten nachher die Arrestanten. Und was Petrow betrifft, so ließ er sich die Strafe mit der größten Ruhe gefallen. Seine Wut war mit der Abfahrt des Majors verpufft. Der Arrestant ist bis zu einem gewissen Grade gehorsam und gefügig, aber es gibt eine Grenze, die man niemals überschreiten darf. Es gibt übrigens nichts Interessanteres als solche seltsamen Ausbrüche von Trotz und Widersetzlichkeit. Ein Mensch lässt sich oft mehrere Jahre lang alles gefallen, er demütigt sich und erduldet die grausamsten Strafen, bricht aber plötzlich bei irgendeiner Kleinigkeit, einer Bagatelle, eines nichtigen Anlasses wegen los. Ich glaube, man kann ihn sogar für verrückt ansehen, und das tut man auch.
Wie ich schon sagte, habe ich im Lauf mehrerer Jahre unter allen diesen Menschen nicht das geringste Anzeichen von Reue, nicht den leisesten schweren Gedanken über das verübte Verbrechen wahrgenommen, und die Mehrzahl von ihnen hielt sich innerlich vollkommen im Recht. Das ist eine Tatsache. Natürlich sind Prahlsucht, schlechte Beispiele, falsche Scham in vielen Fällen die Ursache davon. Andererseits aber: Wer darf sagen, dass er die Tiefe dieser verlorenen Herzen erforscht und in ihnen das vor der ganzen Welt Verborgene gelesen hätte? Man könnte jedoch immerhin im Laufe so vieler Jahre wenigstens etwas bemerken, in diesen Herzen wenigstens einen Zug wahrnehmen und entdecken, der von einem inneren Schmerz und Leiden zeugte. Aber das war nicht der Fall, ganz bestimmt nicht. Ja, es ist wohl unmöglich, ein Verbrechen von einem fertigen, gegebenen Standpunkt aus zu begreifen, und seine Philosophie ist wohl etwas schwieriger als man annimmt. Die Zuchthäuser und das System der Zwangsarbeit bessern die Verbrecher natürlich nicht; sie strafen sie nur und schützen die Gesellschaft vor ferneren Attentaten des Verbrechers auf ihre Sicherheit. Aber im Verbrecher selbst wecken das Zuchthaus und die schwerste Zwangsarbeit nur einen Hass, eine Gier nach verbotenen Genüssen und einen furchtbaren Leichtsinn. Doch ich bin fest überzeugt, dass auch mit dem berühmten Zellensystem nur ein falsches, trügerisches, äußerliches Ziel erreicht wird. Es saugt aus dem Menschen seine Lebenskräfte heraus, es enerviert seine Seele, es schwächt und erschreckt sie und stellt dann die ausgetrocknete Mumie, den Halbverrückten als ein Muster der Besserung und der Reue hin. Der Verbrecher, der sich gegen die Gesellschaft erhoben hat, hasst sie natürlich und hält sich fast immer für unschuldig, sie aber für schuldig. Zudem hat er von ihr schon eine Strafe empfangen und sieht sich aus diesem Grund für geläutert und quitt an. Man kann die Sache schließlich auch von solchen Gesichtspunkten ansehen, dass man den Verbrecher selbst beinahe rechtfertigen müsste. Aber trotz der verschiedenen Gesichtspunkte wird jeder zugeben, dass es solche Verbrechen gibt, die immer und überall, nach allen bestehenden Gesetzen seit der Erschaffung der Welt als zweifellose Verbrechen galten und als solche gelten werden, solange der Mensch ein Mensch bleibt. Nur im Zuchthaus hörte ich Berichte über die schrecklichsten, widernatürlichsten Handlungen, über die ungeheuerlichsten Morde, die man mit dem unbefangensten, kindlich heitersten Lachen wiedergab. Besonders will mir ein Vatermörder nicht aus dem Sinn. Er war adliger Abstammung, hatte gedient und war bei seinem sechzigjährigen Vater eine Art verlorener Sohn gewesen. Er hatte ein äußerst ausschweifendes Leben geführt und bis an den Hals in Schulden gesteckt. Der Vater versuchte ihn zu zügeln und zu ermahnen; aber der Vater besaß ein Haus und ein Gut, man vermutete bei ihm auch Bargeld, und der Sohn ermordete den Vater, um ihn zu beerben. Das Verbrechen war erst nach einem Monat aufgedeckt worden. Der Mörder selbst hatte bei der Polizei Anzeige erstattet, dass sein Vater spurlos verschwunden sei. Diesen ganzen Monat verlebte er auf die liederlichste Weise. Endlich fand die Polizei in seiner Abwesenheit die Leiche des Ermordeten. Auf seinem Hof befand sich ein mit Brettern überdeckter Graben, der zum Abfluss der Fäkalien diente. Die Leiche lag in diesem Graben. Sie war bekleidet und gewaschen, der abgeschnittene ergraute Kopf war an den Rumpf angesetzt und ruhte auf einem Kissen. Der Mörder gestand nicht; er wurde der Adelsrechte und seiner Titel für verlustig erklärt und zu zwanzig Jahren Zwangsarbeit verbannt. Die ganze Zeit, in der ich mit ihm zusammen war, war er in der besten und heitersten Gemütsverfassung. Er war ein im höchsten Grad überspannter, leichtsinniger und unvernünftiger Mensch, aber gar nicht dumm. Ich konnte an ihm niemals irgendeine besondere Grausamkeit bemerken. Die Arrestanten verachteten ihn, aber nicht seines Verbrechens wegen, welches überhaupt niemals erwähnt wurde, sondern wegen seines dummen Gebarens und weil er sich nicht zu benehmen verstand. In den Gesprächen erwähnte er zuweilen seinen Vater. Als er mit mir einmal über die kräftige Konstitution, die in seiner Familie erblich sei, sprach, fügte er hinzu: »Auch mein Erzeuger hat sich bis zu seinem Tod nie über irgendeine Krankheit beklagt.« Eine solche tierische Gefühllosigkeit ist natürlich unmöglich. Sie ist ein Phänomen, und hier liegt irgendein organischer Fehler, irgendein körperlicher und sittlicher, der Wissenschaft noch unbekannter Defekt, aber kein gewöhnliches Verbrechen vor. Ich glaubte an dieses Verbrechen natürlich nicht; aber Leute aus seiner Stadt, die alle Einzelheiten seiner Geschichte kennen mussten, bestätigten mir die ganze Sache. Die Tatsachen waren so klar, dass es unmöglich war, daran nicht zu glauben.
Die Arrestanten hörten einmal nachts, wie er im Schlaf schrie: »Halt ihn, halt! Hau ihm den Kopf ab, den Kopf, den Kopf! ... «
Fast alle Arrestanten sprachen und phantasierten im Schlaf. Am häufigsten kamen ihnen dabei Schimpfworte, Diebesausdrücke, Messer und Beile über die Lippen. »Wir sind ein geschlagenes Volk«, pflegten sie zu sagen, »unser ganzes Inneres ist zerschlagen, darum schreien wir auch des Nachts.«
Die staatliche Zwangsarbeit war keine Beschäftigung, sondern eine Pflicht: der Arrestant erledigte die ihm aufgegebene Arbeit oder absolvierte die vorgeschriebenen Arbeitsstunden und kam wieder ins Zuchthaus. Die Arbeit betrachtete man mit Hass. Ohne seine eigene Privatbeschäftigung, der er mit ganzer Seele und allen seinen Gedanken ergeben war, hätte ein Mensch im Zuchthaus überhaupt nicht leben können. Wie hätte auch dieses ganze verhältnismäßig zivilisierte Volk, das zügellos gelebt hatte und nach dem Leben lechzte, das gewaltsam von der Gesellschaft und vom normalen Leben losgerissen und hier zu einem Haufen zusammengeworfen war, sich normal und regelrecht, nach seinem Willen und seiner Lust einleben können! Schon infolge des Müßigganges allein müssten hier solche verbrecherische Neigungen zur Entwicklung kommen, von denen sie früher keine Ahnung hatten. Ohne Arbeit und ohne ein gesetzlich erlaubtes, normales Eigentum kann der Mensch nicht leben und sinkt zu einem Tier herab. Darum hatte ein jeder von den Zuchthäuslern infolge eines natürlichen Bedürfnisses und eines gewissen Selbsterhaltungstriebs sein eigenes Handwerk und seine eigene Beschäftigung. Der lange Sommertag war fast ganz mit Zwangsarbeit ausgefüllt, und in der kurzen Sommernacht konnte man kaum ausschlafen. Aber im Winter musste der Arrestant nach den Vorschriften mit Einbruch der Dunkelheit im Zuchthaus eingesperrt sein. Was sollte er nun in den langen, langweiligen Stunden des Winterabends treiben? Darum verwandelte sich fast jede Kaserne trotz des Verbots in eine große Werkstätte. Arbeit und Beschäftigung an sich waren nicht verboten, streng verboten war aber der Besitz von Werkzeugen jeder Art, und ohne Werkzeuge war natürlich jede Arbeit unmöglich. Man arbeitete aber heimlich, und die Obrigkeit schien manchmal ein Auge zuzudrücken. Viele Arrestanten kamen ins Zuchthaus, ohne irgendwelche Kenntnisse, lernten aber von den andern und gingen später als tüchtige Handwerker in die Freiheit. Es gab hier Schuster, Schuhmacher, Schneider, Tischler, Schlosser, Graveure und Vergolder. Ein Jude, Issaj Bumstein, war Juwelier und zugleich Wucherer. Alle arbeiteten und verdienten ein paar Kopeken. Die Aufträge kamen aus der Stadt. Geld bedeutet doch geprägte Freiheit und hat darum für einen jeder Freiheit beraubten Menschen den zehnfachen Wert. Wenn nur einige Münzen in seiner Tasche klimpern, so ist er schon halb getröstet, selbst wenn er keine Möglichkeit hat, das Geld auszugeben. Geld kann man aber immer und überall ausgeben, um so mehr, als die verbotene Frucht doppelt so süß ist. Im Zuchthaus konnte man sich auch Branntwein verschaffen. Pfeifen waren strengstens verboten, und doch rauchten alle. Das Geld und der Tabak schützten vor Skorbut und anderen Krankheiten. Die Arbeit schützte aber vor Verbrechen. Ohne Arbeit würden die Arrestanten einander aufgefressen haben wie in einem Glas eingeschlossene Spinnen. Trotzdem war aber die Arbeit wie auch der Besitz von Geld verboten. Oft wurden in der Nacht plötzliche Durchsuchungen vorgenommen, wobei man alles Verbotene konfiszierte; wie sorgfältig die Arrestanten das Geld auch verwahrten, es fiel doch oft den Schergen in die Hände. Das ist zum Teil der Grund dafür, dass man das Geld nicht sparte, sondern schnell vertrank; darum gab es auch im Zuchthaus Branntwein. Nach jeder Durchsuchung verlor der Schuldige nicht nur seinen ganzen Besitz, sondern wurde gewöhnlich auch empfindlich bestraft. Aber nach jeder Durchsuchung wurden die Mängel wieder ersetzt, sofort neue Sachen angeschafft, und alles war wieder beim Alten. Die Obrigkeit wusste es wohl, und die Sträflinge murrten auch nicht über die Strafen, obwohl dieses Leben dem von Ansiedlern auf dem Vesuv glich.
Wer kein Handwerk verstand, trieb andere Geschäfte. Es gab recht originelle Gewerbsarten. Manche lebten z. B. vom Zwischenhandel allein, wobei zuweilen solehe Gegenstände zum Verkauf kamen, die außerhalb des Zuchthauses kaum jemand gekauft oder verkauft oder überhaupt für Gegenstände gehalten hätte. Aber die Zuchthausbevölkerung war sehr arm und außerordentlich betriebsam. Der letzte Lumpen hatte seinen Wert und fand irgendeine Verwendung. Infolge dieser Armut hatte das Geld im Zuchthaus einen ganz anderen Wert als in der Freiheit. Eine große und komplizierte Arbeit wurde mit wenigen Kupfermünzen bezahlt. Viele betrieben mit Erfolg Wucher. Ein Arrestant, der sich ruiniert hatte, brachte seine letzten Sachen dem Wucherer und bekam von ihm einige Kupfermünzen gegen ungeheure Zinsen. Wenn er die Sachen zum Termin nicht einlöste, so wurden sie unverzüglich und unbarmherzig verkauft; der Wucher stand in solcher Blüte, dass selbst staatliches Eigentum als Pfand angenommen wurde, wie die dem Zuchthaus gehörenden Wäschestücke, Stiefel und ähnliche Gegenstände, die der Arrestant jeden Augenblick brauchte. Aber bei solchen Pfändern nahm die Sache manchmal eine andere, übrigens nicht ganz unerwartete Wendung. Der Arrestant, der etwas von diesen Sachen versetzt und dafür Geld bekommen hatte, ging unverzüglich ohne weiteres zum ältesten Unteroffizier, dem nächsten Vorgesetzten im Zuchthaus und meldete von der Verpfändung des Staatseigentums, welches dem Wucherer sofort, selbst ohne Meldung an die höhere Behörde, abgenommen wurde. Es ist bezeichnend, dass sich so etwas zuweilen ohne jeden Streit abspielte. Der Wucherer gab die Sachen schweigend mit mürrischer Miene heraus und schien diese Wendung sogar erwartet zu haben. Vielleicht musste er sich eingestehen, dass er an Stelle des Verpfänders ebenso gehandelt hätte. Wenn er daher zuweilen nachträglich schimpfte, so tat er es ohne jede Bosheit, sondern eher um einer Pflicht zu genügen.
Im Allgemeinen bestahl man hier einander entsetzlich. Fast jeder besaß seinen Kasten mit einem Schloss zur Verwahrung der ihm von der Verwaltung gelieferten Sachen. Das war gestattet, aber die Koffer boten keinen Schutz. Man kann sich wohl denken, was es für geschickte Diebe im Zuchthaus gab. Mir stahl einmal ein Arrestant, ein mir aufrichtig ergebener Mensch (ich sage das ohne Übertreibung), meine Bibel, das einzige Buch, das man im Zuchthaus besitzen durfte; er selbst gestand es mir am gleichen Tag, doch nicht aus Reue, sondern aus Mitleid mit mir, weil ich sie lange suchte. Es gab auch Schankwirte, die mit Branntwein handelten und sich schnell bereicherten. Über diesen Handelszweig will ich später ausführlicher sprechen; er ist recht bemerkenswert. Es gab im Zuchthaus viele ehemalige Schmuggler, und es ist darum nicht zu verwundern, dass trotz aller Durchsuchungen und der strengen Bewachung ins Zuchthaus Branntwein eingeschmuggelt wurde. Der Schmuggel ist übrigens seinem Charakter nach ein ganz eigentümliches Verbrechen. Wird man mir z. B. glauben wollen, dass das Geld und der Gewinn beim Schmuggler zuweilen eine untergeordnete Rolle spielen und erst in zweiter Linie in Betracht kommen? Und doch ist es manchmal so. Der Schmuggler arbeitet aus Leidenschaft, aus Beruf. Er ist zum Teil Dichter. Er riskiert alles, setzt sich furchtbaren Gefahren aus, wendet List an, ist erfinderisch und zieht sich oft aus der Schlinge; manchmal handelt er aus einer Art Intuition. Diese Leidenschaft ist ebenso stark wie die des Kartenspiels. Ich kannte im Zuchthaus einen Arrestanten, einen riesenhaften Kerl, der so sanft, still und bescheiden war, dass man sich gar nicht vorstellen konnte, wie er ins Zuchthaus geraten sein mochte. Er war dermaßen gutmütig und verträglich, dass er während seines ganzen Aufenthaltes im Zuchthaus keinen einzigen Streit gehabt hat. Er stammte aber von der westlichen Grenze des Reichs, war wegen Schmuggels ins Zuchthaus geraten und konnte sich natürlich auch hier nicht beherrschen und verlegte sich auf den Branntweinschmuggel. Wie oft wurde er deswegen bestraft und wie sehr fürchtete er die Ruten! Der Branntweinschmuggel brachte ihm übrigens sehr wenig ein. Am Branntwein bereicherte sich nur der Ausschankbesitzer. Der Kauz liebte die Kunst um der Kunst willen. Er war wie ein Weib zum Weinen aufgelegt und schwor nach jeder Bestrafung, nicht wieder Schmuggel zu treiben. Mit großem Mut beherrschte er sich zuweilen einen ganzen Monat lang, hielt es aber dann doch nicht aus ... Dank solchen Leuten ging der Branntwein im Zuchthaus nie aus ...
Es gab schließlich noch eine Einkunftsquelle, die die Sträflinge zwar nicht bereicherte, ihnen aber ständige und wohltätige Einnahmen sicherte: Das Almosen. Unsere höheren Gesellschaftsschichten haben gar keine Vorstellung davon, wie sehr die Kaufleute, die Kleinbürger und unser ganzes Volk sich um die »Unglücklichen« sorgen. Die milden Gaben laufen fast ununterbrochen ein, meistens in Form von Brot, Semmeln und Brezeln und sehr viel seltener in barem Geld. Ohne diese Gaben hätten es die Arrestanten, besonders die unter Anklage stehenden, die viel strenger als die anderen gehalten werden, an vielen Orten allzu schwer. Die milden Gaben werden von den Arrestanten mit religiöser Gewissenhaftigkeit zu gleichen Teilen geteilt. Wenn es nicht für alle langte, so wurden die Semmeln in gleiche Teile geschnitten, manchmal sogar jede in sechs Teile, und jeder Arrestant bekam unbedingt sein Stück. Ich erinnere mich noch, wie ich zum ersten Mal eine Geldgabe erhielt. Es war bald nach meiner Ankunft im Zuchthaus. Ich kehrte allein mit dem Wachsoldaten von der Morgenarbeit zurück. Mir entgegen kamen eine Mutter mit einer Tochter, einer zehnjährigen Kleinen, so hübsch wie ein Engelchen. Ich hatte die beiden schon einmal gesehen. Die Mutter war eine Soldatenwitwe. Ihr Mann, ein junger Soldat, war vors Gericht gekommen und im Hospital, im Arrestantensaale, in der gleichen Zeit gestorben, als ich dort krank lag. Die Frau und die Tochter waren hingekommen, um von der Leiche Abschied zu nehmen, und hatten beide furchtbar geweint. Als die Kleine mich nun erblickte, errötete sie und flüsterte der Mutter etwas zu; jene blieb sofort stehen, knüpfte ihr Taschentuch auf, entnahm eine Viertelkopeke und gab sie der Kleinen. Diese lief mir nach ... – »Da, Unglücklicher, nimm um Christi willen die Kopeke!« schrie sie, mich einholend und mir die Münze in die Hand drückend. Ich nahm die Münze, und das Kind kehrte vollkommen befriedigt zur Mutter zurück. Diese Viertelkopeke habe ich noch lange aufbewahrt.
II
Die ersten Eindrücke
Der erste Monat und überhaupt der Anfang meines Zuchthauslebens stehen mir lebhaft in Erinnerung. Die folgenden Tage meines Zuchthauslebens schweben in meiner Erinnerung nicht so deutlich. Manche Tage sind gleichsam gänzlich verwischt und zusammengeflossen und haben nur einen einzigen Eindruck hinterlassen: einen schweren, eintönigen, erstickenden.
Aber alles, was ich in den ersten Tagen meines Zuchthauslebens durchgemacht habe, erscheint mir jetzt so, als wäre es erst gestern geschehen. Und so muss es wohl auch sein.
Ich besinne mich deutlich, wie ich gleich beim ersten Schritt auf diesem Weg darüber staunte, dass ich darin gar nichts besonders Erstaunliches, Ungewöhnliches oder, genauer gesagt, Unerwartetes fand. Alles hatte mir gleichsam schon früher vorgeschwebt, als ich auf dem Weg nach Sibirien mich bemühte, das mir bevorstehende Los zu erraten. Bald stieß ich aber bei jedem Schritt auf eine Menge der seltsamsten und unerwartetsten Dinge, auf eine Menge ungeheuerlicher Tatsachen. Erst viel später, als ich eine recht lange Zeit im Zuchthaus verbracht hatte, erfasste ich vollkommen die ganze Ausschließlichkeit, die Eigenart dieser Existenz und musste über sie immer mehr und mehr staunen. Ich gestehe, dass dieses Erstaunen mich während der ganzen langen Frist meiner Strafe begleitete; ich konnte mich mit ihm niemals ganz abfinden.
Mein erster Eindruck beim Eintritt ins Zuchthaus war im Allgemeinen der denkbar abstoßendste; aber trotzdem erschien mir das Leben im Zuchthaus seltsamerweise viel leichter, als ich es mir unterwegs vorgestellt hatte. Die Arrestanten bewegten sich, wenn auch in Ketten, frei im ganzen Zuchthause, sie fluchten, sangen Lieder, arbeiteten für sich, rauchten Pfeifen und tranken sogar (allerdings nur wenige von ihnen) Branntwein; nachts spielten sie aber Karten. Die Arbeit selbst erschien mir beispielsweise gar nicht so schwer, wie ich es von der berühmten »sibirischen Zwangsarbeit« erwartete, und ich kam erst recht spät dahinter, dass die Schwere dieser Arbeit weniger in ihrer Schwierigkeit und ihrer ununterbrochenen Dauer bestand, als darin, dass sie erzwungen, obligatorisch, unter dem Stocke war. Der freie Bauer arbeitet vielleicht unvergleichlich mehr, er arbeitet zuweilen auch nachts, besonders im Sommer; aber er arbeitet für sich, arbeitet mit einem vernünftigen Ziel und hat es infolgedessen unvergleichlich leichter als der Zuchthäusler mit seiner erzwungenen und für ihn vollkommen zwecklosen Arbeit. Mir kam einmal dieser Gedanke: Wenn man einen Menschen vollkommen erdrücken und vernichten, einer so entsetzlichen Strafe unterziehen will, dass vor ihr selbst der grausamste Mörder erbebte und sie schon im Voraus fürchtete, so braucht man nur seiner Arbeit den Charakter vollkommener Zwecklosigkeit und Sinnlosigkeit zu verleihen. Wenn die jetzige Zwangsarbeit für den Zuchthäusler auch uninteressant und langweilig ist, so ist sie doch an sich, als Arbeit vernünftig, der Arrestant stellt Ziegelsteine her, gräbt Erde um, baut und mauert; in dieser Arbeit liegt ein Sinn und ein Zweck. Aber wenn man ihn z. B. zwingen wollte, Wasser aus einem Kübel in einen anderen zu gießen und dann wieder in den ersten zurückzugießen, oder Sand zu stoßen, oder einen Haufen Erde von einem Ort an den anderen zu schleppen und dann wieder zurückzuschleppen, so würde sich der Arrestant, glaube ich, schon nach einigen Tagen erhängen oder tausend Verbrechen begehen, um sich wenigstens durch den Tod von dieser Erniedrigung, Schmach und Qual zu befreien. Eine solche Strafe würde natürlich zu einer Tortur, zu einem Racheakt werden und wäre sinnlos, weil dadurch kein vernünftiges Ziel erreicht wäre. Da aber eine solche Tortur, Sinnlosigkeit, Erniedrigung und Schmach zum Teil unbedingt auch in jeder erzwungenen Arbeit liegt, so ist die Zwangsarbeit unvergleichlich qualvoller als jede freie Arbeit, eben deshalb, weil sie eine erzwungene ist.
Ich trat übrigens ins Zuchthaus im Winter, im Dezember, ein und hatte zunächst keine Ahnung von der fünfmal schwereren Sommerarbeit. Im Winter gab es in unserer Festung überhaupt wenig ärarische Arbeit. Die Arrestanten gingen zum Irtyschufer, um alte, dem Staat gehörende Barken abzubrechen, arbeiteten in den Werkstätten, schaufelten vor den Amtsgebäuden den Schnee, den die Stürme anwehten, brannten und stießen Alabaster usw. Ein Wintertag war kurz; die Arbeit war schnell erledigt, und alle unsere Leute kehrten früh ins Zuchthaus zurück, wo fast nichts zu tun wäre, wenn sie nicht irgendwelche eigene Arbeit hätten. Mit eigener Arbeit befasste sich aber vielleicht nur ein Drittel aller Arrestanten; die übrigen taten aber nichts, trieben sich ohne jedes Ziel in allen Kasernen des Zuchthauses herum, fluchten, intrigierten, machten Radau und betranken sich, wenn sie zufällig Geld hatten; nachts verspielten sie beim Kartenspiel das letzte Hemd; alles aus Langeweile, Müßiggang und Nichtstun. In der Folge begriff ich, dass das Zuchthausleben außer der Freiheitsberaubung und der erzwungenen Arbeit noch eine andere Qual enthielt, die vielleicht noch unerträglicher war als alle anderen. Das ist das erzwungene allgemeine Zusammenleben. Solch ein Zusammenleben gibt es natürlich auch an anderen Orten, aber ins Zuchthaus kommen doch solche Leute, dass nicht jedermann Lust hat, mit ihnen zusammenzuleben, und ich bin überzeugt, dass jeder Zuchthäusler diese Qual empfand, wenn auch natürlich in den meisten Fällen unbewusst.
Die Verpflegung erschien mir ziemlich reichlich. Die Arrestanten behaupteten, dass es in den Strafkompanien im Europäischen Russland kein solches Essen gäbe. Darüber vermag ich nicht zu urteilen, denn ich bin dort nicht gewesen. Außerdem hatten viele die Möglichkeit, sich selbst zu verpflegen. Fleisch kostete bei uns eine halbe Kopeke das Pfund, im Sommer drei Kopeken. Eigenes Essen hatten aber nur die, die ständig über Geld verfügten; die meisten Zuchthäusler aßen Kommiss. Wenn die Arrestanten ihr Essen lobten, sprachen sie übrigens nur vom Brot allein und segneten die Einrichtung, dass das Brot allen gemeinsam und nicht jedem einzelnen nach Gewicht ausgegeben wurde. Vor dem letzteren System hatten sie ein Grauen, denn bei der Brotausgabe nach Gewicht blieb ein Drittel der Menschen hungrig, während bei der Selbstverteilung alle satt wurden. Unser Brot war besonders schmackhaft und wurde deswegen in der ganzen Stadt geschätzt. Man schrieb dies der guten Einrichtung der Backöfen im Zuchthause zu. Die Kohlsuppe war aber gar nicht berühmt. Sie wurde in einem gemeinsamen Kessel gekocht und mit Graupen versetzt und war, besonders an Wochentagen, dünn und mager. Mich erschreckte an ihr die große Menge der in ihr schwimmenden Schabenkäfer. Die Arrestanten schenkten aber dem nicht die geringste Beachtung.
In den ersten drei Tagen ging ich noch nicht zur Arbeit; so verfuhr man mit jedem Neuankömmling, damit er nach der Reise ausruhe. Aber am zweiten Tag musste ich das Zuchthaus verlassen, um neue Fesseln angelegt zu bekommen. Meine Fesseln waren nicht die vorschriftsmäßigen, sondern bestanden aus Ringen; die Arrestanten nannten sie »feines Geläute«. Sie wurden außen über den Kleidern getragen. Aber die vorschriftsmäßigen, für die Arbeit geeigneten Fesseln bestanden nicht aus Ringen, sondern aus vier eisernen, fast fingerdicken Stangen, die miteinander durch drei Ringe verbunden waren. Sie wurden unter den Beinkleidern getragen. An den Mittelring wurde ein Riemen gebunden, der seinerseits an den Gürtelriemen befestigt wurde, den man direkt über dem Hemd trug.
Ich erinnere mich noch an meinen ersten Morgen im Zuchthaus. In der Wache am Zuchthaustor schlug die Trommel Reveille, und der wachhabende Unteroffizier fing nach etwa zehn Minuten an, die Kasernen aufzuschließen. Die Arrestanten erwachten. Sie standen beim trüben Schein eines Talglichtes, vor Kälte zitternd, von ihren Pritschen auf. Die meisten waren schweigsam und mürrisch vom Schlaf. Sie gähnten, reckten sich und runzelten ihre gebrandmarkten Stirnen. Die einen bekreuzigten sich, andere begannen Streit. Die Luft war entsetzlich stickig. Sobald die Tür aufgemacht wurde, drang frische Winterluft ein und zog mit Dampfwolken durch die Kaserne. Die Arrestanten drängten sich um die Wassereimer; sie ergriffen einer nach dem anderen die Schöpfkelle, nahmen den Mund voll Wasser und wuschen sich Gesicht und Hände aus dem Munde. Das Wasser wurde schon am vorhergehenden Abend vom »Paraschnik« vorbereitet. In jeder Kaserne gab es nach dem Statut einen von allen Insassen gewählten Arrestanten, der den Stubendienst in der Kaserne hatte. Er hieß »Paraschnik« und war von anderer Arbeit befreit. Er hatte auf die Reinlichkeit in der Kaserne zu sehen, die Pritschen und die Fußböden zu waschen und zu scheuem, den Nachtkübel zu bringen und hinauszuschaffen und zwei Eimer frisches Wasser zu besorgen, des Morgens zum Waschen und am Tag zum Trinken. Wegen der Schöpfkelle, die in nur einem Stück vorhanden war, entstand sofort Streit.
»Was drängst du dich vor, du aussätziger Kopf!« brummte ein mürrischer, hagerer, großgewachsener Arrestant mit dunklem Gesicht und seltsamen Beulen auf seinem rasierten Schädel, indem er einen andern wegstieß, der dick und klein war und ein lustiges rotes Gesicht hatte. »Halt!« – »Was schreist du! Für das >Halt< zahlt man bei uns Geld. Scher dich! Was reckst du dich wie ein Monument! Es ist nicht die geringste Fortikularität in ihm, Brüder.« – Die »Fortikularität« machte einigen Effekt: viele begannen zu lachen. Der lustige Dicke, der in der Kaserne wohl eine Art freiwilliger Hanswurst war, hatte nur das gewollt. Der lange Arrestant sah ihn mit tiefster Verachtung an. »Rindvieh!« sagte er wie vor sich hin. »Wie er sich mit dem Zuchthausbrot gemästet hat. Ist wohl froh, dass er zu Ostern zwölf Ferkel werfen wird.«
Der Dicke wurde endlich böse. »Was bist du denn für ein Vogel?« rief er aus, plötzlich errötend.
»Das ist es eben: Ein Vogel!«
»Was für einer?«
»So einer.«
»Ja, was für einer?«
»Mit einem Wort, ein Vogel.«
»Aber was für einer?«
Die beiden durchbohrten einander mit den Blicken. Der Dicke wartete auf Antwort und ballte die Fäuste, als wollte er sofort raufen. Ich dachte, dass gleich wirklich eine Schlägerei beginnen würde. Für mich war das alles neu, und ich sah interessiert zu. Später erfuhr ich, dass ähnliche Auftritte durchaus harmlos waren und mehr als Komödie zum allgemeinen Ergötzen gespielt wurden; zu einer Schlägerei kam es fast nie. Dies alles war für die Sitten des Zuchthauses sehr bezeichnend und charakteristisch.
Der lange Arrestant stand ruhig und majestätisch da. Er fühlte, dass alle ihn ansahen und warteten, ob er sich mit seiner Antwort blamieren würde oder nicht; dass er seine Haltung wahren und beweisen müsse, dass er tatsächlich ein Vogel sei, und zwar was für einer. Er schielte seinen Gegner mit unsagbarer Verachtung an und bemühte sich, um ihn noch mehr zu verletzen, ihn über die Schulter, von oben herab, anzublicken, als betrachtete er ein winziges Käferchen. Dann sagte er langsam und deutlich: »Ein Enterich! ...«
Das heißt, dass er Enterich sei. Eine laute Lachsalve belohnte die Findigkeit des Arrestanten.
»Du bist ein Schuft und kein Enterich!« brüllte der Dicke, da er sich in allen Punkten geschlagen fühlte und die äußerste Grenze der Wut erreicht hatte.
Kaum hatte aber der Streit eine ernste Wendung angenommen, als man die beiden Kerle sofort zur Vernunft brachte.
»Was macht ihr für Skandal!« schrie ihnen die ganze Kaserne zu.
»Rauft doch lieber statt zu schreien!« rief jemand aus der Ecke.





























