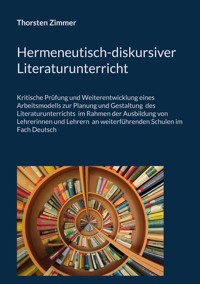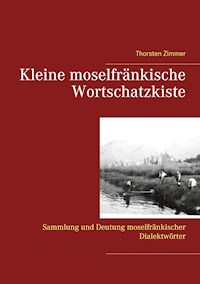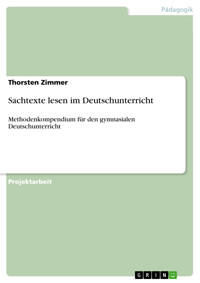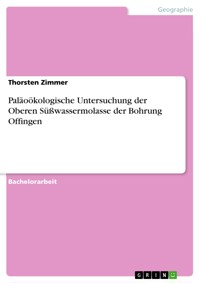Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Materialsammlung orientiert sich an den Inhalten und der Struktur der Lehrerausbildung am Studienseminar für das Lehramt an Gymnasium in Koblenz. Nach einem Intensivkurs über grundsätzliche Zugänge zur Planung und Durchführung des Deutschunterrichts werden einzelne Standardsituationen des Unterrichts in den Blick genommen. Ausführlich werden anschließend didaktische und methodische Hinweise zu den einzelnen Kompetenzbereichen des Deutschunterrichts gegeben. So begleitet das Buch die Ausbildung und versteht sich als übersichtliches Kompendium zur Begleitung der zweiten Ausbildungsphase.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Intensivphase
Grundlagen gelungenen Deutschunterrichts
1.
Grundlagen: Was ist „guter Deutschunterricht am Gymnasium?“
1.1. Was bedeutet
Gymnasium
?
1.2. Was bedeutet
Deutschunterricht
?
1.3. Was bedeutet
guter Unterricht
?
1.4. Guter Deutschunterricht am Gymnasium – Ein erstes Modell
2.
Unterrichtsinhalte, Lernziele und Kompetenzen – Grundlagenbegriffe
2.1. Lehrpläne, Bildungsstandards, Arbeitspläne
2.2. Ziele und Kompetenzen
2.3. Die Anspruchsprogression
3.
Hermeneutisch-diskursiver Deutschunterricht: Ein Modell
3.1. Der Anspruch des Modells
3.2. Hermeneutisch-diskursiver Deutschunterricht
3.3. Theorieanbindung
3.4. Momente gelungenen gymnasialen Deutschunterrichts nach dem Modell
Eine Stunde planen
1.
Ein Grundmodell zur Planung einer Unterrichtsstunde
2.
Prozessphasen des Unterrichts
2.1. Phasenmodelle
2.2. Katalog möglicher Phasen eines Unterrichtsprozesses
2.3. Ein einfacher Stundenaufbau
2.4. Modellhafte Stundenverläufe für verschiedene Kompetenzbereiche
2.5. Beobachtungsbogen
3.
Materialien, Lehrerrolle und Sozialform
4.
Eine eigene Stunde planen
5.
Der schriftliche Entwurf zu einer Stundenplanung
5.1. Sinn und Zweck des Entwurfs
5.2. Der Aufbau eines Entwurfs
5.3. Die Lernziele
5.4. Die Beschreibung der Lerngruppe und die Einordnung der Einzelstunde
5.5. Die Sachanalyse: „Darstellung des Fachgegenstands“
5.6. Didaktische Überlegungen: „Begründung des Lerngegenstands“
5.7. Methodische Überlegungen: „Darstellung des Lehr-Lernprozesses“
5.8. Der Stundenablaufplan
5.9. Literaturliste, antizipierte Lernprodukte und Material
Unterrichtsreihen planen
1.
Zur Vorgehensweise
2.
Einfache Reihenverläufe zu den verschiedenen Kompetenzbereichen
3.
Typische Leistungssituationen im Fach Deutsch
4.
Einfache Planungshilfe für eine Unterrichtsreihe
Standardsituationen
Eine neue Klasse im Fach Deutsch übernehmen
1.
Grundsätzliches
2.
Informationen, die Sie vor der ersten Stunde sammeln sollten
3.
Tipps für die ersten Stunden
4.
Planen Sie das gesamte Halbjahr grob im Voraus
Didaktische Positionen entwickeln
1.
Braucht man das im Leben? Warum unterrichten Sie das?
2.
Exkurs: Historische (, teilweise sehr fragwürdige) didaktische Positionen
3.
Kompetenzen und (didaktisch orientierte) Lernziele
Aufgabenformate unterscheiden und nutzen
1.
Grundsätzliches: Aufgaben und Aufgabentypen im Deutschunterricht
1.1. Vorbemerkung
1.2. Erste Differenzierung: Sinn und Zweck einer Aufgabe
1.3. Zweite Differenzierung: Grad der Öffnung
1.4. Dritte Differenzierung: Die Steuerungsseiten
1.5. Schnell auswertbare Diagnoseaufgaben
2.
Lernaufgaben im lernprozessorientierten Unterricht
2.1. Die Aufgabenkultur prägt die Unterrichtskultur
2.2. Aufgaben haben unterschiedliche Funktionen
2.3. Kompetenzorientierte Lernaufgaben steuern und initiieren Lehr-Lernprozesse
3.
Übung zu den Aufgabentypen
4.
Planungsmaske zur Gestaltung einer Lernaufgabe
Einen Stundenverlauf moderieren
1.
Verschiedene Gesprächssituationen
2.
Moderation als „personale Steuerung“
2.1. Moderieren
2.2. Diagnose und Rückmeldung
3.
Ein Grundmodell der Gesprächsführung
3.1. Öffnende Fragen an den Gelenkstellen
3.2. Weitere Standardsituationen der Gesprächsführung
4.
Ein modellhafter Musterverlauf eines Einstiegsgesprächs
5.
Schema zur Antizipation eines Einstiegsgesprächs
6.
Am Beispiel
7.
Zur Übung
8.
Im Unterricht Diskursivität herstellen
9.
Strukturierungshilfe „Lernprodukte verhandeln“
10.
Lernprodukte verhandeln - Übersicht
Leistungssituationen planen, durchführen und bewerten
1.
Klassenarbeiten schreiben
1.1. Grundsätzliches
1.2. Der Aufbau einer Klassenarbeit
1.3. Durchführung der Klassenarbeit
2.
Thesen zum Einsatz von Bewertungsbögen im Schreibunterricht
3.
Ein Beispiel-Bewertungsbogen
Medienkompetenzen vermitteln
1.
Didaktische Positionen
1.1. Digitale Medien im Deutschunterricht
1.2. Aus den Bildungsstandards
1.3. Teilkompetenzen und Beispiele
2.
Übersichtsmatrix: Neue Medien im Deutschunterricht
3.
Arbeitsblatt: Kompetenzstufung Medienerziehung
4.
Beispielsequenz: Meinungsbildung im Internetforum
5.
Die Tafel als Präsentationsmedium nutzen
5.1. Alternative Medien für die Schule?
5.2. Der Einsatz der Tafel im Deutschunterricht
5.3. Literatur/ Links
In der Sekundarstufe II unterrichten
1.
Grundsätzliches
2.
Didaktische Grundlagen
3.
Methodische Besonderheiten
4.
Leistungsfeststellungen
Einzelne Kompetenzbereiche
Schreiberziehung
1.
Didaktische Positionen und Grundsätze des Schreibunterrichts
1.1. Grundsätzliches
1.2. Schreiben als Prozess – Die Didaktik des Schreibunterrichts
1.3. Intentionen und Strategien des Schreibunterrichts
1.4. Schreibunterricht in verschiedenen Klassenstufen
1.5. Zusammenfassung und Blick auf fächerverbindende Möglichkeiten
2.
Zwischen Norm und Kreativität: Positionen der Schreib- und Aufsatzdidaktik
3.
Schreiber-, themen- und adressatenbezogener Schreibunterricht
4.
Schreibprodukte vorstellen, besprechen und bewerten
5.
Zusammenfassung: Konsequenzen für die Unterrichtspraxis
6.
Literatur
7.
Arbeitsblatt Schreibunterricht: Klassenstufenfolge
Rechtschreibung unterrichten
1.
Fachwissenschaftliche Aspekte
2.
Thesen zur Rechtschreibdidaktik
3.
Thesen zur Methodik des Rechtschreibunterrichts
4.
Exkurs: Das Diktatproblem
5.
Notenschlüssel für Diktate
6.
Literaturhinweise
7.
Im Überblick: Rechtschreibunterricht am Gymnasium – mehr als „Regeln lernen“ und „Regeln anwenden“
8.
Ein pragmatisches Rechtschreib- und Aufgabenkonzept: Einfache Lerner- und Kompetenzorientierung
Grammatikunterricht als Sprachunterricht
1.
Grammatik unterrichten
1.1. Der Gegenstandsbereich
1.2. Stationen der „Grammatik-Geschichte“
1.3. Zur Didaktik des Grammatikunterrichts
1.4. Wie denn jetzt? – Eine Didaktik für die heutige Praxis
1.5. Modellschritte einer Unterrichtsstunde
1.6. Literatur
Sachtext-Lesekompetenz aufbauen
1.
Vorbemerkungen
1.1. Arbeite die Hauptthesen heraus!
1.2. Fachliches: Was ist ein (Sach-)text?
1.3. Didaktisches: Sachtexte im Deutschunterricht
1.4. Methodisches: Grundsätzliche Überlegungen
1.5. Ein Lesecurriculum
2.
Methoden im Sachtext-Leseunterricht
2.1. Lesemethoden/ Lesetechniken
2.2. Leseleistungsdiagnose
2.3. Leseförderung/ Beratungsideen
2.4. Bearbeitungsmethoden
2.5. Unterrichtsmethoden
3.
Literatur
4.
Material
Dialogische Texte wirkungsvoll und verstehbar machen
1.
Grundsätzliches
1.1. Besonderheiten der Textsorte
1.2. Didaktisches
1.3. Methodisches
1.4. Basisliteratur
2.
Didaktische Zielfelder im Dramenunterricht
3.
Einfacher Aufbau einer Dramensequenz
4.
Methodenideen für den analytischen Unterricht
5.
Standbilder als Lernprodukte im analytischen Dramenunterricht
Lyrik verstehen und vollziehen
1.
Zum Einstieg
2.
Thesen zum Lyrikunterricht
3.
Didaktische Zielfelder des Lyrikunterrichts
Unterrichtsreihen zu erzählender Literatur planen und durchführen
1.
Literatur analysieren und interpretieren
1.1. Der hermeneutische Zirkel
1.2. Verschiedene Interpretationsansätze
2.
Erzählende Jugendbücher im Deutschunterricht
2.1. Definitionen
2.2. Spannungsfelder der Definition
2.3. Zur Didaktik des Jugendbuchunterrichts
2.4. Die Auswahl eines Jugendbuchs als Unterrichtsgegenstand
2.5. Thesen zur Methodik des Jugendbuchunterrichts
2.6. Grundlagenliteratur
3.
Romane und Kurzgeschichten im Unterricht
3.1. Zur Didaktik
3.2. Mögliche Themen und Themenschwerpunkte für eine Unterrichtsreihe
4.
Standard-Ablauf einer Roman-Reihe
5.
Der Aufbau am Beispiel: Irmgard Keun, Das kunstseidene Mädchen
6.
Progressionsstufen des Literaturunterrichts
Vorwort
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege,
„Unterrichten kann doch jeder.“ – Vielleicht haben Sie diese oder eine ähnliche Aussage in Ihrem Umfeld schon einmal gehört, vielleicht haben Sie selbst auch früher so gedacht. Wie falsch und unangemessen diese Unterstellung ist, merkt jeder, der über einen längeren Zeitraum hinweg die Verantwortung für den Lernprozess in einer Lerngruppe übernimmt.
Es mag in der Tat manchmal leicht sein, Jugendliche durch eine geschickte Ansprache oder ein motivierendes Thema kurzfristig zu gewinnen. Nachhaltiges und differenziertes Lernen ist dabei allerdings noch längst nicht gewährleistet.
Um zu einer Lehrerin oder einem Lehrer zu werden, der bzw. dem es gelingt, Lernsituationen so zu gestalten, dass sie wirkungsvoll und ertragreich sind, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Dass Lehrpersonen Persönlichkeiten sind, die sich empathisch auf Kinder und Jugendliche einlassen können, sollte selbstverständlich sein. Auch die Freude an der Entwicklung und Begleitung von Arbeits- und Denkprozessen stellt eine wichtige Grundlage des Lehrberufs dar.
Nun gründet die Fähigkeit, den Beruf der Lehrerin und des Lehrers auszuüben, allerdings nicht allein in grundsätzlichen Persönlichkeitsmerkmalen und affektiven Fähigkeiten. Vielmehr ergibt sich die Profession letztendlich aus einer guten Ausbildung, welche sowohl aus fachlichen wie aus fachdidaktischen und -methodischen Komponenten besteht.
Meine Materialsammlung möchte Sie bei der Ausbildung im fachdidaktischen und unterrichtsmethodischen Bereich unterstützen. Beginnend bei der Modellierung einer grundsätzlichen Vorstellung von gelingendem Unterricht sollen einige grundsätzliche Hinweise vorgestellt und erörtert werden. Darüber hinaus erhalten sie Hinweise zum Umgang mit typischen Standardsituationen des Fachunterrichts und zur Gestaltung des Unterrichts in den gängigen Kompetenzbereichen des Unterrichtsfaches Deutsch.
Alle meine Ideen gründen in einer langen Praxis als reflektierter Fachlehrer und Ausbilder. Prüfen Sie, ob das Beschriebene zu Ihnen und Ihren Unterrichtsvorstellungen passt. Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg bei der zunehmenden Professionalisierung in einem der wichtigsten Berufe, die es innerhalb einer Gesellschaft zu bewältigen gilt.
Thorsten Zimmer
Die Intensivphase
Grundlagen gelungenen Deutschunterrichts
1. Grundlagen: Was ist „guter Deutschunterricht am Gymnasium“?
Arbeitsauftrag
Sicherlich führt die spontane Ideensammlung zu interessanten und diskutierbaren Ergebnissen. Ihre Assoziationen verdeutlichen, wo Ihre eigenen Schwerpunkte bei der Beantwortung der Qualitätsfrage liegen. Wie es zu dieser Schwerpunktbildung kommt, lässt sich sicherlich zum Teil mit einem Blick auf Ihre eigene Schulzeit, Ihre Schwerpunkte während des Studiums und die Erfahrungen in den Schulpraktika erklären. Dass die Kapitelfrage allerdings nicht durch eine Sammlung von Assoziationen zu beantworten ist, werden Sie gemerkt haben. Die folgende Ausdifferenzierung der Phrase vom „guten Deutschunterricht am Gymnasium“ bereitet eine weitere Fundierung und Präzisierung Ihrer Vorstellungen vor.
1.1. Was bedeutet Gymnasium?
Schon die Definition der Schulform „Gymnasium“ ist nicht so leicht, wie sie auf den ersten Blick wirkt. Die größte Übereinstimmung der unterschiedlichen Konkretisierungen des „Gymnasiums“ scheint zunächst in dem – trotz aller Diskussionen – noch bestehenden Ausbildungsziel, nämlich der Vorbereitung auf ein Hochschulstudium, zu liegen. Dass längst nicht mehr alle Gymnasiasten ausdrücklich auf ein Hochschulstudium hinarbeiten und dass es inzwischen zahlreiche Ausbildungsberufe gibt, die den gymnasialen Abschluss – offiziell und inoffiziell - als Zulassungsvoraussetzung implizieren, relativiert diesen Definitionsansatz allerdings. Entsprechend formuliert die Kultusministerkonferenz, dass das Abitur den „Zugang zu jedem Studium an einer Hochschule, aber auch den Weg in eine vergleichbare berufliche Ausbildung ermöglicht.“1
Verschiedene Ausprägungen und Profilierungen, unterschiedliche Möglichkeiten bei der Kurswahl, die Stoffverteilung auf 8 oder 9 Schuljahre, Unterrichtssituationen in einer Ganztags- oder einer Halbtagsschule und verschiedene Umgangsweisen mit dem Zentralabitur sind sicherlich weitere Aspekte, die einer allzu pauschalen Definition der Schulform entgegenstehen. Nimmt man die gymnasialen Institutionen der Erwachsenenbildung bzw. des zweiten Bildungswegs hinzu, wird das Bild noch facettenreicher.
1.2. Was bedeutet Deutschunterricht?
Etwas überschaubarer ist die Antwort auf die Frage nach dem Inhalt des Begriffs Deutschunterricht. Je nach Gliederung blicken Lehrpläne, Bildungsstandards und Sekundärliteratur auf unterschiedliche Bereiche des Fachunterrichts, denen konkrete Inhalte, zu erwerbende Kompetenzen und Anforderungsprofile zugeschrieben werden. Die einzelnen Bereiche werden in der Regel bereits in den Klassen 5 und 6 grundgelegt – oder setzen Ansätze aus der Grundschule fort – und werden immer wieder aufgegriffen, geübt und präzisiert.
Die einzelnen Schuljahre sind entsprechend angeordnet und organisieren den Unterricht im Sinne einer Lernspirale – in der eben jeder Aspekt wieder aufgegriffen und auf ein höheres Niveau gehoben wird.
Die Bezeichnungen der Themen- und Kompetenzbereiche erklären sich im Großen und Ganzen von selbst. Gängige Einteilungen unterscheiden …
Inhalts-/ Kompetenzbereiche des Deutschunterrichts
Sprechen
Schreiben
Lesen/ Mit Texten umgehen
Sprache und Sprachgebrauch untersuchen
Die Bezugswissenschaft des Deutschunterrichts und seiner Inhalte ist zunächst die Germanistik, aufgegliedert in Sprach- und Literaturwissenschaft. Der genauere Blick zeigt aber, dass sich die gängigen Studieninhalte keinesfalls einfach auf die Fachinhalte abbilden lassen. Weder erschöpfen sich die wissenschaftlichen Grundlagen des Fachunterrichts Deutsch in den Themen der Germanistik – mindestens pädagogische und gesellschaftswissenschaftliche Theorien müssen hinzugenommen werden – noch vertritt der Deutschunterricht das Ziel, einen bestimmten, formal definierten Umfang an Studieninhalten zu vermitteln.
Als Instanz der Vermittlung zwischen universitärem Lehrinhalt des Faches Germanistik und den schulischen Notwendigkeiten des Deutschunterrichts wird in der Regel die Fachdidaktik des Faches Deutsch angesehen. Der Fachdidaktik diese Vermittlerinstanz zuzusprechen, ist allerdings keine unhinterfragbare Annahme. Es lässt sich ebenso die Position einnehmen, die Fachdidaktik sei eine eigene wissenschaftliche Disziplin innerhalb oder neben der germanistischen Fachwissenschaft.
Arbeitsauftrag
1.3. Was bedeutet guter Unterricht?
Neben subjektiv bestimmten Diskussionen über Unterrichtsqualität sind inzwischen zahlreiche tragfähige und sinnvolle objektivierbare Kriterien für guten Unterricht - insbesondere auch für guten Deutschunterricht - formuliert. Ein verbreiteter und trotz aller Kritik brauchbarer Kriterienkatalog stammt von Hilbert Meyer. Er formuliert die Anforderungen:
1.4. Guter Deutschunterricht am Gymnasium – Ein erstes Modell
Die Vorüberlegungen verdeutlichen die Komplexität der Fragestellung nach gutem Deutschunterricht und lassen ahnen, dass die Frage nicht endgültig beantwortet werden kann. Dass die Qualität des Deutschunterrichts allerdings beschrieben – und damit auch diagnostiziert und verbessert – werden kann, steht außer Frage. Je präziser dabei auf grundlegende Aspekte und Faktoren des Deutschunterrichts geblickt wird, umso größer ist die Chance, wirklich zu einer Qualitätsverbesserung zu gelangen. Die modellhafte Ausdifferenzierung der relevanten Aspekte und Faktoren kann dabei eine wichtige Grundlage bilden.
Arbeitsaufträge
Die vorgegebene Modellfolie enthält bereits einige Implikationen, die zur Fundierung eines zeitgemäßen Deutschunterrichts notwendig sind, indem sie sich vor allem darum bemüht, eine konsequente und grundsätzliche Schülerorientierung abzubilden. Modelle „zeitgemäßen Deutschunterrichts“ sind in diesem Sinne eher „Lernmodelle“ als „Lehrmodelle“. Unterricht wird dabei weniger verstanden als direkte Kommunikationssituation zwischen Lehrern und Schülern, deren Äußerungsakt in der „Belehrung“ besteht, sondern definiert sich als intentional arrangierte Lernumgebung, die den Schülern ermöglicht, sich individuell lernend mit den Fachinhalten auseinanderzusetzen. Möglichkeiten, eigene Lernreihenfolgen zu bilden, eigene Schwerpunkte zu setzen oder nach der eigenen Lerngeschwindigkeit zu arbeiten, konkretisieren beispielsweise die geforderte Individualität, die zunächst als modellierte Idealisierung zu verstehen ist. Dass individualisiertes Lernen grundsätzliche und pragmatische Grenzen haben muss, steht dabei außer Frage, wo diese Grenzen liegen und wie weit individualisiertes Lernen gehen kann, wird in konkreten Unterrichtskontexten immer wieder neu zu klären sein.
Weiterhin suggeriert die Modellfolie eine erste Differenzierung zwischen konkreten Kompetenzen (Was genau lernt der Schüler in der Stunde?) und tiefergehenden grundsätzlichen Fähigkeiten („Was lernt der Schüler im Blick auf seiner Lebensgestaltung?“).
2. Unterrichtsinhalte, Lernziele und Kompetenzen - Grundlagenbegriffe
2.1. Lehrpläne, Bildungsstandards, Arbeitspläne
Um die Frage nach den Inhalten des Deutschunterrichts zu beantworten, werden Sie sicherlich auf die Fachinhalte des Studiums zurückgreifen, vielleicht werden Sie sich auch an die Themen Ihres eigenen schulischen Deutschunterrichts erinnern. Sie werden persönliche Schwerpunkte einbringen und Aspekte ausblenden, die Ihnen weniger sympathisch sind. Auch der Blick in die gängigen Schulbücher kann dabei helfen, die Frage nach den Inhalten des Deutschunterrichts zu beantworten. Vielleicht gibt es situative Notwendigkeiten für die Auswahl eines bestimmten Themas oder Absprachen zwischen Kollegen, an denen sich die Wahl orientiert.
Dass der professionelle und authentische Deutschlehrer diese Antriebe nutzt, um seinen Unterricht inhaltlich zu füllen, ist ohne Frage richtig und sinnvoll. Wichtige, gewissermaßen verbindliche Informationen zu den Inhalten und den Zielen des Deutschunterrichts enthalten allerdings die Lehrpläne, die Bildungsstandards der KMK, die schulinternen Arbeitspläne und die EPAs - das sind die einheitlichen Prüfungsanforderungen für das Abitur.
Die Lehrpläne2 werden von sogenannten fachdidaktischen Kommissionen, die in der Regel aus Fachlehrern bestehen, für ein Bundesland erstellt. Sie spiegeln dabei die jeweils aktuellen fachdidaktischen Ausrichtungen des Deutschunterrichts im jeweiligen Bundesland und enthalten oft Kapitel, in denen eine explizite didaktischen Verortung des Deutschunterrichts in den Blick genommen wird. In unterschiedlicher Konkretheit werden – darauf gründend - Unterrichtsinhalte vorgeschlagen, denen Kompetenzen und Teilkompetenzen zugeordnet sind.
Bundesweit gemeinsam gültig sind die Bildungsstandards, die ein zentrales Ergebnis der Inhalts- und Kompetenzdiskussion seit der PISA-Studie 2000 darstellen. Die Bildungsstandards sind weniger ausdrücklich didaktisch ausgerichtet – bzw. verfolgen eine eher berufspragmatische didaktische Vorstellung vom Zweck und Anspruch des Deutschunterrichts. Sie formulieren für die einzelnen Themenbereiche des Faches sehr konkrete und messbare Einzelkompetenzen und sind in diesem Sinne „output-orientiert“.
Die Bildungsstandards verstehen sich als Regelstandards, die beschreiben, über welche Fähigkeiten ein Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt - konkret am Ende der Klassenstufen 6, 8 und 10 - in der Regel verfügen soll. Abgestimmte Aufgabenbeispiele und ausführliche Erwartungshorizonte sind ebenfalls formuliert und veröffentlicht und konkretisieren den Anspruch der Bildungsstandards.3
Die Fachkonferenzen der Schulen haben immer wieder die Aufgabe, die bundesweit gültigen Bildungsstandards in der Form von schulinternen Arbeitsplänen zu konkretisieren. Dabei entstehen und entwickeln sich sehr unterschiedliche Dokumente, die in den meisten Schulen zu einer guten Kombination der jeweiligen Tradition und Profilierung mit den allgemeinen Vorgaben führen. Die Arbeitspläne der Schulen sollten für Eltern und Schüler veröffentlicht sein und die Grundlage des Unterrichts bilden. Theoretisch ist das Erreichen der besprochenen Standards die verpflichtende Aufgabe des Lehrers, für die er verantwortlich ist.
Für die Sekundarstufe II existieren ebenfalls Lehrpläne und – in einigen Fächern - auch Bildungsstandards. Inhaltliche und methodische Vorgaben für das mündliche und schriftliche Abitur, die natürlich auch Auswirkungen auf die Gestaltung des Unterrichts in der Sekundarstufe II haben, sind hierin formuliert.
Arbeitsauftrag
Faktoren bei der Bestimmung der Unterrichtsthemen 4
2.2. Ziele und Kompetenzen
Der Lernzielbegriff wurzelt in der didaktischen Diskussion der 1960er- und 1970er Jahre und beschreibt dort den intendierten Lerngewinn der Schüler angesichts bestimmter Lerninhalte. Gerade die problematische Messbarkeit des angestrebten und erreichten Lerngewinns und die Beschränkung der Perspektive auf die Lehrtätigkeit des Lehrers – im Gegensatz zur Lerntätigkeit der Schüler – sind häufig Gegenstand der Kritik.
Gleichwohl ist es unumstritten, dass der Unterrichtspraxis eine intentionale Planung vorausgehen muss. In diesem – einem etwas offeneren Sinn – beschreiben Lernziele heute den in arrangierten Lehr-Lernsituationen intendierten Zuwachs an Wissen, Fähigkeiten und Haltungen. Es kann hilfreich sein, die gängige Differenzierung der Lernziele in kognitive, affektive und psychomotorische Lernziele5 im Blick zu behalten. Verschiedene Lernzieltaxonomien - etwa die dreischrittige Lernzielprogression Rekapitulation - Reproduktion - Transfer - differenzieren die Vorstellung von Lernzielen weiterhin.6
Die Bildungsdiskussionen des 21. Jahrhunderts sprechen im Zusammenhang mit der unterrichtlichen Zielorientierung eher von Kompetenzen als von Lernzielen. Die derzeit gängigste Definition des Begriffs stammt von Franz Weinert. Er definiert Kompetenzen als "bei Individuen verfügbare oder durch sie erlernbare, kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen, und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können"7. Eine pragmatische Definition des Kompetenzbegriffs formuliert Josef Leisen, wenn er im Blick auf einen an Lernprozessen und Lernprodukten ausgerichteten Unterricht von Kompetenzen als einem handelnden Umgang mit Wissen8 spricht.
In der derzeitigen Begriffsdichotomie von Lernzielen und Kompetenzen kann es zu Verwirrungen kommen, da sowohl der Lernzielbegriff als auch die Kompetenzdefinition vielfach variiert wurden und gerade in den definitorischen Grenzbereichen aufgeweicht und kaum mehr voneinander zu unterscheiden sind.
Ohne die problematischen Unschärfen freilich völlig beseitigen zu können, erweist sich die folgende Unterscheidung von Kompetenzen und Zielen bei der Planung und Beschreibung von Unterricht als brauchbar. Hiernach wird das Lernziel eher in den Kontext des grundsätzlichen fachdidaktischen Potentials einer Stunde gestellt. Das Lernziel benennt neben dem Unterrichtsinhalt präzise und pointiert den Sinn des Erarbeiteten im lebensweltlichen Zusammenhang. Es beschreibt, was gelernt werden soll, und erklärt, warum und inwiefern dies für das Lernen und die Lebensgestaltung des Schülers von Belang sein kann.
Der Kompetenzbegriff ist demgegenüber enger und konkreter gefasst. Ihm geht es um eine möglichst exakte Beschreibung der Fähigkeiten und Fertigkeiten, über die ein Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügen wird. Vor allem die Messbarkeit und Überprüfbarkeit der Kompetenz stellen einen wesentlichen Unterschied zum Lernziel, - wie es hier verstanden wird -, dar.
Lernziel
Die Schüler erkennen die Entfremdung der Tochter und den Generationenunterschied als wesentliche und kaum zu reduzierende Ursache der gescheiterten Kommunikation in Peter Bichsels Kurzgeschichte Die Tochter, reflektieren die Situation aufgrund eigener Erfahrungen und verbessern ihre Fähigkeiten zu einer empathischen Wahrnehmung ihrer eigenen Alltagsgespräche.
Kompetenzen
Die Schüler können eine Deutungshypothese zu einer Kurzgeschichte formulieren und begründen.Sie üben die Fähigkeit, Deutungshypothesen mithilfe des Textes zu überprüfen und zu überarbeiten.…Die Beispiele in der Tabelle geben einen weiteren Einblick in die oben beschriebene Nuancierung. Sie sind bewusst plakativ formuliert:
Kompetenzen und Lernziele
Themen/ Inhalte
Kompetenzen
(Konkret beschreibbare Einzelfähigkeit)
Lernziele/ didaktische Intentionen
(grundsätzlicher werdend)
z. B.
„Erörterung“
(Schreiberziehung)
Eine Fragestellung verstehen
Eine Meinung zu einem Thema haben
Die Meinung differenzieren können
Die Meinung verstehbar und präzise mündlich ausdrücken können
Die Meinung angemessen schriftlich formulieren können
Überzeugungsstrategien kennen und anwenden können
…
Alltägliche Fragestellungen wahrnehmen und verstehen
Sich an öffentlichen Diskursen beteiligen können
Seine Meinung vertreten und durchsetzen können
…
→ Eigene Ziele wahrnehmen und erreichen können …
→ Aufgeklärt und verantwortungsbewusst handeln …
→ „Ein gelingendes Leben führen“
z. B.
„Kurzgeschichte“
(Literaturunterricht)
Einen literarischen Text inhaltlich erfassen
Den Aufbau eines literarischen Textes erfassen
Konflikte wahrnehmen und ihren Verlauf beschreiben können
Charakterzüge einzelner Figuren erkennen und zu einer Charakterisierung zusammenfügen können
Kommunikationsprozesse durchschauen können
Sprachliche Besonderheiten wahrnehmen und erklären können
…
Einzelne Literarische Texte kennen
Texte verstehen können
Zwischen den Zeilen lesen können
Literatur schätzen lernen
…
Eigene Positionen zu Konfliktthemen differenzieren
Konfliktverläufe durchschauen
die Empathiefähigkeiten verbessern
…
→ Aufgeklärt und verantwortungsbewusst handeln
→„Ein gelingendes Leben führen“
Weitere Themenbereiche:
Grammatikunt. Rechtschreibunt.
Bildungsstandards
Arbeitspläne
Einheitliche Prüfungsanforderungen für das Abitur (EPAs) - Lehrpläne OS/Sek I und Sek II
Arbeitsauftrag
2.3. Die Anspruchsprogression
Um das Anspruchsniveau von Lernzielen genauer erfassen und beschreiben zu können, wurden verschiedene Lernzieltaxonomien entwickelt. So unterscheidet der amerikanische Psychologe Benjamin S. Bloom (1913-1999) zum Beispiel im Bereich der kognitiven Lernziele sechs Niveaustufen. Auch für die psychomotorischen und die affektiven Lernzielbereiche sind entsprechende Niveaubeschreibungen formuliert.
Lernzieltaxonomien9
Kognitive Lernziele
Psychomotorische Lernziele
Affektive Lernziele
•
Wissen
•
Beachtung
•
Imitation
•
Verstehen
•
Reaktion
•
Manipulation
•
Anwendung
•
Wertung
•
Präzision
•
Analyse
•
Aufbau einer
•
Handlungsgliederung
•
Synthese
•
Wertordnung
•
Naturalisierung
•
Bewertung
•
Bestimmtsein durch Werte
Vereinfachte Lernzieltaxonomien unterscheiden im Wesentlichen die drei Anforderungsbereiche Reproduktion („Anforderungsbereich I“), Reorganisation („Anforderungsbereich II“) und Transfer („Anforderungsbereich III“). Oft lassen sich einzelne handlungsanweisende Verben („Operatoren“) ganz konkreten Anforderungsbereichen zuordnen.
Matrix der Kompetenzprogression
Übergeordnete didaktische Ebene/ Bildungsbegriff
Identitätsfindung- Fremdverstehen – Auseinandersetzung mit anthropologischen Grundfragen – Demokratieerziehung
Kompetenzbereiche des Lehrplans und der Bildungsstandards
Sprechen
Schreiben
Lesen/ Mit Texten umgehen
Sprache und Sprachgebrauch untersuchen
Fachmethodische Kompetenzen
I
Sich an einem alltäglichen oder fachlichen Gespräch angemessen beteiligen.
Vorgegebene und einfache offene Schreibsituationen bewältigen.
Einfache Textinhalte und Textformen erfassen und wiedergeben bzw. benennen.
Regeln kennen und an typisierten Beispielen anwenden.
Notwendige Methoden kennen und sich über ihre Anwendungspraxis und ihre Einsatzbereiche bewusst sein
Anforderungsbereiche
II
Wirkungen von Redeweisen wahrnehmen und selbst wirksam reden.
Wirkungen von Geschriebenem wahrnehmen und selbst wirkungsvoll schreiben.
Sich schrittweise und präzisierend der Deutung von anspruchsvollen nicht-fiktionalen und fiktionalen Texten annähern.
Den Einfluss der verschiedenen sprachlichen Beschreibungsebenen auf die Textaussage wahrnehmen und beschreiben.
Situationsbezogen, individuell, angemessen und kritisch über das Methodenrepertoire verfügen.
III
Komplexe Kommunikationssituationen bewusst, intentional und reflektiert bewältigen und bewerten.
Ideen, Gedanken, Überlegungen, Erfahrungen intentional, authentisch und wirkungsvoll – in Bezug auf Inhalt und Form – ausdrücken.
Begründbare Deutungen anspruchsvoller Texte finden, ausdrücken, werten und diskutieren.
Den Einfluss der verschiedenen sprachlichen Beschreibungsebenen auf die Textaussage komplexer Texte wahrnehmen, beschreiben und werten.
Das Methodenrepertoire selbstständig verfeinern und erweitern.
Gängige Operatoren zu den einzelnen Anforderungsbereichen
Arbeitsauftrag
1 Meyer, Hilbert: Was ist guter Unterricht? 2. durchgesehene Auflage. Berlin: Cornelsen Scriptor 2005. 17-18.25ff./ Auch: Brand, Tilman von: Deutsch unterrichten. Einführung in die Planung, Durchführung und Auswertung in den Sekundarstufen. Seelze-Velbert: Friedrich Verlag 2010. S. 13ff.
2 Weiterführend siehe: Martial, Ingbert von: Einführung in didaktische Modelle. 2. überarbeitete Auflage. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren 2002. S. 247-255./ Auch: Kämper-van den Boogaart, Michael: Lehrpläne und Deutschunterricht. In: Kämper-van den Boogaart, Michael (Hrsg.): Deutsch-Didaktik. Leitfaden für die Sekundarstufe I und II. 3. Auflage. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor 2006. S. 12-33.
3 Für einen ausführlichen Blick auf die Bildungsstandards siehe: Kämper-van den Boogaart, Michael: Bildungsstandards für den Deutschunterricht. In: Kämper-van den Boogaart, Michael (Hrsg.): Deutsch-Didaktik. Leitfaden für die Sekundarstufe I und II. 3. Auflage. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor 2006. S. 288-302.
4 Die Überlegungen zu den Unterrichtsinhalten beginnt freilich nicht erst bei den aufgeführten Faktoren, sondern berücksichtigt grundsätzliche - etwa bildungstheoretische und didaktische - Positionen.
5 Vgl. z.B. Martial, Ingbert von: Einführung in didaktische Modelle. 2. überarbeitete Auflage. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren 2002. S. 234-238.
6 Die in der Sekundärliteratur gängige Unterscheidung zwischen Richtzielen, Grobzielen und Feinzielen spielt in der Ausbildungspraxis kaum mehr eine Rolle, sie wurden v.a. durch die Differenzierungen innerhalb der Diskussion um den Kompetenzbegriff abgelöst.
7 Zitiert nach: https://de.wikipedia.org/wiki/Kompetenz_(Pädagogik).
8 Vgl. z.B.: http://www.lehr-lern-modell.de/kompetenzorientierung (Zugriff am 18.12.2017).
9 Genauere Auseinandersetzungen mit den Lernzieltaxonomien finden sich z.B. in: Martial, Ingbert von: Einführung in didaktische Modelle. 2. überarbeitete Auflage. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren 2002. S. 234-238.
3. Hermeneutisch-diskursiver Deutschunterricht: Ein Modell
3.1. Der Anspruch des Modells
Das hier zu beschreibende Modell orientiert sich am Lehr-Lern-Modell des Studienseminars Koblenz10. Es greift dessen Darstellungsform und seine grundsätzlichen Ideen auf, nimmt allerdings auch Veränderungen - im Sinne spezieller Nuancierungen und Schwerpunktsetzungen - vor.11 Sein ausdrücklicher Zweck ist die modellhafte Abbildung möglichst vieler Grundsituationen des Fachunterrichts Deutsch und derjenigen benennbaren und beeinflussbaren Faktoren, die den Deutschunterricht gelingen lassen. Das Modell soll im Kontext der Lehrerausbildung gelesen und genutzt werden, um die Planung und Durchführung des Deutschunterrichts transparent zu machen, differenzierte Planungs- und Durchführungsentscheidungen zu treffen sowie ihre Angemessenheit und ihr Gelingen beobachtbar und bewertbar zu machen.
Dass das Modell Grenzen hat, mit vereinfachten Pauschalisierungen arbeitet und eine idealisierte Vorstellung von gelingendem Deutschunterricht impliziert, die in der Praxis nicht immer vollständig realisiert werden kann, ist dabei als unvermeidbares Manko einer Unterrichtsmodellbildung bewusst.
3.2. Hermeneutisch-diskursiver Deutschunterricht
Als zwei wesentliche Aspekte eines guten12 Deutschunterrichts lassen sich das hermeneutisch angelegte Fortschreiten des Lehr-Lern-Prozesses und eine aus vielfältigen Diskursen entstehende Weiterführung und Vertiefung erreichter Ergebnisse benennen.
Deutungsarbeit im Literaturunterricht hermeneutisch zu gestalten, ist eine gängige - ebenso sach- wie schülerorientierte - Vorgehensweise. Die hermeneutische Textarbeit erlaubt jedem Schüler, auf eben dem Niveau und mit eben den Eindrücken in die Textarbeit einzusteigen, die ihm naheliegen und seinem aktuellen Lernstand und -interesse entsprechen. Die Art und Intensität der weiterführenden Auseinandersetzung mit dem Fachgegenstand kann er - aufgrund eigener Initiative, bereits vermittelter Arbeitstechniken, Impulse seiner Mitschüler und professioneller Moderation - individuell steuern und vollziehen.
Auch Unterrichtsverläufe innerhalb anderer Lernbereiche des Faches Deutsch - etwa im Sprach- und Schreibunterricht - lassen sich im Sinne einer Unterrichtshermeneutik verstehen, die dann eben nicht von Interpretationshypothesen, sondern von Arbeits- oder Problemlösungshypothesen ausgeht, diese schrittweise verifiziert oder falsifiziert und gegebenenfalls überarbeitet.
Diskursiv ist Deutschunterricht insofern, dass wesentliche Ergebnisse in moderierten Unterrichtsgesprächen ausgehandelt und präzisiert werden, sodass die Diskursivität des Deutschunterrichts einen wesentlichen Beitrag zu einer sach- und schülernahen Progression leistet. So wesentlich und wichtig es aus pädagogischer Sicht ist, Erkenntnisse individuell zu vollziehen und Arbeitsergebnisse individuell zu erstellen, so ergiebig ist deren regelmäßige Spiegelung in einem Gruppenplenum. Erst im differenzierten und ergebnisorientierten gemeinsamen Gespräch kann das so Gelernte gefestigt und weiterentwickelt werden. Ohne dass sich der Lehrer inhaltlich einbringen muss, führen professionell moderierte Diskurse zu einer schrittweisen - kollektiv wie individuell vollzogenen - Niveauprogression. Schülernah und schülerorientiert ist diese Progression insofern, dass sie hinsichtlich ihres Inhalts, ihrer Geschwindigkeit und ihres Niveaus ja nahezu ausschließlich auf Schülerantworten basiert. Wo es gelingt, Schüler zu professionellen Moderatoren auszubilden und Phasen des Unterrichtsgesprächs selbst moderieren zu lassen, wird dieser Effekt noch wesentlich verstärkt.
Die Steuerung der hermeneutisch-diskursiven Lehr-Lern-Prozesse erfolgt über verschiedene Faktoren, wobei vor allem die Möglichkeiten der personalen Steuerung direkt mit der beschriebenen Diskursivität des Unterrichts zusammenhängen. So hat eine professionelle Moderation etwa die Aufgaben, Diskursivität öffnend herzustellen, Positionen aufeinander zu beziehen und gegeneinander abzugrenzen. Deutungshypothesen formulieren und immer wieder überprüfen und präzisieren zu lassen, Zwischenergebnisse zu sichern und weitere Arbeitsschritte anzuleiten, sind dabei Moderationsaufgaben, auf die der hermeneutische Unterricht nicht verzichten kann. Diagnostische Beobachtungen und rückmeldende Bewertungen zur Effizienz und zum Niveau der Schülerarbeit erlauben eine dezente, nicht zu lehrerdominante Steuerung des Unterrichtsverlaufs.
Über die beschriebenen Moderationsnotwendigkeiten hinaus bietet und benötigt der Lehr-Lernprozess des Deutschunterrichts auch Situationen, in denen der Lehrer sich persönlich in den Unterrichtsdiskurs einbringen kann. Er wird dies in der Rolle des Fachmannes aber vor allem auch in der Rolle des Literatur-Lesers und -bewerters tun können. Dass diese Form der personalen Steuerung innerhalb eines grundsätzlich schülerorientierten Unterrichts sehr behutsam geschehen sollte, muss nicht eigens begründet werden.
Etwas planbarer als die - situativ im Unterrichtsverlauf anzuwendenden - personalen Steuerungsgrößen sind die Möglichkeiten der materialen Einflussnahme auf den Lehr-Lern-Prozess. Angemessene Unterrichtsmethoden und Unterrichtsmaterialien und überlegte Aufgabenstellungen können und sollen eine sach- wie schülernahe, schrittweise progressive Auseinandersetzung mit den Themen initiieren und begleiten. Wie dies konkret aussehen kann, hängt von den verschiedenen Lernbereichen und Unterrichtsthemen ab.
In seiner Teleologie blickt das hermeneutisch-diskursive Unterrichtsmodell auf verschiedene Zielebenen. Sowohl im Sinne einer individuellen Beobachtung und Förderung der Schüler als auch mit dem Blick auf eine transparente Stundenreflexion im Kontext der Lehrerausbildung ist es sinnvoll und wichtig, den Unterricht und seine Einzelphasen kompetenzenorientiert anzulegen und zu gestalten. Erst wo komplexe Lernprozesse in einzelne Teilkompetenzen zerlegt werden und deren Erarbeitung und Überprüfung konkreten Unterrichtsphasen zugeordnet werden, werden individuelle Leistungsfähigkeiten der Schüler beschreibbar und Unterrichtsverläufe derart transparent, dass ihr Gelingen und Misslingen in einer brauchbaren Präzision erfasst und dargestellt werden kann. Eine Sicherung von Unterrichtsergebnissen in Lernprodukten unterstützt diese Möglichkeit dabei zweifellos weiterhin.13
Dass neben der Vermittlung konkreter sachgebundener Kompetenzen immer auch die Diskursfähigkeit der Schüler und ihre Kompetenz zur Partizipation an hermeneutisch angelegten Deutungs- oder Problemlösungsprozessen angestrebt und beschrieben werden kann, ergibt sich aus den Grundsätzen des Unterrichtsmodells.
Aufgrund ihrer Beschreibbarkeit, ihrer Präzision und ihrer Messbarkeit sind die Kompetenzen und Teilkompetenzen dankbare Zielformulierungen. Es darf aber nicht der Fehler gemacht werden, die Ziele des Deutschunterrichts allein auf der Kompetenzebene anzusiedeln. Über alle Kompetenzenorientierung hinaus - besser: alle Kompetenzenorientierung aufhebend - blickt der Deutschunterricht auch auf grundsätzlichere, tendenziell eher affektive Zielbereiche. Die Entwicklung der Persönlichkeit, eines reflektierten Selbstbewusstseins, eigener Wertvorstellungen und eines zeitgemäßen Sozialverhaltens sind wesentliche didaktische Implikationen des Deutschunterrichts und aller seiner Lernbereiche, die nicht der Messbarkeit und Überprüfbarkeit der eher pragmatisch ausgerichteten Kompetenzideen geopfert werden dürfen. Als „gut“ und „gelungen“ wird Deutschunterricht daher dann bewertet, wenn er dazu führt, dass sich die Schüler die fachlichen Inhalte derart aneignen, dass sich ihre individuellen Fähigkeiten und Einstellungen in der Begegnung mit den Fachinhalten ausschärfen und weiterentwickeln. Individuell und nachhaltig soll der Schüler sich dabei die Fachinhalte „zu eigen machen“, sodass der Deutschunterricht letztlich gleichermaßen zu einer von der individuellen Begegnung mit den Fachinhalten ausgelösten Veränderung der Einstellungen der Schüler wie einer individuellen Konkretisierung der Fachinhalte – also einer Korrelation zwischen Schüler und Fachinhalt - beiträgt.
3.3. Theorieanbindung
Die Ansprüche des Modells im Zusammenhang der Lehrerausbildung wurden eingangs beschrieben. Im Wesentlichen basieren die dem Modell zugrundeliegenden Vorstellungen von „gutem Deutschunterricht“ auf einer Fülle an subjektiven Erfahrungen. Das hermeneutisch-diskursive Lehr-Lern-Modell für den Deutschunterricht versteht sich daher weniger als Übertragung einer bestimmten Unterrichtstheorie in den konkreten Alltag denn als modellhafte Abbildung einer als gelungen erfahrenen Unterrichtspraxis.
Dabei ist das beschriebene Praxismodell trotz seiner heuristischen Genese nicht völlig theoriefern. So impliziert es mindestens die unterrichtstheoretischen Überlegungen und Entscheidungen der zugrunde gelegten Stunden. Außerdem setzt es Forderungen und Ableitungen verschiedener didaktischer Ansätze um bzw. erlaubt deren Einbindung. Eine große Affinität hat das Modell sicherlich zum Konzept der handlungs- und produktionsorientierten Deutschdidaktik14. Auch wenn der eigentliche Ansatz engere Vorstellungen von Lernhandlungen und Lernprodukten vertritt, lassen sich in der schülerorientierten Anlage der Stunde - insbesondere im problemorientierten Stundeneinstieg und dessen weiterer - durchaus auch konstruktivistisch ausgerichteter - Bearbeitung - offensichtliche Kongruenzen ausmachen.15
3.4. Momente gelungenen gymnasialen Deutschunterrichts nach dem Modell
Worin und woraus guter und gelungener Deutschunterricht besteht, ist in der Sekundärliteratur vielfach ausgeführt. Den meisten Forderungen der modernen Deutschdidaktik kann sich das hermeneutisch diskursive Lehr-Lern-Modell stellen. Qualitätsansprüche, die das Modell ausdrückt, sind zum Beispiel die folgenden.
Die Planung des Deutschunterrichts …
… orientiert sich an den Schülern
Didaktische Überlegungen und didaktisch motivierte Entscheidungen nehmen den Schüler, seinen Kompetenzerwerb und seine persönliche Entwicklung in den Blick. Im Zusammenspiel mit den anderen Schulfächern hat der Deutschunterricht auf vielerlei Ebenen den Anspruch, zum gelingenden Leben des Schülers beizutragen.
… ist fachlich fundiert und am Fachgegenstand orientiert
Bei aller Schülerorientierung muss der gymnasiale Deutschunterricht seine Fachinhalte nicht leugnen. Die Vermittlung von inhaltlichem und methodischem Fachwissen wird als wert- und sinnvoll angesehen. Die Fach- und die Schülerorientierung des Deutschunterrichts dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern müssen miteinander in einer Korrelation gebracht werden.
… ist auf Korrelation angelegt
Fachinhalte und Schülerorientierung werden weder gegeneinander ausgespielt noch in eine eindeutige Hierarchie gebracht. Die Aufgabe des Deutschunterrichts besteht darin, die Begegnung zwischen Fachinhalten und Schülern fruchtbar zu machen, sodass der Unterricht zu einer Individualisierung des Fachinhaltes und zu einer fachlichen wie persönlichen Bereicherung des Schülers führt.
10 Vgl.: Das Lehr-Lern-Modell. In: http://www.studienseminar-koblenz.de/bildungswissenschaften/lehr-lern-modell.htm