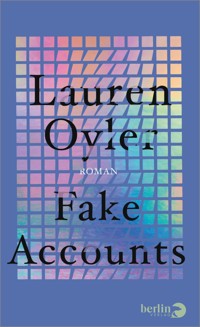
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Eine junge Frau entdeckt, dass ihr Freund höchst erfolgreich als Anonymus im Netz Verschwörungstheorien schmiedet und verbreitet. Sie will sich von ihm trennen, aber während sie noch mit dem Wie ringt, erreicht sie die Nachricht von seinem Tod. Wie trauert man um jemanden, den man vielleicht sogar geliebt, aber eindeutig nicht gekannt hat? Wer war dieser Mann? Und wer ist sie selbst? Ob in Brooklyn oder Berlin — die Heldin dieses gefeierten Debüts muss sich offensichtlich zunächst einmal selbst (er)finden. Von der New York Times zum Editor's Choice gekürt, wurde der Roman in den USA über Nacht zum Bestseller und Liebling der Independent Bookstores.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Deutsch von Bettina Abarbanell
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Fake Accounts« bei Catapult, New York
© Lauren Oyler 2021
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2022
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München, nach einem Entwurf von Nicole Caputo
Covermotiv: Nicole Caputo
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
ANFANG
Konsens war, …
HINTERGRUNDGESCHICHTE
Die Geschichte …
MITTELTEIL
(Etwas passiert)
Am Morgen …
MITTELTEIL
(Nichts passiert)
Als Teenager
Nells Schreibgruppe …
KLIMAX
Im ganzen Land …
ENDE
Ein paar Wochen später …
Danksagungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
ANFANG
Konsens war, dass die Welt unterging oder bald untergehen würde, wenn nicht durch exponentielle Umweltkatastrophen, dann durch eine Kombination aus Atomkrieg, dem amerikanischen Zwei-Parteien-System, dem Patriarchat, weißer Vorherrschaft, Gentrifizierung, Globalisierung, Datenpannen und den sozialen Medien. Die Menschen, in der Subway, in den Kneipen, sahen traurig aus; Entscheidungen wurden angezweifelt, Meinungen umgestellt. Überall wurde die gleiche schwerwiegende Erleuchtung herumgeschleppt: Wir befanden uns im Übergang von einer nur rückblickend betrachtet einfachen Vergangenheit in eine unzweifelhaft schwierigere Zukunft; wir waren, es ließ sich nicht länger leugnen, unabwendbar schlecht. Obwohl sich der Tod jeglicher Hoffnung für die Menschheit, als Folge vieler ineinandergreifender, beängstigend gut beschriebener Systeme, seit Jahrzehnten anbahnte, machte erst die kurze Phase zwischen der Wahl eines neuen Präsidenten und dem Moment, als er eine Hand hob und schwor, den Interessen des Volkes zu dienen, endgültig deutlich, was die Stunde geschlagen hatte, ja, dass es zu spät für uns war.
Ich glaubte das alles nicht unbedingt, aber als die Nachrichten immer schlechter und skurriler wurden, geriet ich ins Schwanken. Ich habe immer zum Pragmatismus geneigt, bin nur nicht gerade ein Naturtalent darin; wenn mein Kopf sagt: »Beruhige dich«, sagt mein Herz, ebenfalls merkwürdig ruhig: »Im Drama liegt mitunter ein paradoxer Trost.« Mein offizieller Standpunkt, wenn ich auf einer Party oder so danach gefragt würde, war und ist der, dass man den populären Hang zum Fatalismus auf Selbstüberhöhung und Geschichtsvergessenheit zurückführen könnte, denn die Geschichte hat gezeigt, dass die Menschen schnell dabei sind, das nun endgültig unmittelbare Bevorstehen der Apokalypse zu verkünden, obwohl deren Eintreffen sich permanent verzögert. Wir wollen nicht sterben, aber wir wollen auch nichts so Anstrengendes tun, wie leben es erfordert, daher war die Redseligkeit, mit der der sichere Untergang diskutiert wurde, so öde wie auch irgendwie konsequent: Mit dem Ende der Welt hätten wir alles auf einmal. Da wir ohnehin bald sterben würden, könnten wir unser Potenzial praktischerweise nicht zur Entfaltung bringen; bis es so weit wäre, hatte der Gedanke, dass jetzt alles vollkommen zwecklos war, etwas Verführerisches, insbesondere als Mantra, das man sich zunutze machen konnte, wenn es einem passte, und wieder ablegen, sobald das Leben wirklich beängstigend wurde. Ich selbst verwendete es schon bald dazu, einem meiner weniger anständigen Impulse nachzugeben, indem ich in den ersten Stunden eines Morgens Anfang Januar, als der Himmel noch dunkel war und die Regierung unaufhaltsam weiter auf uns zuraste, im Smartphone meines Freundes herumzuschnüffeln beschloss, während er schlief.
Ich hatte eigentlich nie den Drang verspürt, die Sachen eines anderen zu durchsuchen. Aus einigen enttäuschenden Erfahrungen mit den Chatverläufen von Jungs, mit denen ich in der Schule zusammen gewesen war, hatte ich gelernt, dass meist Banales, Vorhersehbares und Unattraktives zutage kam, wenn man in den Abfallprodukten der Gedanken anderer herumstöberte. Selbst für Männer, die ich intellektuell respektierte, hatte ich nie genügend Zuneigung empfunden, um ihr Vertrauen zu brechen; meine Freunde vor Felix strahlten die gesunde, liebevolle, elementare Verlässlichkeit von heißen Vätern in Fernsehsendungen aus, dabei waren sie, soweit ich wusste, weder heiß noch Väter, noch im Fernsehen. Anders ausgedrückt, hatte ich vor Felix guten Geschmack gehabt. (Abgesehen von einem Wasserpolospieler, mit dem ich im College mal geduscht habe, einer Handvoll Promis und jedem, von dem ich mich in Zukunft vielleicht noch geblendet fühlen werde, meide ich augenfällige körperliche Attraktivität, weil ich glaube, dass sie Leid verheißt.) Aber in den anderthalb Jahren, die wir inzwischen zusammen waren, hatte Felix sich als vollkommen verpuppt entpuppt, und wenn ich quengelte und bohrte und ihn anflehte, mir von seinen innersten Hoffnungen, Ängsten und in der Kindheit geformten Vorurteilen zu erzählen, behauptete er wieder und wieder, dass es da nichts zu erzählen gebe oder, im Widerspruch dazu, dass er mir schon alles erzählt habe und nichts dafür könne, wenn ich mich nicht daran erinnerte. Es war demütigend und typisch, und ziemlich wenig originell nahm ich an, dass er mir etwas verheimlichte, wahrscheinlich andere Frauen.
Er schlief fast immer mit seinem Handy unter dem Kissen. Zuerst hatte ich gedacht, er mache das einfach nur so oder vielleicht aus der Sorge heraus, dass es in der Nacht irgendwelche Notfälle geben könnte, oder auch, weil er früher keinen Nachttisch gehabt hatte, aber seit er sich anders verhielt – nicht merkwürdig, nur anders –, war ich mir zunehmend sicher, dass er es so hielt, weil er befürchtete, ich könnte seine E-Mails oder Nachrichten lesen. Zwar war seine nächtliche Handygewohnheit schon vor der Wandlung vom lustigen, etwas reservierten Typen zum etwas weniger lustigen, noch etwas reservierteren Typen da gewesen, aber egal: Egal, was dahintersteckte, es war seltsam, mit dem Handy unter dem Kissen zu schlafen, und ich hatte es versäumt, darüber nachzudenken, bis die subtile Veränderung seines Verhaltens mich alles, was er tat, in neuem Licht betrachten ließ. Viele Anhaltspunkte hatte ich nicht, aber auch das war egal. Neuerdings erschienen, wenn wir uns schrieben, manchmal kleine Ellipsen im Chat, die darauf hindeuteten, dass Felix über einen längeren Zeitraum etwas an mich tippte, mitunter eine volle Minute lang, doch dann kam gar keine Nachricht bei mir an: Er musste, was immer er getippt hatte, wieder gelöscht haben, und anstatt mir dafür etwas weniger Heikles oder Ausführliches zu schicken, verstummte er einfach ganz, so, als hätten wir Streit. Das klingt relativ harmlos, bis es einem zwölf oder dreizehn Mal passiert ist.
Sein Passwort, das aus Zahlen bestand, war lang und, soviel ich wusste, beliebig; um es zu entschlüsseln, hatte ich ihn wochenlang, wann immer möglich, verstohlen bei der Eingabe beobachtet und mir so Zahl für Zahl in zufälliger Reihenfolge angeeignet. Er brüstete sich häufig damit, nicht handysüchtig zu sein, weshalb diese Prozedur länger dauerte, als es vielleicht sonst der Fall gewesen wäre, zumal wir uns nicht so oft sahen, wie andere Paare mit unserem Status es anscheinend taten. (Ungefähr einmal pro Woche statt mindestens zweimal.) Das kränkte mich – das Gefühl, dass ich zu kurz kam, war stärker als meine wachsende Ambivalenz hinsichtlich unserer Beziehung, was zum Teil sicher an der Distanz lag, die er zwischen uns geschaffen hatte, aber nicht nur –, und so ging es hier, beim Schnüffeln, auch um Rache. Kurz erwog ich, seinen Daumen auf den eingelassenen runden Fingerabdrucksensor zu legen (der gerade schon wieder außer Gebrauch kommt und durch Gesichtserkennung ersetzt wird, was natürlich noch schlimmer ist), aber ich bin kein waghalsiger Mensch; meine Risiken sind kalkuliert, und meine Unehrlichkeit hat Würde.
Ich hatte schon vorher ein paar Gelegenheiten gehabt zu handeln, etwa wenn er Bier kaufen ging und sein Handy auf dem Tisch liegen ließ oder wenn er duschte, was selten vorkam, da er ja meist nicht lange genug blieb, um sich in meiner Wohnung zu waschen. Sein Handy übte immer einen Sog auf mich aus, wie mein eigenes auch, nur auf unheimlichere Art. Er war zwar verschlossen, aber nicht konsequent, woraus ich hätte schließen können, dass er mir nichts verheimlichte, wäre ich mir meiner Sache nicht so sicher gewesen; stattdessen hielt ich diese Vorkommnisse eher für einen Beweis seiner Unfähigkeit oder, wahrscheinlicher noch, für eine Irreführungstaktik. Bis zu jener Nacht hatte ich allerdings gezögert, sein Smartphone in die Hand zu nehmen und meinen Verdacht zu bestätigen. Das lag einerseits daran, dass ich es nach dem Prinzip kollektiver Gegenseitigkeit, aus Grundschulgewohnheit ebenso wie aus aufrichtiger Überzeugung, zu vermeiden versuchte, anderen zuzufügen, was ich selbst nicht zugefügt bekommen wollte. Vor allem aber hatte ich Angst, erwischt zu werden, Angst vor einer verkrampften Konfrontation, in der ich Reue vortäuschen und um Verzeihung bitten müsste, was ich aller Wahrscheinlichkeit nach tun würde, obwohl es mir eigentlich nichts mehr brachte – die Beziehung war für mich im Grunde ja schon zu Ende. Ich bin nicht scharf auf Schreiduelle, schon gar nicht solche, bei denen ich richtig loslegen und meine eigene fragwürdige Ehre verteidigen muss; mir fallen nie einprägsame Beleidigungen ein, und am Ende stehe ich oft wie ein beschämtes Kind da und nicht wie eine leidenschaftliche, selbstbestimmte Frau. Die moralische Überheblichkeit, mit der Felix mich traktieren würde, falls sich herausstellte, dass er nicht mit anderen Frauen schlief – die Rechtfertigung, die ich für mein hinterhältiges Tun brauchte –, war ebenfalls entmutigend. Es würde die unausweichliche Trennung beschleunigen, was zwar erleichternd wäre, aber ich würde dabei absolut erbärmlich aussehen.
Der glückliche Zufall kam auf Grey-Goose-Schwingen. Felix und ich hatten uns in einer Bar um die Ecke von meiner Wohnung einen leichten Wodkaschwips angetrunken, und danach kam er mit zu mir. »Ich bin müde, ich bin müde, ich bin sehr, sehr müde«, sang er auf dem Heimweg. »Ich werd mir nicht mal mehr die Zähne putzen!« Solche Albernheit war untypisch für ihn; sie machte mich nervös. Wenn ich in einem Café zur Musik mit dem Kopf nickte oder auf irgendeine Art spontaner Freude Ausdruck verlieh, wirkte er oft beunruhigt, blickte sich manchmal sogar um und bat mich aufzuhören, als wäre es ihm regelrecht peinlich. Er putzte sich am Ende doch die Zähne und ging, den »Ich bin müde«-Song summend und auf eine süße, verhaltene Weise tänzelnd, in mein Schlafzimmer. Was sollte das? Ich hatte das Gefühl, irgendwie manipuliert zu werden, konnte aber den Finger nicht darauflegen. Als ich ins Bad ging, sah ich, dass er sein Handy auf dem Regal deponiert hatte, wo es allwissend neben seinem Schlüssel, seiner Brieftasche und einem einzelnen Kaugummistreifen lag. Ich bekam einen kleinen Stromstoß, als hätte es mich gerade gefragt, ob wir uns mal verabreden wollten. Im Badezimmerspiegel sah ich in mein gerötetes Gesicht.
Ich bin nicht stolz auf meinen umfangreichen Hautpflegeplan. Kürzlich hatte ich gelernt, dass es wichtig sei, jedes Produkt »vollständig« einziehen zu lassen, bevor man das nächste auftrug, und wenn ich auch nicht allabendlich fünfundvierzig Minuten im Badezimmer saß und auf Transzendenz wartete, gab mir die Schichtenmethode, die ich mir nicht abgewöhnen konnte, doch reichlich Zeit, meine Optionen zu durchdenken. Nachdem ich mir mit einem speziellen, angeblich in Frankreich beliebten Wasser das Gesicht abgewischt hatte, dachte ich, ich mach’s nicht. Nach einer zweiten Reinigung, mit Gesichtsreiniger, auf Empfehlung Koreas, war ich mir da sogar ziemlich sicher. Nachdem ich mit einer wissenschaftlich gestylten Pipette Serum auf die Nase appliziert hatte, um Rötungen zu mildern und zu »klären«, dachte ich: Große gesellschaftliche Umwälzungen sind ohne weibliches Ferment unmöglich. Nach dem Abtupfen mit einem brennenden, sehr teuren Schaum, von dessen Wirkung ich nicht überzeugt war, dachte ich: Ha, das ist witzig. Bei der Feuchtigkeitscreme angelangt, war ich taufrisch und entschlossen: Ich hatte nichts zu verlieren außer meinen Ketten.
Sofort begann ich, mir Sorgen zu machen, dass ich meine Chance verpasst haben könnte; dass Felix, auch wenn er in keinem sozialen Netzwerk war, in dem er im Dunkeln vor dem Einschlafen stumpfsinnig herumscrollen konnte, dabei sein Augenlicht gefährdend und seinen Schlafzyklus durcheinanderbringend, von dem Drang übermannt worden war, nachzuschauen, wie das Wetter morgen werden würde, oder seine E-Mails zu checken oder nach der Definition eines Wortes zu suchen (keine Ahnung, wofür Menschen ohne soziale Netzwerke ihre Handys benutzen), und das Telefon vom Regal genommen hatte. Nein. Es lag noch da. Ich schlich an der Tür meiner Mitbewohnerin vorbei ins Schlafzimmer. Felix atmete gleichmäßig, einen Arm angewinkelt, sodass sein kantiger Ellbogen auf meine Seite des Bettes ragte. Ich nahm die Brille ab und legte mich unter die Decke, auf den Rücken, die Arme unbequem dicht am Körper, um Kontakt mit seinem schmerzverheißenden Gelenk zu vermeiden. Felix regte sich. Ich starrte in die Dunkelheit und begann zu warten, dann und wann vom vorwurfsvollen Scheppern der besessenen Heizung aufgeschreckt.
Ich döste und wachte auf, döste und wachte auf, bis die vertraute Schrifttype mir sagte, es sei 03:12, und ich wie in Trance seinen Passcode eingab. Die Schlafzimmertür: Ich machte sie ganz langsam zu, damit sie nicht knarrte, ließ sie nicht einschnappen. Auf dem Sofa vorgebeugt, die Ellbogen auf den Knien, um mich herum der Lichtschein des Handys, registrierte ich, dass als Erstes der Homescreen aufging, dorthin musste ich also zurück, bevor ich mich wieder schlafen legte. Zunächst war da zu viel Information, um irgendetwas zu begreifen; ich fühlte mich kopflos, als hätte ich gerade aus einer Laune heraus einen Walmart betreten, um mir vielleicht Socken, vielleicht eine Zeitschrift, vielleicht eine neue Sorte Tiefkühlburritos zu kaufen, und wäre nun stattdessen mit der überwältigenden Verschwommenheit meiner Wünsche konfrontiert. Ich blickte mich zu meiner Schlafzimmertür um, vertraute darauf, dass ich das Bett quietschen hören würde, falls er aufstand. Auch wenn ich nicht glaube, dass es so etwas wie schlechte Menschen überhaupt gibt, abgesehen von dem Wasserpolospieler, mit dem ich im College mal geduscht habe, und einer Handvoll Promis, war ich so nervös, dass ich fürchtete, doch ein schlechter Mensch zu sein, wenn ich bereit war, mich so furchtbar zu fühlen, um das relativ geringfügige Delikt zu verüben, das ich gerade verübte. Wahrscheinlich ist meine Definition eines »schlechten Menschen« egozentrischer als die anderer Leute, obwohl, die Sorge, ein schlechter Mensch zu sein, ist ohnehin komplett egozentrisch. Gute Menschen denken nicht in so kategorischen Begriffen.
Es war ein normales iPhone, mit den schön abgerundeten Ecken, die kürzlich im Zentrum einer (abgeschmetterten) höchstrichterlichen Entscheidung gestanden hatten. Die kleinen quadratischen Icons mit den ebenfalls schön abgerundeten Ecken waren nach seinen unergründlichen persönlichen Vorlieben angeordnet, jedes mit einem hübschen Bild versehen, für dessen Entwicklung zu etwas Wiedererkennbarem, wenn nicht Unvergesslichem jemand eine Menge Geld bekam, alle verschiedenfarbig, aber irgendwie gleich hell, was den Effekt hatte, dass das Auge nie ganz fokussieren konnte und auch nie ganz ermüdete, sodass man sowohl zu viel als auch gar nichts zu sehen meinte. Die manuelle Kamera, der Farbenkreis, die Karten, die bessere Version der Karten, die Uhr, die einen echten, tickenden digitalen Zeitmesser abbildete, zwei Arten, ein Taxi zu rufen, das Wetter, teils wolkig, aber immer leuchtend blau, das Notizbuch. Die Apps, die ins Handy integriert waren und nicht gelöscht werden konnten: der Appstore, der ärgerliche Gesundheitsmonitor, der maß, wie viele Schritte am Tag man machte und wie viel Schaden der Kopfhörer dem Gehör zufügte, die Brieftasche, die bedeutete, dass man seine Bordkarte nicht mehr ausdrucken musste, der Internetbrowser, der ein Kompass war, aber auch eine Safari. Sein Akku war halb aufgeladen; er war automatisch mit dem Internet in meiner Wohnung verbunden. Ich tippte auf den Nachrichten-Tab, und eine Unterhaltung mit mir erschien, der Versuch, eine Zeit und einen Ort für unser Treffen zu finden. Da wir beide ein iPhone hatten, wie jeder, benutzten wir für Kurznachrichten die handyeigene App, iMessage, bei der die Textblasen des Handybesitzers hellblau sind und die des Gesprächspartners hellgrau. Ein Gespräch, an dem ich vor wenigen Stunden selbst teilgenommen hatte, jetzt andersherum zu sehen, war irritierend. Verschwunden das Flair, das ich meiner Zeichensetzung gegeben zu haben glaubte; zu identifizieren war ich nur, weil ich die Fakten des Austauschs kannte, weil auch ich Felix vorgeschlagen hatte, dass wir uns um halb neun in der dunklen Bar mit Kamin treffen könnten, damit ich Zeit hätte, vorher noch ein Stück Pizza zu essen. Mein Name über dem Nachrichtenverlauf wirkte nicht wie meiner; es war, als wäre ich nur einer von Hunderten, mit der ein anderer jederzeit virtuell in Kontakt treten könnte, und was immer ich gesagt oder nicht gesagt hatte, unterschied sich nicht von dem, was irgendwer anders hätte sagen mögen.
Der Rest der Nachrichten war nicht weiter bemerkenswert; in den letzten paar Tagen hatte Felix seiner Mutter geschrieben, einem Kollegen, einem Freund, den ich nicht ausstehen konnte, seinem Hausverwalter und einem Künstlerpaar, mit dem er einen Gruppenchat unterhielt. Es gab auch Frauen, aber ich wusste zumindest grob, wer sie waren, und die Dialoge waren bloß lahme Flirtversuche, beiläufige Kontaktaufnahmen, wenn Felix durch irgendetwas an eine von ihnen erinnert worden war oder sie an ihn; hauptsächlich bestanden sie aus einfallslosen Hahas und Cools. Ich ging wieder zu unserer Unterhaltung zurück, damit sie als Erste auftauchen würde, wenn er seine Nachrichten öffnete, und dann, schon weniger nervös und weniger aufgeregt, zum Homescreen, wo ich auf das E-Mail-Icon tippte und ähnlich vorging, nach dem Namen seiner Ex-Freundin suchte, im Gesendet-Ordner und im Papierkorb nachschaute. Enttäuscht, weil das alles so langweilig war, und mittlerweile hundemüde, wollte ich schon aufgeben, als ich das einzige Icon sah, das Bilder von kleineren Icons enthielt, ganz unten rechts auf dem Bildschirm, bezeichnet mit no.
Als ich es antippte, wurde das kleine Kästchen zu einem größeren, mit zwei Nachrichten-Apps darin, von denen ich noch nie gehört hatte, und der App eines sozialen Netzwerks, bei dem Felix, wie er mich glauben gemacht hatte, keinen Account mehr unterhielt. Er habe sie alle gelöscht, kurz nachdem wir zusammengekommen seien, hatte er gesagt, was von einer Entschlossenheit zeugte, die mich beeindruckte, zumal er mir nie internetsüchtig erschienen war; mir war daher nicht ganz klar, wieso er es gemacht hatte. Jetzt dachte ich augenblicklich an das Naheliegende: Sehnsuchtsbeteuerungen, am Hals oder Bauchnabel abgeschnittene Fotos, Verabredungen in Gegenden der Stadt, wo er meines Wissens nie hinfuhr. Ich konnte mir vorstellen, dass er dumme Frauen fickte, junge Frauen, Frauen, die er leicht wieder loswerden konnte, und dass es das war, was er hier tat, vielleicht sogar unter Pseudonym. Im Schein des Smartphones lächelte ich albern, während meine augenblicklich einsetzende Freude mich zugleich beunruhigte.
Ich tippte auf eins der Icons, Instagram, und das vertraute Layout dehnte sich aus, bis es den Bildschirm füllte. Eine Reihe runder Userfotos am oberen Rand wies auf Accounts hin, die Storys gepostet hatten, Fotos, die binnen vierundzwanzig Stunden verschwinden würden und die ich mir, wie ich aus reichlicher Vorsicht dachte, besser nicht anschauen sollte; wenn ich es täte, würden sie später am Ende der Reihe ohne den schattierten Ring um sie herum auftauchen, was darauf hindeuten würde, dass jemand anders sie sich angeschaut hatte. Der »Neue Nachrichten«-Tab zeigte »68« an. Darunter war der Anfang seines Feeds, bevölkert von Leuten, denen er folgte. Da Lesen nicht der Zweck dieser App war, hatte ich Wörter immer instinktiv übersprungen – Überschriften, Usernamen, Likes-Listen und Kommentare –, doch als ich runterscrollte, darauf bedacht, nicht zweimal zu tippen und irgendeinem Post versehentlich Felix’ Herz hinzuzufügen, stellte ich fest, dass alle Accounts, denen er folgte, dunkle, verwackelte und unbearbeitete Bilder posteten oder primitive Cartoons, deren Bedeutung so unklar war wie die Absicht derer, die sie gepostet hatten. Als ich schon nach kurzer Zeit eine Benachrichtigung von der App bekam – »Du bist auf dem neusten Stand! Du hast alle neuen Beiträge der letzten 2 Tage gesehen« –, empfand ich nicht jene Scham, die sich normalerweise einstellte, wenn ich beim Scrollen durch meinen eigenen Feed so weit kam. Vielmehr war ich überrascht: Felix musste ständig auf Instagram aktiv gewesen sein. Ganz unten auf dem Bildschirm war eine Reihe unauffälliger Strichzeichnungen, ein Haus, eine Lupe, ein Pluszeichen, ein Herz. Die rudimentäre Silhouette einer Gestalt führte mich zu seinem Profil, wo ich merkte, dass ich den Text würde lesen müssen.
Die Themengebiete reichten von Wissenschaft über Politik und Wirtschaft bis zu nationaler Sicherheit, die Illustrationen waren plump und amateurhaft: knackig blauer, mit bauschig-weißen Linien schraffierter Himmel; bildmanipulierte Treffen von Barack Obama mit George W. Bush, Bill Clinton und Jacob Rothschild, die alle in unnatürlicher Haltung einen Arm ausstreckten, um eine Waffe auf den Betrachter zu richten; finster dreinblickende Frauen neben Mobiltelefonen, die schädliche Energie ausstrahlten; die verschwommenen Zwillingstürme in den Momenten, bevor und nachdem sie getroffen wurden; alles mit Warnungen in großen, kunstlosen Schrifttypen versehen. Die Regierung irgendwie schuld. Die Juden irgendwie schuld. Unerhörte, unglaubliche Fakten. Ich merkte mir den Usernamen, verließ die App, wischte sie aus der Reihe offener Seiten, sperrte das Handy mittels des Buttons an der Seite – zum Glück war der Ton aus – und legte es in derselben achtlosen Ausrichtung, in der ich es vorgefunden hatte, wieder aufs Regal. Mich packte eine Entschlossenheit, die ich in einem Arbeitsumfeld nie wiederherstellen könnte. Mein Freund war ein Verschwörungstheoretiker. Ich hätte lachen können, aber davon wäre er wach geworden.
Als ich @THIS_ACCOUNT_IS_BUGGED_ auf meinem eigenen Handy durchsuchte, bekam ich eine Ahnung davon, wie gefragt er war: Zehntausende Follower, Hunderte Kommentare zu jedem Post, immense Dankbarkeit, weil er einer der wenigen sei, die die Wahrheit nicht nur einräumten, sondern sich auch bemühten, sie zum Wohl anderer aufzudecken. Anstelle von Empörung oder Gekränktheit empfand ich jähe, magische Erleichterung. Ich wollte, dass es mit uns aus war. Ich wollte nicht, dass die Dinge zwischen Felix und mir signifikant anders, aka besser wurden, als sie es seit einiger Zeit waren, oder dass die unschöne Verkrampftheit unserer Beziehung sich ohne Bemühen meinerseits in schönsten Frieden verwandelte; vielmehr wollte ich Befreiung, einen Schlussstrich, das Ende der Sorgen. Vielleicht hatte ich grausigerweise gehofft, dass er mich betrogen hatte, aber dies war ein klarerer Fall: Wenn er einen gefragten Internet-Account unterhielt, der Verschwörungstheorien verbreitete (und vielleicht selbst aufstellte), war er nicht nur ein Vertrauensbrecher oder Gelegenheitsmanipulierer, sondern ein Mensch von unmöglicher Komplexität, dessen Beweggründe ich nun nicht mehr zu entwirren brauchte. Vielleicht könnte man ihn anhand irgendeiner verdrehten Logik ja sogar verstehen, aber ich war nicht diejenige, die es herausfinden würde. Denn Felix war keine verirrte, vom Pech verfolgte Seele, ungebildet und abgehängt, keiner, der eine Verschwörung am Werk sehen musste, um sich seinen Schmerz zu erklären; er glaubte nicht, dass die Regierung aus unbekannten, aber zweifellos schändlichen Gründen Luftfahrzeuge aus großer Höhe Chemikalien versprühen ließ, um bei der unschuldigen, ahnungslosen Bevölkerung am Boden Krebs, Alzheimer und grippeartige Symptome und Beschwerden zu verursachen. Er glaubte nicht, dass die Welt von einer kleinen Gruppe extrem einflussreicher zionistischer Verschwörer regiert wurde oder dass WLAN-Strahlen diverse wichtige »Zellen« schädigten, die den Schlaf, kognitive Funktionen und die Immunabwehr beeinflussten. Er glaubte nicht, dass die Terroranschläge vom 11. September 2001 interne Missionen der US-Regierung gewesen waren, mit denen die Invasion Iraks und Afghanistans gerechtfertigt werden sollte. All das wusste ich über Felix, so wie ich anderes über ihn wusste; rückblickend betrachtet, war das wohl nicht viel. Trotzdem, ich bin mir ziemlich sicher, dass er jüdisch war, es wäre also merkwürdig gewesen, wenn er ernsthaft antisemitische Verschwörungen propagiert hätte – möglich, aber merkwürdig. Er war enervierend rational, fragte immer nach Quellen und Beweisen, selbst wenn wir in den frühen Morgenstunden, nach vielen Drinks, bloß herumblödelten. Er war resistent gegen Gesundheitstrends, mit denen schädliche Stoffe wie Toxine eliminiert werden sollten, glaubte, sie würden bloß erfunden, um Sachen zu verkaufen, und die einzige Wissenschaft, die sie anspreche, sei diejenige, die dazu benutzt werde, belanglose Empfindungen aufzuplustern. Einmal gerieten wir in einen Streit über Biomilch. (Ich bin dafür.) BUGGED, also verwanzt, war auch kein Wort, dass echte Internet-Verschwörungstheoretiker verwendeten – es war eine mehrdeutige Entlehnung aus der Vergangenheit, eine Anspielung, ein Indiz. Eins seiner Fotos, neunzehn Wochen zuvor gepostet, war ein Triptychon, auf dem irgendetwas Verschwommenes herangezoomt wurde, offenbar an die Seite eines mit Asche bedeckten World-Trade-Center-Gebäudes angedockt, das von Bild zu Bild schemenhafter wurde; auf dem letzten Foto hatte er das unbestimmte Ding eingekringelt und als ein DEMOLITIONSQUID entlarvt. Ein Insiderwitz, der sich als nachvollziehbarer Schreibfehler tarnte – ein demolition squad war ein Sprengkommando. Für gewöhnlich schlief Felix, wie ihr wisst, mit seinem Handy unter dem Kissen.
Als ich da so schadenfroh und frenetisch auf meinem Sofa saß, boten sich mir viele reizvolle Optionen. Ich könnte ins Schlafzimmer stampfen und ihn rauswerfen, mit oder ohne Erklärung. Ich könnte mir sein Handy noch einmal vornehmen und dort mein Unwesen treiben, über den Account selbst oder seine E-Mails, Kurznachrichten usw. Ich könnte gar nichts tun, außer von jetzt an provokante Formulierungen in unsere Gespräche einzustreuen, die darauf hindeuten, ihm aber nie zweifelsfrei bestätigen würden, dass ich etwas wusste, was ich nicht wissen sollte. Oder ich könnte Zeit schinden: erst mit ihm Schluss machen, wenn ich es mit der würdevollen Gelassenheit tun könnte, die der Partnerin eines hilfsbedürftigen Menschenanstünde. Ob er Hilfe bekam, hätte mich wahrscheinlich nicht ernsthaft geschert; dies hier gab einer Beziehung den Rest, die immer löchrig und instabil gewesen war, und ich wollte das schwerelose Gefühl der Rechtschaffenheit, das ich deswegen empfand, noch genießen, als ein Geheimnis, das nur ich kannte, und zwar ein wesentlich originelleres als das typische »Wenn ich sage, ›Ich liebe dich‹, ist es nicht mehr ehrlich gemeint«. Ich stellte mir vor, wie befriedigend es wäre, pseudo-neugierig zu sagen: »Ich habe in deinem Handy gestöbert und entdeckt, dass du einen gefragten Verschwörungstheorien-Account bei Instagram unterhältst, und ich wollte nur mal wissen … warum?« Aber ich war mir nicht sicher, ob das die absolut beste Art war, mein Blatt zu spielen, und ich wollte mein Blatt unbedingt auf die absolut beste Art spielen. Meinen letzten Freund hatte ich grausam, tollpatschig und ungeschminkt (buchstäblich) abserviert, war einfach damit herausgeplatzt, dass ich ihm etwas sagen müsse, als er gerade dabei war, mit seiner Unterhose Samen von meinem Bauch zu wischen, ein postkoitales Ritual, das ich aus heutiger Sicht rührend finde. Dieses Mal wollte ich einen falschen oder gefühlskalten Umgang mit der Situation um jeden Preis verhindern, bot sich mir hier doch die Chance, die ganz und gar und einzig Gute zu sein. Ich checkte meinen Twitter-Account und beschloss zu warten.
Vielleicht findet ihr es verurteilenswert, dass ich mich wieder zu jemandem ins Bett legte, der so etwas tat, dass ich mich nicht abgestoßen genug fühlte, um ihn auf der Stelle aus meiner Wohnung und meinem Leben zu werfen. Wenn er auf eine üblichere, täuschend ernsthafte Art Fehlinformationen verbreitet hätte, sagen wir, in einem online veröffentlichten Leitartikel, wäre er verurteilt worden, und jeden, der ihn nicht verurteilt hätte, hätte man befragt, wenn nicht selbst verurteilt. Die ethischere Alternative – ein offenes Gespräch mit dem zu Verurteilenden zu führen, ihn zu fragen, was er da tat und warum – schien mir auch nicht reizvoll, vor allem damals nicht, als ich mich nihilistisch und niedergeschlagen fühlte. Dennoch, mir ist schon klar, dass die obige Argumentation nicht gut genug ist. Ich weiß nicht, warum ich das Handy weglegte, die Tür ganz langsam öffnete, um ihn nicht zu wecken, mich auf meine Seite des Bettes legte und vorgab, alles ungelesen gemacht zu haben, was ich gesehen hatte. Ich hatte keine Schwierigkeiten einzuschlafen. Als ich am nächsten Tag aufwachte, war ich ruhig. Jetzt stelle ich mir manchmal vor, ich wäre ins Schlafzimmer gestürmt und hätte ihn wach gerüttelt – er hasste es, aus dem Schlaf geschreckt zu werden, schien immer persönlich beleidigt, wenn irgendein plötzliches Geräusch gemacht wurde, während er nicht bei Bewusstsein war – und von ihm verlangt, mir zu sagen, was verdammt noch mal da los sei. Was immer er in diesen Fantasien zu seiner Verteidigung zu sagen hat, im Halbschlaf, besorgt, wütend, reicht nicht aus, und mit seinem Smartphone wie dem Liebesbrief einer heimlichen Freundin in der Hand schmeiße ich ihn mitten in der Nacht aus der Wohnung. Manchmal werfe ich ihm das Handy hinterher, die Treppe hinunter; manchmal behalte ich es auch. Ich glaube, Letzteres wäre der Ausgang, der mir das größere Machtgefühl verliehen hätte.
Vielleicht mache ich mir und anderen da aber auch etwas vor. Vielleicht waren da irgendwo noch zärtliche Gefühle für Felix, die ich gern vertuschen würde, bedenkt man, was meine Verbindung mit ihm für ein Licht auf mich wirft, und ich würde lieber so tun, als hätte ich mir ein strategisches Vorgehen überlegt, als zuzugeben, dass ich hin- und hergerissen war. So war es sicherlich, obwohl es sich nicht so anfühlt. Und bestimmt werden manche von euch sagen, strategisches Vorgehen sei unmoralisch. Wie auch immer, ein paar Tage später waren wir – ein letztes Mal, wie sich zeigen sollte – in einem Restaurant auf der Lower East Side verabredet, das erst kürzlich vom Besitzer eines anderen, bei Leuten aus der Kunstwelt beliebten Lokals eröffnet worden war, und das entspannende Gefühl, am längeren Hebel zu sitzen, machte mich zu einer generösen Gesprächspartnerin. Neuerdings gingen wirklich alle nach Japan, pflichtete ich ihm bei, während ich in die Speisekarte schaute und die Instagram-Accounts eines Kollegen und eines Freundes meines Bruders zitierte. Das sei dumm, fügte ich hinzu, denn nun könne man selbst nicht mehr da hin, ohne wie eine dem Trend hinterherrennende Amateurin auszusehen, dabei wolle ich auch gern mal nach Japan. Felix war schon dort gewesen und fand es aufregend, zog aber Südamerika vor, das er als »härter« bezeichnete. Mmm, sagte ich zustimmend, obwohl ich Härte hasste und dagegen war, sie sich anzueignen. Er hatte einen dichten Bart, ordentlich getrimmt, an dem er bei dieser Äußerung mit einer seiner fleischigen Hände zupfte. Es gab Hintergrundmusik, die Pflanzen waren üppig, die Speisen eine Mischung aus spanischen, italienischen und französischen Einflüssen, und obwohl die Cocktailpreise ungeheuer waren, kosteten die Weine nicht viel.
Ich empfehle dieses Restaurant noch immer, hege da keine komplizierten Gefühle. Kurz nachdem wir uns hingesetzt hatten, erzählte Felix dem Kellner, einem sanften, schönen, schwulen Mann, dass wir da seien, um meine Aufnahme in einen Promotionsstudiengang zu feiern; der Kellner hob die Augenbrauen und gratulierte, als er hörte, wo ich studieren würde. Felix lächelte mich über den flackernden Tisch hinweg an. Das ist noch ein Grund, warum ich wusste, dass Felix im Kern kein paranoider Falschbuchstabierer war, im Internet bekannt als @THIS_ACCOUNT_IS_BUGGED_: Ich war in keinerlei Promotionsstudiengang aufgenommen worden, schon gar nicht in Harvard, aber Felix machte es Spaß, anderen Leuten kleine, belanglose Lügen aufzutischen und geringfügig alternative Realitäten daraus zu schaffen, ein Spiel ohne anderen Zweck als den, sich selbst zu vergnügen und mich zu verwirren. Bisher war das unser gemeinsames Ding gewesen, zumindest hatte ich das gedacht und es harmlos und witzig gefunden, aber jetzt schien es nur dazu da, intellektuelle Macht über Fremde auszuüben, die es nicht besser wussten und nie besser wissen würden. Hätte ich überhaupt Anfang Januar schon eine Zusage für ein Promotionsstudium haben können? Zeitlich schien mir die Geschichte schlecht durchdacht, aber ich hatte keine Ahnung. Ich übte schon mal das Alleinleben, indem ich mit dem Kellner, der Dean hieß, zu flirten begann, Burrata, ja, das sei ja so ein toller Käse, bevor Felix mich überbot und Sekt bestellte, »um das Genie zu feiern«. Als Dean zurückgeflitzt kam, kippte ich den Schaumwein, sobald er ihn mir eingeschenkt hatte, theatralisch hinunter, eine Zurschaustellung, wie Felix sie hasste, und lächelte, ein Lächeln, das ich mit selbstgefälliger Überheblichkeit zu tränken versuchte. Dean, der den Kopf schüttelte, als wären wir alte Freunde und er mich, wie immer, einfach bezaubernd fände, erklärte, ich sei »eine Inspiration!«. Er schenkte mir nach, während ich mir etwas Flüssigkeit aus den Mundwinkeln wischte. Später brachte er uns Dessert, aufs Haus, und Felix aß nichts davon.
HINTERGRUNDGESCHICHTE
Die Geschichte unseres Kennenlernens ist witzig, vielleicht sogar witzig genug, um zur Beantwortung einer der Fragen beizutragen, die ihr inzwischen wahrscheinlich habt: Warum war ich mit ihm zusammen? Bitte berücksichtigt dabei, dass ich die Antwort im Moment, also zu Beginn dieses Absatzes, selbst nicht vollständig kenne – dass ich mit diesem Text genauso sehr versuche, mich besser zu verstehen, jenen Menschen, der wohl oder übel die wichtigste Figur in dieser Erzählung ist (wenn nicht gar, Verzeihung, die faszinierendste), wie ich vorhabe, ein Publikum zu begeistern, bestimmte Prinzipien, die in der zeitgenössischen Literatur meiner Meinung nach fehlen, voranzubringen, Ereignisse sowohl welthistorisch als auch zwischenmenschlich zu interpretieren (vielleicht beides zugleich) usw. Berücksichtigt auch, dass es, sobald man mit jemandem zusammenkommt, einfacher ist, bei ihm zu bleiben, als ihn zu verlassen, und dass es sich, sobald man eine gewisse Menge Zeit und Mühe in eine Beziehung oder ein Hobby oder was auch immer investiert hat, wie eine Verschwendung dieser Zeit und Mühe anfühlt, wenn man die Sache beendet. Mit das Nützlichste, das ich je gelernt habe, stammt aus der einzigen Vorlesung in Ökonomie, die ich je gehört habe, denn da wurde der Begriff »versunkene Kosten« erklärt, aber das ist noch so etwas, das zu beachten ich anderen besser raten kann, als es selbst anzuwenden.
Wie auch immer, Juni 2015: Ich war auf Urlaub in Berlin, wohin mir ein brasilianisches Paar gefolgt war, das ich in einem Wiener Hostel kennengelernt hatte. Sie waren so froh, zeigten sich wiederholt so begeistert, dass ich nicht nur das gleiche Ziel hatte wie sie, sondern auch in derselben Straße wohnen würde. Sie bestanden darauf, dass ich ihnen meine Handynummer gab und wir unsere Sightseeing-Pläne koordinierten. Da ich keine Sightseeing-Pläne gemacht hatte, war die Koordinierung ziemlich einfach. Ich nickte zu allem und äußerte Interesse an den von ihnen vorgeschlagenen Sehenswürdigkeiten, von denen die meisten mit dem Wort underground warben. Zuerst fand ich die beiden süß, ihren Akzent charmant und ihren Enthusiasmus erfrischend; auf dieser Reise versuchte ich, mich der Schönheit neuer Menschen und Erfahrungen zu öffnen. Geht es beim Reisen nicht genau darum, fragte ich mich, während ich ein Schnitzel aß. Dass Berlin nicht die unüblichste Station nach Wien ist, ließ die Aufregung der beiden über unsere angeblich vom Schicksal bestimmte Begegnung noch goldiger erscheinen; vielleicht ist Prag–Berlin die noch gängigere Strecke, aber die Brasilianer und ich hatten unsere Reiserouten beide auf deutschsprachige Länder beschränkt, obwohl keiner von uns Deutsch sprach. »Prag … das ist wie Disney«, sagten sie und verdrehten die Augen. Sie verübelten es ihren Eltern, dass sie sie auf eine amerikanisch-internationale und nicht auf eine deutsche Schule geschickt hatten; jeder Schwachkopf könne Englisch lernen – das spreche ja jeder! –, aber dank ihren blöden Eltern wäre alles Deutsch, das sie nun noch lernen könnten, fehlerhaft. Versuchten sie denn, Deutsch zu lernen, fragte ich. Nein – das habe jetzt keinen Sinn mehr. Als wir alle in Berlin angekommen waren, sie mit dem Nachtzug, ich mit dem Flugzeug (die Ticketpreise waren in etwa gleich – wir fanden alle drei, dass das unglaublich war und sie die Verkehrsmitteloptionen genauso gründlich hätten recherchieren sollen, wie sie alle buchbaren Aktivitäten in ehemaligen Bunkern erforscht hatten), bedauerte ich meine in diesem Zusammenhang unzuträglich amerikanisch erscheinende Freundlichkeit sofort und fragte mich, ob ich zum Clubbing (nicht der coolen Sorte) gezwungen werden würde. Ich hätte ihre Nachrichten unbeantwortet flottieren lassen sollen. Ich hätte vorgeben können, unzuverlässig zu sein, eine, die ihr Handy nicht oft checkt – das hat ja durchaus etwas Vornehmes –, und mir, wenn ich ihnen auf der Straße begegnet wäre, irgendwas ausdenken können, um spontanen Einladungen entgegenzuwirken: ein Treffen mit einem alten Freund, Tickets für ein Theaterstück, zu dem ich zu spät kommen würde, wenn ich mich nicht beeilte. Ich gehe normalerweise nicht ins Theater, aber ich dachte mir: Wo ich schon mal in Europa bin!
Stattdessen schleppten sie mich mit auf einen Pub Crawl, der von einem Touristikunternehmen gesponsert war, indem sie mich zuerst von meinem Glauben abbrachten, dass »man in den USA eigentlich keine Pub Crawls macht«, und dann versuchten, mich als verschlafene Puritanerin hinzustellen, ja sogar so weit gingen, mich zu fragen, ob ich Angst hätte, mein »Schiff nach Hause, die Mayflower«, zu verpassen. »Kostet nur acht Oh-iie-rohs«, sagten sie lasziv, »und man kriegt für eine Stunde Bier ohne Ende!« Eine Stunde Bier für acht Euro klang für mich, die ich noch nie in Berlin gewesen war und nicht wusste, wie viel Bier hier nicht kosten konnte, nach einem guten Deal. Außerdem fühlte ich mich schlecht wegen der hier aufscheinenden Einseitigkeit der Kulturkenntnisse – ich habe keine Ahnung, was das brasilianische Äquivalent der Mayflower ist, von einer Vertrautheit mit der Geschichte des Landes, die es mir erlauben würde, es in einem Scherz auf Kosten eines seiner Einwohner zu verwenden, ganz zu schweigen. Schließlich gab mir die journalistische Neugier – ich war Journalistin, gewissermaßen – den letzten Schubs. Na gut, sagte ich, ich komme mit. Die meisten Theaterstücke, die gerade liefen, hätte ich sowieso nicht verstanden.
Die Gruppe traf sich in Mitte und begab sich unter die Fittiche einer jungen, durchsetzungsstarken Polin mit Klemmbrett und eines hochgewachsenen Mannes von ambivalenter Ausstrahlung, der andauernd die Hände in die Hüfte stützte und sie dann verschränkte und wieder in die Hüfte stützte. Er hatte dickes, braunes, zu einer normalen Männerfrisur geschnittenes Haar, leicht rechteckig mit ein wenig Bewegung oben, und trug, wie seine Kollegin, ein rotes Polohemd, auf das der Name des Touristikunternehmens gestickt war und dessen Ärmel etwas zu weit unten an seinem Arm endeten. Die Sonne hatte gerade erst zu ihrem langsamen Sommeruntergang angesetzt und wurde von den nahen Straßenbahnschienen orange reflektiert. Während andere zu den beiden hingingen, um ihre acht Euro zu blechen, flirtete er mit jedem Mann und jeder Frau, reagierte bereitwillig, aber beherrscht auf ihre Witze und Fragen, wie ein mittelalter Lehrer mit unsittlichem Innenleben, das ihm im Dienst eine subversive Quelle des Selbstvertrauens ist. Sie fragten, wo der Reichstag von hier aus gesehen sei, wo unsere Tour uns heute Abend entlangführen werde, welches seine Lieblingsbars seien, ob er, auch wenn er nicht für den Pub Crawl arbeite, in die Bars gehe, die wir heute kennenlernen würden, ob hier, wo wir stünden, früher Osten oder Westen gewesen sei. Als ich an der Reihe war, sah ich ihm über den Rand meiner Brille hinweg in die trüben Augen – ich bin groß, aber nicht so groß – und lächelte mit geschlossenem Mund, um ihm, wie ich hoffte, meine Skepsis hinsichtlich unserer bevorstehenden Unternehmung zu vermitteln, wettete einfach darauf, dass er seinen Job hasste, und wenn er es nicht tat, wäre es egal, ob ich Skepsis gezeigt hatte, weil ich dann mein Interesse an ihm aufgeben und weiterziehen würde, zu jemandem, der ebenfalls fand, dass organisierte Pub Crawls bloß einer der unzähligen, demütigenden Exzesse verzweifelter postglobalisierter Volkswirtschaften war. Er lächelte mit geschlossenem Mund zurück, nicht routinemäßig, aber auch nicht zweideutig, und da gerade ein ungutes Erlebnis am College hinter mir lag, bei dem ich meine zwanzig Sekunden an der Spitze der Schlange zu dem Versuch genutzt hatte, mit einem berühmten Autor zu schäkern, während er mein Exemplar seines Romans signierte, zog ich mich zurück, ohne irgendwelche kleinen Kommentare abzulassen. Als es Zeit für ihn war, seinen Einführungssermon zu halten, hüpfte er auf die oberste Stufe einer kleinen Treppe, stellte sich vor und skizzierte mit geübten Gesten den Verlauf des Abends: vier Bars zu Fuß, dann mit der S-Bahn gen Osten in einen Club, ärgert euch nicht über die Deutschen, sie mögen euch nicht. Kasia stellte sich als solche vor und versuchte zu lächeln. Die meisten Teilnehmer, deren Muttersprache nicht Englisch war, schienen seine sarkastischen Kommentare nicht wirklich zu verstehen, was ihm eine gewisse kreative Freiheit gab, die mich überraschte und anzog, und als wir die Straße hinunter- und durch eine Grünanlage marschierten, die mir erstaunlich groß und leer vorkam, schließlich befanden wir uns im Zentrum einer Großstadt, wo es legal ist, draußen Alkohol zu trinken, merkte ich, wie ich, die Brasilianer auf den Fersen, in seine Nähe zu kommen versuchte, bis ich nicht genau neben ihm ging, aber auch nicht weit entfernt. Er unterhielt sich freundlich mit einem Paar aus der Slowakei, das, wie ich später erfuhr, auf Hochzeitsreise war, und obwohl ich das sehr deprimierend fand, schien es ein gutes Zeichen zu sein, dass er es schaffte, mit ihnen zu plaudern, ohne sie zu beleidigen. Wir erreichten eine Reihe leerer, hüttenartiger Lokale am Fluss, an der Spree; ein paar Leute mit Getränken in der Hand verzogen sich von ihren idyllischen Plätzen im Gras, als sie die plappernde Horde von Akzenten kommen sahen, gaben den direkten Blick auf den Fluss und die grandios europäisch aussehende Museumsinsel dafür auf. Vor einer der niedrigen, dunklen Bars war ein Fass aufgestellt, von Plastikbecherstapeln flankiert, und wir wurden angewiesen, für eine Stunde so viel Bier zu trinken, wie wir konnten, während uns ein stummer, vermutlich deutscher Mensch von der Türschwelle aus ungerührt dabei zusah.
Ich nahm mit den Brasilianern am Boden Platz und bekannte mein Interesse an unserem Guide. Es war eine Taktik, die ich bei meiner Mutter oft anwandte: Biete einen kleinen Leckerbissen an, den die meisten Leute als intime Information betrachten würden, während du selbst kein Problem damit hast, sie preiszugeben – ich wähle immer etwas Romantisches –, dann denken die anderen, sie stehen dir nah, wissen etwas Wesentliches über deinen Charakter, und du bekommst von ihnen, was du willst, wozu auch gehört, sie nach Belieben loszuwerden. Die Brasilianer gurrten und schrien auf und sagten, ich müsse mit ihm reden. Ich antwortete mit meiner Gossip-Girl-Stimme: Ich weiß, aber worüber? Ich sei es nicht gewohnt, Männer anzubaggern – normalerweise machten sie mich an, haha –, aber irgendetwas an ihm fände ich fesselnd. Sie sagten, ich solle ihn fragen, was ich in Berlin unternehmen könne. Das war ein miserabler Vorschlag, fand ich, also sagte ich: Gute Idee. Obwohl ich keinen Auslandstarif hatte und deshalb keine Updates empfangen haben konnte, schaute ich aus reiner Gewohnheit auf mein Handy, trank einen Schluck Bier und stand auf.
Falls ich Kasia als Konkurrenz betrachtete, half mir das nur. Sie und Felix unterhielten sich mit drei Amerikanerinnen, die in Spanien studierten und höchstwahrscheinlich Cheerleaderinnen waren, eine auf den ersten Blick beängstigende, aber leicht zu bewältigende Aufgabe. Als ich mich der Gruppe näherte, schaltete ich auf »Eroberungsmodus«, wie meine Freundinnen am College das nannten, setzte einen warmen und leicht arroganten Blick auf, fasste meine Haare an einer Schulter zusammen, um meinen Hals und einen zarten Ohrring bloß zu legen; Letzterer würde ihm vermutlich nicht auffallen, den Frauen dagegen schon. Statt mit Aplomb ins Gespräch einzusteigen, stellte ich mich einfach in den Kreis, mit einer Person – Kasia – zwischen mir und meinem Zielobjekt, sodass ich ihn sah, aber nicht direkt anzuschauen brauchte, und begann, beifällig zu nicken, als eins der Mädchen ihre Gastmutter beschrieb, die sie nur zwischen sechs und acht Uhr abends duschen ließ und jeden Tag den Mülleimerinhalt inventarisierte, um zu beanstanden, was unsachgemäß entsorgt worden war. Ich prüfte nicht, ob er lachte oder gelangweilt wirkte, und hoffte, den Eindruck zu vermitteln, dass ich ein geselliger, lebenslustiger Mensch war, der nur dazugekommen war, um sich unter die Leute zu mischen, Männer und Frauen gleichermaßen, dabei weiß ich nicht, ob ich mich in meinem Leben jemals bewusst unter Frauen gemischt habe. Er fragte, ob sie in Sevilla gewesen seien, wo er vor seinem Umzug nach Berlin einen Monat verbracht habe. Usw. Als eins der anderen Spanien-Mädchen gerade anfing zu erzählen, wie (für mich überraschend) begeistert sie Abschied von Atocha gelesen habe, wandte sich Kasia, rechts neben mir, eine selbst gedrehte Zigarette rauchend, Felix zu und fragte: »Wie fandst du eigentlich die Ausstellung?«
Man musste es ihr lassen. Das musste man wirklich. Ich war von dem Gespräch ausgeschlossen, nicht nur physisch, sondern auch, weil ich keine Ahnung hatte, von welcher Ausstellung sie redete. Da ich bis zu diesem Moment immer nur genickt hatte, während langweilige Auslandsstudiumsgeschichten erzählt wurden, wirkte ich wie ein Groupie. Die hinteren drei Viertel ihres Kopfs hatten dieselbe gleichförmig beige Beschaffenheit wie ihr Gesicht, plus Violinschlüssel-Tattoo hinter dem mehrfach gepiercten Ohr, aber beeindruckt von ihrer Cleverness, deutete ich ihre Farblosigkeit jetzt als selbstbewusst, unbekümmert, vielleicht sogar erhaben, als Zeichen etwa der Demut einer hervorragenden klassischen Pianistin, die versuchte, in der Gig-Wirtschaft über die Runden zu kommen, und mich selbst als vielleicht ein bisschen polonophob. Ich ließ mir einen Moment Zeit, um meine Vorurteile zu überdenken, bevor ich Kasia, obwohl Felix schon angefangen hatte zu sprechen, mit einer Art fragenden Geste eine meiner langen, eleganten Hände über die Schulter legte und mich erkundigte: »Welche Ausstellung?«
Ein Augenzucken sagte mir, dass er dies als aufdringlich empfand, womöglich eine entsetzlich lange Nacht verheißend, also dachte ich kurzerhand um, immer schon besser darin, mit etwas als mit nichts zu arbeiten: Ich könnte den Eindruck, dass ich drauf und dran war, mich als lästige Langweilerin zu erweisen, widerlegen und würde am Ende sogar weniger nervig erscheinen, als es der Fall gewesen wäre, wenn ich von Anfang an überhaupt nicht genervt hätte. Ja, ich hatte mich zu einer Art Underdog gemacht, redete ich mir ein, der besten Art Hund, die ein Mensch sein kann. Jetzt konnte ich mit der Aufholjagd beginnen und siegreich daraus hervorgehen. Als er die Ausstellung zu beschreiben begann – irgendwas irgendwas Video irgendwas, klang furchtbar –, ging ich mein Bier nachfüllen und stellte mich dann auf Kasias andere Seite, was die Auslandsstudentinnen ausschloss, die jetzt tapfer mit einem einsamen Rumänen über Praktika sprachen und uns nicht brauchten, und sah Felix zum ersten Mal aus einer Entfernung, die eine richtige Gesichtsbeschreibung zulässt. Seine Nase war krumm, nicht höckerig, sondern als hätte der Bildhauer sie leicht schief angeklebt, zuerst vielleicht aus Versehen, es dann aber sogar besser findend, und die dunklen Bartstoppeln, vielleicht einen Tag alt, bedeckten seine Haut, mit scharfen Kerben an den Spitzen seiner Lachfalten, gleichmäßig bis zu den Wangenknochen. Normal volle Lippen, die wie der Rest des Gesichts nicht blutleer, sondern verblichen wirkten, sodass er trotz des Eindrucks, seine Züge könnten jeden Moment in Bewegung geraten, müde aussah. Ich glaube, es waren die Augen, sie hatten etwas an sich, das zwischen Flirt und Mutwillen schwankte, etwas, das gedankliche Unabhängigkeit suggerierte, eine Herausforderung für die Sorte umständliches Ego, das eine Frau dazu brachte, sich zu fragen, ob es nicht gut für sie wäre, zur Abwechslung mal einem Mann hinterherlaufen zu müssen. Als er mit seiner Erörterung des Werks allmählich zum Ende kam, es als billige Kopie Martha Roslers von einer Künstlerin bezeichnete, die offenbar noch nie von ihr gehört hatte – vielleicht war es am Ende das, die Kombination aus feministischer Kunstkenntnis mit gnadenloser Verachtung für ahistorische Aneignungen –, begann ich, etwas absichtsvoller zu nicken, als ich es bei den Señoritas getan hatte, und fragte schmeichelnd, mit tiefer, leicht spöttischer Stimme: »Bist du Künstler?«
Kasia zog ohne Trara von dannen. Hier sind die Informationen, die ich gesammelt habe:
Ja, Maler. Na ja, verlegen, »Multimedia«, egal
2009 nach Berlin gezogen
Wohnt in (irgendein Viertel, von dem ich noch nie gehört hatte, für jungfräuliche Ohren unentschlüsselbar, ich hätte keine Frage darauf verschwenden sollen)
In Montreal geboren, Eltern amerikanische Collegeprofessoren
Einige Zeit in New Haven gelebt, nicht als Student
Italienische Kinderfrau, von Eltern nicht geplant, aber gut, weil er jetzt fließend Italienisch spricht, großer Fellini-Fan
Abschluss in Kunstgeschichte (von welcher Uni, habe ich nicht gefragt, um nicht herauszustellen, dass ich Amerikanerin bin, denn wir sind die Einzigen, die das interessiert, und Amerikaner im Ausland sind, nach Franzosen, das zweitschlechteste Publikum für andere Amerikaner im Ausland)
Hat das Studium abgebrochen, an einem Datum, das er nie vergessen wird, weil es »der Tag war, an dem das iPhone auf den Markt kam«
Spielt gern Schach
Vegetarier, isst auch keinen Fisch, vor allem über die Massenabschlachtung von Kabeljau empört
An dieser Stelle hatten zwei Männer unverkündeter Herkunft angefangen, in der Nähe herumzulungern, als wollten auch sie ihre Fragen loswerden, also ging ich mir Bier nachschenken. Sind diese Kennenlerndetails eigentlich wichtig? Ich kam nicht auf die Idee, mich das zu fragen. Der kreative New Yorker rümpft die Nase über sie, und sein Auftritt gegen die Cocktailpartyfrage »Was machst du so?« dauert ungefähr dreimal so lange, wie eine normale Antwort dauern würde. Frage mich nicht, was ich mache; frage mich, wer ich bin!, ruft der New Yorker, in der Hoffnung, so bald wie möglich groß rauszukommen, sodass er solche willkürlichen Unterscheidungen vergessen kann. Ich möchte diese Dinge immer wissen. Ich behaupte, das ist so, weil ich einen Kontext schaffen will, aber vielleicht will ich vielmehr, wenn ich über mich selbst rede, glauben können, dass mein nickendes Gegenüber neugierig genug ist, um auch für mich einen Kontext schaffen zu wollen, und um freiheraus von sich zu reden, ohne wie ein Arschloch zu wirken, ist ein gewisses Maß an Gegenseitigkeit notwendig. Er hat mir keine einzige Frage gestellt! – schlimmer, als die falsche zu stellen. Mir ist schon klar, dass biografische Informationen, Neigungen und Abneigungen, die Art Sachen, die man in ein Online-Profil stellt, auch Nebelkerzen sein können. Menschen entsprechen ihrem Typ, widersprechen ihm aber auch. Wo man herkommt und was man beruflich macht, kann eine Menge oder überhaupt nichts heißen; das Maß der Bedeutung jeder kleinen Einzelheit liegt für gewöhnlich irgendwo in der Mitte, je nachdem, wie viel von der Geschichte die Person, die sie erzählt, einem mitteilt. Wegen meiner eigenen biografischen Datenlage war eine so glamouröse, intellektuelle Herkunft, wie Felix sie beschrieb, für mich leider tendenziell einschüchternd, beeindruckte mich die Ablehnung von Institutionen, die sein Studienabbruch, das Leben in Berlin, sein schrecklicher Job, dank dessen er (wie ich annahm) weiter Kunst machen konnte, nahelegten. Ich kam nicht auf die Idee, seine Geschichte anzuzweifeln, eine Geschichte, die nur interessant, nicht unglaubwürdig war. Es hätte mich kränken können, mit welcher Leichtfertigkeit er ein Leben verwarf, das mein jüngeres Ich vielleicht gern gelebt hätte, aber damals waren schon die meisten Leute, die ich kannte, Leute der oberen Mittelschicht, die überhaupt nichts begriffen, »also, reich waren wir nicht«, und darum kratzte es mich nicht mehr. Außerdem deutete er an, dass er sich ein bisschen dafür schämte, und zwar nicht, indem er pseudo-reumütig seine Privilegiertheit oder sein »Glück« einräumte, sondern indem er aufrichtig unsicher schien, wie er die damit einhergehenden Sommer in der Familienvilla darstellen sollte, wie er den Kopf über sein jüngeres Ich schüttelte, als er beim Studienabbruch angelangt war, und sich selbst, hörbar, »dumm« nannte. All das war gut zu wissen oder wäre es gewesen, hätte es der Wahrheit entsprochen.
Der Himmel sah immer noch aus, wie mit Lila gebatikt, als wir die zweite Bar erreichten, die drinnen war, buchstäblich unterirdisch, mit frei liegenden Rohren an der Decke und einigen höhlenartigen Aspekten; das aufdringlichste Ausstattungsmerkmal war eine silberne, an der Decke hängende, vermutlich aus Pappmaché hergestellte Skulptur eines menschlichen Kopfs mit Kometenschweif, die vielleicht das Insekt des Barnamens heraufbeschwören sollte, Silberfisch, aber sicher war ich mir da nicht. Die Leute drinnen schienen sich an der plötzlichen Anwesenheit einer internationalen Gruppe nicht zu stören; sie trugen Fußballtrikots und waren, bei näherer Inspektion, lautstark australisch. Auf dem Weg hatte ich Felix gefragt, wo wir hingingen, und er hatte »Silverfish« gesagt. Ich sagte: »Oh, ich glaube, davon habe ich gehört – soll das nicht richtig cool sein?«, und er machte gnädige Geräusche. Ich dachte an das Silverfuture, eine queere Bar auf der anderen Seite der Stadt, die auf der Liste der Underground-Orte meiner brasilianischen Freunde aufgetaucht war, und als ich meinen Fehler beim Googeln am nächsten Tag bemerkte, verspürte ich ein Kribbeln der Peinlichkeit, denn nun dachte er vielleicht, ich läse die Art von Publikation oder spräche mit der Art von Leuten, die die Art von Etablissement, als welche das Silverfish sich entpuppte, empfehlen würden. Die Brasilianer reichten mir einen Schnaps, und mir ging ein idiotisches Licht auf: Jägermeister ist deutsch.
Eifrig darauf bedacht, nicht eifrig zu erscheinen, versuchte ich, mit anderen Leuten zu reden, und behielt, während ich durch den Raum streifte, mein Zielobjekt im Auge. Ich fragte die Slowaken, was sie bisher in Berlin gesehen hätten, ich fragte die Auslandsstudentinnen nach den Zubereitungsarten von Tintenfisch, den sie gegessen hatten, ich fragte die Brasilianer, ob sie sich eine der berühmteren unterirdischen Attraktionen anschauen würden, eine aus dem Kalten Krieg stammende, verlassene Abhörstation im Wald. (Nein, sagten sie, denn früher sei es so gewesen, dass man durch ein Loch im Zaun habe hineinschleichen müssen, und nun seien alle Löcher in dem Zaun geflickt, und ein Veranstaltungsbüro nehme Eintritt, also sei es nichts Besonderes mehr. Woher sie das wussten, fragte ich nicht; sie schienen alles zu wissen.) Ich lernte niemand Neues kennen; war kaum bei der Sache. Kasia drängelte sich hinter Felix, die Arme weit wie Torpfosten über der Menge ausgebreitet, in einer Hand eine Flasche, in der anderen eine unangezündete Zigarette, und er sah sich zu ihr um und nickte. Ein freundschaftliches Bis-später? Kurze Kontaktaufnahme, bevor es weiterging? Vergewisserung unbeschreiblicher Leidenschaft, die sie nach der Arbeit erwartete, wenn sie das Nur-Kollegen-Theater endlich sein lassen konnten? Während dieser Analyse waren die Brasilianer irgendwie von meiner Seite verschwunden und kamen nun aus der anderen Richtung auf mich zu, buchstäblich, wenn auch immerhin lässig Samba tanzend, die Köpfe unbegreiflicherweise waagerecht, während sie mit den Hüften kreisten und lachten und sagten: Pass auf! Dein Freund flirtet! Du musst ihn dir schnappen!
Aber es führte kein Weg zu ihm; er stand mitten in einer undurchdringlichen Menge Antipodianer, die er offenbar bestens unterhielt. Er vollführte einen Armschwung, als erzählte er eine Baseball-Geschichte. Ich beschloss, mich bis zum letzten Inning auf Tatsachenfindungsmission begeben zu können, und stieß mir auf dem Weg nach draußen den Kopf an dem Mauervorsprung über der Treppe. Das war mir peinlich – warum ist es immer peinlich, sich an unnachgiebigen Gebäudeteilen den Kopf zu stoßen? Peinlich müsste es doch dem Architekten sein – und ärgerte mich. Hi, sagte ich. Kann man drinnen nicht rauchen? Kasia sagte, doch, »aber nicht in Ruhe«. Ich lachte und merkte dann, dass ich mich in eine lehrbuchmäßig unangenehme Lage gebracht hatte, weil ich ohne Gesprächsstrategie herausgekommen war. Sie konnte sich aufs Rauchen konzentrieren; ich stand bloß da. Ich hätte sie um eine Zigarette bitten können, aber da sie Selbstgedrehte rauchte, war das ein lästigeres Ansinnen, als wenn ich einfach ihren Vorrat hätte dezimieren können; und dass ich mir eine drehte, war ausgeschlossen. Ich bereute es, die Brasilianer stehen gelassen zu haben. Auf der Suche nach einer Beschäftigung kramte ich in meiner Tasche. Lipgloss, im Grunde »Butter«, die man mit den Fingern aufträgt, sodass man sie sich hinterher an verfügbarem (idealerweise dunklem) Stoff abwischen muss. Ich holte mein Handy heraus und tat so, als würde es funktionieren, las alte Werbe-Mails, als wären es wichtige Updates von allen, die ich kannte. Kasia schaute schräg an mir vorbei und atmete den Rauch aus, als arrangierte sie sich gerade mit einem riesengroßen Problem in ihrem Leben. Plötzlich, oder vielleicht schien es mir nur plötzlich, weil ich in fingierter Handytrance war, sah sie mich an und fragte, woher ich käme.
Wir unterhielten uns ein paar Minuten über Greenpoint, wo sie offenbar mehr Leute kannte als ich in ganz New York City, und als es zur fixen Idee für mich zu werden drohte, dass ich keine Zigarette hatte, kam Felix mit eingezogenem Kopf aus der Bar. Meine zwei Lieblingspersonen, sagte er, kann ich dir eine drehen? Ein Ritter in schimmernder Rüstung, der mich ansah. Er würde sich auch weiterhin als fast beängstigend vorausschauend erweisen, was die Wünsche anderer betraf, ein ständiger Gastgeber, aber hier schien es nicht ungewöhnlich – er bot nur einer Frau vor einer Bar eine Zigarette an. Trotzdem, da ich mich so unter Druck gesetzt hatte, empfand ich enorme Erleichterung. Mit Kasia zusammen einer Kategorie zugeordnet zu werden, war zusätzlich schmeichelhaft und elektrisierend; ich brauchte anscheinend nicht mehr mit ihr zu konkurrieren, hatte schon gewonnen. (Sie selbst hatte sicher Monate gebraucht, um zur Lieblingsperson aufzusteigen, was mir so schnell gelungen war.) Wir einigten uns, dass es das Beste sei, aufzurauchen und weiterzuziehen.
Okay, jetzt komm zur Sache, sagen meine Ex-Freunde im Publikum, nicht unfreundlich, aber auch nicht freundlich. Sie hören mir zwar zu, wenn ich über andere Männer rede, aber man merkt, dass es ihnen keinen echten Spaß macht; sie nutzen jeden Vorwand, um das jeweilige Erlebnis herunterzuhandeln. Du brauchst immer ewig, um was zu erzählen. Es ist schwer zu sagen, was sie an mir gefunden haben, wenn sie diesen entscheidenden Aspekt meines Charmes nicht zu schätzen wissen.
Ende der Leseprobe





























