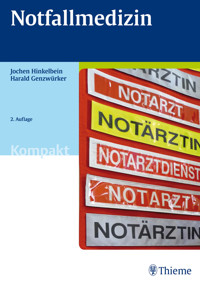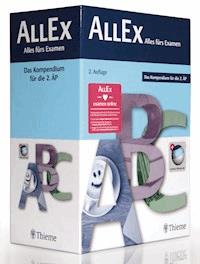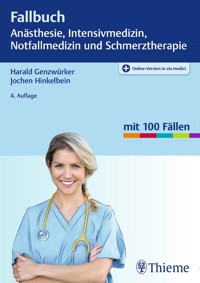
50,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thieme
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Fallbuch
- Sprache: Deutsch
<p><strong>Das Sicherheitstraining f&uuml;r die Pr&uuml;fung</strong></p> <p>Schluss mit der Theorie! Hier wird der Klinikalltag lebendig! Die 100 wichtigsten F&auml;lle aus An&auml;sthesie, Notfall-, Intensiv- und Schmerzmedizin. Reines Lehrbuchwissen reicht f&uuml;r eine m&uuml;ndliche oder praktische Pr&uuml;fung oft nicht aus. Gefragt ist hier fall- und problemorientiertes Vorgehen - wie in der Praxis. Mit dem Fallbuch An&auml;sthesie lernst und trainierst Du die Vorgehensweise am konkreten Patientenbeispiel.</p> <p>Damit bist du optimal vorbereitet:</p> <ul> <li>Simulation von Pr&uuml;fungssituationen</li> <li>typische F&auml;lle, wie sie in Examenspr&uuml;fungen h&auml;ufig gefragt werden</li> <li>Fragen zum Patienten - wie in der Pr&uuml;fung oder im "Ernstfall"</li> <li>L&ouml;sungsteil mit ausf&uuml;hrlichen Kommentaren zu den einzelnen F&auml;llen</li> </ul> <p>Jederzeit zugreifen: Die Inhalte dieses Buches kannst du dir online auf der Lernplattform via medici freischalten (viamedici.thieme.de/code) und sie dann mit allen g&auml;ngigen Smartphones, Tablets und PCs nutzen.</p>
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 715
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie
Harald Genzwürker, Jochen Hinkelbein
4., überarbeitete Auflage
118 Abbildungen
Vorwort
„Nur Narkose den ganzen Tag, das ist doch langweilig!“ Viele Gespräche über unser Fachgebiet nehmen so ihren Anfang. Bei näherer Betrachtung wird aber schnell klar, dass die ganz normale Narkose mit Vorbereitungsmaßnahmen, Betreuung im OP und postoperativer Überwachung im Aufwachraum bereits erhebliches Wissen voraussetzt. Hinzu kommt noch eine Vielzahl von Regionalanästhesieverfahren, die allein oder in Kombination mit der Allgemeinanästhesie eingesetzt werden und für die Ultraschallkenntnisse notwendig sind. Operative Fächer wie Kinder-, Kardio- oder Neurochirurgie stellen zusätzliche Anforderungen an das Wissen und die Fertigkeiten des Anästhesisten. Viele Entwicklungen der Chirurgie waren und sind nur durch die Weiterentwicklung der Anästhesieverfahren möglich.
Die Intensivmedizin ist ein weiterer wichtiger Anteil anästhesiologischen Tuns. Auch hier bietet sich ein breites Betätigungsfeld von der postoperativen Betreuung bis zur Versorgung Schwerstverletzter, von Verbrennungsopfern und bis zu Patienten mit Ausfall wichtiger Organfunktionen. Beatmung, Antibiotikatherapie, Ernährung und viele andere Themenkomplexe gilt es zu beherrschen. Die rasche Stabilisierung von Atmung und Kreislauf, das Erkennen und Behandeln lebensbedrohlicher Störungen – viele Notärzte kommen aus der Anästhesie, und das aus gutem Grund.
Notfallmedizin, sei es im Notarztdienst oder in der innerklinischen Versorgung im Schockraum und auf den Stationen, ist ebenfalls ein typisch anästhesiologisches Betätigungsfeld: Aufgrund der interdisziplinären Ausrichtung des Fachgebietes, der intensivmedizinischen Tätigkeit und der Arbeit im OP besitzen Anästhesisten wichtige Grundvoraussetzungen für diesen Bereich der Medizin, in dem regelmäßig richtige Entscheidungen in kurzer Zeit zu treffen sind.
Weniger spektakulär, aber für viele Patienten nicht weniger lebenswichtig, ist die Ausschaltung akuter und chronischer Schmerzen. Auch hier haben Anästhesisten über die Jahre – aufbauend auf die Kenntnisse beim Einsatz analgetischer Substanzen – eine weitere Disziplin der Anästhesie etabliert. Zunehmend werden in diesem Kontext auch palliativmedizinische Patienten mitbetreut.
Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie – 4 Säulen machen unser Fachgebiet aus und lassen die Anforderungen, aber auch die Anreize für die Tätigkeit in diesem Bereich ständig wachsen. Umso schwieriger ist es, eine Auswahl der wichtigsten Aspekte zu treffen, die es Studierenden ermöglichen, das erworbene Fachwissen zu vertiefen.
Anhand von Fällen soll mit dem vorliegenden Buch der Praxisbezug hergestellt werden, um über die Prüfungsvorbereitung hinaus auch wichtige Tipps für den Beginn der klinischen Tätigkeit im Praktischen Jahr oder nach dem Studium zu geben. Wir hoffen, dass wir richtig gewählt haben, sind uns aber der Tatsache bewusst, dass wir häufig nur an der Oberfläche kratzen und manche Bereiche aus Platzgründen ganz ausklammern mussten.
Unser besonderer Dank gilt Frau Dr. Lydia Bothe, die dieses Buch mit aus der Taufe gehoben hat, und Frau Dr. Hanna Sibyll Manßen sowie Herrn Dr. Jochen Neuberger, die uns bei der vollständigen Überarbeitung für diese 4. Auflage zahlreiche wertvolle Anregungen gaben. Viele Fragen zu unseren Fragen haben die Fälle erst „rund“ gemacht.
Selbstverständlich danken wir auch unseren Frauen Karen und Franzi für ihre Geduld und Nachsicht mit uns!
Wir wünschen den Lesern viel Vergnügen bei der Lektüre und viel Erfolg bei den Prüfungen. Bitte lassen Sie uns wissen, was wir verbessern können. AINS ist viel mehr als nur Narkose machen. Wir hoffen, Ihr Interesse für unser Fachgebiet wecken zu können und Lust auf mehr zu machen:
Anästhesie – das sind nicht nur Stunden der Langeweile, unterbrochen von Momenten der Panik!
Buchen und Köln im April 2019
Harald Genzwürker
Jochen Hinkelbein
Interesse an Anästhesie? → www.anaesthesist-werden.de
Abkürzungen
ASA-Klasse/-Klassifikation:
Klassifikation des präoperativen Patientenzustandes/Anästhesierisikos anhand definierter Kriterien
Glasgow Coma Scale (GCS):
Score zur Erfassung der Schwere einer Bewusstseinsstörung
International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR):
internationales Expertenkomitee für kardiomulmonale Reanimation
Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung:
erlaubt eine Basisversorgung (Innere Medizin, Chirurgie)
Krankenhaus der Schwerpunktversorung:
erlaubt eine Basisversorgung mit zusätzlichen Fachgebieten, z.B. Spezialklinik für Lungenerkrankungen
Krankenhaus der Maximalversorgung
großes akademisches Lehrkrankenhaus oder Universitätsklinik mit allen Fachdisziplinen
Monitoring:
kontinuierliche Überwachung der Vitalparameter (Atmung, Herz-Kreislauf) mittels EKG, Blutdruckmessung, Pulsoxymetrie
Notarztwagen (NAW):
Besatzung: Fahrer (1 Rettungsassistent/-sanitäter/-helfer), Rettungsassistent und Notarzt; Indikationen: akute lebensbedrohliche Erkrankungen oder Verletzungen
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF):
Besatzung: Fahrer (meist Rettungsassistent) und Notarzt; NEF + RTW → Unfallort
Rettungswagen (RTW):
Besatzung: mindestens 1 Rettungsassistent, zusätzlich 1 weiterer Rettungshelfer/-sanitäter; Indikation: Notfall ohne offensichtliche Vitalbedrohung oder zusätzlich zum NEF oder NAW
Rettungsleitstelle:
kooordiniert alle Rettungs- und Notfalleinsätze in einem bestimmten Gebiet
Shaldon-Katheter:
dicklumiger Katheter mit 2 Lumen; Indikationen: schnelle Infusion/Transfusion oder Hämofiltration/Dialyse
Schockraum:
separater Raum in einer Notfallaufnahme, ähnlich wie ein kleiner OP ausgestattet, zusätzlich alle Utensilien zur Versorgung Schwerverletzer oder -erkrankter
Schockkatheter/8F-Schleuse:
dicklumiger venöser Katheter zur raschen Infusion/Transfusion
Tidalvolumen:
Atemzugvolumen
Weaning:
Entwöhnung vom Respirator
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Vorwort
1 Vorstellung eines 48-jährigen Patienten in der Prämedikationsambulanz
1.1 Welche Untersuchungen sollten bei diesem Patienten durchgeführt werden?
1.2 Was verstehen Sie unter der ASA-Klassifikation? In welche ASA-Klasse stufen Sie den Patienten ein?
1.3 Über welche Risiken und Besonderheiten der Intubationsnarkose klären Sie den Patienten auf?
1.4 Welche zusätzlichen Informationen könnten Sie der Akte des vorangegangenen stationären Aufenthalts entnehmen?
1.5 Welche Substanzen eignen sich zur Prämedikation bei diesem Patienten?
2 39-jährige Patientin mit akuter linksseitiger Hemiparese
2.1 Welche Arbeitsdiagnose und welche Differenzialdiagnosen haben Sie?
2.2 Welche notfallmedizinischen Maßnahmen führen Sie durch?
2.3 Welches Krankenhaus wählen Sie aus? Begründen Sie Ihre Entscheidung!
2.4 Welche Maßnahmen und Vorbereitungen treffen Sie auf dem Transport in die Klinik?
2.5 Welche Akutdiagnostik ist indiziert?
3 Langzeitbeatmete Patientin mit Verschlechterung der pulmonalen Situation
3.1 Halten sie diese Verdachtsdiagnose für wahrscheinlich? Begründen Sie Ihre Meinung!
3.2 Wie sichern Sie diese Diagnose innerhalb kurzer Zeit? Welche Befunde erwarten Sie jeweils?
3.3 Befunden Sie die Röntgenaufnahme! Welche Erreger kommen in Frage?
3.4 Welche Kriterien und Befunde müssen erfüllt sein, um eine antibiotische Therapie einzuleiten?
3.5 Mit welcher Antibiotikagruppe therapieren Sie diese Infektion?
4 Postoperative Thromboembolieprophylaxe bei einem 58-jährigen Patienten
4.1 Mit welcher Medikamentengruppe bzw. mit welchen Substanzen und ab welchem Zeitpunkt setzen Sie die Thromboembolieprophylaxe postoperativ fort?
4.2 Müssen Sie diese Therapie durch Gerinnungskontrollen überwachen?
4.3 Besteht ein Handlungsbedarf, wenn klinisch kein Hinweis für eine verstärkte Blutungsneigung vorliegt?
4.4 Welche Verdachtsdiagnose müssen Sie stellen? Wie können Sie diese verifizieren?
4.5 Welche Medikamente bieten sich bei Bestätigung Ihrer Verdachtsdiagnose als Alternative an?
5 Periduralkatheter zur Entbindung bei einer 28-jährigen Patientin
5.1 Beschreiben Sie das Vorgehen bei der Durchführung der Periduralanästhesie!
5.2 Welche Indikationen zur Durchführung einer geburtshilflichen Periduralanästhesie gibt es?
5.3 Eignet sich die Periduralanästhesie für die Anästhesie zur Sectio caesarea?
6 46-jährige Patientin nach Cholezystektomie im Aufwachraum
6.1 Welche Anordnungen treffen Sie für die postoperative Überwachung im Aufwachraum?
6.2 Welche Anordnungen treffen Sie für die Schmerztherapie im Aufwachraum?
6.3 Auf welche Besonderheiten weisen Sie die Mitarbeiter im Aufwachraum hin?
6.4 Verlegen Sie die Patientin auf die Normalstation?
7 Geringe Urin-Stundenportionen bei einem beatmeten, 68-jährigen Patienten
7.1 Welche Verdachtsdiagnose stellen Sie?
7.2 Wie verifizieren Sie Ihren Verdacht?
7.3 Welche Möglichkeiten haben Sie, um die Ausscheidung bei dem Patienten wieder zu steigern?
7.4 Welche Kriterien machen die Einleitung eines Nierenersatzverfahrens unbedingt notwendig?
7.5 Welche Verfahren bieten sich bei diesem Patienten prinzipiell an? Für welches entscheiden Sie sich?
8 Anästhesie bei einem 63-Jährigen mit großem Keilbeinflügel-Meningeom
8.1 Welche relevanten Risiken bestehen im Rahmen des Eingriffs?
8.2 Welche Maßnahmen veranlassen Sie im Vorfeld des Eingriffs? Über welche anästhesiologischen Besonderheiten klären Sie den Patienten auf?
8.3 Welche Besonderheiten sollten Sie bei der Durchführung einer Narkose für den geplanten intrakraniellen Eingriff beachten?
8.4 Ist eine fehlende postoperative Überwachungsmöglichkeit auf der Intensivstation ein Grund, den Eingriff zu verschieben?
8.5 Wie gehen Sie vor, falls der Patient nach dem Eingriff auf der Intensivstation eintrübt und die rechte Pupille fraglich größer als die linke erscheint?
9 63-jährige, bewusstlose Patientin mit erhaltener Spontanatmung
9.1 Welche Erstmaßnahmen führen Sie durch?
9.2 Wie lautet Ihre Verdachtsdiagnose? Begründen Sie diese! Welche Differenzialdiagnosen kommen infrage?
9.3 Welche einfache Untersuchung sollten Sie bei jedem Patienten mit Bewusstseinsstörung durchführen?
9.4 Wie behandeln Sie die Patientin, wenn sich Ihre Verdachtsdiagnose bestätigt?
9.5 Unter welchen Voraussetzungen können Sie zustimmen?
10 32-jährige Raucherin mit akuter Atemnot
10.1 Welche Verdachtsdiagnose stellen Sie? Begründen Sie Ihren Verdacht!
10.2 Befunden Sie die Röntgenaufnahme! Was müssen Sie nun veranlassen?
10.3 Welche Therapiemaßnahmen ergreifen Sie?
10.4 Halten Sie eine Aufnahme auf die Intensivstation für erforderlich?
11 48-jährige Patientin zur Strumateilresektion
11.1 Wie stellen Sie sicher, dass die Ventilation während des Eingriffs nicht gestört wird?
11.2 Worauf sollten Sie bei der geplanten Lagerung für den Eingriff zusätzlich achten?
11.3 Mit welchen Problemen müssen Sie aufgrund der Schilddrüsenvergrößerung bei der Intubation rechnen?
11.4 Woran müssen Sie denken? Was müssen Sie tun?
12 78-Jähriger, der sich in suizidaler Absicht in die Schläfe schoss
12.1 Welche Diagnose stellen Sie aufgrund der postoperativen kranialen Computertomografie (Abb. 12.1)?
12.2 Welche Primär- und Sekundärschäden erwarten Sie?
12.3 Welche Komplikation müssen Sie befürchten? Welche Untersuchungen nehmen Sie vor?
12.4 Welche Diagnose stellen Sie? Welche Maßnahmen müssen Sie nun sofort ergreifen, falls sie noch nicht geschehen sind?
12.5 Wie schätzen Sie die Gesamtprognose (Outcome) ein?
13 Akute Dyspnoe bei einer 34-jährigen Patientin mit multiplen Allergien
13.1 Welche Diagnosen kommen für die geschilderte Symptomatik bei der Patientin in Frage?
13.2 Was sollten Sie unbedingt in Ihrem Notfallrucksack mit sich führen?
13.3 Welche Diagnose stellen Sie?
13.4 Wie können Sie der Patientin akut helfen?
13.5 Welche weitere Möglichkeit haben Sie, wenn keine Besserung eintritt?
14 56-jährige Patientin zur Revision eines Dialyse-Shunts
14.1 Ist eine hochgradig eingeschränkte Nierenfunktion für die Versorgung der Patientin und die Narkoseführung relevant? Begründen Sie Ihre Entscheidung!
14.2 Welche Informationen sind für Sie als Anästhesisten wichtig, um Dialysepatienten adäquat behandeln zu können?
14.3 Was sollten Sie beachten, wenn Sie einen Dialysepatienten für eine Operation vorbereiten?
14.4 Wodurch erklären Sie sich, dass bei Dialysepatienten Blutdruckabfälle häufig gravierend sind? Wie können Sie diese Blutdruckabfälle behandeln?
15 78-jähriger Schmerzpatient mit metastasiertem Leberkarzinom
15.1 Erachten Sie das verabreichte Medikament als adäquat? Was würden Sie verwenden?
15.2 Erläutern Sie das WHO-Stufenschema zur Schmerztherapie!
15.3 Welche Möglichkeiten kennen Sie zur weiteren suffizienten Analgesie in der Akutsituation?
15.4 Welche Alternative bietet sich an?
16 Agitierter Patient nach Spaltung eines periproktitischen Abszesses
16.1 Welche Verdachtsdiagnose stellen Sie? Welche Differenzialdiagnosen kommen infrage?
16.2 Mit welchen Medikamenten können Sie die Symptomatik mildern?
16.3 Was müssen sie bei einer parenteralen Ernährung berücksichtigen?
16.4 Welche Vorteile hätte eine frühe enterale Ernährung?
17 54-Jähriger mit retropharyngealem Abszess zur operativen Entlastung
17.1 Welche Vorbereitungsmaßnahmen zur Atemwegssicherung halten Sie bei diesem Patienten für sinnvoll?
17.2 Mit welchen einfachen Untersuchungsmethoden versuchen Sie abzuschätzen, welche Schwierigkeiten bei der Laryngoskopie und Intubation auftreten können?
17.3 Stimmen Sie zu?
17.4 Was sollten Sie bei der Extubation des Patienten beachten?
17.5 Beeinflusst die Tatsache, dass der Patient nierentransplantiert ist, Ihr Handeln?
18 49-jährige Patientin mit persistierender Motilitätsstörung des Darmes
18.1 Um welche Form der Motilitätsstörung des Darms handelt es sich wahrscheinlich? Welche spezifischen klinischen Symptome erwarten Sie in der körperlichen Untersuchung?
18.2 Wie können Sie die Funktion des Darms zum Nahrungstransport anregen?
18.3 Welche Probleme drohen bei mangelndem Abtransport der über die Magensonde verabreichten Sondenkost?
18.4 Welches Medikament sollten Sie spätestens jetzt bei einer Magen-Darm-Atonie zusätzlich einsetzen?
19 78-jährige Patientin mit akuter Atemnot und Tachyarrhythmia absoluta
19.1 Wie lautet Ihre Verdachtsdiagnose?
19.2 Welche Therapieansätze bieten sich?
19.3 Welche Erstmaßnahmen sind zu ergreifen?
19.4 Welche Therapiemaßnahmen sind indiziert, wenn sich der Zustand der Patientin weiter verschlechtert?
20 Therapie der insuffizienten Spontanatmung bei einer 65-jährigen Patientin
20.1 Wie können Sie zunächst versuchen, die Oxygenierung zu verbessern?
20.2 Welche Tubusgröße erachten Sie als geeignet? Begründen Sie Ihre Antwort!
20.3 Für welchen Beatmungsmodus entscheiden Sie sich bis zum nächsten Morgen?
20.4 Für welches Beatmungsverfahren entscheiden Sie sich jetzt?
20.5 Welche Einstellungen am Beatmungsgerät erachten Sie – neben intakten Schutzreflexen bei der Patientin – als erforderlich, um die Patientin zu extubieren?
21 Narkoseeinleitung bei einem 5-jährigen Mädchen zur Tonsillektomie
21.1 Welche weitere Möglichkeit zur Narkoseeinleitung gibt es außer der intravenösen Injektion von Narkotika?
21.2 Beschreiben Sie Ihr Vorgehen!
21.3 Kann auf einen periphervenösen Zugang verzichtet werden?
21.4 Welche Punktionsstellen eignen sich bei Kindern am besten für die Anlage eines periphervenösen Zuganges?
22 23-jährige Patientin mit Verbrennungen durch Grillunfall
22.1 Wie bewerten Sie die Kühlung der Patientin?
22.2 Wie viel Prozent der Körperoberfläche sind verbrannt?
22.3 Welche weiteren relevanten Störungen können bei der Patientin vorliegen?
22.4 Mit wie viel Volumen und welchen Infusionslösungen therapieren Sie die Patientin?
22.5 Welche Komplikationen erwarten Sie während des Weiteren intensivmedizinischen Behandlungsverlaufs?
23 Transport einer 46-jährigen Patientin von der Intensivstation zum OP
23.1 Können Sie die Patientin für die Zeit der Verlegung von der Intensivstation in den OP mit einem Beatmungsbeutel beatmen?
23.2 Stimmen Sie zu?
23.3 Was unternehmen Sie?
23.4 Schätzen Sie den Transport von Intensivpatienten als gefährlich ein?
24 14-Jähriger mit intraoperativem Anstieg von Herzfrequenz und paCO2
24.1 Welche Verdachtsdiagnose müssen Sie stellen? Nennen Sie die wichtigen Symptome bei diesem Patienten!
24.2 Welche Maßnahmen müssen Sie vordringlich einleiten?
24.3 Welches Medikament sollten Sie so schnell wie möglich applizieren?
24.4 Kann die Operation problemlos durchgeführt werden?
24.5 Welche Maßnahmen sollten Sie einleiten, wenn der Patient die akute Erkrankung überstanden hat?
25 34-jähriger Bauarbeiter nach Sturz aus 5 Meter Höhe
25.1 Mit welchen Verletzungen müssen Sie aufgrund des Unfallhergangs rechnen?
25.2 Wie überwachen Sie den Patienten adäquat auf der Intensivstation?
25.3 Welche Komplikation ist am wahrscheinlichsten? Wie verifizieren Sie Ihre Vermutung?
25.4 Befunden Sie das Röntgen-Thorax ( Abb. 25.1), das Sie wegen der Zustandsverschlechterung des Patienten veranlasst haben!
25.5 Was ist die kausale Therapie in dieser Situation? Wie gehen Sie dabei vor?
26 Knie-TEP bei einer 64-jährigen Patientin in CSE
26.1 Beschreiben Sie das Vorgehen bei der Durchführung der CSE!
26.2 Mit welchen Medikamenten kann eine kontinuierliche Infusion zur postoperativen Analgesie über den Periduralkatheter erfolgen?
26.3 Wie gehen Sie vor?
27 53-Jähriger nach Hüft-TEP-Implantation mit retrosternalem Engegefühl
27.1 Welche Diagnose stellen Sie?
27.2 Welche Maßnahmen führen Sie durch?
27.3 Therapeutische Optionen bei diesem Krankheitsbild sind u. a. die Antikoagulation und die Reperfusionstherapie. Gilt dies auch für diesen Patienten? Begründen Sie Ihre Meinung!
27.4 Welche Komplikationen gilt es zu verhindern?
27.5 Welche Ursache vermuten Sie für das Auftreten dieser Erkrankung bei diesem Patienten?
28 Blutdruckabfall bei 47-jähriger Patientin während der Narkoseausleitung
28.1 Beschreiben Sie Besonderheiten bei der Durchführung einer Vollnarkose bei Patienten mit chronisch obstruktiven Atemwegserkrankungen (COPD)!
28.2 Welche Verdachtsdiagnose stellen Sie? Begründen Sie Ihren Verdacht!
28.3 Wie können Sie Ihre Verdachtsdiagnose erhärten?
28.4 Wie behandeln Sie die lebensbedrohliche Situation?
29 54-jähriger LKW-Fahrer nach Verkehrsunfall mit Herzrhythmusstörungen
29.1 Mit welchen Verletzungen müssen Sie rechnen?
29.2 Wie lange müssen Sie den Patienten mindestens überwachen? Begründen Sie Ihre Entscheidung!
29.3 Welche Verdachtsdiagnose stellen Sie? Welche Differenzialdiagnosen müssen Sie in Erwägung ziehen?
29.4 Wie können Sie Ihre Verdachtsdiagnose verifizieren?
29.5 Wie therapieren Sie den Patienten, wenn sich Ihre Verdachtsdiagnose bestätigt und sich sein Zustand verschlechtert?
30 43-jähriger Patient mit Bewusstseinstrübung und Sturz auf den Boden
30.1 Welche Verdachtsdiagnose stellen Sie?
30.2 Welche Maßnahmen führen Sie bei dem Patienten durch?
30.3 Welche Maßnahmen ergreifen Sie?
30.4 Befunden Sie das CCT! Welche Ursachen für zerebrale Krampfanfälle kennen Sie?
31 Fieber unklarer Ursache bei einer 61-Jährigen auf der Intensivstation
31.1 Welche Ursachen ziehen Sie für die rezidivierenden Fieberschübe in Betracht?
31.2 Welche Maßnahmen führen Sie zur Bestätigung bzw. zum Ausschluss Ihres Verdachts durch?
31.3 Welche Infektionsquelle müssen Sie nun in Betracht ziehen?
31.4 Was ist nun die wichtigste therapeutische Maßnahme?
31.5 Wie können Sie den Verdacht erhärten?
32 68-Jährige mit Marcumar-Therapie zur Implantation einer Knie-TEP
32.1 Kann eine Regionalanästhesie unter den genannten Voraussetzungen bei dieser Patientin mit ausreichender Sicherheit durchgeführt werden? Begründen Sie dies!
32.2 Welchen Mindestabstand müssen Sie zwischen der Gabe eines niedermolekularen Heparins und der Durchführung eines rückenmarknahen Anästhesieverfahrens einhalten?
32.3 Welchen zeitlichen Abstand zum operativen Eingriff erachten Sie bei einer Therapie mit Acetylsalicylsäure als notwendig?
32.4 Müssen Sie beim Entfernen eines Periduralkatheters eine antikoagulatorische Therapie mit Heparin berücksichtigen?
33 Akute Atemnot postoperativ bei einem 59-jährigen Patienten mit COPD
33.1 Können Sie die Befürchtung der Schwesternschülerin nachvollziehen? Wenn ja, wie rechtfertigen Sie Ihre Maßnahme?
33.2 Welches Monitoring erachten Sie aufgrund der Vorerkrankung als erforderlich?
33.3 Welche Medikamente setzen Sie ein?
33.4 Begründen Sie, warum Methylxanthine bei diesem Patienten nicht Mittel der ersten Wahl sind!
33.5 Darf ein β-Blocker bei Patienten mit COPD überhaupt angewendet werden?
34 OP-Vorbereitung einer 41-jährigen Patientin mit Muskelschwäche
34.1 Welche neuromuskuläre Störung vermuten Sie aufgrund dieser Angaben?
34.2 Hat diese Störung Bedeutung für Ihr anästhesiologisches Vorgehen?
34.3 Müssen Sie die üblichen präoperativen Untersuchungsmaßnahmen ergänzen? Wenn ja, um welche Maßnahmen?
34.4 Worüber sollten Sie die Patientin aufklären?
35 Versorgung eines Neugeborenen nach Kaiserschnittentbindung
35.1 Müssen Sie dieses Kind intubieren oder ergreifen Sie andere Maßnahmen? Wenn ja, welche? Begründen Sie Ihre Entscheidung!
35.2 Welchen APGAR-Score erheben Sie?
35.3 Beschreiben Sie das Vorgehen bei der Reanimation eines Neugeborenen!
35.4 Wie gehen Sie bei der Reanimation eines 2 Monate alten Säuglings vor?
36 24-jährige Patientin mit starken Kopfschmerzen nach Spinalanästhesie
36.1 Teilen Sie die Meinung des chirurgischen Oberarztes?
36.2 Welche Ursachen werden als Auslöser eines postspinalen Kopfschmerzes diskutiert?
36.3 Wie kann der Entstehung von Kopfschmerzen nach der Punktion vorgebeugt werden?
36.4 Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?
36.5 Wie ist die Prognose bezüglich der Chronifizierung der Kopfschmerzen einzuschätzen?
37 68-jähriger Patient mit plötzlich aufgetretenen multiplen Blutungen
37.1 Welche Komplikation einer Sepsis vermuten Sie? Begründen Sie Ihre Aussage!
37.2 Welche Laborparameter können Sie zusätzlich bestimmen, um Ihre Verdachtsdiagnose zu bekräftigen?
37.3 Welche Differenzialdiagnosen ziehen Sie aufgrund der Thrombozytopenie in Erwägung?
37.4 Halten Sie eine Substitution von ATIII für sinnvoll?
38 Bluttransfusion bei einer 74-jährigen Patientin
38.1 Bestimmen Sie die Blutgruppe der Patientin anhand des Bedside-Tests!
38.2 Welche Maßnahmen müssen Sie vor der Transfusion der bereitgestellten Blutkonserven durchführen?
38.3 Müssen Sie von den beiden Blutkonserven jeweils einen eigenen Bedside-Test durchführen, um sich von der Übereinstimmung mit der Blutgruppe der Patientin zu überzeugen?
38.4 Welche wichtigen Risiken beinhaltet die Transfusion von Blut?
38.5 Ab welchem Hb-Wert ist die Transfusion von Blut bei dieser Patientin indiziert? Begründen Sie Ihre Angabe!
38.6 Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Wie gehen Sie vor?
39 18-jähriger Patient nach Motorradunfall mit Schmerzen im Beckenbereich
39.1 Welche Diagnosen stellen Sie?
39.2 Wie überwachen Sie den Patienten adäquat? Welche weiteren Maßnahmen veranlassen Sie?
39.3 Welche Diagnose stellen Sie jetzt? Was müssen Sie nun unbedingt veranlassen?
39.4 Was antworten Sie hierauf?
40 „Kollaps“ einer 32-jährigen Patientin nach Wespenstich
40.1 Welche Erstmaßnahmen führen Sie durch?
40.2 Welche erweiterten Therapiemaßnahmen führen Sie bei der vorliegenden anaphylaktischen Reaktion durch?
40.3 Welche Symptome können zusätzlich zu den vorliegenden auftreten?
40.4 Wie behandeln Sie die Patientin?
41 56-jährige Patientin mit 3-stündiger OP bei niedriger Raumtemperatur
41.1 Akzeptieren Sie die eingestellte Raumtemperatur?
41.2 Welche Probleme können durch eine perioperative Hypothermie der Patientin entstehen?
41.3 Welche Gegenmaßnahmen können Sie ergreifen?
41.4 Ist die Hypothermie auch bei Eingriffen in Regionalanästhesie ein relevantes Problem?
42 Intubationsnarkose bei Notsectio
42.1 Mit welchen Problemen müssen Sie bei Schwangeren bei der Durchführung einer Allgemeinanästhesie generell rechnen?
42.2 Beschreiben Sie die Durchführung der Narkose bei dieser dringlichen Indikation!
42.3 Welche Maßnahmen sollten Sie ergreifen, wenn bei dieser Patientin Intubationsschwierigkeiten auftreten?
42.4 Warum kann die Sectio caesarea bei dieser Patientin nicht in Spinalanästhesie durchgeführt werden?
43 38-jähriger Patient mit Fieber, Husten und eitrigem Auswurf
43.1 Welche Verdachtsdiagnose stellen Sie?
43.2 Welche Maßnahmen führen Sie durch, um Ihren Verdacht abzuklären? Welche Befunde erwarten Sie jeweils?
43.3 Welches Beatmungskonzept wählen Sie?
43.4 Welche Komplikationen erwarten Sie beim vorliegenden Krankheitsbild?
43.5 Was können Sie auf dieser Aufnahme erkennen?
44 Geplante ambulante Knie-Arthroskopie bei einem 24-jährigen Patienten
44.1 Sind Sie mit der Durchführung des Eingriffs als ambulante Operation einverstanden? Begründen Sie Ihre Entscheidung!
44.2 Worauf müssen Sie ihn unbedingt hinweisen?
44.3 Welche Eingriffe und welche Patienten eignen sich nicht für ambulante Operationen?
45 32-jährige Patientin, die sich aus dem 3. Obergeschoss stürzte
45.1 Mit welchen Verletzungen müssen Sie rechnen?
45.2 Welche Untersuchungen halten Sie in der Notaufnahme für sinnvoll? Welche Befunde erwarten Sie jeweils?
45.3 Welche Diagnose stellen Sie aufgrund des Befundes?
45.4 Welche Komplikationen können aufgrund des Befundes während des intensivmedizinischen Behandlungsverlaufs auftreten?
46 64-jährige Patientin mit Herzrhythmusstörungen
46.1 Befunden Sie das EKG! Welche Diagnose stellen Sie?
46.2 Welche therapeutischen Möglichkeiten nutzen Sie nun?
46.3 Welches Medikament können Sie zusätzlich anwenden?
46.4 Besteht noch weiterer Handlungsbedarf?
47 Narkoseeinleitung bei einem nicht nüchternen Patienten
47.1 Beschreiben Sie das Vorgehen zur Narkoseeinleitung bei diesem aspirationsgefährdeten Patienten!
47.2 Welche Maßnahmen sollten Sie ergreifen, wenn es bei einem Patienten zu einer Aspiration kommt?
47.3 Welche prophylaktischen Maßnahmen sollten Sie bei aspirationsgefährdeten Patienten durchführen?
48 68-Jähriger postoperativ nach Neck-Dissection auf der Intensivstation
48.1 Erachten Sie die Aufnahme des Patienten auf die Intensivstation als gerechtfertigt?
48.2 Mit welchen frühen postoperativen Komplikationen müssen Sie bei dem Patienten rechnen?
48.3 Welche Maßnahmen veranlassen Sie sofort?
48.4 Wie verfahren Sie nun weiter?
49 64-jähriger Patient mit Herz-Kreislauf-Stillstand
49.1 Welche Maßnahmen leiten Sie umgehend ein?
49.2 Woran müssen Sie denken? Was müssen Sie als Nächstes tun?
49.3 Welche Diagnose stellen Sie? Welche Medikamente lassen Sie vorbereiten?
49.4 Welches Medikament sollten Sie nach einer Reanimationsdauer von 20 Minuten in Erwägung ziehen?
49.5 Was antworten Sie?
50 31-jährige Patientin zur Cholezystektomie in Intubationsnarkose
50.1 Welche praktischen Maßnahmen treffen Sie zur Vorbereitung der Intubationsnarkose im Einleitungsraum?
50.2 Schildern Sie Ihr Vorgehen bei der Durchführung der Intubationsnarkose!
50.3 Welche Hypnotika können Sie zur Narkoseeinleitung verwenden? Nennen Sie Dosierungen!
50.4 Müssen Sie bei dieser Patientin Besonderheiten bei der Einleitung der Narkose beachten?
51 Fremdblutsparende Maßnahmen bei Bauchaortenaneurysma-OP
51.1 Welche Möglichkeiten gibt es allgemein, eine ggf. notwendige Fremdblutgabe zu vermeiden?
51.2 Welche dieser Verfahren eignen sich in der unmittelbaren prä- und intraoperativen Phase?
51.3 Welche der fremdblutsparenden Maßnahmen können bei planbaren operativen Eingriffen durchgeführt werden?
51.4 Gelten für die Indikation zur Transfusion von Eigenblut andere Indikationen als für die Transfusion von Fremdblut?
52 Spinalanästhesie bei einem 19-jährigen Patienten mit Außenbandruptur
52.1 Welche Vorbefunde sind für die Durchführung einer Spinalanästhesie notwendig?
52.2 Über welche typischen Risiken und Komplikationen müssen Sie den Patienten aufklären?
52.3 Beschreiben Sie das Vorgehen bei der Durchführung einer Spinalanästhesie!
52.4 Nennen Sie geeignete Lokalanästhetika, deren Dosierungen und Wirkprofil!
52.5 Wie können Sie die Ausbreitung einer Spinalanästhesie beeinflussen?
53 49-Jährige nach abdomineller OP mit Verschlechterung der Lungenfunktion
53.1 Welche Diagnose stellen Sie anhand des Röntgen-Thorax?
53.2 Wie können Sie einer weiteren Verschlechterung des Gasaustausches entgegenwirken?
53.3 Welchen Beatmungsmodus und welche Einstellungen wählen Sie am Intensivrespirator?
53.4 Befunden Sie das CT-Thorax!
53.5 Welche therapeutischen Maßnahmen ergreifen Sie nun?
54 Anlage von Gefäßzugängen im Rahmen einer großen OP-Vorbereitung
54.1 Beschreiben Sie das Vorgehen bei der Anlage einer arteriellen Kanüle in der A. radialis für das kontinuierliche Monitoring des Blutdrucks!
54.2 Welche Indikationen gibt es für die Anlage eines zentralen Venenkatheters?
54.3 Beschreiben Sie die wichtigsten Venen zur Anlage eines zentralen Venenkatheters und das Vorgehen!
54.4 Welche Komplikationen können bei der Anlage eines zentralen Venenkatheters auftreten?
55 Plexusblockade zur Metallentfernung nach Radiusfraktur bei einem 24-Jährigen
55.1 Beschreiben Sie das Vorgehen bei der Durchführung einer axillären Plexusblockade!
55.2 Welche Areale können zur Identifikation einer ausreichenden Anästhesie von N. radialis, N. medianus und N. ulnaris genutzt werden (Areae propriae)?
55.3 Beschreiben Sie die typischen motorischen Reizantworten bei Stimulation der einzelnen Nerven des Plexus brachialis!
55.4 Welche anderen Punktionsorte zur Blockade des Plexus brachialis gibt es?
56 38-jährige Patientin mit schwallartigem Bluterbrechen
56.1 Welche Verdachtsdiagnose stellen Sie?
56.2 Welche Maßnahmen müssen Sie jetzt unverzüglich durchführen?
56.3 Beschreiben Sie die endoskopische Akuttherapie!
56.4 Welche Untersuchungen führen Sie während des weiteren Verlaufs auf Station durch?
56.5 Welche Risiken und Gefahren bestehen während des weiteren intensivmedizinischen Verlaufs in den nächsten Tagen?
57 Schwierigkeiten bei der Narkoseausleitung bei einem 52-Jährigen
57.1 Sollte dieser Patient extubiert werden?
57.2 Beschreiben Sie Ihr weiteres Vorgehen!
57.3 Nennen Sie wichtige Extubationskriterien!
57.4 Welche Symptome erwarten Sie bei einem Opioidüberhang?
58 Narkose bei einem 76-jährigen Patienten zur Implantation eines AICD
58.1 Welche Narkoseform besprechen Sie mit dem Patienten?
58.2 Welche Besonderheiten müssen Sie während des operativen Eingriffs beachten?
58.3 Welche Maßnahmen ergreifen Sie bei intraoperativ persistierendem Kammerflimmern?
58.4 Welche Komplikationen können bei der Implantation von Schrittmacherelektroden auftreten?
59 67-jähriger Patient mit hohem Fieber nach einer OP an der Wirbelsäule
59.1 Was ist die wahrscheinlichste Diagnose? Begründen Sie Ihre Antwort!
59.2 Welche Maßnahmen und welche therapeutischen Bemühungen führen Sie durch?
59.3 Wie können Sie versuchen, Ihren Verdacht zu erhärten?
59.4 Welche Diagnose stellen Sie jetzt? Welche Ursache liegt diesem Krankheitsbild zugrunde?
59.5 Welche Komplikationen können während des weiteren Behandlungsverlaufs auftreten?
60 Einsatzmeldung: „Verunfallter Motorradfahrer“
60.1 Sind Sie mit der Helmabnahme durch die Rettungsassistenten einverstanden?
60.2 Welche Maßnahmen müssen Sie vordringlich durchführen?
60.3 Ein Rettungsassistent fragt, ob Sie dem Patienten nicht zuerst eine Zervikalstütze anlegen wollen. Ist dies sinnvoll?
60.4 Was antworten Sie?
61 62-Jähriger mit akuter Dyspnoe, Husten und fleischwasserfarbenem Auswurf
61.1 Welche Diagnose stellen Sie?
61.2 Wie sichern Sie Ihre Vermutung?
61.3 Welche weiteren intensivmedizinischen Therapiemaßnahmen führen Sie durch?
61.4 Welche Möglichkeiten bieten sich zur Verbesserung der Oxygenierung an?
62 4-jähriges Mädchen zur Leistenhernien-OP mit Kaudalanästhesie
62.1 Welche Vorteile bietet die Durchführung einer Kaudalanästhesie bei dem geplanten Eingriff?
62.2 Beschreiben Sie den Punktionsort und mögliche Fehlpunktionsstellen!
62.3 Wie wird eine Kaudalanästhesie durchgeführt?
62.4 Nennen Sie Kontraindikationen für die Durchführung einer Kaudalanästhesie!
63 56-jähriger Alkoholiker mit heftigen Oberbauchschmerzen
63.1 Welche Diagnose vermuten Sie aufgrund der Anamnese und der bisherigen Diagnostik?
63.2 Wie können Sie Ihren Verdacht verifizieren?
63.3 Interpretieren Sie das Ergebnis!
63.4 Erläutern Sie das Ergebnis!
63.5 Besteht Handlungsbedarf? Begründen Sie Ihre Meinung und machen Sie ggf. einen Therapievorschlag!
64 Intraoperative ST-Strecken-Senkung bei einem 78-jährigen Patienten
64.1 Sollten Sie dem Patienten intraoperativ einen β-Blocker verabreichen? Begründen Sie Ihre Entscheidung!
64.2 Wie beurteilen Sie das perioperative Absetzen von ASS bei diesem Patienten?
64.3 Woran müssen Sie aufgrund der Vorgeschichte denken?
64.4 Wie klären Sie ab, ob die EKG-Veränderungen Anhalt für eine potenziell bedrohliche Störung sind?
65 Anwendung von Inhalationsanästhetika
65.1 Welche Kriterien muss ein „ideales Inhalationsanästhetikum“ erfüllen?
65.2 Welche Vorteile besitzt eine Narkose mit Inhalationsanästhetika gegenüber einer totalen intravenösen Anästhesie (TIVA)?
65.3 Von welchen Faktoren hängt die Verteilung eines Inhalationsanästhetikums im menschlichen Körper ab?
65.4 Was verstehen Sie unter diesem Verfahren?
65.5 Was müssen Sie bei Narkosen mit Sevofluran im Modus „Low Flow“ oder „Minimal Flow“ beachten?
66 Abrasio bei einer 37-jährigen Patientin
66.1 Planen Sie eine endotracheale Intubation für den beschriebenen Eingriff bei dieser Patientin? Begründen Sie Ihre Entscheidung!
66.2 Beschreiben Sie die Vorbereitungsmaßnahmen zur Durchführung der Narkose!
66.3 Welche Medikamente eignen sich für den geplanten Kurzeingriff?
66.4 Wie sollten Sie das Kreisteil einstellen?
67 Therapieresistente Pneumonie bei einem 68-jährigen Patienten
67.1 An welche Erreger müssen Sie bei langzeitbehandelten intensivmedizinischen Patienten mit therapierefraktären Infektionen denken?
67.2 Müssen Sie noch weitere Untersuchungen vornehmen?
67.3 Welche Maßnahmen müssen Sie nun auf Ihrer Intensivstation durchführen?
67.4 Welche Antibiotika wählen Sie jetzt zur Therapie?
68 Perioperative Beatmungsschwierigkeiten nach Gabe einer kolloidalen Lösung
68.1 Welche Ursachen ziehen Sie in Erwägung?
68.2 Welche Verdachtsdiagnose stellen Sie?
68.3 Welche Akutmaßnahmen ergreifen Sie?
68.4 Um welchen klinischen Schweregrad handelt es sich bei der Reaktion der Patientin?
68.5 Was antworten Sie ihr?
69 60-jährige Patientin mit akuter Vigilanzminderung
69.1 Was hätten Sie – als Anästhesist – in Anbetracht des Bewusstseinszustandes bei der Primärversorgung anders gemacht als der Notarzt?
69.2 Welche Maßnahmen führen Sie jetzt unbedingt durch?
69.3 Welchen Befund erkennen Sie in der Computertomografie ( Abb. 69.1)?
69.4 Wie therapieren Sie nun weiter?
69.5 Wie schätzen Sie den weiteren klinischen Verlauf ein?
70 Erklärung des Narkosesystems bei einer Vollnarkose
70.1 Welche 3 Einstellungen des Kreissystems sind prinzipiell möglich?
70.2 Wie sollte das Kreissystem zur Maskenbeatmung während der Narkoseeinleitung eingestellt werden?
70.3 In welchem Funktionszustand befindet sich das Kreissystem bei modernen Narkosegeräten während der volumen- oder druckkontrollierten Beatmung?
70.4 Welche Einstellungen des Kreissystems eignen sich für die Narkoseausleitung bei einsetzender Spontanatmung des Patienten?
70.5 Was bedeutet diese Verfärbung des Atemkalks?
71 Oberschenkelamputation bei einer 78-Jährigen in Spinalanästhesie
71.1 Wie erklären Sie sich diese Reaktion? Wie reagieren Sie?
71.2 Wie gehen Sie vor?
71.3 Warum sollten Sie eine Spinal- oder Periduralanästhesie bei Amputationen an der unteren Extremität gegenüber einer Allgemeinanästhesie bevorzugen?
71.4 Warum eignen sich Spinal- und Periduralanästhesie gut für die Durchführung gefäßchirurgischer Eingriffe an der unteren Extremität?
72 Tracheotomie bei 76-Jähriger wegen respiratorischer Insuffizienz
72.1 Halten Sie eine Tracheotomie für gerechtfertigt?
72.2 Welche Kontraindikationen sollten Sie beachten?
72.3 Nennen Sie einige Verfahren zur Tracheotomie, die am Patientenbett durchgeführt werden können!
72.4 Beschreiben Sie das anästhesiologische Vorgehen für eine klassische operative („chirurgische“) Tracheotomie!
73 Übelkeit und Erbrechen bei einem 52-jährigen Patienten nach Vollnarkose
73.1 Wie wird das Beschwerdebild bezeichnet?
73.2 Ist eine Behandlung indiziert?
73.3 Welche Therapieansätze gibt es?
73.4 Nennen Sie Strategien zur Vermeidung dieser Problematik!
74 Komatöse 19-jährige Discobesucherin
74.1 Befunden Sie das cCT! Wie lautet Ihre Verdachtsdiagnose? Welche Differenzialdiagnosen kommen in Frage?
74.2 Was veranlassen Sie zur Verifizierung der von Ihnen vermuteten Diagnose?
74.3 Wie interpretieren Sie die Befunde? Welche Maßnahmen veranlassen Sie zur Überwachung und primären Stabilisierung der Patientin auf der Intensivstation?
74.4 Mit welchen Komplikationen müssen Sie während der intensivmedizinischen Behandlung bei dieser Patientin rechnen?
74.5 Welche Langzeitfolgen sind möglich?
75 Vorbereitung eines 3-jährigen Patienten zur Phimosen-OP
75.1 Welche Untersuchungen sollten bei diesem Patienten durchgeführt werden?
75.2 Wie antworten Sie auf die Frage nach der präoperativen Nüchternheit?
75.3 Welche Anordnung treffen Sie für die Medikamente zur Prämedikation des 3-Jährigen?
75.4 Wie würde das Vorliegen einer Latexallergie bei einem Kind Ihr Handeln beeinflussen?
75.5 Nach welchen Kriterien entscheiden Sie, ob die Operation durchgeführt werden kann?
76 77-jährige bewusstlose Patientin
76.1 Welche Diagnose stellen Sie? Welche Maßnahmen leiten Sie umgehend ein?
76.2 Welche Medikamente lassen Sie vorbereiten?
76.3 Wie überprüfen Sie die korrekte Lage des Endotrachealtubus?
76.4 Wie können Sie sicherstellen, dass der Endotrachealtubus auch beim späteren Transport der Patientin nicht disloziert?
76.5 Wie stellen Sie die Beatmung der Patientin sicher?
77 54-jähriger Patient zur OP mit Thorakotomie und Ein-Lungen-Beatmung
77.1 Welche präoperativen Untersuchungen sollten bei diesem Patienten durchgeführt werden?
77.2 Welche Maßnahmen sind zur intra- und postoperativen Überwachung notwendig?
77.3 Beschreiben Sie Besonderheiten, die sich aus dem Einsatz einer Ein-Lungen-Beatmung ergeben!
77.4 Müssen Sie die Beatmung anpassen?
78 79-jährige, exsikkierte Patientin zur Aufnahme auf die Intensivstation
78.1 Welche Tätigkeiten müssen Sie bereits vor Aufnahme der Patientin erledigen?
78.2 Halten Sie dies für angemessen? Begründen Sie Ihre Entscheidung!
78.3 Wie überwachen Sie die Patientin adäquat?
78.4 Was müssen Sie hierzu erledigen? Welche Unterlagen brauchen Sie?
78.5 Welche Maßnahmen und weiteren Untersuchungen ordnen Sie an?
79 21-Jähriger zur Kniearthroskopie mit supraglottischem Atemweg
79.1 Nennen Sie typische Indikationen und Kontraindikationen für den Einsatz supraglottischer Atemwegshilfen wie Larynxmaske und Larynxtubus!
79.2 Welches Hypnotikum eignet sich am besten für die Narkoseeinleitung beim Einsatz von Larynxmaske oder Larynxtubus?
79.3 Nennen Sie Vorteile der Anwendung supraglottischer Atemwegshilfen (SGA)!
79.4 Nennen Sie mögliche Komplikationen bei der Beatmung mit Larynxmaske oder Larynxtubus!
79.5 Was ist die wahrscheinlichste Ursache für die plötzlich aufgetretene Undichtigkeit der Larynxmaske? Wie reagieren Sie adäquat?
80 Ablehnung einer Tranfusion durch eine Zeugin Jehovas mit akuter Blutung
80.1 Dürfen Sie sich über den erklärten Willen der Patientin hinwegsetzen und dennoch Blut transfundieren, wenn Sie eine vitale Indikation erkennen?
80.2 Welche Möglichkeiten außer einer Transfusion kennen Sie, um einen akuten Mangel an Sauerstoffträgern (= niedriger Hb-Wert) zu kompensieren?
80.3 Welchen wichtigen Unterschied gibt es zwischen den beiden Fällen?
81 31-jährige Patientin mit hohem Fieber nach Auslandsaufenthalt
81.1 Welche gezielten Fragen an die Patientin geben Ihnen wichtige Hinweise auf die Diagnose?
81.2 Welche Diagnose vermuten Sie? Wie können Sie diese beweisen?
81.3 Mit welchen weiteren typischen Symptomen und Komplikationen rechnen Sie während des intensivmedizinischen Behandlungsverlaufs?
81.4 Wie überwachen Sie die Patientin?
81.5 Welche Therapie beginnen Sie?
82 69-jähriger Patient mit Schwindel und Atemnot bei Spinalanästhesie
82.1 Wie erklären Sie sich die beschriebene Symptomatik?
82.2 Wie gehen Sie vor?
82.3 Welche besonderen Probleme sollten Sie bei diesem Patienten beachten?
82.4 Was antworten Sie?
83 50-jähriger Patient mit heftigsten Schmerzen in Rücken und Bauch
83.1 Welche Verdachtsdiagnose und welche Differenzialdiagnosen stellen Sie?
83.2 Welche diagnostischen Möglichkeiten kennen Sie zur Verifizierung der Verdachtsdiagnose?
83.3 Befunden Sie das CT! Welche Maßnahmen müssen Sie jetzt sofort durchführen?
83.4 Erläutern Sie die weitere Therapie auf der Intensivstation!
83.5 Mit welchen postoperativen Komplikationen müssen Sie rechnen?
84 Pankreasteilresektion bei einem 52-jährigen Patienten mit thorakaler PDA
84.1 Welchen Nutzen sehen Sie in der Anlage eines Periduralkatheters bei diesem Patienten?
84.2 Beschreiben Sie das Vorgehen bei der Anlage eines thorakalen Periduralkatheters!
84.3 Welche Medikamente eignen sich zur Injektion in den liegenden Periduralkatheter?
84.4 Warum kann die Anlage eines thorakalen Periduralkatheters mit mehr Risiken verknüpft sein als die Punktion auf lumbaler Höhe?
85 Intensivüberwachung eines 74-Jährigen mit respiratorischer Insuffizienz
85.1 Welche Möglichkeiten haben Sie, die Oxygenierung des Patienten zu überwachen?
85.2 Welche Vor- und Nachteile haben die Verfahren?
85.3 Erklären sie die Funktionsweise der Verfahren!
85.4 Welche unteren und oberen Grenzwerte erachten Sie während der Überwachung als sinnvoll für beide Verfahren?
86 46-Jährige mit postoperativer Hyperglykämie trotz Insulintherapie
86.1 Berechnen Sie den Energiebedarf der Patientin!
86.2 Welche Verdachtsdiagnose stellen Sie?
86.3 Erläutern Sie die pathophysiologischen Veränderungen, die hier vorliegen!
86.4 Welches Ziel hat die HHH-Therapie? Wie wird sie durchgeführt?
87 18-jähriger Patient mit Polytrauma und beginnender Sepsis
87.1 Welche Kriterien müssen vorhanden sein, damit entsprechend der Definition eine Sepsis vorliegt?
87.2 Grenzen Sie die Sepsis vom SIRS ab!
87.3 Was ist ein Multiorganversagen? Welche Unterschiede bestehen zur Multiorgandysfunktion?
87.4 Welche Komplikation einer Sepsis vermuten Sie? Begründen Sie Ihre Aussage!
88 Intraoperative Umlagerung eines Patienten von Rücken- in Bauchlage
88.1 Was sollten Sie nach der Umlagerung als erstes tun?
88.2 Wie gehen Sie vor, wenn eine adäquate Ventilation des Patienten nicht möglich ist?
88.3 Wie gehen Sie vor?
89 72-Jähriger mit heftigsten Bauchschmerzen und Herzrhythmusstörungen
89.1 Welche Verdachtsdiagnose stellen Sie?
89.2 Welche Erstmaßnahmen ergreifen Sie?
89.3 Wie können Sie Ihre Verdachtsdiagnose bestätigen?
89.4 Wie verfahren Sie weiter mit dem Patienten?
90 56-jährige Patientin mit Rückenschmerzen bei liegendem Periduralkatheter
90.1 Wodurch können die beschriebenen Symptome verursacht sein?
90.2 Beschreiben Sie Ihr weiteres Vorgehen!
90.3 Nennen Sie die wichtigsten Komplikationen bei rückenmarknahen Anästhesieverfahren!
91 32-Jähriger mit Langzeitbeatmung und Verschlechterung des Gasaustauschs
91.1 Welche Verdachtsdiagnose stellen Sie?
91.2 Befunden Sie die Röntgen-Thoraxaufnahme!
91.3 Mit welchen Komplikationen müssen Sie bei einer Langzeitbeatmung generell rechnen?
91.4 Wie können Sie versuchen, einen weiteren pulmonalen Schaden zu minimieren?
91.5 Welche weiteren Möglichkeiten existieren zur Verbesserung oder zum Ersatz der Lungenfunktion?
92 42-jähriger Patient mit akutem Thoraxschmerz
92.1 Welche Verdachtsdiagnose stellen Sie?
92.2 Welche Erstmaßnahmen ergreifen Sie?
92.3 Können Sie Ihre Verdachtsdiagnose aufgrund des 12-Kanal-EKGs ( Abb. 92.1) konkretisieren?
92.4 Können Sie bei dem Patienten bereits präklinisch spezifische Maßnahmen einleiten?
92.5 Für welche Zielklinik entscheiden Sie sich?
93 73-jähriger Patient mit kardialen Vorerkrankungen zur Leistenbruch-OP
93.1 Welche weiteren Befunde und Untersuchungen benötigen Sie bei diesem Patienten zur Abschätzung des perioperativen Risikos?
93.2 In welche ASA-Klasse stufen Sie den Patienten ein?
93.3 Welche Narkoseverfahren kommen bei diesem Patienten für den Eingriff in Frage?
93.4 Hat die Metformineinnahme Konsequenzen für die Planung des Anästhesieverfahrens oder die Durchführung des Eingriffs?
94 12 Monate altes Kind mit Krampfanfall
94.1 Welche Verdachtsdiagnose stellen Sie? Nennen Sie wichtige Informationen, die Ihre Verdachtsdiagnose stützen!
94.2 Welche Erstmaßnahmen ergreifen Sie?
94.3 Wie überzeugen Sie die Mutter, dass eine Vorstellung des Kindes in der Kinderklinik sinnvoll ist?
95 78-jähriger Patient mit intrazerebraler Blutung nach hypertensiver Krise
95.1 Erachten Sie eine Maximalgrenze für den systolischen Blutdruck als sinnvoll? Wenn ja, wie hoch sollte diese sein?
95.2 Welche weiteren Komplikationen müssen Sie bei einer Blutdruckentgleisung in Erwägung ziehen?
95.3 Welches Medikament wählen Sie zur Akuttherapie? Wie wirkt es?
95.4 Welches Medikament wählen Sie zusätzlich? Wie wirkt es?
95.5 Welches Medikament setzen Sie ein?
96 Krampfanfall bei einem Patienten mit Spinalanästhesie
96.1 Welchen Verdacht haben Sie? Wie gehen Sie vor?
96.2 Beschreiben Sie Ihre Maßnahmen!
96.3 An welche wichtige Komplikation müssen Sie denken? Welche Behandlungsmöglichkeiten kennen Sie?
96.4 Welche weiteren Komplikationen drohen?
97 38-jährige Patientin mit Subarachnoidalblutung
97.1 Beschreiben Sie das Vorgehen zur Hirntoddiagnostik!
97.2 Welche Schritte müssen Sie veranlassen?
97.3 Was können Sie den Angehörigen sagen?
97.4 Was müssen Sie bezüglich der Narkoseführung bei einer Organexplantation beachten?
98 28-Jähriger mit starken postoperativen Schmerzen
98.1 Halten Sie die präoperative Schmerztherapie für ausreichend?
98.2 Erläutern Sie die Schmerzmessung mit der NRS!
98.3 Welche Möglichkeiten bestehen für die postoperative Schmerztherapie?
98.4 Können Opioide auch außerhalb von Aufwachraum und Intensivstation eingesetzt werden?
99 66-Jähriger mit Polytrauma und starker Blutung im Schockraum
99.1 Welche standardisierten Versorgungskonzepte gibt es zur Behandlung von Polytraumapatienten im Schockraum?
99.2 Erläutern Sie in Kürze Ihre unmittelbaren Ziele im Schockraum!
99.3 Mit welchen Komplikationen müssen Sie generell während der Schockraumphase rechnen?
99.4 Wie verbessern Sie die Gerinnungssituation weiter?
99.5 Sollte vorher noch ein CT durchgeführt werden?
100 82-jähriger Patient mit Latex-Allergie und Bewusstseinstrübung
100.1 Welche Anästhesie-Materialien können Latex enthalten?
100.2 Ist es ein Problem, dass der Patient an dritter Stelle im OP operiert wird?
100.3 Welche Komplikation ziehen Sie in Betracht?
100.4 Welche Maßnahmen führen Sie nun durch?
100.5 Verlegen Sie den Patienten jetzt auf Normalstation?
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum
1 Vorstellung eines 48-jährigen Patienten in der Prämedikationsambulanz
In der Prämedikationsambulanz stellt sich ein 48-jähriger Patient vor, der in knapp 2 Wochen zur Entfernung einer Metallplatte am rechten Oberarm stationär aufgenommen werden soll. 8 Monate zuvor war er mit dem Motorrad gestürzt und hatte sich neben der Oberarmfraktur auch ausgedehnte Weichteilverletzungen im Bereich der rechten Körperseite zugezogen. Er berichtet, dass sich bei der operativen Versorgung in Ihrem Krankenhaus keine Besonderheiten ergeben hätten, und betont im selben Atemzug, dass er unbedingt wieder eine Vollnarkose wolle, während er Ihnen den teilweise ausgefüllten Fragebogen zur Anamnese überreicht. Bei der Durchsicht des Fragebogens und der Ergänzung der fehlenden Angaben wird Ihre Frage nach einer Dauermedikation verneint, Medikamentenallergien seien nicht bekannt, allerdings meint der Patient auf gezielte Nachfrage, dass er an „Heuschnupfen“ leide. Bei einer Körpergröße von 1,82 m wiegt der Patient 91 kg. Er rauche etwa 1 Schachtel Zigaretten am Tag und trinke gelegentlich Alkohol, allerdings eher am Wochenende. Bis zu dem Motorradunfall sei er nie ernsthaft krank gewesen oder operiert worden. Er verneint die Frage nach kardialen Problemen wie belastungsabhängiger Angina pectoris.
1.1 Welche Untersuchungen sollten bei diesem Patienten durchgeführt werden?
körperliche Untersuchung, um den Allgemein- und Ernährungszustand abzuklären, eine Organinsuffizienz bzw. Leistungsminderung auszuschließen und das anästhesiologische Risiko abzuschätzen
Herz-Kreislauf-System: Auskultation des Herzens, Messung von Blutdruck und Pulsfrequenz, Sauerstoffsättigung (SpO2)
Respirationstrakt: Perkussion und Auskultation der Lunge
Einschätzen möglicher Intubationsschwierigkeiten: Beurteilung der Mundhöhle und -öffnung (z. B. raumfordernde Prozesse? Kiefer- oder Gesichtsmissbildungen? Beweglichkeit von Kiefergelenken und Halswirbelsäule?), Zahnstatus, Mallampati-Test (s. Fall 17), Patil-Test, Upper Lip Bite Test (ULBT)
optional (s. Kommentar): Labor (Hb, Kalium, ALT [GPT], AST [GOT], γ-GT, AP)
Die Auskultation von Herz und Lunge ergibt keine pathologischen Befunde.
1.2 Was verstehen Sie unter der ASA-Klassifikation? In welche ASA-Klasse stufen Sie den Patienten ein?
ASA-Klassifikation (American Society of Antesthesiologists): Klassifikation zur Einstufung des präoperativen Patientenzustandes bzgl. des Anästhesierisikos und der perioperativen Mortalität; einfach, jedoch wenig differenziert ( ▶ Tab. 1.1und Kommentar)
Der Patient kann in die ASA-Klasse II eingestuft werden.
Tab. 1.1 ASA-Klassifikation.ASA-Klasse
Patientenzustand
perioperative Mortalität
I
normaler, gesunder Patient ohne Vorerkrankungen (z.B. Nichtraucher, kein/kaum Alkoholkonsum)
ca. 0,1 %
II
Patient mit leichter Allgemeinerkrankung (Raucher, regelmäßiger Alkoholkonsum)
ca. 0,5 %
III
Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung und Leistungseinschränkung
ca. 4,4 %
IV
Patient mit schwerer, lebensbedrohlicher Allgemeinerkrankung
ca. 23,5 %
V
moribunder Patient, Tod mit oder ohne Operation innerhalb von 24 h zu erwarten
ca. 50,8 %
VI
Organspende
entfällt
1.3 Über welche Risiken und Besonderheiten der Intubationsnarkose klären Sie den Patienten auf?
Verlaufsaufklärung: allgemeiner Ablauf, perioperative Überwachung (Monitoring), venöser Zugang
Risikoaufklärung: eingriffsspezifische, typische Risiken (z. B. Herz-Kreislauf-Reaktionen [bis zum Herz-Kreislauf-Stillstand], allergische Reaktionen, Zahnschäden durch die Laryngoskopie, postoperative Heiserkeit, Stimmbandschäden, Aspiration von Mageninhalt)
therapeutische Aufklärung: Hinweise, Anweisungen, Verhaltensmaßregeln für Patienten (z. B. Nüchternheitsgebot ab 6 h präoperativ für feste Nahrung, klare Flüssigkeit bis maximal 2 h präoperativ)
1.4 Welche zusätzlichen Informationen könnten Sie der Akte des vorangegangenen stationären Aufenthalts entnehmen?
Narkoseprotokoll des Eingriffs vor 8 Monaten:
Hinweise auf Probleme bei der Maskenbeatmung oder Intubation
Hinweise auf sonstige intra- und postoperative Probleme oder anästhesiologische Besonderheiten (z. B. Narkotika-, Schmerzmittelbedarf)
evtl. vorhandene Vorbefunde (EKG, Labor)
Als der Patient gerade gehen will, fragt er, ob er denn vor der Operation auch so eine Tablette gegen die Aufregung bekäme wie seine Frau vor der Gallenoperation.
1.5 Welche Substanzen eignen sich zur Prämedikation bei diesem Patienten?
Für die Prämedikation eignen sich Benzodiazepine gut, da sie anxiolytisch und sedierend wirken, die Patienten bei angemessener Dosierung aber jederzeit erweckbar und kooperativ sind.
kurzwirksame Benzodiazepine, z. B. Midazolam (7,5 mg p. o. für Erwachsene 1 h vor Narkosebeginn)
langwirksame Benzodiazepine: z. B. Diazepam (10–20 mg p. o. für Erwachsene 2–3 h vor Narkosebeginn) oder Clorazepat (10–20 mg p. o. für Erwachsene 2–3 h vor Narkosebeginn)
Wichtig ist es, auf die rechtzeitige Gabe der medikamentösen Prämedikation durch die Allgemeinstationen hinzuwirken!
Eine Prämedikation kann, muss aber nicht durchgeführt werden
Kommentar
Präoperative anästhesiologische Visite (Prämedikationsvisite)
Ziel der Prämedikationsvisite
Bei der Vorbereitung einer Anästhesie sind eine sorgfältige Anamneseerhebung, Voruntersuchungen (z. B. körperliche Untersuchung, Labor) und die Sichtung präoperativer Befunde sehr wichtig. Nur so können Erkrankungen oder Besonderheiten entdeckt werden, die für die Durchführung der Narkose relevant sind oder die im Verlauf zu Problemen oder Komplikationen führen können. Neben dem individuellen Risiko des Patienten sind dabei immer auch eingriffspezifische Risiken (z. B. erhöhtes Blutungsrisiko bei großem Gefäßeingriff) zu berücksichtigen. Der Umfang der Maßnahmen vor einer Anästhesie und Operation orientiert sich v. a. am Alter und Allgemeinzustand des Patienten sowie an der Invasivität und Dauer des operativen Eingriffs.
Zusätzlich wird der Patient über den Ablauf der Maßnahmen informiert und auf besondere Risiken hingewiesen. Bei der Wahl des Anästhesieverfahrens orientiert man sich an den Besonderheiten des vorgesehenen Eingriffs und an den Wünschen des Patienten. Alternativen werden erläutert, damit der Patient eine fundierte Entscheidung treffen kann. Idealerweise führt der Anästhesist das Prämedikationsgespräch, der den Patienten auch im OP betreut. Auf jeden Fall sollte das Gespräch genutzt werden, um dem Patienten zu verdeutlichen, dass alles Erdenkliche getan wird, um Risiken zu minimieren und dass er „in guten Händen“ ist.
Präoperatives Screening
Die Vorgeschichte des Patienten wird in der Regel mit standardisierten Fragebögen erhoben, die Fragen zu allen wichtigen Organsystemen sowie zu Allergien, Dauermedikation, Voroperationen und -narkosen sowie Lebensgewohnheiten des Patienten (Alkohol- und Nikotinkonsum) enthalten. Sie sind eine wichtige Grundlage für das Aufklärungsgespräch, müssen aber durch eine gründliche körperliche Untersuchung (s. Antwort zu Frage 1.1) und Auswertung weiterer ggf. bereits vorhandener Befunde (z. B. Labor, EKG) ergänzt werden. Im Verlauf des anästhesiologischen Vorgesprächs kann die Notwendigkeit weiterer Voruntersuchungen erkannt werden. Bei gesunden Patienten ohne relevante Vorerkrankungen, die für elektive Eingriffe (s. Fallbeispiel) vorgesehen sind, kann bei sorgfältiger Anamneseerhebung und körperlicher Untersuchung auf Laboruntersuchungen, ein EKG oder eine Röntgenuntersuchung in der Regel verzichtet werden. Bereits vorhandene Befunde sowie die Informationen von früheren Operationen und Narkosen sind selbstverständlich zu berücksichtigen.
ASA-Klassifikation
Im Jahre 1963 publizierte die American Society of Anesthesiologists (ASA) eine Klassifikation zur Einstufung des präoperativen Patientenzustandes, die weltweit Verbreitung findet (s. Antwort zu Frage 1.2). Die ASA-Klassifikation korreliert dabei in begrenztem Maße mit der perioperativen Mortalität der Patienten (bis zum 7. postoperativen Tag), wobei durch die Entwicklung der modernen Anästhesieverfahren die Mortalität in der Regel erheblich niedriger ist als vorhergesagt. Problematisch ist allerdings die relativ grobe Unterteilung ohne differenzierte Bewertung einzelner Vorerkrankungen. Die verschiedenen Organsysteme sind mit unterschiedlicher Häufigkeit an der perioperativen Morbidität und Mortalität beteiligt: Kardiovaskuläre Erkrankungen haben die größte Bedeutung, bronchopulmonale, endokrine und renale Erkrankungen beeinflussen den anästhesiologischen Verlauf deutlich geringer. Die Einteilung in die einzelnen ASA-Klassen ist zusätzlich vom Untersucher abhängig (Fehlen objektivierbarer Kriterien), sodass in manchen Abteilungen differenziertere Risikochecklisten erarbeitet wurden, um eine verlässlichere und aussagekräftigere Einstufung zu erreichen (s. Mannheimer Risikocheckliste, ▶ Tab. 1.2 und ▶ Tab. 1.3). Ziel ist die Identifikation besonders gefährdeter Patienten anhand statistischer Wahrscheinlichkeiten, um das am besten geeignete Narkoseverfahren, die optimalen Medikamente sowie die Notwendigkeit eines erweiterten Monitorings (z. B. intraarterielle Blutdruckmessung) und einer postoperativen Überwachung auf der Wach- oder Intensivstation besser abschätzen zu können. Besonders bei Patienten mit hohem Risikoprofil muss immer abgewogen werden zwischen der Dringlichkeit des Eingriffs und der Möglichkeit, den Zustand des Patienten vor Durchführung der Operation zu verbessern.
Tab. 1.2Mannheimer Risikocheckliste – Punktvergabe.Punkte
0
1
2
4
8
16
Dringlichkeit der Operation
geplant, nicht dringlich (elektiv)
geplant, bedingt dringlich
dringlich, nicht geplant
Notfalleingriff
Nüchternzeit
> 6 h
< 6 h
< 1 h
Art des Eingriffs
Oberflächenchirurgie
Extremitäteneingriff
OP mit Eröffnung der Bauchhöhle
OP mit Eröffnung von Thorax oder Schädel
Zweihöhleneingriff
Polytrauma/Schock
Patientenalter [Jahre]
1–39
< 1 oder 40–69
70–79
> 80
OP-Dauer [min]
≤ 60
61–120
121–180
> 180
Körpergewicht
Normgewicht ± 10 %
10–15 % Untergewicht
15–25 % Untergewicht bzw. 10–30 % Übergewicht
> 30 % Übergewicht
Blutdruck
Normotonie < 160/90 mmHg
behandelte Hypertonie (kontrolliert)
unbehandelte bzw. kurzfristig behandelte Hypertonie
behandelte Hypertonie (unkontrolliert)
kardiale Vorerkrankungen
Herzleistung normal
rekompensierte Herzinsuffizienz
Angina pectoris
dekompensierte Herzinsuffizienz
EKG
normal
mäßige Veränderungen
Schrittmacher-EKG
fehlender Sinusrhythmus; > 5 ventrikuläre Extrasystolen/min
Z. n. Herzinfarkt
-
> 2 Jahre
> 1 Jahr
> 6 Monate
< 6 Monate
< 3 Monate
Respirationstrakt
normal
abklingender Infekt der oberen Atemwege
Emphysem, spastische Bronchitis
bronchopulmonaler Infekt oder Pneumonie
andere schwere Erkrankung
manifeste Ateminsuffizienz; Zyanose
Leber-, Nierenwerte, Säure-Basen-Haushalt, Elektrolyte
normal
leichte Veränderungen
schwere Veränderungen
Hämoglobin
12,5 g/dl (7,8 mmol/l)
12,5–10 g/dl (7,8–6,2 mmol/l)
< 10 g/dl (< 6,2 mmol/l)
Wasserhaushalt
normal
Dehydratation
Tab. 1.3Mannheimer Risikocheckliste – Risikogruppierung.Risikogruppe
Punkte
I
0–2
II
3–5
III
6–10
IV
11–20
V
> 20
Weiterführende Diagnostik
Die Notwendigkeit von Laboruntersuchungen, eines präoperativen 12-Kanal-EKGs und eines Röntgen-Thorax wird v. a. vom individuellen Zustand und Risikoprofil des Patienten abhängig gemacht, nicht von starren Altersgrenzen. Die Deutschen Gesellschaften für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI), Innere Medizin und Chirurgie betonen in ihren 2010 veröffentlichten und 2017 aktualisierten gemeinsamen Empfehlungen (Präoperative Evaluation erwachsener Patienten vor elektiven, nicht herz-thoraxchirurgischen Eingriffen), dass bei organgesunden Patienten in jungen und mittleren Lebensjahren ohne spezifische Risikohinweise in der Regel keine zwingende medizinische Notwendigkeit für eine routinemäßige Durchführung ergänzender Untersuchungen besteht. Auch die evidenzbasierte Leitlinie der European Society of Anaesthesiology (ESA) empfiehlt für gesunde Patienten, möglichst auf ergänzende Untersuchungen zu verzichten. Eine Altersgrenze, oberhalb derer z. B. ein EKG obligat und für den Patienten von Nutzen ist, lässt sich aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse nicht festlegen. Ein Röntgen-Thorax gilt nur als indiziert, wenn eine klinische Verdachtsdiagnose mit Konsequenzen für das perioperative Vorgehen (z. B. Pleuraerguss, Atelektase, Pneumonie) abgeklärt werden soll. Bei zusätzlichen Hinweisen in Anamnese und körperlicher Untersuchung können - in Abhängigkeit von den Begleiterkrankungen und der Pharmakotherapie, dem geplanten Eingriff und dem angestrebten Anästhesieverfahren - weitere Untersuchungen sinnvoll sein, z. B. Labor (kleines Blutbild, Kalium, Nierenwerte [Kreatinin, Harnstoff], Blutzucker, Leberwerte [ASAT, ALAT, γ-GT, AP], Quick, aPTT, Blutgase), Röntgen-Thorax, (Belastungs-)EKG und Echokardiografie. Kürzlich durchgeführte Untersuchungen sollten hierbei berücksichtigt werden, um eine Mehrfachbelastung des Patienten und unnötige Kosten zu vermeiden. Sehr wichtig ist die Erhebung einer standardisierten Gerinnungsanamnese, die mit vorgegebenen Fragen zur Gerinnung das perioperative Blutungsrisiko besser erfassen kann als die Standard-Laboruntersuchungen Quick, PTT und Thrombozytenzahl.
Das anästhesiologische Vorgespräch sollte mit ausreichendem zeitlichen Abstand zum Eingriff erfolgen (Minimum: 24 Stunden, besser mehr), u. a. um das Anfordern auswärtiger Befunde, aber auch das Beschaffen hauseigener Patientenakten zu ermöglichen. Gibt es keine relevanten Veränderungen des Gesundheitszustandes des Patienten, so existieren auch hier keine eindeutig definierten zeitlichen Grenzen für das Alter der Befunde. Die in manchen Häusern übliche Praxis, Labor- oder EKG-Befunde auch bei Patienten, die für elektive Eingriffe aufgenommen werden, nur zu akzeptieren, wenn sie nicht älter als 1 Woche sind, ist durch wissenschaftliche Daten nicht zu rechtfertigen.
Aufklärung und Einwilligung des Patienten
Siehe Antwort zu Frage 1.3 und Fall 90.
Medikamente zur Prämedikation
Die Prämedikation sollte sich an den Bedürfnissen des Patienten orientieren. In der Regel genügt die Gabe eines Benzodiazepins am Morgen vor dem Eingriff (s. Antwort zu Frage 1.5), eine abendliche Medikation ist meist entbehrlich. In Absprache mit den Kollegen der operativen Abteilung ist darauf zu achten, dass die Patienten ihre Prämedikation rechtzeitig – d. h. ≥ 1 Stunde vor Abruf des Patienten in den OP – erhalten, damit die gewünschte Anxiolyse und Sedierung auch erreicht werden kann.
ZUSATZTHEMEN FÜR LERNGRUPPEN
präoperative Labordiagnostik
Risikoabschätzung bei operativen Eingriffen
Dringlichkeitsstufen von operativen Eingriffen (z. B. elektiver Eingriff, Notfalloperation)
Erheben einer standardisierten Gerinnungsanamnese
2 39-jährige Patientin mit akuter linksseitiger Hemiparese
Um 16:38 Uhr werden Sie als Notarzt mit dem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) in die Wohnung einer 39-jährigen Patientin gerufen. Die Besatzung des Rettungswagens (RTW) ist ebenfalls erst vor einigen Minuten am Einsatzort eingetroffen. Vom Ehemann der Patientin erfahren Sie, dass diese seit etwa 45 Minuten unter einer zunehmenden Schwäche der linken Körperseite leide, nicht mehr gehen könne und seitdem auch verwaschen spreche. Vorerkrankungen werden vom Ehemann verneint. Folgende Werte wurden von den Rettungsassistenten bereits gemessen: Blutdruck 190/110 mmHg, Puls 80/min, Sinusrhythmus im EKG, Sauerstoffsättigung 97 %. Bei der körperlichen Untersuchung stellen Sie fest, dass die Patientin den linken Arm und das linke Bein kaum heben kann, die Motorik der rechten Körperseite ist normal.
2.1 Welche Arbeitsdiagnose und welche Differenzialdiagnosen haben Sie?
Arbeitsdiagnose: ischämischer Schlaganfall; Begründung: Halbseitenlähmung, verwaschene Sprache
Differenzialdiagnosen: transitorische ischämische Attacke (TIA), hypertensive Krise, intrazerebrale oder Subarachnoidalblutung, epidurales Hämatom, Sinusvenenthrombose, Hirntumor, Hypoglykämie, Enzephalitis, psychogene Lähmung
2.2 Welche notfallmedizinischen Maßnahmen führen Sie durch?
Sauerstoffgabe falls SpO2 < 95 %
Monitoring: 12-Kanal-EKG, Pulsoxymetrie, Blutdruckmessung (alle 3–5 min)
periphervenöser Zugang (mindestens 18 G), kristalline Infusionslösung (Ringerlösung, 500 ml i. v.)
Bestimmung des Blutzuckers: Ausschluss einer Hypoglykämie
Blutdrucksenkung nicht erforderlich (s. Kommentar)
In Ihrem Rettungsdienstbereich befinden sich 3 Krankenhäuser:
A: Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung, Fahrzeit 5 min, kein CT-Gerät
B: Krankenhaus der Maximalversorgung mit neurologischer Abteilung und Stroke-Unit, Fahrzeit 20 min
C: Krankenhaus der Schwerpunktversorgung, CT-Gerät, aber keine neurologische Abteilung, Fahrzeit 15 min
2.3 Welches Krankenhaus wählen Sie aus? Begründen Sie Ihre Entscheidung!
Krankenhaus B: Krankenhaus der Maximalversorgung mit neurologischer Abteilung und Stroke-Unit, Fahrzeit 20 min. Auch wenn die Fahrzeit länger ist, profitiert die Patientin sicherlich von der besseren Infrastruktur in einem Krankenhaus der Maximalversorgung (CT, Stroke-Unit, ggf. Lysetherapie oder interventionelle Therapie).
2.4 Welche Maßnahmen und Vorbereitungen treffen Sie auf dem Transport in die Klinik?
Information der Zielklinik (Ankunftszeit), möglichst Direktkontakt mit dem diensthabenden Neurologen (z.B. auf der Stroke-Unit)
genaue Dokumentation der Anamnese (z. B. Dauer der Symptomatik) und des Befundes (neurologische Befunde: Reflexe, Cincinnati Cerebral Performance Stroke Scale [CPSS])
Anamnese zu möglichen Kontraindikationen für eine Fibrinolysetherapie (z. B. Gehirnblutung oder OP vor wenigen Wochen)
Messung der Körpertemperatur
evtl. Blutabnahme (Blutbild, Gerinnung, Leber- und Nierenwerte)
2.5 Welche Akutdiagnostik ist indiziert?
Zur Differenzierung zwischen zerebraler Ischämie und intrakranieller Blutung muss schnellstmöglich eine kraniale Bildgebung mittels Computertomografie (CCT) oder Magnetresonanztomografie (cMRT), ggf. mit Darstellung der hirnversorgenden Gefäße, durchgeführt werden.