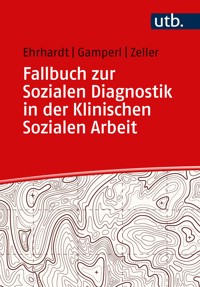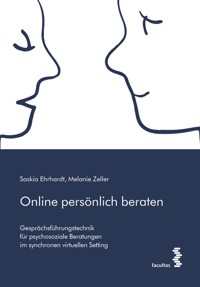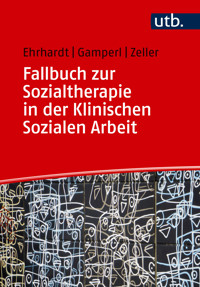
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Fallbuch stellt 25 Fälle der sozialarbeiterischen Praxis kompakt dar und kann für Lern-, Lehr- und Prüfungszwecke eingesetzt werden. Anhand aktueller Fallbeispiele wird die Anwendung der Sozialtherapie in der Sozialen Arbeit vertieft. Zu jedem Fall finden sich Fragen zu sozialtherapeutischen Methoden und Techniken. Die wesentlichen Grundlagen der Sozialtherapie werden im ersten Teil des Buches erklärt und bilden die Basis für die Bearbeitung der Praxisbeispiele. Der zweite Teil beinhaltet ausführlich erläuterte Lösungen zu jedem Fall. Damit ist praxisorientiertes, fallbezogenes und theoriegeleitetes Lernen und Üben garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
utb 6412
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Brill | Schöningh – Fink · Paderborn
Brill | Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen – Böhlau · Wien · Köln
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag · Tübingen
Psychiatrie Verlag · Köln
Psychosozial-Verlag · Gießen
Ernst Reinhardt Verlag · München
transcript Verlag · Bielefeld
Verlag Eugen Ulmer · Stuttgart
UVK Verlag · München
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
Wochenschau Verlag · Frankfurt am Main
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Angaben in diesem Fachbuch erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr, eine Haftung der Autorinnen oder des Verlages ist ausgeschlossen.
1. Auflage 2025
Copyright © 2025 Facultas Verlags- und Buchhandels AG
facultas, Universitätsverlag, Stolberggasse 26, 1050 Wien, Österreich
www.facultas.at, [email protected]
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung, sind vorbehalten.
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung, Stuttgart
Umschlagfoto: © Anna Gamperl, Wien
Lektorat: Mag.a Katharina Schindl, Wien
Satz: Wandl Multimedia-Agentur, Groß Weikersdorf
Druck: Friedrich Pustet, Regensburg
Printed in Germany
utb-Nummer 6412
ISBN 978-3-8252-6412-3 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8385-6412-8 (Online-Leserecht)
ISBN 978-3-8463-6412-3 (E-PUB)
Online-Angebote oder elektronische Ausgaben sind erhältlich unter www.utb.de.
Inhalt
1 Einleitung
2 Historische Einordnung
3 Disziplinäre Einordnung
3.1 Begriffsbestimmung
3.1.1 Vielfalt der sozialtherapeutischen Verständnisse
3.1.2 Sozialtherapie als Interventionskonzept
3.2 Gegenstand sozialarbeiterischer Sozialtherapie
3.2.1 Therapie als veränderungsinhärentes Handeln
3.2.2 Therapeutisches Handeln in sozialen Bezügen
3.3 Ausrichtung sozialtherapeutischer Zielsetzung
3.4 Funktion von Sozialtherapie
4 Frequently Asked Questions
4.1 Sind Sozialtherapie, Soziale Therapie, Soziotherapie und Soziale Psychotherapie das Gleiche?
4.2 Wer darf oder soll (nicht) sozialtherapeutisch handeln?
4.3 Ist jede Soziale Arbeit sozialtherapeutisch?
4.4 Untergräbt sozialtherapeutisches Handeln professionelle Fundamente Sozialer Arbeit?
5 Sozialtherapeutische Methoden und Techniken
5.1 Schritte zu einem sozialtherapeutischen Interventionsvorschlag
5.1.1 Schritt 1: Feststellen eines konkreten Veränderungsbedarfs unter Bezugnahme auf ein biopsychosoziales Gesundheitsverständnis
5.1.2 Schritt 2: Durchführung Soziale Diagnostik
5.1.3 Schritt 3: Anwendung methodischen Interventionswissens
5.2 Vorstellung ausgewählter Methoden und Techniken
5.2.1 Interventionen in Akutphasen mit dem Fokus auf die (Wieder-)Herstellung von Teilhabe
5.2.2 Interventionen in der Stabilisierungsphase mit dem Fokus auf Teilhabeförderung
5.2.3 Interventionen in der Sicherungsphase mit dem Fokus auf Teilhabesicherung
Fallgeschichten
Aufgabenübersicht
Fall A: Tageszentrum für obdachlose Menschen
Fall B: Wohngemeinschaft für fremduntergebrachte Kinder
Fall C: Beratungszentrum für Asylwerber:innen
Fall D: Suchtberatungsstelle
Fall E: Aufsuchende, mobile Hilfe für Kinder und Jugendliche
Fall F: Frauenberatungsstelle
Fall G: Psychosoziale Beratungsstelle
Fall H: Schulsozialarbeit
Fall I: Erwachsenenpsychiatrie
Fall J: Frauenhaus
Fall K: Kompetenzzentrum für Menschen mit Essstörung
Fall L: Pflegeheim
Fall M: Wohngemeinschaft für fremduntergebrachte Kinder und Jugendliche
Fall N: Sozialberatung
Fall O: Integrationsprojekt für geflüchtete Menschen
Fall P: Aufsuchende, mobile Hilfe für Kinder und Jugendliche
Fall Q: Tageszentrum für Senior:innen
Fall R: Berufsberatungsstelle für Jugendliche
Fall S: Psychosoziale Beratungsstelle
Fall T: Kinder- und Jugendpsychiatrie
Fall U: Justizanstalt
Fall V: Frauenberatungsstelle
Fall W: Berufsberatungsstelle für Jugendliche
Fall X: Sozialpsychiatrisches Ambulatorium
Fall Y: Kinder- und Jugendhilfe
Lösungen
Lösung Fall A: Tageszentrum für obdachlose Menschen
Lösung Fall B: Wohngemeinschaft für fremduntergebrachte Kinder
Lösung Fall C: Beratungszentrum für Asylwerber:innen
Lösung Fall D: Suchtberatungsstelle
Lösung Fall E: Aufsuchende, mobile Hilfe für Kinder und Jugendliche
Lösung Fall F: Frauenberatungsstelle
Lösung Fall G: Psychosoziale Beratungsstelle
Lösung Fall H: Schulsozialarbeit
Lösung Fall I: Erwachsenenpsychiatrie
Lösung Fall J: Frauenhaus
Lösung Fall K: Kompetenzzentrum für Menschen mit Essstörung
Lösung Fall L: Pflegeheim
Lösung Fall M: Wohngemeinschaft für fremduntergebrachte Kinder und Jugendliche
Lösung Fall N: Sozialberatung
Lösung Fall O: Integrationsprojekt für geflüchtete Menschen
Lösung Fall P: Aufsuchende, mobile Hilfe für Kinder und Jugendliche
Lösung Fall Q: Tageszentrum für Senior:innen
Lösung Fall R: Berufsberatungsstelle für Jugendliche
Lösung Fall S: Psychosoziale Beratungsstelle
Lösung Fall T: Kinder- und Jugendpsychiatrie
Lösung Fall U: Justizanstalt
Lösung Fall V: Frauenberatungsstelle
Lösung Fall W: Berufsberatungsstelle für Jugendliche
Lösung Fall X: Sozialpsychiatrisches Ambulatorium
Lösung Fall Y: Kinder- und Jugendhilfe
Literatur
Stichwortverzeichnis
Über die Autorinnen
1 Einleitung
Sozialtherapie ist in vielen Bereichen der Sozialen Arbeit im deutschsprachigen Raum ein prominentes Thema. Viele Einrichtungskonzepte verweisen auf sozialtherapeutisches Arbeiten, Tagungen werden mit diesem Schwerpunkt ausgerichtet und es existiert eine fast schon schwer zu fassende Anzahl an Publikationen, Ansätzen und (Weiter-)Entwicklungen, die theoretisch und regional unterschiedlich gefärbt sind.
Nachdem wir uns im Jahr 2023 der Sozialen Diagnostik als Schwerpunkt für ein Fallbuch für die Soziale Arbeit gewidmet haben, befassen wir uns in diesem Fallbuch mit der Sozialtherapie. Das aktuelle Buch könnte als Weiterführung verstanden werden, denn die Soziale Diagnostik ist für unsere Auffassung von Sozialtherapie essenziell.
Wir stellen hier die spezifische Ausrichtung und Praxis der Sozialtherapie in Wien – den sogenannten „Wiener Weg“ – vor. Dabei geht es uns nicht darum, das Rad neu zu erfinden, sondern darum, bestehende Stränge und Ansätze zu bündeln, neu zu ordnen und unseren spezifischen Blickwinkel auf die sozialarbeiterische Sozialtherapie darzulegen. Wir greifen dabei auch auf zahlreiche Wissensbestände zurück, die sich in den letzten Jahren vor allem in der Fachcommunity der Klinischen Sozialen Arbeit entwickelt haben.
Dieses Buch zielt darauf ab, Leser:innen für die Sozialtherapie in der Praxis zu begeistern. Sozialtherapie ist ein Interventionskonzept, das in Österreich und besonders in Wien an Bedeutung gewinnt. In den letzten Jahren sind etliche Forschungsarbeiten erschienen, darunter hauptsächlich Masterarbeiten, auf die wir uns z. T. bei unserer theoretischen Aufarbeitung und praxisnahen Reflexion beziehen. Unser Anliegen ist es, durch eine strukturierte Einführung in die sozialtherapeutischen Grundlagen eine Basis zu schaffen, die insbesondere für praktisches sozialtherapeutisches Arbeiten relevant ist. Gleichzeitig soll unser Werk als Handbuch fungieren, das keine umfassende Methodenlehre, sondern vielmehr eine kompakte, praxisnahe Orientierung zur Sozialtherapie bietet. Somit ist dieses Buch für Studierende und Lehrende eine wertvolle Begleitung.
Das Buch ist in zwei Hauptteile gegliedert:
Zunächst bieten wir im Theorieteil einen Überblick über die Grundlagen der Sozialtherapie und den Wiener Ansatz. Dieser Überblick soll Leser:innen eine schnelle und fundierte Orientierung ermöglichen und Grundlagenwissen vermitteln.
Darauf folgt der zweite Teil, der 25 Fallbeispiele aus der aktuellen sozialarbeiterischen Praxis darstellt. Die Fallbeispiele sind durch verschiedene Handlungsfelder inspiriert, Bezüge zu Personen oder Institution wurden von uns anonymisiert, modifiziert und auf den thematischen Schwerpunkt zugeschnitten. Um eine gendersensible und diversitygerechte Darstellung zu gewährleisten, verzichten wir bei den Fällen auf die Verwendung von Namen und bezeichnen die Personen mit einem Großbuchstaben.
Die in diesem Buch enthaltenen Fälle spiegeln die Vielfalt der sozialarbeiterischen Fragestellungen wider, die mit dem Wiener Ansatz der Sozialtherapie bearbeitet werden können.
Zu jedem der 25 Fälle stellen wir Fragen, die es den Leser:innen ermöglichen, sich aktiv mit den Möglichkeiten, Herausforderungen und Grenzen sozialtherapeutischen Intervenierens auseinanderzusetzen. Im hinteren Teil des Buches finden sich zu jedem Fall Lösungsvorschläge, die auf den theoretischen Grundlagen aus dem ersten Teil des Buches fußen. Diese verstehen wir als mögliche Varianten zur Interpretation und Bearbeitung der Fälle, nicht als abschließende oder alleingültige Antworten. Vielmehr möchten wir Leser:innen anregen, eigene Perspektiven zu entwickeln und das Gelesene kritisch zu reflektieren.
Wir, die Autorinnen, bringen verschiedene therapeutische Ansätze in dieses Werk ein – systemische Familientherapie, Verhaltenstherapie und Psychoanalyse. Diese verschiedenen Hintergründe erlauben es uns, die sozialtherapeutische Praxis aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und damit einen integrativen Zugang zu schaffen, der sowohl in der Lehre als auch in der Praxis immer wieder diskutiert und kritisch hinterfragt wird. Diese Vielseitigkeit im therapeutischen Zugang ist nicht nur für uns eine Bereicherung, sondern auch eine Einladung an die Leser:innen, die eigene Sichtweise einzubauen.
Besonderen Dank möchten wir an dieser Stelle den Kolleg:innen aus der Praxis aussprechen, die uns wertvolle Einblicke in ihre Handlungsfelder gewährt haben und mit uns in einen regen Austausch über Sozialtherapie in der Sozialen Arbeit getreten sind. Ihre Beiträge und Perspektiven haben maßgeblich dazu beigetragen, dass dieses Buch den aktuellen Stand der sozialarbeiterischen Sozialtherapie authentisch widerspiegeln kann. Wir danken allen beteiligten Kolleg:innen für das Review der Fallgeschichten hinsichtlich Plausibilität und Korrektheit.
Ein ausdrücklicher Dank geht außerdem an die Studierenden und Absolvent:innen des Masterstudiengangs Klinische Soziale Arbeit der FH Campus Wien. Wir greifen auf etliche Erkenntnisse aus empirischen Masterarbeiten und Forschungsprojekten zurück, die in diesem Rahmen entstanden sind. Viele der Gedanken, die im Rahmen des Studiums in der Auseinandersetzung mit Sozialtherapie immer wieder zu spannenden Diskussionen geführt haben, haben wir in das Kapitel der Frequently Asked Questions aufgenommen. Vielen Dank für die Inspiration.
Zum Abschluss bleibt uns Autorinnen, allen Leser:innen viel Freude und Anregung bei der Lektüre dieses Fallbuchs zu wünschen. Machen wir uns auf den Wiener Weg der Sozialtherapie!
Saskia Ehrhardt, Anna Gamperl & Melanie Zeller
2 Historische Einordnung
Der Begriff „Sozialtherapie“ ruft ein breites Spektrum an Vorstellungen und Erwartungen über erweiterte Handlungsoptionen, Heilsversprechungen, Professionalitätsmerkmale, Reputationsgewinne und Missbrauchspotenziale hervor. Es scheint ein Reizwort zu sein – auch deshalb, weil sich selbst nach einer bemühten Recherche, was unter Sozialtherapie zu verstehen ist, eher die ernüchternde Erkenntnis festsetzt, dass die Frage nicht eindeutig beantwortet werden kann.
Das folgende Kapitel wird die Vielzahl an Auslegungen, was Sozialtherapie meint, nicht ausräumen. Es folgt dem Ansatz, über einen kurzen Abriss der historischen Entwicklung im deutschsprachigen Raum eine Ordnung der Begriffsverständnisse vorzuschlagen. Dabei ist zu betonen, dass in der Benennung prägender Akteur:innen keine Vollständigkeit angestrebt wird und die Einordnung aus einer österreichischen Perspektive getroffen wurde. Vielmehr liegt das Hauptaugenmerk auf der disziplinären Zuordnung der sozialtherapeutischen Ansätze.
Relativ gesichert lässt sich sagen, dass die Variation „Soziale Therapie“ den begrifflichen Ursprung bildet. Der Begriff ist auf eine Publikation von Siddy Wronsky und Alice Salomon aus dem Jahr 1926 zurückzuführen (Wronsky & Salomon, 1926). Die Autorinnen veröffentlichten unter dem Titel „Soziale Therapie: ausgewählte Akten aus der Fürsorge-Arbeit“ (Wronsky & Salomon, 1926) eine Sammlung von Falldarstellungen aus unterschiedlichen Einrichtungen der Fürsorge. Eine differenzierte begriffliche Bestimmung der „Sozialen Therapie“ findet sich in ihrem Werk jedoch nicht (Wimmer, 2022; Schmid, 2023). Wronsky greift 1932, diesmal unter dem Begriff der „Sozialtherapie“, das Konzept in einem gemeinsam mit Arthur Kronfeld veröffentlichten Buch nochmals auf (Wronsky & Kronfeld, 1932) und geht hier ausführlich auf die Grundlagen von Sozialtherapie in ihrem Verständnis ein (Schmid, 2023). Wronsky verwendet in ihren Erläuterungen die Begriffe „Sozialtherapie“ und „Soziale Therapie“ synonym. Aus einer Fürsorge-Perspektive, die sowohl Wronsky als auch Salomon vertraten, hat Sozialtherapie einen behandelnden (Wronsky & Salomon, 1926) und rehabilitativen, ressourcenorientierten (Wronsky & Kronfeld, 1932) Charakter. Diese frühen Arbeiten zur Sozialtherapie haben gemeinsam, dass sie soziale Kontextfaktoren, wie Wohn-, Einkommens- oder familiäre Situation und gesundheitliches Befinden, in einen engen Zusammenhang stellen. Sie folgen zusammengefasst der Annahme, dass „in Störungs- und Problemkontexten marginalisierter, verarmter und in sozialer Notlage befindlicher (…) Menschen“ für die Verbesserung des gesundheitlichen Befindens eine Verbesserung des sozialen Umfelds notwendig ist (Pauls & Hahn, 2020, S. 48).
Die Bedeutung der sozialen Umstände für das gesundheitliche Befinden bzw. dessen Verbesserung im Zuge einer Behandlung wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts aber nicht nur aus der Fürsorgeperspektive beschrieben:
Mit Arthur Kronfeld, der Psychiater, Psychologe und Psychotherapeut war, ist bereits ein Vertreter einer medizinischen und psychotherapeutischen Sichtweise benannt. Er war überzeugt, dass soziale Not „die unmittelbare Ursache einer Reihe von Krankheitsformen“ (Kronfeld, 1931, S. 332) ist. Um den Gesundheitszustand zu verbessern, sei es unabdinglich, dass „soziale Fürsorge und die Psychotherapie zusammenwirken“, so Kronfeld (1931, S. 333). Diese aus dem Jahr 1931 stammenden Äußerungen hatte Kronfeld noch unter der Überschrift der „sozialen Psychotherapie“ (Kronfeld, 1931) veröffentlicht, während er ein Jahr später gemeinsam mit Wronsky dann den Begriff der „Sozialtherapie“ verwendet (Wronsky & Kronfeld, 1932). Ebenso aus der medizinischen Sichtweise kommend, widmete sich Alfred Adler, der Arzt und Psychotherapeut war, dem Begriff der Sozialtherapie. Er wurde 1902 von Sigmund Freud in die „Mittwochsgesellschaft“ eingeladen, wo er mit dessen psychoanalytischen Theorien in Kontakt kam (ÖVIP, 2024). Nach „unüberwindbaren Differenzen“ (ÖVIP, 2024) kam es jedoch 1911 zum Bruch zwischen Adler und Freud, woraufhin Adler den Verein für Individualpsychologie in Wien gründete. Adler grenzte sich vor allem von Freuds Triebtheorie ab und betonte „die Bedeutung der sozialen Dimension in der Psychoanalyse“ (Pauls & Hahn, 2020, S. 48). Adler interessierte sich vor allem für die „Neurosenprophylaxe“ (ÖVIP, 2024) und knüpfte dabei an die pädagogische Disziplin an. 1920 wurden unter Adlers Mitwirkung in Wien 28 Erziehungsberatungsstellen gegründet (ÖVIP, 2024).
Ein psychoanalytisches Fundament verband nicht nur medizinische, psychiatrische und psychotherapeutische Konzepte der Sozialtherapie im beginnenden 20. Jahrhundert, sondern erstreckte sich weiter bis in die Pädagogik, Sozialpädagogik und die Soziale Arbeit. Mit August Aichhorn findet sich eine Schlüsselfigur jener disziplinären Verschränkungen. Er bewegte sich vor allem in seiner Arbeit mit delinquenten Jugendlichen zwischen psychoanalytischer Pädagogik und psychoanalytischer Sozialarbeit (Aichhorn, 2014). Die Ausrichtung seiner Tätigkeit sei sozialtherapeutisch gewesen (Diepold, 1994, S. 2). Ernst Federn, gut bekannt mit August Aichhorn, wird als Vertreter einer therapeutischen, psychoanalytischen Sozialarbeit im Bereich des Strafvollzugs angesehen (Deloie & Lammel, 2020).
Die Historie der Sozialtherapie bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten zeigt, dass in unterschiedlichen fachlichen Ausrichtungen Ansätze entwickelt wurden, die grundsätzlich von einer wechselseitigen Einflussnahme sozialer Faktoren und gesundheitlicher Verfassung ausgehen. Die Entwicklung der Sozialtherapie erfuhr im deutschsprachigen Raum durch den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg eine ebensolche Zäsur, wie dies auch für die Soziale Arbeit (Deloie & Lammel, 2022; Hering & Münchmeier, 2012) und für die Soziale Diagnostik (Ehrhardt et al., 2023) dokumentiert ist. Wichtige Akteur:innen mussten fliehen (wie z. B. Alice Salomon oder Arthur Kronfeld), wurden in Konzentrationslager interniert (wie z. B. Ernst Federn) oder arbeiteten isoliert weiter (wie z. B. August Aichhorn). Jedenfalls führte die Machtübernahme der Nationalsozialisten zu einer Vernichtung des organisatorischen Zentrums der „Psychoanalytischen Bewegung“ in Wien (Aichhorn, 2014, S. 213). Da die Psychoanalyse in so vielen Bereichen eine Grundlage für sozialtherapeutische Konzepte war, erfuhr auch deren Weiterentwicklung einen Riss. Zwar konnte nach dem Zweiten Weltkrieg an einige Grundlagen angeknüpft werden, die Auswirkungen der „Verarmung der Psychoanalyse“ (Diepold, 1994, S. 2) seien jedoch bis in die Gegenwart zu spüren.
Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Bedeutung der Sozialtherapie im Sinne der Beachtung sozialer Faktoren für die medizinische Behandlung vor allem durch „sozial engagierte Mediziner“ (Pauls & Hahn, 2020) betont. In diesem Diskurs finden sich Akteure wie Viktor von Weizsäcker oder Hans Strotzka. Unter dem Leitspruch, nicht Krankheiten, sondern kranke Menschen behandeln zu wollen (NDB 27/2020; Klinikum Heidelberg, 2024), verbirgt sich von Weizsäckers Auffassung, dass Lebensgeschichten und -umstände der Patient:innen in der Behandlung mitzuberücksichtigen seien (Klinikum Heidelberg, 2024). 1947 habe von Weizsäcker den Begriff der Sozialen Therapie in die klinische Praxis als eine Methode der modernen Psychotherapie eingeführt, so Hahn (2014, S. 12). Dabei verfolgte von Weizsäcker „die subsidiäre Auffassung von Sozialtherapie“, die dann anzuwenden sei, wenn eine psychotherapeutische Behandlung nicht stattfinden kann (Wimmer, 2022, S. 18). Mit Hans Strotzka, Mediziner, Psychotherapeut und Psychoanalytiker, sei ein weiterer wesentlicher Akteur benannt, der maßgeblich für die Anerkennung sozialer Einflussfaktoren auf gesundheitliches Befinden und Behandlungsmöglichkeiten eintrat (Deloie & Lammel, 2020; Wimmer, 2022, S. 19). Andere prägende Personen waren Horst Eberhard Richter, Adrian Gaertner oder Rolf Schwendter (Deloie & Lammel, 2020; Deloie & Lammel, 2022).
Der Rolle der Fürsorge während des Nationalsozialismus und ihre langjährige, selbstkritische Aufarbeitung in der Sozialen Arbeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind möglicherweise mitursächlich dafür, dass die Sozialtherapie im deutschsprachigen Raum durch die Soziale Arbeit erst wieder ab dem Ende der 1970er-Jahre thematisiert wurde (Schmid, 2023). In den späten 1990er-Jahren und um die Jahrtausendwende wurde vor allem mit der Entwicklung der Fachdisziplin der Klinischen Sozialen Arbeit der Diskurs um die sozialarbeiterische Sozialtherapie wieder deutlich verstärkt (Deloie & Lammel, 2022).
Sozialtherapie ist aber heutzutage nicht nur psychoanalytisch ausgerichtet. Es gibt daneben verhaltensorientierte, humanistisch orientierte, systemisch orientierte und integrative Sozialtherapie. Eine ausführliche Gegenüberstellung der verschiedenen Grundorientierungen findet sich bei Deloie und Lammel (2020). Zusätzlich wird Sozialtherapie vereinzelt in psychotherapeutischen Richtungen wie Psychodrama (Dannheiser, 2007) oder Gestalttherapie (Schneider, 1979) benannt. Gleichwohl es unterschiedliche sozialtherapeutische Orientierungen gibt, ist der Status der Sozialtherapie keinesfalls mit dem der Psychotherapie zu vergleichen. Bislang gibt es weder eine standardisierte Ausbildung noch eine flächendeckende Anerkennung oder Abgeltung sozialtherapeutischer Leistungen durch Krankenkassen oder andere Sozialversicherungen (→ Kap. 4.1). Je nach disziplinärer Verortung existiert die Sozialtherapie in unterschiedlicher Relevanz und fachlicher Ausgestaltung dennoch beständig seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts, wie unser kurzer historischer Abriss zeigt.
Ein bisher unerwähnter fachlicher Strang der Sozialtherapie lässt sich entlang der anthroposophischen Heilpädagogik beschreiben (Fischer, 2018) und ebenfalls bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts zurückverfolgen. Rudolf Steiners Ansichten als Begründer der Anthroposophie spielen für die konzeptionelle Ausrichtung der anthroposophischen Sozialtherapie bis heute eine entscheidende Rolle (lebensart, 2024; Rudolf Steiner Seminar, 2024; Fischer, 2018). Sie versteht sich selbst als durchdrungen von den drei Bereichen „Medizin, Pädagogik und soziale Gestaltung des Miteinanders von Menschen mit und ohne Behinderung“ (Fischer 2018, S. 10).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich seit dem beginnenden 20. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum zumindest fünf fachliche Stränge dokumentieren lassen, die sozialtherapeutische Konzepte entwickelten und bis heute in verschiedenen Praxisfeldern einsetzen (Abb. 1).
Abb. 1: Fachliche Stränge der Sozialtherapie (eigene Darstellung)
Je nach fachlicher Zugehörigkeit gibt es für die Sozialtherapie in der inhaltlichen Auslegung, in der Stringenz der Entwicklung, in der Etablierung innerhalb von Professionen und Disziplinen und damit im Zusammenhang stehend in der strukturellen Verankerung (sowohl in der Praxis als auch in der Ausbildung) erhebliche Unterschiede. Um Sozialtherapie aus der Perspektive der Fachdisziplin der Klinischen Sozialen Arbeit fassbarer zu machen, beschränken sich die folgenden Kapitel dieses Buches ausschließlich auf den Strang der Sozialen Arbeit. Das heißt, wenn wir von Sozialtherapie sprechen, meinen wir im Folgenden die sozialarbeiterische Sozialtherapie.
3 Disziplinäre Einordnung
3.1 Begriffsbestimmung
3.1.1 Vielfalt der sozialtherapeutischen Verständnisse
Vor 20 Jahren schreiben Brigitte Geißler Piltz, Albert Mühlum und Helmut Pauls in einem der ersten Bücher zur Klinischen Sozialen Arbeit, dass die Sozialtherapie „begrifflich merkwürdig unscharf “ sei, und weiter, dass sie „kein Bestandteil der Psychotherapie, sondern nach internationalen Maßstäben ein Teilgebiet der Klinischen Sozialarbeit [ist] und […] – sozial akzentuiert – in situations- und bewältigungsorientierter psychosozialer Beratung verwirklicht“ wird (Geißler-Piltz et al., 2005, S. 108).
Wer sich an dieser Stelle – 20 Jahre danach – eine begriffliche Klarheit bzw. einen definierten Strang der sozialarbeiterischen Sozialtherapie erhofft hat, muss leider enttäuscht werden, denn nach wie vor fehlt es innerhalb der Sozialen Arbeit an einer einheitlichen Definition der Sozialtherapie und es existiert ein unscharfes Bild dessen, was darunter zu verstehen ist (Wimmer, 2022, S. iii). Pointiert formuliert kann der Begriff der Sozialtherapie bis heute als „begrifflich merkwürdig unscharf “ (Geißler-Piltz et al., 2005, S. 108) erachtet werden. Dies ist durch die teils sehr unterschiedlichen Entwicklungen aufgrund eines fehlenden gemeinsamen Verständnisses und infolge dessen durch die divergierenden Rahmenbedingungen für die sozialtherapeutische Ausübung in den deutschsprachigen Ländern zu begründen. Im Folgenden werden einige dieser vielfältigen Beschreibungen von Sozialtherapie beispielhaft dargestellt und damit wird das bunte Bild der mannigfaltigen Definitionsversuche zumindest ansatzweise aufgezeigt, was nicht zu bedeuten hat, dass all diese Definitionen auch dem derzeitigen Wiener Verständnis der Sozialtherapie entsprechen:
Sozialtherapie wird als ein „Behandlungsansatz der Klinischen Sozialarbeit“ (Ehrhardt & Steiner, 2021, S. 66; Gamperl et al., 2023, S. 5; Pauls & Lammel, 2020, S. 8; Zeller & Gamperl, 2023, S. 12), als „Milieutherapie“ (Pauls, 2013, S. 293) und als ein „Insgesamt von psycho-sozialen Interventionen“ (Pauls, 2013, S. 295), das je nach „Aufgabenstellung, Klientel und Kontext“ (Pauls, 2013, S. 295) variiert, beschrieben. Sozialtherapie subsumiere sämtliche „Behandlungsmethoden, die bei psychischen Störungen […] Einfluss auf die Lebensweise und auf die Lebenslage der Betroffenen nehmen“ (Pauls, 2013, S. 294). Ortmann und Röh (2014, S. 75) verstehen die Sozialtherapie als „eine eher der Person zugewandte Form der Bearbeitung von sozialen Problemen, wobei darüber nicht die Umwelt bzw. das Umfeld der Person außer Acht gerät“. Dabei sehe ein „sozialtherapeutisches Grundverständnis […] psycho-soziale Probleme und Störungen als Inkongruenzen, Inkompatibilitäten oder Passungsprobleme zwischen Konstitution, Zielen, Wünschen, Anforderungen, Potentialen, Ressourcen etc. auf den Ebenen der betroffenen Individuen, der sozialen Umgebung und Netzwerke, der gesellschaftlichen Bedingungen und Chancenstrukturen“ (Pauls, 2013, S. 292) an.
Sozialtherapie ist „in jenen Fällen notwendig, in denen Information, Vermittlung und Beratung nicht mehr ausreichen, um die zumeist gravierenden und komplexen Problemlagen bearbeiten zu können“ (Pauls & Hahn, 2015, S. 30). Sozialtherapie ziele „auf die Sicherung des Überlebens, die Verhinderung von Folgeschäden, die Verhinderung sozialer Desintegration und eine autonome Lebensgestaltung ab“ (Beushausen, 2020, S. 25). Somit hat Sozialtherapie auch „eine politische Dimension, indem sie sich für die Veränderung von krankmachenden Lebensverhältnissen einsetzt, die Selbstbemächtigung von Menschen sowie deren Solidarisierung fördert und advokatisch für die Verbesserung von sozial ungerechten Lebensbedingungen eintritt“ (Lammel et al., 2015, S. 25).
Sozialtherapie wird als „Handlungskonzept“ (Pauls & Lammel, 2020; Ohling, 2020; Röh et al., 2020, S. 27; Zeller & Gamperl, 2023, S. 13), „Handlungsmodell“ (Hahn, 2014, S. 13) oder „Handlungsbereich“ (Wimmer, 2020, S. 78) der Klinischen Sozialen Arbeit verstanden. Darüber hinaus wird Sozialtherapie als „beratende und behandelnde Interventionsform in der Klinischen Sozialen Arbeit“ (OGSA, 2022) beschrieben. Helmut Pauls (2013, S. 290) erachtet die Klinische Soziale Arbeit als grundsätzlich sozialtherapeutisch, wodurch eine eindeutige Abgrenzung von der Klinischen Sozialen Arbeit unmöglich wird.
„Soziale Psychotherapie“ (Beushausen, 2020, S. 22; Deloie, 2011, S. 15ff.) oder „Soziotherapie“ (Beushausen, 2020, S. 22; Pauls & Lammel, 2020; S. 8) werden synonym und inhaltlich ident gebraucht. Synonym wird auch von „sozialtherapeutischer Beratung“ (Beushausen, 2020, S. 22; Pauls & Reicherts, 2014, S. 4) oder „Sozialer Therapie“ (Pauls & Lammel, 2020, S. 8) gesprochen.
Sozialtherapie sei eine „Methode Klinischer Sozialarbeit“ (Binner et al., 2010, S. 12) oder ein „wissenschaftliches Methodenkonzept der Klinischen Sozialarbeit“ (Deloie, 2017, S. 180) bzw. konkreter als ein „methodisches Konzept […] und letztlich als eine Spezialisierung methodischen Handelns innerhalb der Sozialen Arbeit zu verstehen“ (Deloie & Lammel, 2022, S. 31). Helmut Pauls und Gernot Hahn (2015, S. 29) sprechen von einer „Methode in der (neben den Patienten) die soziale Mitwelt […] gezielt beeinflusst und verändert wird“. Darüber hinaus würde sich Sozialtherapie neben „sozialarbeiterischen Methoden auch jener der Psychotherapie [bedienen], aber nur insofern, als sie kompatibel mit den Theorien der Sozialen Arbeit sind und der Zielerreichung in sozialarbeiterischem Sinne dienen“ (Deloie & Lammel, 2022, S. 33). „Wissensbestände unterschiedlicher psychotherapeutischer Verfahren (systemisch, verhaltenstherapeutisch, psychodynamisch, humanistisch)“ zählen zur Sozialtherapie (Ohling, 2020). Im Verständnis des Deutschen Verbands für Sozialtherapie (2023) ist Sozialtherapie „eine eigenständige therapeutische Disziplin neben und in Wechselwirkung mit Psychotherapie, Seelsorge und Medizin. Sie setzt bei der Stärkung des positiven Selbstbildes der Klient*innen an und konzentriert sich auf den Aufbau von Strategien zur Alltagsbewältigung“ (Deutscher Fachverband für Sozialtherapie e. V., 2023). Insgesamt besteht eine Uneinigkeit darüber, wie stark sich Sozialtherapie an der Psychotherapie orientieren oder sich von ihr abgrenzen soll (Ohling, 2020). Pauls verweist darauf, dass der sozialtherapeutische „Ansatz eine Kooperation der Disziplinen benötigt“ (Pauls, 2013, S. 291).
3.1.2 Sozialtherapie als Interventionskonzept
Bei der Betrachtung all dieser – teils konträren – Definitionen drängt sich die Frage auf: Was ist Sozialtherapie nun wirklich? Ist Sozialtherapie eine eigene therapeutische Disziplin, ein Teilgebiet der Klinischen Sozialen Arbeit, ein Konzept, eine Methode oder schlichtweg ein Behandlungsansatz?
Barbara Wimmer hat diese Frage angetrieben, sich im Rahmen ihrer Masterarbeit an der FH Campus Wien intensiv damit zu beschäftigen, weshalb sie analysierte, wie Sozialtherapie in Ausbildungscurricula und somit die theoretische Fundierung der Sozialtherapie im deutschsprachigen Raum konzeptualisiert ist. Am Ende dieser Arbeit formulierte Wimmer eine Definitionsvorschlag, der mittlerweile als die Grundlage für das Wiener Verständnis der Sozialtherapie gilt. Es lassen sich in der Literatur und den untersuchten sozialtherapeutischen Curricula mindestens drei grundlegende Säulen der Sozialtherapie (Abb. 2) identifizieren, auf deren Basis die Sozialtherapie in Wechselbeziehung zur Klinischen Sozialen Arbeit zustande kommt (Wimmer, 2022, S. 93):
Abb. 2: Säulen der Sozialtherapie (eigene Darstellung)
Sozialtherapie vereint dabei – wie in der dritten Säule sichtbar wird – eine Vielzahl von Methoden und Techniken in sich (Wimmer, 2022, S. 93), die zum Ziel haben, Klient:innen adäquat und professionell therapeutisch begegnen zu können. Die beiden Begrifflichkeiten Methoden und Techniken werden im Alltagssprachlichen oft vermischt verwendet, sind fachlich betrachtet jedoch nicht identisch.
Methoden beschreiben eine gewählte Vorgangsweise zur Erreichung eines konkreten Ziels und sind eine Art des Herangehens an Aufgaben oder Probleme. Leitend sind dabei die Fragen „Was will ich warum erreichen?“ und „Welche Handlungsschritte können wie eingesetzt werden?“ (Galuske, 2013, S. 29). Die konkreten Handlungsinstrumente, die eingesetzt werden, sind die Techniken oder Verfahren, welche somit die Antworten auf Detailprobleme meinen. Techniken dürfen dabei nicht im Sinne von mechanischen Abläufen oder standardisierten Rezepten verstanden werden, sondern meinen auch die reflektierte und anpassungsfähige Handlungskompetenz, die Fachkräfte in der Sozialen Arbeit befähigt, flexibel und situationsgerecht zu agieren. Während Techniken also einzelne Handlungsinstrumente oder -schritte beschreiben, sind Methoden ein „übergeordneter Rahmen, der das Handeln strukturiert und leitet. […] Methoden umfassen somit im Regelfall ein ganzes Set an unterschiedlichen Techniken/Verfahren“ und fokussieren auf „Handlungswissen, weniger auf Erklärungswissen“ (Galuske, 2013, S. 31). Methoden sind wiederum Teilaspekte von Konzepten. Konzepte sind daher übergeordnet und als ein Handlungsmodell zu verstehen, in dem Inhalte, Methoden und Verfahren zusammengefasst werden. Ein Konzept ist eine systematische und durchdachte Handlungsorientierung, die als übergeordneter Rahmen fungiert und Beschreibungen des theoretischen Hintergrunds, der Zielgruppen, der methodischen Ausrichtung und der ethischen Dimension oder Grundsätze inkludieren kann. Konzepte bieten daher die theoretisch fundierte Basis für die Planung und Durchführung von Handlungen und stellen kurz gesagt ein Gesamtmodell samt Ziel- und Gegenstandsbeschreibungen und Wegen zur Zielerreichung dar. Methoden wären der Plan zur Vorgehensweise bzw. die begründete Planung der Intervention. Techniken sind Einzelelemente von Methoden, sprich konkrete Handlungsschritte oder -instrumente (Galuske, 2013, S. 30f.).
Dieser Differenzierung von Konzept – Methode – Technik folgend, ist Sozialtherapie als ein „Interventionskonzept innerhalb der Fachdisziplin der Klinischen Sozialen Arbeit“ (Wimmer, 2022, S. 94) zu verstehen. Aufgrund der Bündelung unterschiedlicher methodischer Zugänge scheint die Zuteilung zu Konzept am geeignetsten. Der Begriff der Intervention wird dabei synonym zu jenem der Behandlung verstanden, meinen doch beide ein „zielgerichtetes, planmäßiges und methodisches Handeln“ (Pauls, 2013, S. 177). Diese Definition von Sozialtherapie als Interventionskonzept der Klinischen Sozialen Arbeit geht nicht alleinig und erstmalig auf Barbara Wimmer zurück, sondern wurde von anderen Autor:innen (u. a. Pauls, 2013, S. 290; Röh et al., 2020, S. 27; Beushausen, 2020, S. 26; Ohling, 2020; Pauls & Hahn, 2015) auch so verstanden und nun unter der Definition nochmals empirisch belegt und begründet.
Wir möchten nun folgend nochmals vertiefter auf die drei Säulen blicken und diese im Verständnis der Sozialen Arbeit explizit darstellen.
3.1.2.1 Biopsychosoziales Verständnis von Gesundheit und Krankheit
Das biopsychosoziale Verständnis von Gesundheit und Krankheit bildet die erste der drei Säulen der Sozialtherapie und wird in diesem Abschnitt eingehend beleuchtet. Das Kapitel fasst die zentralen Inhalte aus der Perspektive der Klinischen Sozialen Arbeit zusammen und widmet sich insbesondere der sozialen Dimension, dem spezifischen Zuständigkeitsbereich der Sozialen Arbeit.
Das biopsychosoziale Verständnis stellt einen holistischen Ansatz dar, der allgemein auf der Annahme beruht, dass das menschliche Erleben und Verhalten durch das komplexe Zusammenspiel biologischer, psychologischer und sozialer Faktoren beeinflusst wird. Diese Betrachtungsweise ermöglicht eine umfassende Perspektive auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Klient:innen. Innerhalb der Klinischen Sozialen Arbeit wird das biopsychosoziale Verständnis oftmals als grundlegendes Paradigma betrachtet, dessen Gültigkeit und Relevanz weitgehend als unumstritten angesehen werden können. Auch in fachlichen Diskursen und in der professionellen Arbeit mit den Adressat:innen erfreut sich dieses Verständnis großer Akzeptanz, wird vielfach verwendet und oft als selbstverständlich vorausgesetzt.
Die Grundlage der biopsychosozialen Betrachtung von Gesundheit findet sich in der bis heute anerkannten und vielfach zitierten Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von deren Verfassung aus dem Jahr 1946: „Gesundheit ist ein Zustand vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen“ (WHO, 1946, S. 1). Darüber hinaus wird in der WHO-Verfassung betont, dass „der Besitz des bestmöglichen Gesundheitszustandes […] eines der Grundrechte jedes Menschen ist, unabhängig von Rasse, Religion, politischer Überzeugung sowie wirtschaftlichem oder sozialem Status“ (WHO, 1946, S. 1). Lange Zeit wurde Gesundheit dennoch primär aus einer biomedizinischen Perspektive betrachtet. Gesundheit definierte sich dabei weiterhin über das Fehlen von Krankheiten und Defiziten und Krankheit wurde diesem Verständnis nach als eine Funktionsstörung und Abweichung von der physiologischen Norm angesehen. Gesundheit erschien lange als ein einheitlicher Zustand, so als gäbe es nur eine Gesundheit, wobei aber eine Vielzahl von Krankheiten existiere, die diesen Zustand stören könne (Egger, 2017).
Als revolutionär ist daher die Entwicklung des biopsychosozialen Modells des US-amerikanischen Psychiaters George L. Engel zu erachten: 1977 beschrieb Engel mit einem einflussreichen Artikel im renommierten „Science“ seinen Vorschlag für ein integrativsystemisch gedachtes Modell von Gesundheit und Krankheit. Er erachtete in diesem Artikel die Medizin als in einer tiefen Krise befindlich, welche er auf die ausschließliche Orientierung an einem biologisch ausgerichteten Krankheitsmodell zurückführte. Das biologisch orientierte Krankheitsmodell, so Engel, entspräche nicht mehr den wissenschaftlichen Erkenntnissen und werde der sozialen Verantwortung der Medizin nicht gerecht (Engel, 1977, S. 129). Er betrachtete Krankheitsmodelle als eine Art Glaubenssystem, die zur Erklärung von Naturphänomenen verwendet werden. Krankheiten sind jedoch auch stets kulturell geprägt und müssten dahingehend betrachtet werden (Engel, 1977, S. 130). Innerhalb des damals vorherrschenden biomedizinischen Modells wurde Krankheit primär über somatische Parameter definiert, als Abweichungen von biologischen Normwerten, die messbar sowie vom sozialen Verhalten der Betroffenen unabhängig sind. Zwei unterschiedliche Ansätze prägen dabei den Zusammenhang von Verhalten und Krankheit innerhalb dieses Modells: Der reduktionistische Ansatz betrachtet Verhaltensphänomene als Resultate physikalisch-chemischer Prinzipien und versucht, diese ausschließlich auf diese Weise zu erklären. Der exklusivistische Ansatz hingegen schließt alle Phänomene von der Krankheitskategorie aus, die sich nicht auf dieser Basis erklären lassen (Engel, 1977, S. 13).
Obwohl das biomedizinische Modell bei der Behandlung von Krankheiten erfolgreich und verbreitet war, zeigte sich seine Begrenzung insbesondere bei komplexen Erkrankungen, die sowohl somatische als auch psychologische Anomalien aufweisen können und deren Ursachen ebenfalls vielfältig sind. Engel nannte hier konkret Schizophrenie oder Diabetes mellitus als Beispiele (Engel, 1977, S. 131). Zudem wirken sich psychologische, soziale und kulturelle Faktoren darauf aus, wie Patient:innen Krankheitssymptome wahrnehmen und kommunizieren. Engel argumentiert für eine zwingende Notwendigkeit einer umfassenderen Betrachtung der psychologischen Dimension sowie des sozialen Kontextes, in dem ein Mensch lebt, weil diese Auswirkungen auf die Wahrnehmung und den Verlauf von Krankheiten haben. Ob jemand „gesund“ oder „krank“ ist, wird durch kulturelle, soziale und psychologische Faktoren beeinflusst (Engel, 1977, S. 132). Da das vorherrschende biomedizinische Modell weder sozialen, psychologischen noch verhaltensbezogenen Dimensionen von Krankheit Platz einräumte, schlug Engel das biopsychosoziale Modell vor. Dieses Modell berücksichtigt nicht nur biologische, sondern klar auch psychologische und soziale Faktoren, die zur Entstehung von Krankheit und zur Definition von „illness and patienthood“ (Engel, 1977, S. 133), also zu Krankheit und Patient:in-Sein beitragen und in Wechselwirkung zueinander stehen. Das biopsychosoziale Modell „provides a blueprint for research, a framework for teaching, and a design for action in the real world of healthcare“ (Engel, 1977, S. 135). Zentral ist dabei immer die individuelle Sichtweise der Betroffenen und so hängt die Entscheidung, ob ein Leiden als „problem of living“ oder als „sick“ (Engel, 1977, S. 133) einzuordnen ist, von den Patient:innen und der Tatsache, ob sie ihre Rolle als Kranke:r akzeptieren bzw. das Gesundheitssystem in Anspruch nehmen, ab. Diese Unterscheidung zwischen „Krankheit“ und „Lebensproblem“ stellt jedoch sowohl für Ärzt:innen als auch für Patient:innnen eine Herausforderung dar und fordert eine differenzierte Betrachtung.
Das biopsychosoziale Modell von George L. Engel wurde ein Leitkonzept für viele nachfolgende Entwicklungen und Publikationen. So haben etwa Thure von Uexküll und Wolfgang Wesiack (1998) in ihrer „Theorie der Humanmedizin“ oder Josef Egger im Rahmen der von ihm definierten „psychosozialen Medizin“ (2017) darauf grundlegend Bezug genommen. Auch in der Ottawa-Charta, dem Abschlussdokument der ersten internationalen Konferenz zur Gesundheitsförderung der Weltgesundheitsorganisation, wird klar das ganzheitliche biopsychosoziale Gesundheitsverständnis als komplexes Zusammenspiel der Dimensionen aufgegriffen und in der Ableitung von Strategien berücksichtigt (WHO, 1986).
Von Beginn an war das biopsychosoziale Verständnis auch systematisch ein Bestandteil Klinischer Sozialer Arbeit und hat sich mittlerweile in den verschiedensten Arbeitsfeldern mit Gesundheitsbezug und Arbeitsweisen (Pauls & Mühlum, 2024, S. 25), so auch der Sozialtherapie, ausgebreitet. Obwohl das „biopsychosoziale Modell […] in empirisch-wissenschaftlicher und erkenntnistheoretischer Hinsicht ein ‚Modell im Werden‘ mit vielen Evidenzen, aber auch ungeklärten Fragen und Herausforderungen“ (Pauls, 2021, S. 23) ist, bekennt sich die Klinische Soziale Arbeit in Österreich nach wie vor klar zu einem biopsychosozialen Verständnis von Gesundheit und Krankheit und erachtet es als unerlässlich, soziale Bedarfslagen in der Wechselwirkung mit gesundheitlichem Wohlbefinden zu betrachten (Gamperl et al., 2023, S. 3).
Aufgrund der Komplexität ermutigt das biopsychosoziale Modell zu einem interdisziplinären Ansatz in der Behandlung von Patient:innen und unterstreicht die Notwendigkeit, dass Fachkräfte unterschiedlicher Professionen zusammenarbeiten, um die Gesundheit eines Menschen ganzheitlich zu fördern. Trotz der weiten Verbreitung des Modells und der disziplinenübergreifenden Anerkennung als Standard in der jeweiligen Profession wird auch Kritik am biopsychosozialen Modell geäußert. Einige Kritiker:innen bemängeln, dass das Modell zu breit sei und es schwerfällt, praktische Richtlinien daraus abzuleiten. Andere sagen, dass es in der Praxis oft verkürzt oder oberflächlich angewendet wird, ohne wirklich die drei Dimensionen gleichwertig zu berücksichtigen. So wird etwa die Gefahr gesehen, dass die weitere Entwicklung biologisch orientiert bleiben dürfte, da definierte Forschungskriterien für die Auszahlung von Fördergeldern eher danach orientiert sind (Tretter, 2020, S. 16). Zudem stellt die enorme Komplexität des biopsychosozialen Ansatzes einen zentralen Grund dar, warum das Modell bis dato nicht voll zum Tragen gekommen ist. Oftmals stehen die einzelnen Dimensionen nur in additiver Verbindung oder laufen gänzlich unverbunden nebeneinander her (Sommerfeld, 2020, S. 130f.).
Das ursprüngliche biopsychosoziale Verständnis von Gesundheit und Krankheit verdeutlicht aber die Notwendigkeit, psychologische und soziale Faktoren gleichberechtigt als Einflussgrößen auf die Gesundheit zu berücksichtigen (Egger, 2017). Während die körperliche Gesundheit in der Regel klar definiert ist, sind die Konzepte der psychischen sowie insbesondere der sozialen Gesundheit schwerer zu fassen.
Dabei ist die Vorstellung davon, was unter psychischer Gesundheit zu verstehen ist, noch greifbarer: Häufig wird sie durch das Fehlen von Symptomen definiert, die anhand von Klassifikationssystemen wie dem ICD-10 oder DSM-5 als psychische Störungen diagnostiziert werden können. Doch psychische Gesundheit ist weiter gefasst und beschreibt laut der WHO „einen Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann“ (WHO, 2019, S. 1). Dieser Zustand ermöglicht es einer Person, ihr intellektuelles und emotionales Potenzial zu entfalten und eine erfüllende Rolle in der Gesellschaft zu finden. Psychisch gesunde Menschen verfügen über eine ausgewogene Balance zwischen den Anforderungen und Belastungen ihres Lebens sowie den ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen und Bewältigungsstrategien – ein Spannungsverhältnis, das sich über die Lebensspanne und durch einschneidende Lebensereignisse verändern kann (WHO, 2019). Nicht zuletzt durch vermehrtes öffentliches Interesse oder Medienbeiträge haben Menschen mittlerweile eine bessere Vorstellung von und psychischer Gesundheit und ein gesteigertes Bewusstsein dafür entwickelt.