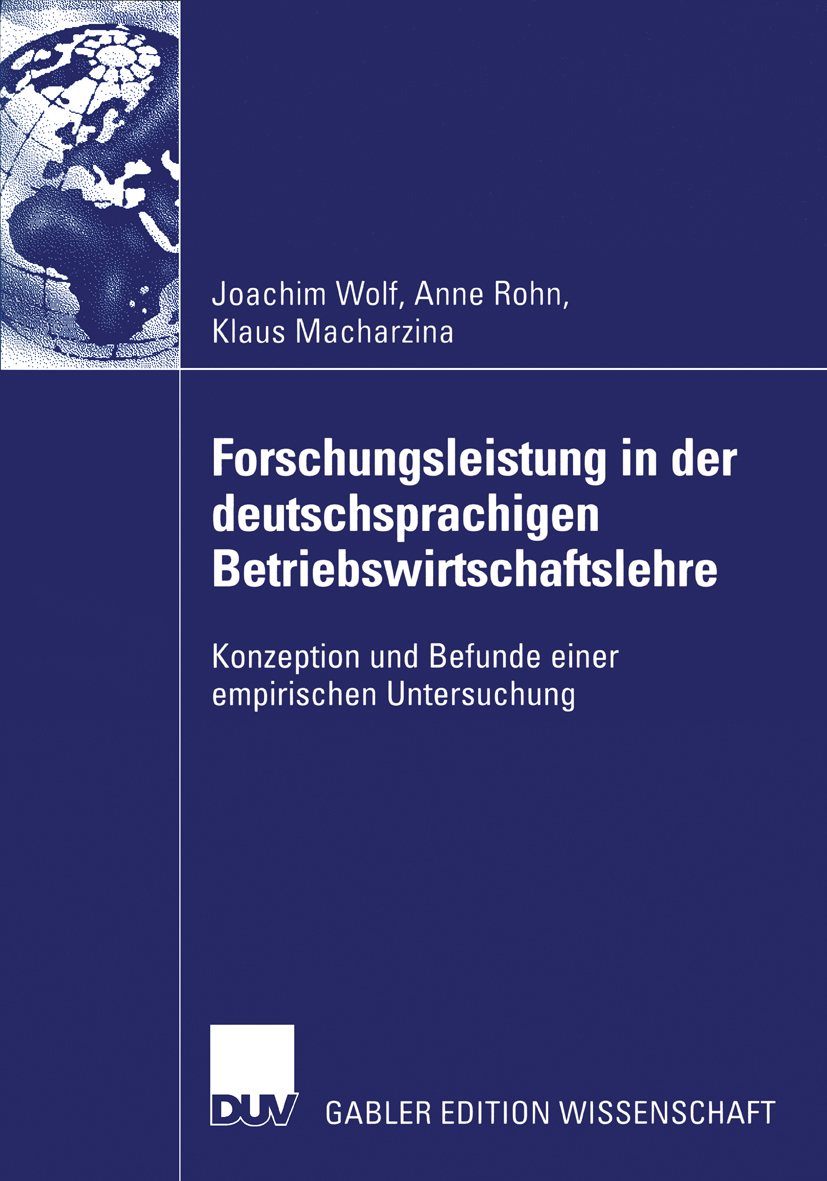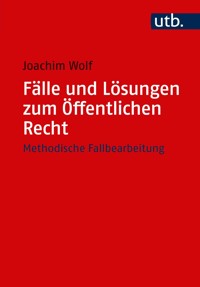
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Systematisches Klausurtraining im Öffentlichen Recht Die Fallbearbeitung im Öffentlichen Recht stellt hohe Anforderungen. Diese Anforderungen lassen sich nur mit methodischen Fähigkeiten bewältigen. Das vorliegende Buch arbeitet fachübergreifend und anhand einer strikt methodischen Falllösungslehre, mit dem Ziel von Anfang an die Fähigkeit zu trainieren, auch unbekannte Fallkonstellationen selbständig bewältigen zu können. Die hier präsentierten Fälle und Lösungen bilden eine exemplarisch ausgewählte Grundlage zum Erwerb des benötigten gutachterlichen Könnens. Den Studierenden wird so ein systematisches Klausurtraining ermöglicht. Die Fallbearbeitung im Öffentlichen Recht stellt Anforderungen, die sich nur mit methodischen Fähigkeiten bewältigen lassen. Die hier präsentierten Fälle und Lösungen bilden eine exemplarisch ausgewählte Grundlage zum Erwerb des benötigten Könnens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joachim Wolf
Fälle und Lösungen zum Öffentlichen Recht
Methodische Fallbearbeitung
Mohr Siebeck GmbH & Co. KG
Inhaltsverzeichnis
|V|Vorwort
In allen Teilbereichen des Jurastudiums – dem Zivilrecht, dem Strafrecht, dem Öffentlichen Recht, dem Europarecht und dem Völkerrecht – stellt die Methodik der Fallbearbeitung verglichen mit anderen Ausbildungsschwerpunkten die höchsten Anforderungen an die Studierenden. Der Grund liegt im Denkaufwand und in den hiermit verbundenen konkreten Formulierungsanforderungen, die jede gutachterliche Fallbearbeitung verlangt. Diese Schwierigkeiten lassen sich nur mit methodischen Fähigkeiten bewältigen. Auf sie kann man sich nicht durch Auswendiglernen eines Stoffes vorbereiten.
Wer sich diesen Schwierigkeiten von Anfang an bewusst stellt, wird mit einem erfolgreichen Studienverlauf und in aller Regel mit einem überdurchschnittlichen Studienabschluss belohnt. Das belegen langjährige Ausbildungserfahrungen. Auch hierfür lassen sich klare Gründe benennen. In erster Linie ist dies die Selbstständigkeit im juristischen Denken, die mit jeder zu Übungszwecken geschriebenen weiteren Klausur wächst. Mit ihr nimmt zugleich die Fähigkeit zu, auch neue und bislang selbst so noch nicht bearbeitete Fallkonstellationen selbstständig und erfolgreich zu bewältigen. Zugleich schärft sich der Blick und das Bemühen der Studierenden dafür, nicht nur nach Maßgabe der einschlägigen Gesetzesgrundlagen, sondern auch im Hinblick auf die tatsächlichen Betroffenheiten der Streitbeteiligten eines Falles überzeugende und in diesem Sinne „gerechte“ Lösungen zu erarbeiten. Zusammen genommen bilden diese beiden Faktoren und die Fähigkeiten, zu denen sie führen, das eigentliche Studienziel. Sicherlich müssen für eine erfolgreiche Klausurbearbeitung auch systematische Kenntnisse über einschlägige Gesetzesgrundlagen mitgebracht werden. Am besonderen Stellenwert methodischer Fähigkeiten ändert dies nichts.
Dies erklärt auch die Präsentation des Übungsstoffes in den in diesem Buch enthaltenen Fällen und Fallösungen. Bewusst wird nicht zwischen angeblich leichten Fällen für Anfänger, Fällen für Fortgeschrittene und Examensfällen unterschieden. Die methodischen Anforderungen sind „im Prinzip“ überall gleichermaßen anspruchsvoll und daher schwierig. Zusammen genommen sollen sie durch die exemplarische Auswahl der hier präsentierten Fälle die Grundlage für das gutachterliche Können bilden, das für ein erfolgreiches Studium benötigt wird. In einem besonderen Punkt gibt es von diesem Gleichrang der Anforderungen eine Ausnahme, die aber weniger in der Methodik, sondern eher in den materiellrechtlichen Sachanforderungen begründet ist. Das ist die zunehmende Überlagerung und Durchdringung des deutschen öffentlichen Rechts durch das Europarecht, das Gemeinschaftsrecht, das Unionsrecht und die zunehmende europarechtliche Integration des Grundrechtsschutzes. Einige Grundfragen dieser Problematik werden in Fall 2 behandelt. Es wird empfohlen, sich mit diesem Fall erst zu beschäftigen, wenn im Laufe des Studiums ausreichende europarechtliche Grundlagen erarbeitet worden sind.
Bochum, im Februar 2018 Prof. Dr. Joachim Wolf
|IX|Abkürzungsverzeichnis
Abs.
Absatz
AEUV
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
Alt.
Alternative
AltPflG
Altenpflegegesetz
Art.
Artikel
BauGB
Baugesetzbuch
BauNVO
Baunutzungsverordnung
BauO
Bauordnung
BFH
Bundesfinanzhof
BGH
Bundesgerichtshof
BPolG
Bundespolizeigesetz
BR-Drs
Bundesrats-Drucksache
BT-Drs
Bundestags-Drucksache
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
BVerfGG
Bundesverfassungsgerichtsgesetz
BVerwG
Bundesverwaltungsgericht
DÖV
Die Öffentliche Verwaltung
DVBl
Deutsches Verwaltungsblatt
EGGVG
Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz
etc.
et cetera
EU
Europäische Union
EuGH
Europäischer Gerichtshof (Luxemburg)
FGO
Finanzgerichtsordnung
GG
Grundgesetz
Ggf.
Gegebenenfalls
h.M.
herrschende Meinung
hrsg.
herausgegeben
IFG
Informationsfreiheitsgesetz
i.S.d.
im Sinne des
i.V.m.
in Verbindung mit
JVKostO
Justizverwaltungskostenordnung
JZ
Juristenzeitung
LG
Landgericht
NJW
Neue Juristische Wochenzeitschrift
NRW
Nordrhein-Westfalen
NVwZ
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NVwZ-RR
Rechtsprechungs Report
NWVBl
Nordrhein-westfälisches Verwaltungsblatt
OB
Oberbürgermeister
OBG
Ordnungsbehördengesetz
OLG
Oberlandesgericht
PolG
Polizeigesetz
PresseG
Pressegesetz
PUAG
Gesetz über die Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse
Rn.
Randnote
S.
Seite
Slg.
Sammlung
sog.
sogenannt
TA Lärm
Technische Anleitung Lärm
u.a.
unter anderem
UrhG
Urhebergesetz
VGH
Verwaltungsgerichtshof
VwGO
Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG
Verwaltungsverfahrensgesetz
ZPO
Zivilprozessordnung
|1|Kapitel 1: Grundlagen
|3|I. Unterschätzte Bedeutung der Methodik der Fallbearbeitung für das Studium
Der Philosoph Ludwig Wittgenstein hat gesagt: „Die Welt ist alles, was der Fall ist“.[1] Dieser Satz enthält zwei für die juristische Fallbearbeitung wichtige Grundaussagen. Erstens kann der Mensch die Welt niemals in ihrer Gesamtheit erkennen, sondern immer nur „von Fall zu Fall“, das heißt in Form von Ausschnitten, die seiner eigenen Beobachtung und Erfahrung zugänglich sind. Zweitens ist die Anzahl möglicher Beobachtungsausschnitte, also auch die Anzahl der Fälle, schon für jeden einzelnen Menschen unendlich, eben weil es um die gesamte Welt geht. Nimmt man hinzu, dass es auf unserer heutigen Welt rund 7 Milliarden Menschen gibt und jedem einzelnen von ihnen unzählige Einzelfälle offenstehen, potenziert sich diese Vielfalt ins Unermessliche. Selbst wenn man sich nur auf strikt juristische Streitfälle beschränkte, wäre es von vornherein völlig utopisch, die Gesamtheit dieser Fälle erfassen zu wollen. Auch dem Gesetzgeber, der zur Lösung juristischer Streitfälle abstrakte Rechtsregeln aufstellt, ist eine solche gesamthafte Erfassung unmöglich.
Für die juristische Fallbearbeitung im Studium und im Examen folgt hieraus: ohne juristische Methodik ist die Fülle des ausbildungsrelevanten Rechtsstoffs nicht zu bewältigen. Juristische Methodik setzt sich zusammen aus einem am Gesetz ausgerichteten Denken, einer Bearbeitung von Streitfällen, die auf einschlägigen Gesetzesgrundlagen aufbaut, sowie einer am gerichtlichen Streitentscheidungsverfahren orientierten juristischen Argumentationsweise.
Die vorliegende Fallbearbeitungslehre für das Öffentliche Recht soll eine Grundlage dafür legen, diese Anforderungen mit überdurchschnittlichem Erfolg zu bestehen.
II.Was ist ein „Juristisches Gutachten“?
Ein juristisches Gutachten hat Antworten auf Rechtsfragen zu geben und die Gründe für diese Antworten darzulegen. Über die gutachterlich zu bearbeitenden Rechtsfragen geben der Sachverhalt und die mit ihm verknüpften streitigen Rechtsstandpunkte der Parteien Auskunft. Vom Sachverhalt ausgehend ist der gedankliche Weg (Methode = Weg) zu erarbeiten, der auf der Grundlage einschlägiger Gesetze und der Verfassung schrittweise über Zwischenergebnisse zur abschließenden Antwort auf die Fallfragen führt.
1.Konkreter Rechtsstreit (Rechtsfall)
Rechtsfälle entstehen aus Streitigkeiten über Vorgänge des täglichen Lebens, deren Folgen für betroffene Menschen bewältigt werden müssen, weil sie eine soziale Störung darstellen oder weil problematische Grundlagen für rechtliche Gestaltungsent|4|scheidungen – behördliche Genehmigungen, Verträge etc. – geklärt werden sollen. Rechtsfälle sind stets konkret, d.h. nach beteiligten Personen, Ort und Zeit streitauslösender Ereignisse und vorgegebener Sachverhaltssituationen individualisierbar. Bei den Sachverhaltsinformationen des Rechtsfalles handelt es sich durchweg um konkrete Angaben, mit denen einzelne streitige und fragliche Rechtsbeziehungen in individualisierter Form beschrieben werden. Dementsprechend stellen auch die hieraus abgeleiteten Rechtsfragen des Falles konkrete Rechtsfragen dar: bezogen auf individuelle Streitparteien in einer spezifischen alltäglichen Streit- und Entscheidungssituation.
Methodische Grundregel: durchgängige Fallbezogenheit
Alle gutachterlichen Ausführungen müssen einen Bezug zur Beantwortung der Rechtsfragen des konkreten Falles aufweisen, der gelöst werden soll. Das bedeutet umgekehrt, dass Ausführungen im Gutachten, denen der konkrete Fallbezug fehlt, methodisch fehlerhaft sind. Dieser – leider sehr verbreitete – Fehler wird nur bei folgender Vorgehensweise vermieden:
(1) Zunächst werden auf der Grundlage des Sachverhalts konkrete Rechtsfragen formuliert, die im Gutachten beantwortet werden müssen.
(2) Jede dieser im Rechtsstreit begründeten konkreten Rechtsfragen lässt sich im Sinne einer abstrakten Rechtsfolge verallgemeinern und einer gesetzlichen Regelung zuordnen, die die gesuchte Rechtsfolge enthält.
(3) Die für die gutachterliche Fallösung „einschlägigen“ Gesetze werden also über die gesetzliche Rechtsfolge durch ihre inhaltliche Verbindung mit den konkreten Rechtsfragen des Falles gefunden.
(4) Damit erweist sich das Gesetz als der methodische Leitfaden, der aufgrund seiner durchgängigen strukturellen Unterscheidung zwischen Tatbestand und Rechtsfolge innerhalb jedes Gesetzes die für die rechtliche Lösung des konkreten Streitfalles benötigte Verknüpfung der konkreten Sachverhaltsgegebenheiten mit der in der gesetzlichen Rechtsfolge zum Ausdruck kommenden abstrakt-generellen Rechtsregel liefert. Die im Gesetz formulierten Tatbestandsvoraussetzungen enthalten die abstrahierten Voraussetzungen, die im konkreten Fall erfüllt sein müssen, damit der Schluss auf die gesuchte gesetzliche Rechtsfolge rechtlich trägt.
(5) Wenn die konkreten Daten des Falles die abstrakten Tatbestandsmerkmale der gesetzlichen Regel erfüllen, dann ist die Schlussfolgerung des Gutachters auf die ebenfalls abstrakte gesetzliche Rechtsfolge begründet.
Das Gesetz dient bei dieser Vorgehensweise als rechtliche Erkenntnisquelle für die schrittweise zu erarbeitende Fallösung. Es liefert damit zugleich die abschließende Antwort auf die Fragen, welche konkreten Falldaten nach Maßgabe der gesetzlichen Tatbestandselemente für die Lösung relevant sind und welche Schlussfolgerungen aus ihnen für die gesuchte Fallösung mit Blick auf die gesetzliche Rechtsfolge gezogen werden dürfen.
|5|2. Gutachtenstil – systematische Suche nach dem Ergebnis
Im Unterschied zum Richter (Urteil) kennt der Gutachter das Ergebnis des Rechtsfalles nicht, wenn er mit der Begutachtung beginnt. Seine Arbeitsmittel sind der konkrete Sachverhalt, die sich hieraus ergebenden konkreten Rechtsfragen, die er selbst formulieren muss, sowie der verbindliche Rechtsmaßstab zur Beantwortung dieser Fragen: die Verfassung, das Gesetz, der Vertrag sowie die einschlägigen Auslegungsregeln für diese. Auch dieser Schritt, das Auffinden der allgemeinverbindlichen einschlägigen Rechtsgrundlagen, gehört zu den Aufgaben des Gutachters.
Aus der Verknüpfung von konkretem Sachverhalt mit abstrakten, möglicherweise für die Fallösung einschlägigen Gesetzen, ergibt sich der hypothetische Charakter der gutachterlichen Arbeitsmethode. Auf der Grundlage streitiger und fraglicher, also ungewisser, Rechtsbeziehungen wird danach gefragt, ob sich die Existenz oder eben die Nichtexistenz der streitigen Rechtsfolge aus der jeweiligen Gesetzesgrundlage gesichert nachweisen lässt: durch Übereinstimmung der konkreten fraglichen Rechtsfolge mit der abstrakten gesetzlichen Rechtsfolge in Verbindung mit der schrittweisen Prüfung, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen für den Eintritt der Rechtsfolge aus dem Sachverhalt begründbar sind (sog. Subsumtion). Gedanklich wie darstellungsmäßig stehen beim Gutachten stets die Fragestellungen am Anfang, die Ergebnisse als letzter Begründungsschritt am Ende. Am ehesten deckt sich diese gutachterliche Arbeitsmethode in der Rechtspraxis mit der anwaltlichen Beratungstätigkeit, die dann ggf. einem gerichtlichen Rechtsstreit zugrunde gelegt wird. Das ist aber nur eine gedankliche Hilfsbrücke für den gutachterlichen Denk- und Darstellungsstil.
3.Rechtsstreitigkeiten unter Einbeziehung des Staates – Besonderheiten der Fallbearbeitung im Öffentlichen Recht
Der Staat kann seine Entscheidungen nicht wie eine Privatperson nach eigenem Belieben treffen. Er ist an rechtliche Ermächtigungsgrundlagen gebunden. Sie ergeben sich teils aus der Verfassung, teils stehen sie im Gesetz. Aus der durchgängigen Ermächtigungsabhängigkeit staatlichen Handelns[2] folgen strukturelle Besonderheiten des öffentlichen Rechts. Diese Besonderheiten wirken sich auf die Methodik der Fallbearbeitung im Öffentlichen Recht aus. Das führt zu Abweichungen gegenüber dem Zivilrecht und dem Strafrecht.
Die Wahrnehmung von Staatsaufgaben im täglichen Leben und der Einsatz spezifisch staatlicher Durchführungsmittel hierzu findet in unterschiedlich strukturierten Rechtsbeziehungen öffentlichrechtlicher Natur statt, aus denen sich spezifische Anforderungen an die Methode der Prüfung öffentlichrechtlicher Streitfälle ergeben Die Grundkonstellationen sind:
|6|Die Ermächtigung des Staates zur Wahrnehmung und Durchsetzung seiner Aufgaben gegenüber dem Bürger und der Allgemeinheit, falls erforderlich durch Eingriff in Bürgerrechte (Staat-Bürger-Verhältnis).
Das umgekehrte Verhältnis: negatorische (Staatsabwehr) und positive (leistungsmäßige) Inanspruchnahme des Staates durch den Bürger (Bürger-Staat-Verhältnis).
Innerstaatliche Rechtsverhältnisse und Rechtsstreitigkeiten, an denen der Bürger nicht beteiligt ist und die er nicht aus eigenem Recht beeinflussen kann (sog. Binnenrechtsstreitigkeiten).
III.Staat-Bürger-Verhältnis
Wird eine öffentlichrechtliche Streitigkeit dem Staat-Bürger-Verhältnis zugeordnet, ist bei der gesuchten Ermächtigungsgrundlage für das streitige staatliche Tätigwerden zwischen der Aufgabenermächtigung und der Eingriffsermächtigung zu unterscheiden. Für beide bestehen in der Regel unterschiedliche Verfassungs- und Gesetzesgrundlagen.
Aufgabenermächtigungen sind verfassungsrechtliche oder gesetzliche Regelungen, die eine Staatsaufgabe inhaltlich und umfänglich generell festlegen und mit einer Kompetenz (= generell ermächtigende und verpflichtende Rechtswirkungen für zuständige staatliche Stellen) verbinden.
Polizeigesetz (PolG) NRW
§ 1 Aufgaben der Polizei.
(1) Die Polizei hat die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren (Gefahrenabwehr). Sie hat im Rahmen dieser Aufgabe Straftaten zu verhüten sowie vorbeugend zu bekämpfen und die erforderlichen Vorbereitungen für die Hilfeleistung und das Handeln in Gefahrenfällen zu treffen.[3]
|7|Artikel 87a Grundgesetz
Aufstellung der Streitkräfte. (1) Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Ihre zahlenmäßige Stärke und die Grundzüge ihrer Organisation müssen sich aus dem Haushaltsplan ergeben.
Für die Antwort auf die von der Aufgabenermächtigung und -zuweisung zu unterscheidende weitergehende Frage, ob der Staat zur Durchsetzung dieser Aufgaben im Einzelfall beschränkend in Rechte von Bürgern eingreifen darf, müssen besondere Ermächtigungsgrundlagen herangezogen werden (Eingriffsermächtigungen).
Polizeigesetz (PolG) NRW
§ 8 Allgemeine Befugnisse.
(1) Die Polizei kann die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen Falle bestehende konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung (Gefahr) abzuwehren, soweit nicht die §§ 9 bis 46 die Befugnisse der Polizei besonders regeln.[4]
Artikel 87a Abs. 2 Grundgesetz
(2) Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es zuläßt.
In „Kann“-Bestimmungen, wie beispielsweise § 8 Abs. 1 PolG NRW, kommt als weitere kompetenzrechtliche Besonderheit des öffentlichen Rechts die gesetzliche Ermächtigung zuständiger staatlicher Stellen zum Ausdruck, im Hinblick auf die Durchführung ihrer Aufgabe nach Maßgabe der konkreten Umstände des Falles – situationsabhängig – von der Behörde selbst gestaltete Rechtsfolgen zu setzen (Ermessensermächtigung).
Polizeigesetz (PolG) NRW
§ 3 Ermessen, Wahl der Mittel.
(1) Die Polizei trifft ihre Maßnahmen nach pflichtgemäßem Ermessen.[5]
(2) Kommen zur Abwehr einer Gefahr mehrere Mittel in Betracht, so genügt es, wenn eines davon bestimmt wird. Der betroffenen Person ist auf Antrag zu gestatten, ein anderes ebenso wirksames Mittel anzuwenden, sofern die Allgemeinheit dadurch nicht stärker beeinträchtigt wird.
Die Ausübung von Ermessensermächtigungen durch zuständige staatliche Stellen ist durchgängig an den rechtsstaatlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gebunden (verfassungsrechtliches – mitunter einfachgesetzlich untermauertes – Gebot, nur mit Blick auf die einschlägige allgemeine Aufgabe geeignete und – situationsbedingt – erforderliche Maßnahmen zu ergreifen; pflichtgemäßes Ermessen).
|8|PolG NRW
§ 2 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
(1) Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen hat die Polizei diejenige zu treffen, die den einzelnen und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt.[6]
(2) Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu dem erstrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht.
(3) Eine Maßnahme ist nur solange zulässig, bis ihr Zweck erreicht ist oder sich zeigt, dass er nicht erreicht werden kann.
IV.Bürger-Staat-Verhältnis
Die Rechte des von staatlichen Entscheidungen betroffenen Bürgers zur Abwehr des Staates aus seinem privaten Rechtsbereich sind vornehmlich die Grundrechte in ihrer klassischen Funktion als negatorische Abwehrrechte (Inzidenter-Prüfung im Prozess vor den Verwaltungsgerichten; unabhängig davon: Verfassungsbeschwerde als subsidiärer Rechtsbehelf zum Bundes- oder Landesverfassungsgericht).
Auf der Ebene einfachen Gesetzesrechts wird diese negatorische Abwehrfunktion prozessual unterstützt durch die verwaltungsgerichtliche Anfechtungsklage gegenüber behördlichen Verwaltungsakten (§ 113 Abs. 1 VwGO). Für das umgekehrte Begehren gesetzlich begründeter positiver staatlicher Leistungen durch behördlichen Verwaltungsakt steht die Verpflichtungsklage zur Verfügung (§ 113 Abs. 5 VwGO).
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
§ 42 Anfechtungs- und Verpflichtungsklage. (1) Durch Klage kann die Aufhebung eines Verwaltungsakts (Anfechtungsklage) sowie die Verurteilung zum Erlaß eines abgelehnten oder unterlassenen Verwaltungsakts (Verpflichtungsklage) begehrt werden.
§ 113 Urteilsinhalt. (1) Soweit der Verwaltungsakt rechtswidrig und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt ist, hebt das Gericht den Verwaltungsakt und den etwaigen Widerspruchsbescheid auf.“ (Anfechtungsklage)
…
(5) Soweit die Ablehnung oder Unterlassung des Verwaltungsakts rechtswidrig und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt ist, spricht das Gericht die Verpflichtung der Verwaltungsbehörde aus, die beantragte Amtshandlung vorzunehmen, wenn die Sache spruchreif ist. Andernfalls spricht es die Verpflichtung aus, den Kläger unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts zu bescheiden.“ (Verpflichtungsklage).
Der nicht auf förmliche Verwaltungsakte gegründete Bereich verwaltungsbehördlicher Tätigkeit ist materiellrechtlich gesetzlich gestaltet. Negatorische Abwehr- und positive Leistungsansprüche der Bürger können hier prozessual vor den Verwaltungsgerichten über die allgemeine Leistungsklage und über die Feststellungsklage durchgesetzt |9|werden. Die allgemeine Leistungsklage ist in der VwGO nicht explizit geregelt, aber vorausgesetzt (§§ 43 Abs. 2, 111, 113 Abs. 4 VwGO). Mit der subsidiären Feststellungsklage können streitige verwaltungsrechtliche Rechtsverhältnisse gerichtlich verbindlich geklärt werden.
§ 43 VwGO
(1) Durch Klage kann die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses oder die Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes begehrt werden, wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an der baldigen Feststellung hat (Feststellungsklage).
Dieselben negatorisch-abwehrenden und leistungsmäßig fordernden materiellen Anspruchs- und prozessualen Rechtsschutzkonstellationen wie bei den verwaltungsgerichtlichen Klagearten gibt es auch außergerichtlich auf der behördlichen Ebene, soweit die Behörde rechtsförmlich durch Verwaltungsakt handelt. Anknüpfungspunkt ist dann die grundsätzlich nach einem Monat eintretende Bestandskraft der Verwaltungsaktregelung. Sie kann von betroffenen Bürgern im Wege des rechtzeitigen Widerspruchs bei der erlassenden Behörde hinausgeschoben oder beseitigt werden (Anordnung des Sofortvollzugs). Der individuelle Rechtsschutzeffekt einer aufschiebenden Wirkung liegt darin, dass der Verwaltungsakt zeitweise oder dauerhaft nicht vollstreckt werden kann.
V.Sog. Binnenrechtsstreitigkeiten
Staatsorganisationsrechtlich handelt es sich bei Binnenrechtsstreitigkeiten im Wesentlichen um
Organstreitigkeiten (zwischen verschiedenen Staatsorganen über ihre verfassungsmäßigen Rechte), oder
Bund-Länder-Streitigkeiten im föderalen System.
Verwaltungsrechtlich geht es bei sog. Binnenrechtsstreitigkeiten vornehmlich um an Rechtsaufsichtsmaßnahmen anknüpfende Streitigkeiten zwischen einer mit Selbstverwaltungskompetenzen ausgestatteten staatlichen Einrichtung (Kommunen, Körperschaften des öffentlichen Rechts) und den zur Rechtsaufsicht über sie berufenen übergeordneten staatlichen Stellen (in der Regel Regierungspräsidien und Regierungen der Länder).
|10|VI. Materielle und formelle Rechtmäßigkeit staatlicher Maßnahmen
Aus dem Umstand, dass der Staat nur durch rechtlich hergestellte Organisation entsteht und Bestand hat (Art. 20 Abs. 2 Satz 1 und 2GG) ergibt sich in Verbindung mit der verfassungsrechtlich durchgängigen Ermächtigungsbedürftigkeit staatlichen Handelns (Art. 20 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3GG) eine weitere Besonderheit für die öffentlichrechtliche Fallbearbeitung. Das ist die Unterscheidung von formeller und materieller Rechtmäßigkeit staatlichen Handelns.
Vereinbarkeit des Erfolgs staatlichen Handelns mit der Verfassung und dem Gesetz (materielle Rechtmäßigkeit),
Vereinbarkeit staatlichen Handelns mit verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Zuständigkeits-, Form- und Verfahrensanforderungen (formelle Rechtmäßigkeit).
Es gibt im öffentlichen Recht eigene Regeln dafür, wann die Rechtmäßigkeit staatlichen Handelns
die strikte Einhaltung sämtlicher formeller und materieller Rechtmäßigkeitsanforderungen verlangt. In diesem Fall führen schon formelle Fehler zur Qualifizierung des staatlichen Handelns als rechtswidrig, obwohl die Entscheidung der jeweiligen staatlichen Stellen im Ergebnis mit dem Gesetz im Einklang steht;
in erster Linie die Einhaltung materieller Rechtmäßigkeitsanforderungen verlangt, während formelle Fehler zwar nicht irrelevant sind, aber geheilt werden können,
nur die Einhaltung materieller Rechtmäßigkeitsanforderungen verlangt, während formelle Fehler für das auf die staatliche Tätigkeit insgesamt bezogene Rechtmäßigkeitsurteil irrelevant sind.
Die Frage, welche dieser Rechtmäßigkeitsstufen eingreift, muss grundsätzlich der Gesetzgeber beantworten.
VII.Arbeit am Sachverhalt und an den Rechtsfragen des Falles
Die meisten Klausuraufgaben enthalten wenig geordnete Grunddaten über die tatsächlichen Gegebenheiten, die Situation und die Ereignisse, die zu ihr geführt haben – also über die Sachlage, die den konkreten Streitfall ausmacht. Hinzu kommt, dass die am Ende der Aufgabenstellung formulierte(n) Rechtsfrage(n) – Was kann X gegen den Bescheid unternehmen? Hat die Klage des X Aussicht auf Erfolg? Ist das umstrittene Gesetz wirksam zustande gekommen? – in aller Regel zu allgemein sind, um einen schrittweise abarbeitungsfähigen Leitfaden für die schriftliche Fallösung zu liefern. Hierfür ist eine Strukturierung der Sachverhaltsgegebenheiten im Hinblick auf die zu beantwortenden Rechtsfragen des Falles erforderlich. Die Strukturierung des Falles besteht aus vier Arbeitsschritten. Sie gehören noch nicht zur Fallösung, sondern stellen Vorbereitungsschritte dar. Mit kurzen Notizen zu den Ergebnissen jedes dieser Arbeitsschritte ist der Weg für die abschließende schriftliche Ausarbeitung eröffnet.
|11|1. Tatsachenstoff des Falles (1. Stufe)
Der erste Arbeitsschritt besteht in der Zusammenstellung des Tatsachenstoffs, also aller zwischen den Beteiligten unstreitigen Daten, Ereignisse und Zusammenhänge des Falles, in die der nachfolgende rechtliche Streitstoff eingebettet ist. Zum Tatsachenstoff gehört auch die „Rechtsgeschichte“ des Falles. Das ist alles, was sich im Vorlauf der aktuell zu bearbeitenden rechtlichen Fragen zwischen den Beteiligten vor Gerichten oder in Form verwaltungsbehördlicher Entscheidungen abgespielt hat. Es empfiehlt sich, den Tatsachenstoff in Form von stichwortartigen Notizen festzuhalten. Damit ist eine Abgrenzungsgrundlage gegenüber den streitigen Rechtspositionen und Fallfragen geschaffen.
2.Parteivorbringen, Streitgegenstand (2. Stufe)
In einem zweiten Arbeitsschritt werden die streitigen Positionen jeder beteiligten Seite formuliert und einander gegenübergestellt, und zwar möglichst in den eigenen laienhaften Worten der Beteiligten, um den Blick für die wirklichen Anliegen der Streitbeteiligten frei zu halten (konkrete Streitpositionen). Maßstab für die Formulierung dieser Positionen ist das, was jede Seite für sich rechtlich erreichen will. Damit wird der maßgebliche Ansatz erarbeitet, um nachfolgend die einschlägigen Rechtsfragen zu bestimmen, die begutachtet werden sollen.
Zur Ermittlung der streitigen Standpunkte und des wirklichen rechtlichen Begehrens der Beteiligten sind ggf. Auslegungen der mitgeteilten Informationen über diese Standpunkte erforderlich. Das ist keine juristische Auslegungsarbeit, sondern eine Auslegungsarbeit, die sich auf den Sachverhalt bezieht. Sie ist typisch für die anwaltliche Beratungstätigkeit, die für den Anwalt damit beginnt, herauszufinden, was die Mandantin oder der Mandant wirklich will.
Hier liegt eine erste potentielle Fehlerquelle für die Fallbearbeitung. Ihr begegnen Bearbeiter am wirksamsten durch strikte Vermeidung juristischer Fachausdrücke und vorschnelle rechtliche Einordnungen des Falles nach Maßgabe von gesetzlichen Entscheidungsgrundlagen. Der Streit ist – wiederum stichwortartig – so zu skizzieren, wie ihn die Parteien mit ihren eigenen Worten darstellen. Für die Auslegung dieser Darstellung ist auf die allgemeine Lebenserfahrung zurückzugreifen, soweit es um Privatpersonen im Streit mit dem Staat geht. Auch das staatliche Streitvorbringen sollte nicht mit juristischen Fachausdrücken beschrieben werden, sondern mit der psychologisch naheliegendsten Zielsetzung, die sich aus der jeweiligen staatsaufgabenmäßigen (amtlichen) Stellung der beteiligten staatlichen Stelle ergibt.
|12|Merke
Der Grund für die Zurückhaltung beim Umgang mit gesetzlichen Rechtsbegriffen und Systembegriffen liegt in der Gefahr, durch vorschnellen gedanklichen Rückgriff auf solche Allgemeinbegriffe mit ihren vielfältigen assoziativen Zuordnungsmöglichkeiten den eigentlichen konkreten Rechtsstreit zu verfehlen (häufiger Fehler). Die Vielfalt der Lebenswirklichkeit, der die Streitfälle entnommen sind, ist unbegrenzt. Das allgemeinverbindlich formulierte, abstrakte Gesetz ist dagegen stets begrenzt. Wer sich beim Einstieg in die Fallbearbeitung zu stark vom abstrakten Gesetz leiten lässt, verfehlt leicht den konkreten Streitstoff.
In einem allein auf die Fallbearbeitung bezogenen Sinne kann man dieses so ermittelte konträre Parteivorbringen als „Streitgegenstand“ bezeichnen. Mit einem prozessualen Streitgegenstand vor Gericht hat das wenig zu tun. Es geht um die aus dem Fall zu ermittelnden streitigen Positionen, auf die das verlangte Gutachten zu gründen ist.
3.Rechtliche Fragestellungen des Falles auf der Grundlage des konkreten Parteivorbringens (3. Stufe)
Mit der Formulierung der rechtlichen Fragestellung oder der mehreren rechtlichen Fragestellungen wird auf der dritten Stufe die Grundlage für die juristische Begutachtung vervollständigt. Gedanklich und arbeitstechnisch geht es bei diesem Strukturierungsschritt darum, aus dem auf der zweiten Stufe ermittelten konkreten Streitbegehren der Beteiligten die rechtlichen Fragen des Falles herauszufiltern und zu formulieren, die begutachtet werden sollen. Dazu müssen diese Rechtsfragen in der einschlägigen Gesetzessprache und mit Hilfe der Systematik der jeweiligen Rechtsmaterie – Staatsorganisationsrecht, Grundrechte, allgemeines Verwaltungsrecht, Polizeirecht, Baurecht, Kommunalrecht etc. – formuliert werden. Jetzt – erst jetzt – sind abstrakte Gesetzes- und Rechtskenntnisse gefragt.
Dieser Arbeitsschritt, die Umsetzung des konkreten streitigen Parteivorbringens in die allgemeinen Rechtsfragen des Falles, die zu begutachten sind, ist der umfassendste und schwierigste. Er liefert aber das, wonach die Bearbeiter suchen: das Prüfungsprogramm für die Erstellung des Gutachtens. Darin sind folgende Teilschritte eingeschlossen:
Erster Teilschritt: zu beantworten ist zunächst die Frage, ob es sich überhaupt um eine öffentlichrechtliche Streitigkeit – verfassungsrechtlicher oder verwaltungsrechtlicher Natur – handelt. Hier sind ggf. Abgrenzungen gegenüber privatrechtlichen Streitigkeiten erforderlich.[7]
Der zweite Teilschritt besteht in der Klärung der Frage, in welchem Verhältnis sich der Rechtsstreit abspielt: im Staat-Bürger-Verhältnis, im Bürger-Staat-Verhältnis, im innerstaatlichen bzw. innerkommunalen Verhältnis (zwischen Staatsorganen, Verwaltungsbehörden, kommunalen Entscheidungsträgern). – Durch einen Blick |13|auf die in der rechtlichen Fallfrage genannten Personen und staatlichen/kommunalen Stellen lässt sich diese Frage in der Regel problemlos und schnell beantworten.
Als dritter Teilschritt folgt dann die rechtlich-systematische Formulierung der Rechtsfragen des Falles, die aus den kontroversen Standpunkten der Beteiligten (unter Ziffer 2) abzuleiten sind.
Der vierte Teilschritt besteht in der Ermittlung der einschlägigen Gesetzes-, Verfassungs- und Verordnungs- oder Satzungsgrundlagen. Diese Ermittlung läuft über die in den formulierten Rechtsfragen enthaltenen allgemeinen Rechtswirkungen, für die passende Grundlagen in den Rechtsfolgen in Betracht kommender allgemeinverbindlicher Regeln gefunden werden müssen. Dann können im Gutachten die Tatbestandsgrundlagen geprüft werden.
Einschlägige Rechtsgrundlagen
Oft passen allgemeine gesetzliche Rechtsfolgen nicht genau zu den konkreten streitigen Rechtswirkungen. Sie müssen dann ggf. auf der Grundlage verschiedener gesetzlicher Regelungen miteinander kombiniert oder entsprechend (analog) angewendet werden.[8]
Welche gesetzlichen Regelungen im Hinblick auf die Fallösung einschlägig sind und der Begutachtung zugrunde gelegt werden müssen, ist immer aus dem konkreten Streitstoff heraus zu beantworten. Der konkrete Streitstoff liefert den Zugang zu derjenigen Rechtswirkung, die im Streit ist: z.B. einem Entschädigungsanspruch, der Gültigkeit eines Gesetzes, der Wirksamkeit eines Verwaltungsakts oder seiner Rücknahme, der Rechtmäßigkeit einer polizeilichen Gefahrenabwehrmaßnahme etc.
Daraus folgt: die gesuchten einschlägigen Gesetzesgrundlagen müssen über die gesetzliche Rechtsfolge gefunden werden.[9] Einschlägig ist jede gesetzliche Rechtsfolge, die der konkret streitigen Rechtswirkung eine Rechtsgrundlage zu liefern vermag (Übereinstimmung von konkreter streitiger Rechtswirkung und abstrakter gesetzlicher Rechtsfolge nach der Art der Rechtswirkung).
Ist diese Übereinstimmung gefunden, konzentriert sich das Gutachten auf die Prüfung des jeweiligen gesetzlichen Tatbestands (Tatbestandselemente plus richtige Anwendung im Einzelfall (Ermessensfehlerfreiheit, Verhältnismäßigkeit).
4.Gutachterlicher Prüfungsauftrag (4. Stufe)
Die generelle und umfassende Frage am Ende der Aufgabenstellung enthält zugleich den gutachterlichen Prüfungsauftrag. In der Regel weicht dieser Prüfungsauftrag inhaltlich und umfänglich nicht von den konkreten rechtlichen Fragestellungen ab, die auf der 3. Stufe ermittelt und formuliert worden sind. Es kann aber zu folgenden Abweichungen kommen, denen dann gutachterlich gefolgt werden muss.
Der gutachterliche Prüfungsauftrag kann:
|14|Einschränkungen gegenüber den als gutachterlich relevant ermittelten konkreten Rechtsfragen enthalten. Wenn es beispielsweise im Hinblick auf eine verwaltungsgerichtliche Klage heißt: „Ist die Klage des X gegen das Land L begründet?“, wird nur nach der Begründetheit gefragt und ist die prozessuale Zulässigkeit der Klage nicht zu prüfen. Mitunter wird die Prüfung bestimmter Gesetzesgrundlagen ausgeklammert, weil sie nicht zum Prüfungsstoff gehören.
Erweiterungen gegenüber den als gutachterlich relevant ermittelten Rechtsfragen enthalten. Dann muss das Gutachten entsprechend erweitert werden, beispielsweise durch Prüfung einer Fallvariante, nach der zusätzlich gefragt wird.
|15|Kapitel 2: Fälle zum Verfassungsrecht – Grundrechte
|17|Fall 1: Körperscanner
Menschenwürde Art. 1 I GG, Allgemeines Persönlichkeitsrecht Art. 2 I i.V.m. Art. 1 I GG, präventive Verfassungsbeschwerde gegen geplante Gesetzesvorhaben
240 Abgeordnete der C-, F- und S-Parteien bringen einen Gesetzentwurf im Bundestag ein mit dem Antrag, § 5 Abs. 1 Luftsicherheitsgesetz zu ändern. Die geltende Fassung dieser Bestimmung lautet:
„Die Luftsicherheitsbehörde kann Personen, welche die nicht allgemein zugänglichen Bereiche des Flugplatzes betreten haben oder betreten wollen, durchsuchen oder in sonstiger geeigneter Weise überprüfen. Sie kann Gegenstände durchsuchen, durchleuchten oder in sonstiger geeigneter Weise überprüfen, die in diese Bereiche verbracht wurden oder werden sollen.“
Die neue Fassung soll lauten:
„Die Luftsicherheitsbehörde kann Personen, welche die nicht allgemein zugänglichen Bereiche des Flugplatzes betreten haben oder betreten wollen, durchleuchten oder in sonstiger geeigneter Weise überprüfen.“
Durch diese Gesetzesänderung soll der umstrittene Einsatz von Körperscannern auf deutschen Flughäfen als zusätzliche Sicherheitskontrolle ermöglicht werden. Die vorgeschlagene Gesetzesänderung sieht außerdem vor, dass nur eine unstreitig nicht gesundheitsschädliche Terahertz-Technologie für die Durchleuchtung verwendet werden darf.
Anlass für die von den Gesetzesinitiatoren begehrte flächendeckende Einführung von Körperscannern auf deutschen Flughäfen war folgender Vorfall: Ein junger Mann aus dem Jemen, Abdul N., wollte in Frankfurt/Main das Flugzeug auf dem Weiterflug nach New York wechseln. Der islamistisch hochgradig radikalisierte Mann hatte unter der Kleidung am Bein eine Sprengladung aus knetbarem Sprengstoff befestigt. Auf dem Weiterflug nach New York wollte er die Bombe hochgehen lassen und das vollbesetzte Flugzeug zum Absturz bringen. Auf dem Weg zu seinem „Gate“ (Eingangsstelle für den Weiterflug) begegneten ihm zwei Beamte der Bundespolizei mit Spürhunden für die Drogenfahndung. Einer der Hunde sprang den entgegenkommenden Abdul N. unvermittelt an und biss ihn in das Hosenbein. Bei der anschließenden Körperkontrolle wurde die Bombe entdeckt.
Der Fall erregte in Sicherheitskreisen großes Aufsehen und verschärfte den Druck auf die Einführung von Körperscannern. Die Begründung für die Gesetzesinitiative zur Einführung dieser neuen Sicherheitstechnologie stellt vor allem auf folgenden Punkt ab: Die Verwirklichung solcher Risiken, wie sie der Fall Abdul N. zeige, dürfe nicht dem puren Zufall überlassen bleiben. Ob der Frankfurter Fall durch Körperscanner wirklich schon an den allgemeinen Kontrollstellen entdeckt worden wäre, |18|ist unklar. Terahertzstrahlen werden nur von konsistenten Gegenständen am Körper zurückgeworfen, nicht z.B. von Flüssigkeiten. In Stellungnahmen von Experten heißt es, der Frankfurter Fall wäre mit ziemlicher Sicherheit schon bei einer Körperscanner-Kontrolle entdeckt worden. Er wäre also wohl keine Zufallsentdeckung geblieben. Diese Einschätzung bleibt aber letztlich eine Vermutung, weil die Technologie noch in der Entwicklung und Testphase ist. Kritiker der Gesetzesinitiative meinen, die Körperscanner-Technologie sei mit Persönlichkeitsrechten der Fluggäste unvereinbar, da der nackte Körper durch die Kleider hindurch ziemlich detailscharf sichtbar werde. Das sei insbesondere gegenüber weiblichen Fluggästen, aber auch gegenüber Fluggästen, die aus religiösen Gründen eine Einsicht anderer in unbedeckte Bereiche ihres Körpers strikt ablehnen, rechtswidrig und unzumutbar. Technische Weiterentwicklungen der Scannertechnologie, die detailscharfe Einblicke in den unbekleideten Körper deutlich absenken, ohne den für den beabsichtigten Sicherheitsgewinn wesentlichen Durchleuchtungseffekt zu beeinträchtigen, sind unstreitig technisch noch nicht einsatzfähig.
Auch effektive Sicherheitsgewinne durch die neue Körperscanner-Technologie gegenüber den herkömmlichen Metalldetektoren sind letztlich nicht geklärt. Daher lautet ein Kritikpunkt an der Gesetzesinitiative, die Einführung der neuen Sicherheitstechnologie sei weder geeignet noch erforderlich. Der Unverhältnismäßigkeitseinwand wird auch mit der krassen Abweichung zur Kontrolle des in demselben Flugzeug mitgeführten Begleitgepäcks begründet. Während die Fluggäste nunmehr flächendeckend durchleuchtet werden sollen, werden beim Begleitgepäck im Frachtraum – was tatsächlich so vorgesehen ist – unverändert nur stichprobenartige Durchleuchtungen vorgenommen. In der Gesetzesdebatte im Bundestag wird diesem Einwand entgegengehalten, schon wenige Einzelentdeckungserfolge, die über die bisherige Technologie hinausführen, könnten die Eignung und Erforderlichkeit der neuen Technologie begründen.
Von der Fraktion „Die Linke“ wird die Frage an die Autoren der Gesetzesinitiative aufgeworfen, was mit eingescannten Daten passiere. Die Antwort lautet, grundsätzlich würden die Daten sofort gelöscht. Im Falle eines Sicherheitsbefundes, wenn also Gegenstände am Körper entdeckt werden, sei in die Scannertechnologie eine automatische Datenweiterleitung an die zuständigen staatlichen Sicherheitsbehörden integriert. Darüber kommt es im Bundestag zum Streit. Der Vorwurf der Fraktion „Die Linke“ lautet: Ihr sammelt heimlich biometrische Daten. Das sei vom Luftsicherheitsgesetz nicht gedeckt und verfassungswidrig.
Auch die Frage der administrativen Umsetzung der neuen Scannertechnologie bleibt umstritten. Die Autoren der Gesetzesinitiative teilen hierzu mit, die Sache werde wie bei der etablierten Metalldetektoren-Kontrolle und Handgepäckdurchleuchtung ablaufen. Es handele sich um eine Eigensicherung des Flughafenbetreibers, in der Regel also ein privatwirtschaftliches Unternehmen, als Teil seiner unternehmerischen Verantwortlichkeit und seines Hausrechts. Die Sicherheitskontrollen, auch die geplante neue Scannertechnologie, stellten keine Aufgabe staatlicher Sicherheitsbehörden dar. Sie würden durch private Sicherheitsunternehmen im Auftrag des Flughafenbetreibers durchgeführt. Die administrative Umsetzung hierfür bezüglich der Körperscanner sei bereits durch den Entwurf einer neuen Richtlinie des Bundesministers des Innern auf der Grundlage des Luftsicherheitsgesetzes vorbereitet. Danach werde die neue Sicherheitsvariante mit Körperscannern ebenfalls als Form der Eigensicherung durch |19|den jeweiligen Flughafenbetreiber über die zuständige Luftsicherheitsbehörde durchgeführt.
Dieses Konzept stößt auf erhebliche Kritik im Bundestag. Mehrere Abgeordnete vertreten den Standpunkt, die neue Kontrolle mit Körperscannern an Flughäfen sei aufgrund der Eingriffe in Persönlichkeitsrechte und der vorgesehenen hoheitlichen Auswertung und Speicherung gescannter Daten eine hoheitliche Aufgabe, die nur von staatlichen Behörden durchgeführt werden könne. Mit dieser neuen Sicherheitstechnologie seien die verfassungsrechtlichen Privatisierungsgrenzen klar überschritten. Die Autoren der Gesetzesinitiative meinen demgegenüber, einen prinzipiellen Unterschied zur bisherigen Detektorenkontrolle und Handgepäckdurchleuchtung könnten sie bei den Körperscannern nicht erkennen.
Ist der vorgelegte Gesetzesentwurf zur Änderung des § 5 Abs. 1 Satz 1 Luftsicherheitsgesetz mit dem Grundgesetz vereinbar?
Wäre eine Verfassungsbeschwerde von Frau F, einer regelmäßig ins Ausland fliegenden Geschäftsfrau, mit dem Antrag, die Verfassungswidrigkeit der geplanten Gesetzesänderung schon vor Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens festzustellen, zulässig?
Bearbeitungshinweis: Europarechtliche und datenschutzrechtliche Fragen sind nicht zu erörtern
Strukturierung des Sachverhalts
1.Tatsachenstoff
Die geltende Fassung des § 5 Abs. 1 Luftsicherheitsgesetz soll durch einen von 240 Abgeordneten des Bundestags eingebrachten Gesetzentwurf wie folgt geändert werden: „Die Luftsicherheitsbehörde kann Personen, welche die nicht allgemein zugänglichen Bereiche des Flughafens betreten haben oder betreten wollen, durchleuchten oder in sonstiger geeigneter Weise überprüfen.“ Die für die Durchleuchtung vorgesehene Terahertz-Technologie ist unstreitig nicht gesundheitsschädlich. Technisch ist es bislang jedoch nicht gelungen zu verhindern, dass bei der Durchleuchtung detailscharfe Bilder des unbekleideten menschlichen Körpers sichtbar werden. Das Konzept sieht vor, dass von durchleuchteten Personen erhobene Bilddaten bei nicht auffälligem Befund sofort gelöscht werden. Werden dagegen am Körper versteckte Gegenstände entdeckt, werden die Daten automatisch an die zuständigen staatlichen Sicherheitsbehörden weitergeleitet. Im Unterschied zum Begleitgepäck im Frachtraum des Flugzeugs, das unverändert nur stichprobenweise kontrolliert werden soll, ist die Personendurchleuchtung strikt und ausnahmslos vorgesehen. Der Gesetzentwurf enthält ferner Bestimmungen, nach denen sämtliche mit dem Durchleuchtungsvorgang |20|verbundenen Eingriffe in Rechte der Fluggäste kompetenzmäßig auf die privaten Flughafenbetreiber und ihr Personal als Beliehene übertragen werden.
2.Parteivorbringen (Streitgegenstand)
Anlass für den Gesetzentwurf war ein Vorfall im Sicherheitsbereich des Flughafens, bei dem ein Suchhund einer polizeilichen Drogenstaffel einem entgegenkommenden Flugpassagier ins Bein biss und sich bei einer Überprüfung herausstellte, dass dieser Flugpassagier unter seiner Hose eine Bombe aus knetbarem Sprengstoff befestigt hatte. Die den Gesetzentwurf tragenden Abgeordneten meinen, die Sicherheit des Flugverkehrs dürfe nicht von solchen Zufallsfunden abhängen. Eine durchgängige Körperkontrolle aller Passagiere sei unverzichtbar.
Die Gegner des Gesetzentwurfs im Bundestag wenden ein, eine ausnahmslose Durchleuchtung der Kleidung von Passagieren sei entwürdigend, insbesondere gegenüber Frauen und Fluggästen, die aus religiösen Einsichtnahmen Fremder in unbedeckte Körperbereiche strikt ablehnten. Außerdem könne die Durchleuchtungstechnologie nur konsistente Gegenstände erkennen, nicht aber Flüssigkeiten und andere nicht reflektierende Stoffe. Es sei unverhältnismäßig, Flugpassagiere ausnahmslos zu durchleuchten, das in demselben Flugzeug mitgeführte Begleitgepäck aber nur stichprobenartig.
3.Rechtliche Fragestellungen
Der Streitgegenstand verlangt die Prüfung eines Eingriffs in den Schutzbereich der Menschenwürde durchleuchteter Flugpassagiere nach Art. 1 Abs. 1GG. Dafür ist die in der Rechtsprechung des BVerfGs entwickelte Objektformel heranzuziehen, aus der ein konkreter Eingriffsbefund ermittelt werden muss. Angesichts der zeitlichen Kürze des Durchleuchtungsvorgangs und dem ersichtlich vorrangigen reinen Sicherheitszweck ist ein Eingriff problematisch. Nur dann, wenn ein Eingriff in den Schutzbereich der Menschenwürde bejaht wird, besteht Veranlassung, auf die umstrittene Frage einzugehen, ob jeder Eingriff in den Schutzbereich der Menschenwürde per se verfassungswidrig sei, weil diese uneinschränkbar gewährleistet sei. Das ist nach wie vor die überwiegende Auffassung in Rechtsprechung und Schrifttum zu Art. 1GG. Nur wenige Autoren halten auch die Menschenwürde für abwägungsoffen.
Zu prüfen ist ferner ein Eingriff in den Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts nach Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1GG, und zwar in seinen Ausprägungen als Recht am eigenen Bild und als Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Bei der Erörterung des Schrankenvorbehalts im Falle von Eingriffen kommt es auf eine Auseinandersetzung der höchsten Eingriffshürde an, nämlich dem Vorliegen von Gründen, die selbst einen Eingriff in die Intimsphäre rechtfertigen können. Im Hinblick auf Fluggäste, die Einblicke Fremder in ihren unbekleideten Körper aus religiösen Gründen strikt ablehnen, ist eine Verletzung der Glaubens- und Religionsfreiheit nach Art. 4GG zu erörtern.
|21|Staatsorganisationsrechtlich ist die vorgesehene Übertragung von Kontrolleingriffen gegenüber Fluggästen auf private Unternehmen als Beliehene im Hinblick auf die in Art. 33 Abs. 4GG enthaltene Verfassungsbestimmung problematisch und überprüfungsbedürftig. Nach Art. 33 Abs. 4GG ist die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse als ständige Aufgabe in der Regel staatlichen Beamten vorbehalten. Bei der ausnahmslosen Erhebung personenbezogener Daten von Flugpassagieren und ihrer etwaigen Weiterleitung an staatliche Sicherheitsbehörden handelt es sich um hoheitsrechtliche Befugnisse.
Bei der zweiten verfassungsprozessualen Frage des Falles ist die Problematik einer präventiven Beschwerdebefugnis gegen Gesetzesvorhaben zu erörtern.
4.Gutachterlicher Prüfungsauftrag
Aus den Fragestellungen am Ende der Aufgabenstellung ergeben sich gegenüber den ermittelten Rechtsfragen des Falles keine Abweichungen.
Gutachten
Vorbemerkung: Die Einführung einer neuen Sicherheitstechnologie an Flughäfen in Form von Körperscannern ist aufgrund ihres routinemäßigen und massenhaften Einsatzes bei allen Fluggästen und aufgrund der erheblichen Eingriffe in Persönlichkeitsrechte durch Einblicke in den unbekleideten Körper eine wesentliche Frage, die nur der Gesetzgeber regeln kann. Durch einen bloßen Rückgriff auf die bestehenden polizeirechtlichen Generalklauseln zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung lässt sich die geplante Einführung der neuen Durchleuchtungstechnologie nicht rechtfertigen. Die polizeirechtlichen Generalklauseln kommen also als Ermächtigungsgrundlagen für die Einführung der Scannertechnologien von vornherein nicht in Betracht. Das ergibt sich auch aus der Fragestellung des Falles, die klar auf die Verfassungsmäßigkeit der geplanten Änderung des § 5 Luftsicherheitsgesetzes abstellt.
Erste Fallfrage: Ist der vorgelegte Gesetzesentwurf zur Änderung des § 5 Abs. 1 S. 1 Luftsicherheitsgesetz mit dem Grundgesetz vereinbar?
I.Eingriff der geplanten Änderung des § 5 Abs. 1 S. 1 Luftsicherheitsgesetz in die grundrechtliche Menschenwürde nach Art. 1 Abs. 1GG
Nach dem Wortlaut des Art. 1 Abs. 1GG und nach dem System des Grundgesetzes ist die Menschenwürde „unantastbar“. Das wird in Lehre und Rechtsprechung über die vom operativen Grundrechtsteil abgehobene Wortwahl des Art. 1 Abs. 1GG hinaus zusätzlich aus dem Fehlen jeglichen Schrankenvorbehalts zur Menschenwürdegewährleistung hergeleitet. Jeder staatliche Eingriff in die Menschenwürde stellt somit nach |22|klar überwiegender, wenn auch nicht mehr unwidersprochener Auffassung in Lehre und Rechtsprechung zugleich ihre Verletzung dar. Zu prüfen ist also ein staatlicher Eingriff in Art. 1 Abs. 1GG durch die geplante Gesetzesänderung (Zum Aufbau: auf die Problematik einer Abwägbarkeit der Menschenwürde mit überragenden Gemeinschaftsgütern, wie etwa der öffentlichen Sicherheit, ist im Anschluss an die Schutzbereichserörterung einzugehen. Hier kann dann auch die Streitfrage erörtert werden, ob der verfassungsrechtliche Menschenwürdegehalt überhaupt abwägungsoffen ist oder nicht).
Der grundrechtliche Gehalt der Menschenwürde liegt im Selbstbestimmungsrecht jedes Einzelnen über den Status und die Reichweite der eigenen Persönlichkeitssphäre und des hiermit verbundenen Achtungsanspruchs gegenüber Staat und Gesellschaft (Art. 1 Abs. 1 S. 2: „zu achten und zu schützen“).[10] Auch[11] hier ist somit der klassische negatorische Ausschlussgehalt der Menschenwürde als Grundrecht zunächst einmal maßgeblich, der aber – im Unterschied zur bloßen allgemeinen Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1GG – alle Bereiche der menschlichen Persönlichkeit umfasst, nicht nur die verhaltensbezogenen, geäußerten Formen, sondern auch „innere Werte“, wie u.a. die Intimsphäre und das Schamgefühl. Hinzu kommt, dass die Menschenwürde nach Art. 1 Abs. 1 S. 2GG von der staatlichen Gewalt „zu achten und zu schützen ist“. Diese Schutzpflicht geht über einen rein klassischen negatorischen Grundrechtsgehalt hinaus.
1.Sog. Objektformel
Dieser grundrechtliche Gewährleistungsgehalt der Menschenwürde wird nach unverändert überwiegender Auffassung in Lehre und Rechtsprechungspraxis in die sog. Objektformel gekleidet. Danach darf der Mensch nicht zum bloßen Objekt staatlichen Handelns degradiert werden. Dies sei der Fall, wenn seine Subjektqualität in Frage gestellt werde, das heißt „die Behandlung durch die öffentliche Gewalt die Achtung des Wertes vermissen lässt, der jedem Menschen um seiner selbst willen zukommt“ (BVerfGE109, 279, 312f.; BVerfG, Urteil vom 15.02.2006, 1 BvR 357/05, NJW2006, 751, 757f.).
Der Körperscanner erzeugt Bilder, auf denen u.a. intime Details des Körpers des jeweiligen Fluggastes sichtbar werden. Dadurch wird das individuelle Schamgefühl tangiert. Da diese Form der Sicherheitskontrolle per Gesetz allgemeinverbindlich für alle ausgestaltet werden soll, bleibt dem Einzelnen keinerlei Vermeidungs- und Rückzugsmöglichkeit mehr. Die Prozedur muss hingenommen werden, auch bei entschiedener Ablehnung durch den einzelnen Fluggast. Andernfalls steht das Flugzeug als Transportmittel nicht mehr zur Verfügung. Ob und inwieweit dieser Eingriff in den Intimbereich und das Schamgefühl der Fluggäste technisch durch Verschleierungen des Einblicks des Sicherheitspersonals in körperliche Einzelheiten der Fluggäste verhinderbar ist und hieraus ggf. eine modifizierte Beurteilung der Frage des Eingriffs in die Menschenwürde folgt, ist aufgrund der Angaben im Sachverhalt nicht zu er|23|örtern. Im Sachverhalt heißt es, dass solche Verschleierungstechniken noch nicht zur Verfügung stehen.
Hinweis zur gutachterlichen Prüfung der Objektformel
Eine Auseinandersetzung mit der sog. Objektformel als in Lehre und Rechtsprechung übereinstimmend hervorgehobenes Substrat des grundrechtlichen Gewährleistungsgehalts der Menschenwürde ist für die hier verlangte Prüfung eines staatlichen Eingriffs in den Schutzbereich der Menschenwürde nach Art. 1 Abs. 1 S. 1GG