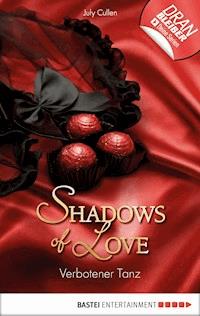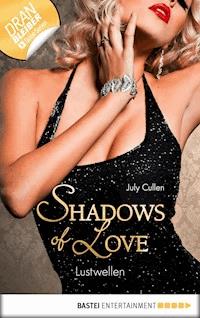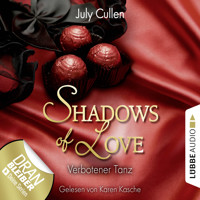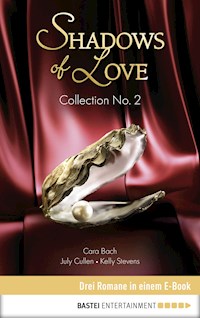4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fear and Desire
- Sprache: Deutsch
Washington: Cat wirkt wie das unscheinbare Mädchen von nebenan. Sie arbeitet in der Zoohandlung ihres besten Freundes, um ihr Chemiestudium zu finanzieren, und besucht regelmäßig ihren Dad im Pflegeheim. Aber sie hat auch eine dunkle Seite. Denn wenn die Stadt schläft und das Verbrechen die Überhand gewinnt, sind Cats Dienste gefragt: Sie entfernt im Auftrag der Mafia DNA-Spuren von Tatorten. Doch dann tritt Dan in ihr Leben.
Dan - Detective - ist neu in der Stadt und hat noch eine Rechnung mit der italienischen Mafia Washingtons offen: Mafiaboss Diego Scarpetti brachte vor 10 Jahren seinen Bruder um. Jetzt ist Dan fest entschlossen, Scarpetti das Handwerk zu legen ... und stößt bei seinen Ermittlungen immer wieder auf Cat. Er kann ihrem unschuldigen Reiz nicht widerstehen. Schon beim ersten Date sprühen die Funken. Doch als Scarpetti erfährt, dass Cat und Dan miteinander gesehen wurden, gerät Cat in tödliche Gefahr ...
Ebooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Über dieses Buch
Washington: Cat wirkt wie das unscheinbare Mädchen von nebenan. Sie arbeitet in der Zoohandlung ihres besten Freundes, um ihr Chemiestudium zu finanzieren, und besucht regelmäßig ihren Dad im Pflegeheim. Aber sie hat auch eine dunkle Seite. Denn wenn die Stadt schläft und das Verbrechen die Überhand gewinnt, sind Cats Dienste gefragt: Sie entfernt im Auftrag der Mafia DNA-Spuren von Tatorten. Doch dann tritt Dan in ihr Leben.
Dan – Detective – ist neu in der Stadt und hat noch eine Rechnung mit der italienischen Mafia Washingtons offen: Mafiaboss Diego Scarpetti brachte vor 10 Jahren seinen Bruder um. Jetzt ist Dan fest entschlossen, Scarpetti das Handwerk zu legen … und stößt bei seinen Ermittlungen immer wieder auf Cat. Er kann ihrem unschuldigen Reiz nicht widerstehen. Schon beim ersten Date sprühen die Funken. Doch als Scarpetti erfährt, dass Cat und Dan miteinander gesehen wurden, gerät Cat in tödliche Gefahr …
Über die Autorin
July Cullen ist das Pseudonym der Autorin Kira Licht, die bereits mehrere Romane veröffentlicht hat. Sie verlebte ihre Teenagerjahre in Kobe, Japan und besuchte dort eine internationale Schule. Zurück in Deutschland studierte sie Biologie und Medizin. Sie lebt, liebt und schreibt in Bochum, reist aber gerne um die Welt und besucht Freunde. Nebenberuflich studiert die Biologin Literaturwissenschaften an der Fernuniversität Hagen. Als July Cullen schreibt sie erotische Romane und Novellen.
JULY CULLEN
Verräterische Spuren
beHEARTBEAT
Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Petra Förster
Lektorat/Projektmanagement: Anna-Lena Meyhöfer
Covergestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Elovich | conrado | Plume Photography
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-4803-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Kapitel 1
Cat
Durch die Nacht
»Ich brauche dich, Cat.« Die Stimme des Mannes am anderen Ende der Leitung klang rauchig und dunkel.
Catinka Reynolds drehte sich auf die Seite und sah auf die neonblau leuchtenden Zahlen des Radioweckers. 2:17 Uhr. Verschlafen presste sie das Handy noch etwas fester ans Ohr.
»Diego …«
»Sofort.«
Cat unterdrückte ein Seufzen und richtete sich im Bett auf. »Ich komme. Wo bist du?« Sie knipste die Nachttischlampe an. Zwei gescheckte Katzen blinzelten empört zwischen den Bergen und Tälern der cremeweißen Bettdecke zu ihr empor.
»Im Four Seasons. Zimmer 342.« Es klickte. Das Gespräch war beendet.
»Tut mir leid, ihr zwei süßen Fellnasen.« Sie gähnte ausgiebig und schwang dann die Beine über die Bettkante. »Die Pflicht ruft.« Eine Katze maunzte anklagend, die andere klappte die Augen zu und schlief ungerührt weiter.
Sobald der hastig hinuntergestürzte Espresso seine Wirkung zeigte, war Cat durch und durch Profi. In weniger als zwanzig Minuten war sie bereit zum Aufbruch. Vor dem Spiegel im Flur betrachtete sie sich kurz. Die Spitzenverzierungen ihrer halterlosen Strümpfe malten sich dezent unter dem zarten Stoff ihres Kleids ab. Die glänzend roten Lippen und das auffällige Augen-Make-up ließen sie älter aussehen. Die Absätze ihrer Pumps waren hoch, doch die Schuhe waren bequem wie Pantoffeln. Cat hatte früh gelernt, nicht an der Qualität ihres Arbeitsmaterials zu sparen. Sie korrigierte ein letztes Mal den Sitz ihrer Perücke – ein rabenschwarzer, scharfkantig geschnittener Bob – und schloss dann die Finger um den Griff des bereitstehenden Trolleys.
*
Der Nachtportier des Four Seasons musterte sie ebenso unverhohlen wie der Taxifahrer, der sie nach Georgetown gefahren hatte. Zuletzt blieb der Blick des Hotelangestellten an ihrem grauen Trolley hängen. Was er sich wohl vorstellte – dass sich darin lederne Fesselriemen, ein Latexanzug oder gar eine sexy Stewardess-Uniform verbargen? Cat musste innerlich grinsen.
Er grüßte sie nicht, doch ebenso wenig hielt er sie auf. Generell waren alle Hotels in Washington per Gesetz dazu angehalten, Prostitution unter ihrem Dach nicht zu billigen. Doch die Edelhotels tolerierten die Wünsche ihrer wohlhabenden Gäste, solange die »Damen« sich diskret verhielten. Huren, die an den Hotelbars nach Freiern suchten, handelten sich ein lebenslanges Hausverbot ein. Callgirls, die mitten in der Nacht ins Zimmer der Gäste huschten, wurden »übersehen«.
Cat fuhr mit dem Aufzug in die dritte Etage. Die Absätze ihrer Pumps versanken in dem hochflorigen Teppich. Vor Zimmer 342 zückte sie ihr Handy.
»Ich bin da.«
Sekunden später öffnete sich die Tür. Ein Mann, fast noch ein Junge, starrte sie an.
»Äh. Sind Sie …?« Sein Adamsapfel hüpfte nervös auf und ab, als sein Blick an Cat hinab- und wieder hinaufwanderte.
»Hör auf zu stottern und lass sie rein!«, dröhnte eine Stimme. Der junge Mann zuckte zusammen, machte die Tür weit auf und bedeutete ihr mit einer höflichen Geste einzutreten.
»Bei der heiligen Maria, warum reißt du die Tür nicht ganz aus den Angeln? Vielleicht möchte noch jemand einen Blick ins Zimmer werfen?«
Der Mann fuhr erneut zusammen. Hastig schloss er die Tür hinter Cat.
»Kätzchen! Wie schön, dass du es einrichten konntest.«
»Diego.«
Wenn Cat ihre Pumps trug, reichte ihr Diego Scarpetti gerade bis zur Schulter. Er war ungefähr so breit wie hoch, was er allerdings ausschließlich auf die Kochkünste seiner Frau schob. Dass er ein launischer Psychopath ohne jedes Schuldempfinden war, hatte vermutlich wenig mit Aurora Scarpettis kalorienreichen Nudelgerichten zu tun.
»Das ist der strohdumme Neffe eines Cousins«, stellte Diego den Jüngling vor. »Emanuele soll bei mir eine …« Er grinste. »… eine Lehre machen. Du weißt schon.«
Cat nickte Emanuele zu, der prompt ein wenig rot wurde. Sie schätzte ihn auf maximal siebzehn. Die weichen, dunklen Haare fielen ihm bis über die Augenbrauen. Er trug das Shirt einer berühmten Surfmarke und moderne Sneakers. Seine riesigen braunen Augen konnten sich nicht von Cats Beinen lösen. Er sah so unschuldig und adrett aus wie ein frisch gewaschenes Hundebaby.
»Die Familie wohnt in Kansas«, fügte Diego hinzu, als würde das alles erklären.
»Wo sind die anderen?«
Diego setzte gerade zu einer Antwort an, als sich die Zimmertür einen Spalt öffnete und zwei Männer lautlos hineinschlüpften.
»So geht das, Junge!«
Emanuele murmelte etwas auf Italienisch und sah auf den Teppich. Einer der neu Angekommenen klapste ihm in den Nacken. »Keine Widerworte.«
»Cat.« Der andere grüßte sie. Kurz, aber respektvoll. Er war größer als Diego und bullig wie ein Ringer. Dennoch war die Familienähnlichkeit unverkennbar.
»Lorenzo.«
Auch der Mann neben Emanuele, ein breitschultriger Kerl mit der lädierten Nase eines Boxers, konnte seine Zugehörigkeit zum Scarpetti-Clan nicht leugnen.
»Hallo, Catinka.« Er hatte seinen muskelbepackten Arm auf Emanueles schmalen Schultern abgelegt und lächelte breit. »Siehst heiß aus.«
Cat grinste und machte eine Blabla-Geste mit der Hand.
»Ich mein’s ernst.«
»Und ihr seht aus, als wolltet ihr beim FBI anheuern, Michele.«
»Es geht doch nichts über maßgeschneiderte Anzüge.« Michele strich mit der freien Hand über den schwarzen Stoff. »Allerdings sehe ich besser darin aus als er.« Er deutete auf Lorenzo. Der verdrehte nur die Augen.
So gerne Cat Smalltalk mit Diegos Schlägern machte, sie wollte möglichst bald anfangen. Je nachdem wie groß die Sauerei war, würde sie vielleicht den Rest der Nacht in diesem Hotel verbringen. In weniger als zweieinhalb Stunden würde es hell werden. Es war eine ihrer goldenen Regeln, vor Sonnenaufgang zu verschwinden.
»Was haben wir?«
Diego winkte sie zu sich. »Komm mit, Kätzchen.«
Der Flur führte in eine kleine Suite. Besser als der Standard, aber weit unter dem, was man im Four Seasons für eine Übernachtung ausgeben konnte. Zur Rechten lag das Schlafzimmer samt angrenzendem Badezimmer. Zur Linken ein Wohnbereich mit Sitzgruppe und riesigem Fernseher. Vor einer Wand stand ein schmaler Konferenztisch mit sechs Stühlen. Die bodenlangen Gardinen an der Kopfseite des Zimmers waren zwar zugezogen, doch Cat vermutete dahinter den Zugang zum Balkon.
Die Suite war wunderschön. Sah man davon ab, dass in praktisch jedem Zimmer Blutspritzer die geschmackvolle Einrichtung verunstalteten.
Cat schnalzte missbilligend mit der Zunge.
»Ich weiß, ich weiß.« Diego strich sich die sorgsam gegelten Haare aus der Stirn. »Es war ein Unfall.«
»Unfall«, wiederholte Cat tonlos. »Sieht aus, als hättet ihr mit ihm Fangen quer durch alle Zimmer gespielt.«
»Er ist dem Frischling abgehauen«, sagte Michele, der sich dazugesellte. »Der Kleine hat ihn nicht richtig erwischt, und – zack – ging der Kerl stiften.«
Cat schüttelte den Kopf. »Hoffentlich habe ich genug Mittelchen dabei.« Sie sah zu Diego. »Wo ist er gestorben?«
»Im Bad. In der Wanne.«
»Okay. Kann ich mich im Schlafzimmer umziehen?«
Michele nickte und pfiff Emanuele heran, der Cat daraufhin den Koffer brachte.
Als sich die Tür hinter ihr schloss, ließ Cat sich auf die Bettkante sinken. Sie zog sich bis auf das Höschen und den BH aus und öffnete dann ihren Trolley. Ihre Kleidung samt Pumps verstaute sie sorgsam in einem Kleidersack. Sie nahm einen weißen Schutzanzug aus dem Koffer und schlüpfte hinein. Dazu dicke Socken und weiche Sneakers. Zusätzlich zog sie Schutzhüllen aus sterilem Plastik über die Schuhe. Sie nahm die Perücke vom Kopf und band sich das blonde Haare zu einem straffen Knoten zusammen. Darüber kam ein Haarnetz. Die Schutzbrille hängte sie an eine der Taschen des Anzugs, genauso wie das Paket mit den sterilen Latexhandschuhen, die bis über den Ellenbogen reichten. Mit einem Taschentuch wischte sie sich den klebrigen Lippenstift vom Mund.
»Ich bin so weit.« Sie öffnete die Tür, vor der die drei Männer samt Lehrling bereits warteten. Emanueles Augen wurden groß wie Untertassen.
»Fangen wir an. Ich brauche eine Reihenfolge nach Kontaminationsgrad, ihr kennt das ja schon. Wo war er, wo war er nicht? Wo hat er geblutet, wo hat er nur gesessen oder gelegen? Welche Abflüsse habt ihr benutzt? Und so weiter.« Ihre Regeln besagten, dass die groben Arbeiten bereits getan sein mussten, ehe sie anfing. Sie beseitigte keine Leichen, sie zupfte keine Hirnmasse vom Teppichboden, und sie wischte auch keine Blutlachen auf. Leichen, Flüssigkeiten und Gewebereste mussten vom Verursacher auf eigene Gefahr entsorgt werden.
»Wir haben mit ihm auf den Couchen gesessen«, begann Lorenzo und verschränkte die Arme vor der Brust. »Es sollte einfach nur ein nettes, kleines Gespräch unter Geschäftspartnern werden.«
»Leider sahen wir uns irgendwann zu anderen Maßnahmen gezwungen«, fügte Diego hinzu. Sein liebenswürdiges Lächeln jagte Cat einen eisigen Schauer den Rücken hinab. Sie kannte diese Männer schon seit ihrer Kindheit, und sie wusste ganz genau: Nichts an ihnen war liebenswürdig. Die höfliche Art, mit der sie sie behandelten, war genauso eine Fassade wie die 700-Dollar-Maßanzüge und die teuren Hotelzimmer.
»Er floh ins Bad, weil Michele ihm den Weg zur Tür abgeschnitten hat. Emanuele sollte ihn beseitigen – quasi eine Feuertaufe –, doch er hatte Schwierigkeiten.« Wieder dieses erschreckend liebenswürdige Lächeln.
»Ich hätte diesen Jonathan erwischt, wenn –«
Lorenzo schlug Emanuele so hart auf den Mund, dass dieser abrupt abbrach. Noch so eine Regel. Keine Namen von Opfern. Niemals.
Cat tat so, als wäre nichts geschehen. Nicht ein Muskel zuckte in ihrem Gesicht. Von einer Sekunde auf die andere hatte sich alles verändert. Der Mann, dessen Blut hier überall im Zimmer verteilt war, hatte plötzlich einen Namen. Das war nicht gut.
Emanueles Lippen färbten sich dunkelrot, als Blut aus seinem Mund quoll. Mechanisch reichte Cat ihm ein Zellulosetüchlein. »Im Schlafzimmer liegt ein Müllbeutel. Entsorge es da. Nirgendwo anders.«
Emanuele nickte. Seine Augen glitzerten verdächtig.
»Er hat ihn jedenfalls erwischt, aber nicht richtig«, fuhr Lorenzo fort. »Hat geblutet wie ein Schwein und ist einmal quer durch den Wohnbereich. Wir alle hinter ihm her. Der Typ war so verwirrt, dass er irgendwann wieder im Bad landete. Dort ist er ohnmächtig zusammengebrochen. Emanuele hat es dann zu Ende gebracht, war ja keine große Kunst.«
»Schusswaffe?«, fragte Cat.
»Messer«, antwortete Diego.
»Wo hast du dich umgezogen?« Cat sah zu Emanuele. Wenn er diesen Jonathan mit einem Messer getötet hatte, müsste seine Kleidung über und über mit Blut bespritzt sein.
»Im Wohnzimmer. Da liegt auch mein Rucksack.«
»Okay.« Cat sah zu Diego. »Ich fange im Flur an.«
»Gut. Michele bleibt zu deinem Schutz hier.«
Sie nickte. So war es üblich. Schließlich konnte sie einen verirrten Pagen schlecht in Schutzanzug und mit blutverschmierten Handschuhen vor der Tür abwimmeln.
»Was bekommst du dafür, Kätzchen?«
Sie seufzte innerlich. Das wusste er ganz genau, sie nahm immer dasselbe. Ein Mord kostete einen Tausender. Eine Messerstecherei oder Schlägerei sechshundert. Säubern eines Fahrzeuginnenraums vierhundert. So einfach.
Er grinste. »Hey, ich bin Geschäftsmann.« Er reichte ihr die zehn Hundert-Dollar-Noten.
»Ich auch.« Sie lächelte süffisant.
Diegos Grinsen wurde noch breiter. Cat schob das Geldbündel in eine der kleinen Brusttaschen und zog den schmalen Reißverschluss sorgsam wieder zu.
»Wie geht es William?« Diegos Gesichtsausdruck war ungewöhnlich ernst.
Cats Muskeln verkrampften sich, wie jedes Mal, wenn sie über ihren Vater sprechen musste. »Es geht. Mal besser, mal schlechter. Er macht kleine Fortschritte.«
»Das ist gut.« Diego klopfte ihr etwas unbeholfen auf den Rücken. »Er kann stolz auf dich sein.« Lorenzo nickte bekräftigend. Emanuele war verschwunden, um den Zellulosestreifen zu entsorgen.
Als die drei gegangen waren und Michele sich vor den Fernseher lümmelte, hielt Cat einen Moment lang inne. Ihr Vater und stolz? Vielleicht war er stolz, weil sie es schaffte, neben ihrem Studium ausreichend Geld für die Bezahlung seines Pflegeheims zu verdienen.
Sie ging ins Schlafzimmer und packte die Flaschen mit den unzähligen Chemikalien aus. Aber wäre er auch noch stolz, wenn er erführe, womit sie ihr Geld tatsächlich verdiente? Er hatte versucht, sie von Kriminalität und Unrecht fernzuhalten. Doch genau wie er hatte sie irgendwann die Seiten gewechselt. Sich der dunklen Seite der Gesellschaft verpflichtet. Ihr Vater hatte es damals getan, um die Krebsbehandlung ihrer Mutter zu bezahlen. Und Cat hatte es getan, um seine Rechnungen zu bezahlen. Es schien, als teilten sie dasselbe Schicksal. Ihr Vater hatte darunter gelitten, sich Vorwürfe gemacht. Cat hingegen schaffte es, das alles nicht so nah an sich heranzulassen. Für sie war es ein Job. Sie war der Cleaner des Scarpetti-Clans, der größten und gefährlichsten Mafia-Familie im Großraum der Landeshauptstadt Washington. Sie hatte den Job von ihrem Vater geerbt. Es war fast lachhaft, dass selbst die Jobs, die ausschließlich dazu dienten, den Scarpettis hinterherzuräumen, »in der Familie« blieben. Sie wusste, wie erleichtert Diego gewesen war, als sie seinem Angebot zugestimmt hatte. Für ihn zählten familiäre Bande mehr als ein vom Notar beglaubigtes Dokument. Er hatte die ersten großen Rechnungen für die Krebsbehandlung ihrer Mutter bezahlt, Cat so manches teure Spielzeug geschenkt und ihr Bodyguards hinterhergeschickt, als sie mit sechzehn anfing, auszugehen. Sie kannte Diego und Aurora schon seit über zwölf Jahren. Für eine »Kündigung«, die Rückkehr in ein bürgerliches Leben, war es schon lange zu spät.
Ein Auftrag pro Monat reichte, um das Pflegeheim ihres Vaters zu bezahlen. Ein zweiter, um das Geld für eine Bleibe, groß genug für sie beide, zurückzulegen. Und nur das zählte. Es war egal, ob es sich um die Spuren einer Schlägerei handelte, die sie beseitigte, oder ob an diesem Ort tatsächlich jemand gestorben war. Den Scarpettis war es wichtig, so wenig verwertbare DNA-Spuren wie möglich in dieser Stadt zu hinterlassen. Und erst recht nicht wollten sie, dass man ihre DNA mit den Verbrechen an anderen Mitbürgern in Verbindung bringen konnte. Egal, ob sie jemanden verprügelten, um Schutzgeld zu erpressen, oder jemanden töteten, der ihnen im Weg stand. Für sie war das Ziel immer dasselbe: Keine verwertbaren Spuren für die Kriminaltechniker. Keine Verbindung zu einem Tatort. Sie wollten einen Freifahrtschein für ihre brutale Willkür. Und den kauften sie bei Cat.
Cat blendete alle Gefühle aus, als sie in die Handschuhe schlüpfte. Wer nicht richtig bei der Sache war, machte Fehler. Und die konnte sie sich nicht leisten. Sie setzte die Schutzbrille auf. Erst dann griff sie nach den Flaschen mit den hochgiftigen Flüssigkeiten. Zuallerletzt holte sie die Gasmaske aus dem Koffer.
»Mach die Fenster auf, Michele«, rief sie, während sie sich in den Flur begab. Ein unwilliges Brummen war die Antwort, doch noch bevor sie die Flaschen vor dem ersten kleinen Blutfleck abgestellt hatte, hörte sie das vertraute Quietschen der Gummidichtungen. Sie hielt die Gasmaske vor die untere Gesichtshälfte und befestigte sie mit den elastischen Riemen am Hinterkopf. Wenn man Körperflüssigkeiten mit Chemie auflöste, sollte man die Stoffwechselprodukte dieser Reaktion nicht direkt einatmen. Mit einer Sprühflasche befeuchtete sie den ersten Tropfen. Seiner Form nach zu urteilen war er aus Richtung des Wohnbereichs geflogen, als das Opfer sich auf der Flucht zurück ins Bad befand. Der Tropfen war von fast bräunlicher Farbe. Seine Konsistenz war zäh wie Sirup, die sich scheinbar untrennbar mit den zarten Fasern des Teppichbodens verbunden hatte. Eine der guten Eigenschaften von Blut wurde hier zu einer lästigen Angelegenheit: seine Fähigkeit zur schnellen Gerinnung. Bei einer Verletzung garantierte diese Eigenschaft, dass sich eine Wunde schnell schloss und so ein möglicher Blutverlust minimiert wurde. Außerhalb des Körpers führte sie dazu, dass Blut nicht flüssig blieb, sondern an der Luft schneller trocknete als jede andere Flüssigkeit. Cat besprühte den Fleck mit einer Lösung, die die Proteine des Blutplasmas auflösen würde. Danach würde sie die anderen zellulären Bestandteile mit einer weiteren Flüssigkeit in nanopartikelgroße Einzelteile zerlegen. Zuletzt würde sie alles mit einer Reinigungslösung auf biochemischer Basis aufwischen. Es war eine anstrengende Arbeit, doch der Aufwand lohnte sich. Zum guten Schluss prüfte Cat die gereinigten Zimmer mit einer Speziallampe, die biologische Flüssigkeiten und Sekrete sichtbar machte. Bis jetzt war sie mit dem Ergebnis jedes Mal zufrieden gewesen. Sie hatte einen entscheidenden Anteil daran, dass man den Scarpettis in den letzten vier Jahren trotz wiederkehrender Verdachtsmomente nie die Beteiligung an einem Verbrechen hatte nachweisen können.
Aus dem Wohnzimmer erklangen Musikjingles, die sich mit frenetischem Applaus und kreischenden Mädchenstimmen abwechselten. Michele hatte offenbar beschlossen, sich eine Folge von America’s Next Top Model anzusehen. Cat schüttelte den Kopf, zückte ein steriles Zellulosetuch und widmete sich wieder dem verräterischen Blutfleck.
*
»Ich würde wirklich gerne wissen, wie du deine Nächte verbringst.«
Cat schreckte hoch. Ihre Wange schmerzte, ihr Unterarm war eiskalt, der Rücken unangenehm verspannt.
»Jeremy. Es tut mir leid.« War sie wirklich auf der Ladentheke eingeschlafen? Was für ein Glück, dass kein Kunde sie so gesehen hatte.
Jeremy Bird musterte sie interessiert über die kreisrunden Gläser seiner Brille hinweg. Cat sah peinlich berührt zu Boden, streckte den Rücken durch und richtete sich auf dem Hocker auf. Daraufhin beugte Jeremy sich über die gläserne Theke, als wäre er ein Kunde in seinem eigenen Geschäft.
»Geht es dir nicht gut? Bist du krank?«
Cat rieb sich die schmerzende Wange. »Nein, alles in Ordnung.« Sie ließ die Hand sinken und fingerte an dem altmodischen Rechnungsblock herum.
Jeremy strich ihr das Haar zur Seite und berührte zart ihre Wange. Überrascht wich Cat zurück.
Sie sah, wie Jeremy schluckte, sich aber nichts weiter anmerken ließ. »Du hast den Abdruck deines Fingerrings auf der Wange.«
»Ich hab auf der Hand geschlafen. Tut mir wirklich leid, Jerms.« Sie benutzte seinen Spitznamen nur selten. Er schaffte eine Vertraulichkeit zwischen ihnen, die sie eigentlich zu vermeiden versuchte. Cat bemerkte, dass seine Augen dunkler wurden. Jeremy war im Begriff, etwas zu erwidern, als die Ladentür mit einem Knall aufflog.
»Einen wunderschönen guten Nachmittag, Chef!«, trällerte Trina, verstummte aber sofort, als ihr Blick auf Cat fiel. Jede Freude in ihrem Gesicht verschwand, als habe man sie ausradiert. Offenbar hatte Trina Cat gar nicht gesehen.
»Hallo«, warf sie nüchtern hinterher.
»Hallo, Trina.« Cat sprang von dem Hocker, wofür sich ihr verspannter Rücken mit einem stechenden Schmerz bedankte.
»Trina, fängst du mit dem Bücherregal an?«, sagte Jeremy geschäftsmäßig. »Heute Morgen ist ein Paket mit verschiedenen Tierzeitschriften gekommen. Die Lieferung mit dem Bio-Streu verzögert sich. Die Transportfirma ruft später an.«
Trina nickte knapp und verschwand mit polternden Schritten durch eine Tür, auf der das Schild »Privat« prangte.
Cat vergrub die Hände in den Taschen ihrer Jeansshorts. Trina Evans war schon in Jeremy verknallt gewesen, als sie als Schülerin hier gejobbt hatte. Als er sie nach der Highschool Vollzeit eingestellt hatte, war das für Trina einem Heiratsantrag gleichgekommen. Eigentlich verstand sich Cat gut mit der temperamentvollen, rothaarigen Achtzehnjährigen. Nur wenn es um Jeremy ging, kannte Trina keine Freundschaft. Hinter der Tür mit dem »Privat«-Schild rumorte es.
Cat wandte sich unbehaglich ab. Jeremy hingegen besaß die Gabe, alles Unerfreuliche einfach auszublenden. Und er ließ nicht locker. Cat wusste, dass er gerne mit ihr ausgehen würde. Er war nie über zarte Andeutungen hinausgekommen, denn so war er nun mal. Aber die Art, wie er sie ansah, sprach Bände. Cat kannte solche Blicke. Seit ihrem fünfzehnten Lebensjahr sahen die Männer sie so an.
»Cat.« Jeremy hatte eine angenehme Stimme. Melodisch, vollmundig und warm. Er hätte Radiomoderator sein können oder Sprecher von Hörbüchern. Cat konnte ihm stundenlang zuhören, wenn er, der studierte Zoologe, über die verschiedenen Tierarten erzählte. Und sie hatte wirklich versucht, mehr in ihm zu sehen. Mehr als einen Freund und einen Mann, neben dem sie gerne arbeitete. Doch da war nichts.
»Hast du wieder die ganze Nacht gelernt?«
Es war ihre Standard-Ausrede. Abgenutzt, einfallslos, billig. Doch er klang so mitfühlend, dass Cat sich schämte, als sie ihm ins Gesicht log.
»Ja.«
Er hob die Hand, als wollte er sie am Arm berühren, ließ sie dann aber wieder sinken.
»Geh dich ausruhen. Ich schreibe dir die Stunden trotzdem gut.«
Sie sah in sein attraktives Gesicht und fragte sich erneut, warum sie sich nicht in ihn verlieben konnte. Jeremy war gutaussehend mit seinen wilden blonden Locken, der Nickelbrille und den Hipster-Klamotten. Eine Mischung aus Rocker, Intellektuellem und Ökö-Terrorist. Er hatte sich für Greenpeace an ein Walfängerschiff gekettet, hatte sich den Harpunenkanonen in den Weg gestellt und kluge Artikel für den WWF verfasst. Er schrieb nebenbei an seiner Doktorarbeit, spielte Bass in einer Jazzband und war im Internet als Öko-Aktivist bekannt. Er war klug, er war lieb, und er sah gut aus. Er führte schon seit Jahren die Tierhandlung seiner Eltern. Dank ihm war sie inzwischen für ihr »Bio-Zubehör« und die Vorträge bekannter Tierforscher in ganz Washington berühmt.
»Cat, geh nach Hause, ich bitte dich.«
»Danke, Jeremy.« Sie lächelte ihn an. Es könnte so einfach sein. Er bewohnte die zwei Etagen über der Tierhandlung. Das Haus gehörte ihm. Wenn sie wollte, könnte sie einfach nach oben gehen, sich ins Bett legen und die Augen schließen. Alles würde gut werden. Er würde sich um sie kümmern, sie lieben und immer für sie da sein.
Jeremy spürte ihr Zögern. »Möchtest du –«
»Nein.« Sie würde sich nicht bei ihm oben ausruhen, auch wenn das einfacher war, als zu ihrer Wohnung ins East End zu fahren. Leider war das Leben nicht einfach. Jedenfalls nicht für Cat. Sie zog ihre Tasche aus einem Fach unter der Theke.
»Danke dir.«
Er erwiderte nichts, deutete nur ein Nicken an. Cat fühlte sich schuldig. Sie wollte ihm etwas zurückgeben. Ihm vielleicht nur ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern.
Doch sie kam nicht dazu.
»Wenn du Probleme hast, erzähle mir bitte davon.«
Cat hörte auf, sich Gedanken darüber zu machen, welche Überraschung sie Jeremy bereiten könnte.
»Ich habe keine Probleme.«
Sie kam um die Theke herum und baute sich vor ihm auf. »Sehe ich aus wie jemand, der Probleme hat?«
Jeremy sah sie zweifelnd an.
»He!« Sie schubste ihn freundschaftlich.
»Du siehst aus wie eine wandelnde Leiche, Cat«, sagte er in ernstem Ton. »In den Rändern unter deinen Augen kann ein Fünftonner verschwinden.« Er schüttelte leicht den Kopf. »Wenn du Probleme in der Uni hast, kann ich dir Nachhilfe besorgen. Ich kenne jede Menge Leute aus der Chemie, die dir –«
»Ich brauche keine Nachhilfe.« Sie waren beide an derselben Universität, der Howard University. Jeremy forschte dort, sie war als Studentin eingeschrieben. Es war nett von Jeremy, ihr anzubieten, seine Kontakte zu nutzen. Ihr Chemiestudium stellte jedoch kein wirkliches Problem dar.
»Du siehst aber so aus«, beharrte er.
Cat biss sich auf die Unterlippe. Jeremy war vielleicht sechs Jahre älter als sie, was aber kein Grund war, sie so zu »bemuttern«.
»Es geht mir gut.« In einer flüchtigen Geste strich sie ihm den Arm hinab. »Wir sehen uns morgen.«
Sie sah aus dem Augenwinkel, wie ihre Berührung ihn zurückließ. Sie konnte sein Sehnen fast körperlich spüren. Seine Leidenschaft bis hierher fühlen.
Es könnte so einfach sein. Doch »einfach« schien in ihrem Leben nicht vorgesehen zu sein. Mit einem leisen Seufzen stieß sie die Ladentür auf und trat hinaus auf die Straße.
Kapitel 2
Daniel
Ein neuer Anfang
Daniel Ambrose starrte in die fahle Dunkelheit. So also fühlte es sich an, nach Hause zu kommen. Er ließ den Blick über die Umzugskartons schweifen, die in dem leeren Zimmer an den Wänden entlang gestapelt waren. Er hatte noch keinen einzigen ausgeräumt. Er war schon vier Tage hier, und doch lebte er aus dem einen Koffer, den er hastig gepackt hatte, als die Möbelpacker kamen.
Es war gut, dass er eine Woche Urlaub hatte, bevor er seinen Dienst im 16. Revier antreten würde. Er fühlte sich noch fremd hier, noch nicht angekommen, immer noch trauernd. Alles, was ihn aufrechthielt, war der Gedanke, dass er nun endlich für Gerechtigkeit sorgen konnte. Dass er diesen bohrenden Stachel aus seinem Fleisch ziehen und den Schmerz besänftigen konnte.
Er knüllte die leere Bierdose wie einen Pappbecher in seiner Hand zusammen. Endlich.
Seine Mutter, eine tiefgläubige Christin, hatte Daniels Gedanken an Rache und Vergeltung immer verurteilt. Ihr zuliebe hatte er seine Wut unterdrückt. Doch sobald er alt genug gewesen war, war er weggezogen und nach Chicago auf die Polizeiakademie gegangen, obwohl die Akademie in Washington einen bedeutend besseren Ruf genoss. Seine Mutter hatte geweint, sein Vater hatte versucht, ihn umzustimmen. Aber Daniel war fest entschlossen und hatte sein Ziel immer klar vor Augen: Irgendwann würde er zurückkommen und ihn jagen wie einen Hund.
Das Bimmeln der Türglocke riss ihn aus seinen Gedanken. Wer könnte das sein? Dan strich sich mit der freien Hand die Haare aus der Stirn, warf die zerknüllte Dose auf einen der Kartons und joggte die Treppenstufen hinunter bis zur Haustür.
»Daniel! Bei allen Heiligen, ich habe mir Sorgen gemacht. Du bist schon so lange hier, und nie brennt Licht. Und immer kommt dieser Pizzabote. Das kann doch nicht gesund sein. Da dachte ich mir, ich koche dir mal etwas Vernünftiges. Ich hoffe, du magst Rindsgulasch? Levy liebt mein Gulasch. Er sagt, du kannst auch gerne zum Essen zu uns kommen, wenn du Lust hast. Er meint, ich würde mich aufdrängen. Aber ich sage zu ihm: Levy, jemand muss sich um den Jungen kümmern. Er hat doch niemanden mehr. Und dann so ganz allein in diesem Haus. Da wird man doch depressiv und geht nicht mehr vor die Tür.«
Eine Frau um die sechzig, so klein und rund wie ein Kugelfisch, gestikulierte wild. Der Inhalt der Tupperdose in ihrer linken Hand schwankte im Takt dazu. Ihre grau gesträhnten Haare waren dramatisch frisiert, sie war perfekt geschminkt und trug eine altmodische, rot karierte Schürze über ihrem dunklen Etuikleid. Die schwarzen Pantoffeln schmückte ein Streifen Marabufedern.
»Mrs Lewitzky.« Dan klang so matt, wie er sich nach dieser verbalen Attacke fühlte. »Das ist nett von Ihnen. Aber mir geht es gut. Ich habe nur viel zu tun.« Er warf einen Blick auf die Tupperdose. »Das sieht gut aus. Vielen Dank.«
Sie reichte ihm die Dose und tätschelte mütterlich seinen Arm. »Du kannst doch nicht nur von Pizza leben. Deine Mutter würde das nicht gutheißen. Sie würde mit dir schimpfen.«
Dan straffte die Schultern. Er war dreiunddreißig Jahre alt, und seine Mutter war schon lange nicht mehr für seine Ernährung zuständig. Trotzdem ließ die Erwähnung ihres Namens ihn zusammenzucken.
Rahel Lewitzkys Gesicht nahm einen schuldbewussten Ausdruck an. »Es tut mir leid, Daniel.«
»Ist schon gut«, erwiderte er schnell und machte Anstalten, sich abzuwenden. »Bitte, grüßen Sie Ihren Mann von mir.«
»Daniel.« Mrs Lewitzky hielt ihn sanft am Unterarm fest. »Ich habe es dir schon auf der Beerdigung deiner Mutter gesagt, und ich sage es dir noch mal. Ich kenne dich seit deiner Geburt, und deshalb spreche ich so offen. Es ist keine gute Idee, in dieses Haus zu ziehen. Diese vier Wände stecken voller Erinnerungen. Erinnerungen an deinen Vater, deine Mutter und Spencer. Verkaufe dieses Haus, Dan. Es ist dein Elternhaus, aber es birgt zu viel Schmerz für dich.« Ihre Finger drückten sich fester in seinen Unterarm. »Ich gebe dir einen guten Rat, Daniel. Als Weggefährtin deiner Eltern, als Freundin, Nachbarin, als jemand, der nur dein Bestes will: Lass los. Lass das alles hinter dir. Stürze dich nicht kopfüber in dieses bodenlose Loch aus Schmerz und Vergangenem. Es wird dich verschlingen, und du wirst nie wieder daraus emportauchen.«
Einen Moment lang sahen sie sich schweigend an. Rahel Lewitzky war winzig und ging Dan mit seinen knapp einen Meter neunzig gerade bis zur Achselhöhle. Sie musste den Kopf in den Nacken legen, um ihm in die Augen zu sehen.
»Ich kann nicht.« Sanft löste er ihre Finger. »Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Und vielen Dank für die Verpflegung.« Dann drehte er sich um und schloss die Tür. Es dauerte einen Moment, bis die klappernden Absätze von Mrs Lewitzkys Pantoffeln auf den steinernen Stufen der Eingangstreppe erklangen. Er war unhöflich gewesen. Doch er wollte sich nicht bekehren lassen, genauso wenig, wie er mit ihr weiterdiskutieren wollte. Er hatte seine Entscheidung getroffen. Die Zeit war reif, die Jagd aufzunehmen. Er hatte die Position, den Job und das Know-how dazu. Niemand konnte ihn mehr aufhalten.
Daniel schnappte sich eine Dose Bier von dem Sideboard im Flur, durchquerte das Wohnzimmer und öffnete die Tür zum Garten. Die Luft war noch warm und roch schwach nach Blumen. Er ließ sich auf der Veranda in einen Rattanlehnstuhl sinken und öffnete das Bier. Der Deckel von Mrs Lewitzkys Tupperdose besaß einen integrierten Löffel, wofür Daniel in diesem Moment außerordentlich dankbar war. Da er seine Mikrowelle noch nicht ausgepackt hatte, würde er das Gulasch kalt zu seinem Bier genießen. Obwohl Mrs Lewitzky eine ausgezeichnete Köchin war, hoffte er, es würde nicht zur Gewohnheit werden, dass sie ihm Essen vorbeibrachte. Er suchte keine Ersatzfamilie, keine Freunde oder überhaupt jemanden. Alles, wonach er sich sehnte, war das süße Gefühl der Rache.
*
Der nächste Morgen kam viel zu früh. Daniel hatte noch bis weit nach Mitternacht grübelnd auf der Veranda gesessen. Obwohl er es niemals zugegeben hätte, so hatten Mrs Lewitzkys eindringliche Worte ihn doch nachdenklich gemacht. Zwar war er weiterhin fest entschlossen, hier zu wohnen, doch den Gedanken, das Haus zu verlassen, um nicht depressiv zu werden, fand er durchaus logisch. Er erhob sich von der achtlos auf den Boden geworfenen Matratze und suchte in einem der Kartons nach seinen Sportklamotten. Gab es eine bessere Gelegenheit, sich seine alte Nachbarschaft anzusehen, als bei einer morgendlichen Joggingrunde?
Die Straße erstreckte sich ruhig und dämmrig vor ihm. Die Sonne erhob sich gerade erst als goldener Streif am Horizont. In nur wenigen Häusern brannte bereits Licht. In der Nacht hatte es geregnet. Daniel sog die kühle Luft in seine Lungen. Eine Mischung aus feuchtem Asphalt, Erde und dem verführerischen Brötchenduft einer nahegelegenen Bäckerei.
Der Spielplatz, auf dem Spencer und er ganze Nachmittage verbracht hatten, war vergrößert und modernisiert worden. Die chinesische Reinigung der Familie Zhao sah noch genauso aus wie früher. Schräg gegenüber im Lieferanteneingang der Fleischerei brannte schon Licht. Ein junger Zeitungsbote auf einem Fahrrad warf ihm ein etwas verschlafenes »Guten Morgen« hin. Daniel hob grüßend die Hand. In Jack’s Diner an der Straßenkreuzung hatte er nach der Schule mit seinen Jungs abgehangen und den Mädchen nachgeguckt. Der Laden sah immer noch so aus, als wäre er einem Film aus den fünfziger Jahren entsprungen. Er musste grinsen, als er sich daran erinnerte, wie verschossen sie alle in Chrystal, die dralle blonde Kellnerin, gewesen waren.
Die belgische Bäckerei war neu. Das verschnörkelte goldene Logo war im Vintage-Stil gehalten, die helle Einrichtung wirkte einladend. Auf seinem Rückweg machte Daniel dort einen Abstecher. Es war schön gewesen, seine »alte Gegend« neu zu erkunden und sich die ehemals vertrauten Straßenzüge neu zu erschließen. In der Bäckerei kaufte er sich einen großen Kaffee und zwei belegte Brötchen.
Als er wenige Minuten später die Eingangstür hinter sich schloss, fühlte er sich wie verwandelt. Energiegeladen, frisch, voller Tatendrang. Er stellte den Kaffee und die Brötchen auf dem Sideboard ab, um seine Laufschuhe auszuziehen. Sein Blick glitt über die vielen Kartons. Er kam wieder hoch und straffte die Schultern. Er würde jetzt duschen, frühstücken und heute nicht eher ausruhen, bis er jeden verdammten Karton in diesem Haus ausgepackt hatte.
*
»Ich freue mich, Ihnen Ihren neuen Kollegen und meinen Stellvertreter Detective Daniel Ambrose vorstellen zu dürfen.«
Die bisher so verstohlenen Blicke der Kollegen richteten sich nun mit offener Neugier auf ihn. Daniel hob sein Glas mit dem lauwarmen Sekt und nickte höflich in die Runde.
»Daniel hat die Polizeiakademie in Chicago mit Auszeichnung abgeschlossen. Bereits in seinem ersten Jahr als Streifenpolizist wurde er für eine Tapferkeitsmedaille vorgeschlagen, die ihm in seinem zweiten Jahr verliehen wurde. In weniger als drei Jahren brachte er es zum Detective. Daniel hat diverse Spezialeinheiten der Abteilung Organisiertes Verbrechen und Bandenkriminalität geleitet. Zusammen mit Kollegen der IT-Sicherheit hat er ein Programm entwickelt, das wiederkehrende Muster im Tathergang, DNA-Spuren und andere Tatortfunde kombiniert und diese mit zurückliegenden Verbrechen, die sich in der Datenbank finden, in Verbindung bringen kann. Seine Aufklärungsquote lässt uns alle ziemlich alt aussehen.« Captain Hugh Acinas, ein hoch aufgeschossener Afroamerikaner mit Glatze und Händen so groß wie Servierplatten, grinste. Er hob sein Glas und prostete Daniel zu. »Ich habe keine Ahnung, was er bei uns will. Aber ich freue mich sehr, mit ihm in Zukunft zusammenzuarbeiten.«
Die Kollegen brachen in Gelächter aus, und auch Daniel lachte freiheraus.
»Ich danke Ihnen für diesen Einstand, Captain Acinas.« Er drehte sich zu seinen neuen Kollegen. »Und glauben Sie nicht alles, was im Internet über mich steht.«
Wieder Gelächter. Daniel war erleichtert. Durch seine lockere Art hatte Captain Acinas Daniels Streber-Lebenslauf so rübergebracht, dass man ihn respektierte, aber nicht sofort hasste. In Anbetracht der Tatsache, dass die meisten seiner zukünftigen Kollegen älter waren und Daniel als Nachfolger des Captains gehandelt wurde, eine durchaus naheliegende Befürchtung.
Doch die meisten lächelten immer noch, und ihre Gesichter wirkten offen und freundlich. Einzig ein Mann, etwa in Daniels Alter mit rabenschwarzem Haar und blauen Augen so kalt und hart wie Glasmurmeln, starrte ihn mit offener Ablehnung an. Sein maßgeschneidertes Oberhemd und die dunkle Anzughose aus feinster Wolle hatte er sicherlich nicht von seinem Gehalt als Detective bezahlt. Am Ringfinger seiner rechten Hand prangte ein dicker goldener Siegelring. Daniel bemerkte die muskulösen, sehnigen Unterarme. Alles an seiner Haltung, die Art, wie er aufrecht dastand, wie dynamisch und immer auf dem Sprung er dabei wirkte, verriet den Kampfsportler. Er war schlank und eher sehnig als muskelbepackt. Daniel suchte den Blick des Mannes, um seine Position von Anfang an klarzumachen. Er starrte in das kantig geschnittene Gesicht und sah keinen Respekt, keine Angst und keinerlei Verbindlichkeit darin. Okay. Der Typ, der aussah wie eine Mischung aus Armani-Model und Serienkiller, konnte ihn definitiv nicht leiden.
Das Handy des Captains klingelte, er verabschiedete sich hastig und ging davon in sein Büro. Daniel war mit seinen neuen Kollegen allein.
»Mitch Norberg. Die zukünftige bessere Hälfte.« Ein hünenhafter Kerl streckte ihm lächelnd die Hand entgegen. Mit seinen goldblonden Haaren, den breiten Schultern und der sportlichen Figur musste er zu Highschool-Zeiten der Traum aller Cheerleader gewesen sein, mutmaßte Daniel.
»Hallo, Mitch. Freut mich, ich bin Daniel.« Daniel wollte auf keinen Fall gesiezt werden. Mitch wirkte erleichtert.
Das also würde sein Partner sein. Daniel hatte Mitchs Akte gelesen, sein Foto aber nicht so genau betrachtet. Mitch schien nur aus Muskeln zu bestehen. Das nur mäßig gekonnt gebügelte Oberhemd spannte im Brustbereich, als würde Mitch den Fetzen Stoff im nächsten Moment wie Hulk sprengen. Er sah aus, als wäre er als Teenie in einen Anabolika-Topf gefallen.
»Ex-Quarterback«, sagte Mitch mit einem breiten Grinsen, als habe er Daniels Gedanken erraten. »Bin aus der College-Auswahl geflogen, weil ich mir die Achillessehne gerissen habe. Shit happens. Also Recht und Gesetz statt Ruhm und Models.«
Daniel lachte auf. Er mochte Mitch auf Anhieb.
»Ich spiele nur noch in der Altherren-Liga am Wochenende. Womit hältst du dich fit?«
»Häkeln.«
Mitchs donnerndes Gelächter ließ die anderen Kollegen automatisch einfallen. Er haute Daniel auf die Schulter. Der war sich sicher, die gesplitterten Überreste seines Schulterblatts vom Teppichboden aufsammeln zu können. Mitch sah nicht nur so aus, es besaß tatsächlich Bärenkräfte.
»Ich schmeiß mich weg!«, wieherte Mitch. »Wir werden eine Menge Spaß haben.«
»Hauptsächlich CrossFit«, sagte Daniel. »Ich mag keine Muckibuden. Marathon, Sprint, egal. In manchen Parks stehen Klimmzugstangen, aber mir reicht auch ein Ast oder der Teil einer Statue fürs Training. Ich trainiere mit dem, was ich finde.«
»Geil.« Mitch sah ihn mit ehrlichem Interesse an. »Davon habe ich schon gehört. Ich bin eher oldschool. Sterile Pumperbude, immer die gleiche Temperatur, immer dieselben Geräte.« Er grinste. »Da sitzt die Frisur für die Ladys. Was machst du, wenn es regnet?«
»Nass werden.«
Mitch prustete los und hob seine riesige Pranke, vermutlich um sie ein zweites Mal auf Daniels Schulter donnern zu lassen. Daniel war schon im Begriff, sich wegzuducken, als Captain Acinas ihn rettete. »Ambrose, kommen Sie gleich mal einen Moment zu mir«, rief er von der Tür seines Büros aus.
Daniel drehte sich geschmeidig von Mitch weg und hob entschuldigend die Hände.
»Ich warte und zeige dir deinen Schreibtisch«, sagte Mitch gutmütig.
Daniel musste noch ein paar Hände schütteln auf seinem Weg zum Büro des Captains. Einzig der schwarzhaarige Typ machte keinerlei Anstalten, sich vorzustellen. Er lehnte an einem Schreibtisch, hatte die Arme vor der Brust verschränkt und beobachtete ihn so regungslos wie eine Sphinx. Daniel beschloss, dass Angriff die beste Verteidigung war. Der Captain würde noch einen Moment warten müssen.
Der Typ sah ihm mit völlig ausdruckslosem Gesicht entgegen. Warum war er zur Polizei gegangen? Er hätte Pokerkönig in jedem Land dieser Erde werden können.
»Daniel Ambrose.« Daniel streckte auffordernd die Hand aus.
Der Typ ließ sich Zeit. Einen ewigen Moment musterte er Daniel von oben bis unten, die Arme immer noch vor der Brust verschränkt.
»Thomas Vanderbylt-Belmont.« Er schüttelte Daniels Hand, als habe ihn jemand dazu gezwungen. Ostküsten-Adel. Warum war er nicht eher darauf gekommen? Dieser Thomas schien die Arroganz und Überlegenheit dieser selbsternannten Royals aus jeder Pore seines Körpers auszuströmen. War er etwa mit Henry Vanderbylt-Belmont, dem amtierenden Polizeipräsidenten, verwandt?
»Freut mich«, erwiderte Daniel diplomatisch. Thomas nickte nur. Genau wie ein Adliger einem Höfling begegnen würde. Er war ungefähr so alt wie Daniel, doch seine arrogante Kälte ließ ihn älter wirken. Daniel schluckte seinen Ärger hinunter. Thomas würde ihn nicht akzeptieren, daran ließ sich vermutlich nichts ändern. Es sollte ihm egal sein. Solange sie sich beide in Höflichkeit und Professionalität begegneten, war es Daniel gleichgültig, für wen oder was Thomas Vanderbylt-Belmont sich hielt.
»Ambrose!« Der Captain klang ungeduldig. »Zeit für ein Kaffeekränzchen ist später noch.«
»Sofort, Captain.«
Thomas schnaubte, verzog die Lippen zu einem argwöhnischen Lächeln und ließ Daniel stehen. Das war deutlich.
Einige Kollegen hatten das Schauspiel neugierig beobachtet, wandten sich jedoch hastig ab, als die Stimme des Captains erklang.
Diesen Kampf hatte Daniel noch nicht gewonnen. Aber es würde sich schon eine Chance ergeben, Thomas zu zeigen, wer hier wem Befehle erteilte.
*
In der Mittagspause ließ Mitch es sich nicht nehmen, Daniel das nach seiner Aussage »angesagteste Diner Washingtons« zu zeigen. Fakt war: Die Burger waren ganz nett. Aber dieses ganze Tamtam um grüne Smoothies, ökologisch korrekten Ketchup und glutenfreie Brötchen ging Daniel ein wenig auf die Nerven. Und wer aß schon Cookies aus Bucheckernmehl?
So ausgewählt wie die Zutaten war auch das Personal. Jungs mit Undercut und engelsgleichen Gesichtern wirbelten hinter der Theke herum und kreierten Smoothies aus den absonderlichsten Zutaten. Langbeinige Mädchen mit Blütenbändern in den Haaren und spitzenverzierten Trägertops servierten feengleich die fraglos hipsten Burger der Stadt.
Daniel zog ein seltsam rot geädertes Blatt unter dem Sesambrötchen seines Burgers hervor, während Mitch verzückt einer Kellnerin nachsah.
»Und?«, fragte der, ohne seinen Blick abzuwenden. »Ist der Knaller, oder?«
Meinte er jetzt die Kellnerin oder sein Essen?
»Ja«, erwiderte Daniel vage und untersuchte nach diesem seltsamen Fund seinen Burger doch etwas genauer. »Ernsthaft?« Er hielt Mitch ein mit Ketchup beschmiertes Gänseblümchen unter die Nase. »Die kochen hier mit Blumen?«
Mitch zuckte die Schultern. »Ist doch nichts anderes als Salat.«
Daniel ließ das schlappe Blümchen auf seinen Tellerrand fallen. Er hatte als Kind bei Mrs Zhao frittierte Heuschrecken in Honig probiert. Auf einer Dienstreise nach Guatemala hatte er mal Kuhmagen gekostet und in einer illegalen mexikanischen Suppenküche Vogelspinnensuppe essen müssen, weil er eine Wette verloren hatte. Aber das hier ging eindeutig zu weit.
Mitch grinste. »Willkommen in Washington.«
»Ich bin hier aufgewachsen.« Daniel bemühte sich um einen neutralen Tonfall. Er würde Mitch die rührseligen Details ersparen. Aber es war gut für ihre Zusammenarbeit, wenn sie ein wenig voneinander wussten. »Ich bin erst nach Chicago gezogen, als die Zusage der Akademie kam.«
Mitch ließ die Gabel mit einer ökologisch wertvollen Kartoffelecke sinken. »Die wollten dich hier nicht?«
»Ich wollte die nicht.«
Mitch starrte ihn ungläubig an. Als Daniel nichts mehr hinzufügte, wandte Mitch seine Aufmerksamkeit dem Essen zu. »Okay.« Er schob sich die Kartoffel in den Mund und kaute bedächtig. Daniel war ein zweites Mal an diesem Tag erleichtert. Mitch war keiner von der Sorte, die jedes Detail einer Biographie hartnäckig herauszufinden versuchten. Daniel hatte zwar seinen Lebenslauf nicht frisiert, aber trotzdem brachte er ein Geheimnis an seinen neuen Arbeitsplatz mit.
»Da du dich hier auskennst: In welchem Laden feiern wir heute Abend deinen Einstand?« Mitch sah ihn erwartungsvoll an.
Daniel hatte gehofft, diese Tradition sei in Washington mittlerweile ausgestorben. Die einschlägigen Cop-Bars waren ihm zwar bekannt, aber ob man da unbedingt herumhängen wollte? Andererseits … wollte er in einer Hipster-Kneipe abhängen und Bio-Bier schlürfen?
»Ich bin für einen Tipp dankbar. Ich trinke allerdings weder Spinat-Smoothies noch Bionade.«
Mitch lachte dröhnend. »Glaub mir, die Jungs würden mich umbringen. Nee, nee. Abends muss es schon ein Budweiser oder ein Miller sein. Ich kenne einen guten Laden, nicht weit vom Revier. Dort wirst du dir keine Feinde machen.«
Beim Stichwort »Feinde« musste Daniel sofort an Thomas Vanderbylt-Belmont denken. »Geht die ganze Abteilung mit?«
»Okay, wen kannst du schon jetzt nicht leiden?« Mitch wackelte mit den Augenbrauen.
Daniel winkte ab. »Niemanden.« Er konnte sich nur einfach nicht vorstellen, wie dieser arrogante Schnösel lachend mit ein paar Kollegen an einem Tresen stand.
Mitch kniff die Augen zu Schlitzen zusammen. »Lass mich raten.«
»Es gibt niemanden. Es geht um die gemeinsame Arbeit, da sollten persönliche Befindlichkeiten hintanstehen.«
»Du redest manchmal, als würdest du in deiner Freizeit Wikipedia-Einträge korrigieren«, lachte Mitch. »Persönliche Befindlichkeiten.« Er machte Daniels ernstes Gesicht nach. »Scheiß drauf. Wir sind alle nur Menschen.«
Daniel konnte Mitch und seiner entwaffnenden Ehrlichkeit nicht böse sein. »Hast recht.«
»Ah! Jetzt hab ich’s!« Mitch schob seinen leeren Teller zur Seite. »Das Duell mit dem Kronprinzen.«
Daniel fragte sich, ob die seltsamen Blätter und Blumen auf Mitchs Burger die ersten halluzinogenen Nebenwirkungen zeigten. »Bitte wer?«
»Unser Kronprinz! Der Belmont-Spross. Daddy hat ihm ganz schön den Hosenboden stramm gezogen, weil er deinen Posten nicht bekommen hat.«
»Thomas? Er ist also tatsächlich der Sohn den Polizeipräsidenten?«
»Ja, klar. Tom hat sich intern beworben. Sollte zwar ein großes Geheimnis bleiben, aber ein Typ aus seinem Gefolge hat sich verquatscht.«
So sah es also aus. Daniel hatte Thomas den Job vor der Nase weggeschnappt. Jetzt konnte er fast verstehen, dass dieser ihm so unfreundlich begegnet war. Trotzdem. Sein Verhalten war ziemlich unprofessionell, das musste man ihm lassen.
»Nimm dich vor ihm in Acht.« Mitch sah ihn mit ernstem Blick an. »Tom ist nicht ohne.«
Dan zog ein Gesicht. »Wird er mich in einer dunklen Seitenstraße verprügeln? Er ist Kampfsportler, richtig?«
Mitch nickte. »Richtig geraten. Kampfsport macht er wohl schon seit der Schulzeit. Tom ist echt zäh. Er hat mal einen flüchtenden Täter acht Blocks die Constitution Avenue verfolgt. Und zwar im Sprintmodus!«
»Hat er ihn gekriegt?«
»Allerdings. Für den Täter mussten wir die Sanitäter rufen, weil er keine Luft mehr gekriegt hat. Tom hat in der Zwischenzeit seelenruhig die Personendaten übers Telefon abgefragt.«
»Okay, er ist also fit. Das bin ich auch.«
Mitch lehnte sich in seinem Stuhl zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. »Tom ist eher das Messer aus dem Hinterhalt. Er würde dir nie offiziell ein Ei verpassen, das kann er sich politisch gar nicht leisten. Schließlich will er mal Daddys Posten erben. Pass auf und lass dir nichts zuschulden kommen. Egal, welche Leiche du im Keller hast … Wenn Tom dir was will, dann findet er sie.«
»Von mir aus.« Dan tat unbeeindruckt, obwohl er bei Mitchs Worten genau an diese Leichen in seinem Keller denken musste. Trotzdem. Tom war vielleicht ein kluges Kerlchen, aber das war er auch. So schnell würde ihm niemand in die Karten gucken. Dafür würde er schon sorgen.
Kapitel 3
Cat
Ein Date mit Mr Darcy
Nach einer Vorlesung plus anschließender praktischer Übung zum Thema »Anorganische Strukturaufklärung« und einem Seminar mit dem Titel »Metallorganische Komplexkatalyse« fuhr Cat auf direktem Wege mit der U-Bahn nach Lanier Heights. Das Pflegeheim lag nicht weit entfernt von der Haltestelle in einer ruhigen Seitenstraße.
»Hallo, Catinka.« Die Frau am Empfang nickte ihr zu.
»Hi, Melany.« Im Laufe der Jahre waren die Mitarbeiter des Pflegeheims fast zu einer Ersatzfamilie geworden, da Cat ihren Vater beinahe täglich besuchte.
Cat bog links ab und ging einen langen, hell gestrichenen Gang entlang. Man hatte sich zwar bemüht, dem Heim ein wohnliches Dekor zu geben, doch in den Gängen roch es wie in einem Krankenhaus. Cat jagte es jedes Mal ein Schauer den Rücken hinunter. Zu viele Erinnerungen stiegen dann in ihr auf. Gedanken an ihre Mom, deren langes Leiden und schließlich Sterben zwischen all den piepsenden, blinkenden Maschinen. Cat wickelte sich fester in ihre Strickjacke. Sie musste an etwas Schönes, Fröhliches denken. So gefangen in all den schmerzlichen Erinnerungen wollte sie ihrem Dad nicht gegenübertreten. Pflegekräfte, die ihr entgegenkamen, grüßten sie herzlich. Cat setzte ein mechanisches Lächeln auf und bemühte sich um Freundlichkeit. Sie musste sich zusammenreißen!
Cat stieß die Tür mit der Nummer sechzehn auf.
»Hi, Dad!« Sie klang fröhlich. Doch ihre gespielte gute Laune hallte wie ein düsteres Echo in ihr nach. Sie hatte lange gebraucht, um sich daran zu gewöhnen, dass ihr Vater nicht reagierte. Die Ärzte nannten es Apallisches Syndrom. Hier im Pflegeheim wurde William Reynolds als Wachkomapatient behandelt.
Cat ließ ihre Tasche auf einen Stuhl fallen und setzte sich auf den Bettrand.
»Wie geht es dir heute?« Sie nahm seine Hand. »Hast du gestern Abend wieder deine Lieblingsserie geguckt?« Sie deutete auf den Fernseher, der an der gegenüberliegenden Wand angebracht war.
William Reynolds’ Augen bewegten sich unkontrolliert. Sein Gesichtsausdruck war erstarrt in einer Mischung aus Überraschung und Desinteresse. Cat streichelte die schlaff in ihrer Hand ruhenden Finger.
»War Angela mit Buster noch mal da? Ich weiß doch, wie gerne du Hunde hast. Hat er wieder auf deinem Bett gesessen?« Sie strich ihrem Vater eine Haarsträhne aus der Stirn. Es war schon fast wieder zu lang. Nächste Woche würde sie die Pfleger darum bitten, den Friseur kommen zu lassen.
»Oder war er etwa frech?« Sie lächelte. »Er ist noch ein junger Therapiehund, da musst du ihm kleine Fehler verzeihen.«
Es klopfte an der Tür.
»Ja, bitte?«
Eine Frau mittleren Alters in grauem Business-Kostüm und hohen Pumps erschien. »Hallo, William, hallo, Catinka. Melany sagte, du wärst gerade angekommen.« Sie drückte ihr Klemmbrett vor ihren Oberkörper und sah Cat mit ernstem Blick an. »Du weißt, warum ich dich anspreche?«
Cat nickte und sprang auf. »Tut mir leid, Beth.« Sie griff nach ihrer Umhängetasche und holte das Bündel Einhundertdollarscheine aus einer Innentasche. »Meine Tante war krank, und ich –«
»Schon gut.« Beth winkte ab, als sie das Geld sah. »Ich weiß ja, dass du immer bezahlst. Nur die Geschäftsleitung zwingt mich, ab dem Dritten des Monats die Angehörigen auf die fehlende Zahlung anzusprechen.«
»Ich weiß.« Cat gab ihr die Scheine. »Entschuldige.«