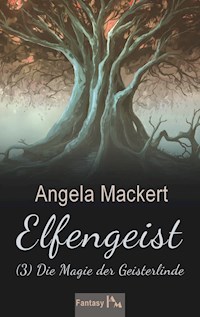Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Antiquerra-Saga
- Sprache: Deutsch
Die Fantasy-Romanreihe ANTIQUERRA-SAGA: Begleiten Sie die Halbfee Lena und ihre Gefährten auf der gefährlichen Reise durch die Schattenwelt und begegnen Sie göttlichen Königinnen, mutigen Feen, Lichtmagiern, Alraunen und Vampiren. Erleben Sie den Verlauf von Jahrzehnten und lassen Sie sich berühren von Mut, Freundschaft und Liebe. Band 2 Seit der Rückkehr aus dem Schattenreich sind Jahrzehnte vergangen, und außer den Gefährten weiß niemand um Lenas Schicksal. Viele Feen aus Antiquerra leben nun in der fast zerstörten Welt der Menschen. Sie haben ihre Erinnerung und ihre magischen Kräfte verloren, müssen wie alle um ihr tägliches Brot kämpfen. Auch Rosa und Alena wissen nicht mehr, woher sie stammen und dass sie nur deshalb hierher kamen, um der Menschheit aus ihrem Elend herauszuhelfen. Doch eines Tages leuchtet in einer Eiche ein magisches Licht auf. Ist das die Wende? Es scheint einiges darauf hinzudeuten, doch als Rosa sich endlich wieder an ihr Versprechen erinnert, fangen die Probleme erst richtig an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die »Antiquerra-Saga« ist eine mehrteilige Fantasy-Reihe.
Bisher erschienen:
Band 1: DIE FARBE DER DUNKELHEIT
Band 2: FEENSCHWUR
Band 3: VAMPIRBLUT (voraussichtlich ab Frühjahr 2016)
Drei Schlüssel
Um Leben zu erfahren
Der Erste erschließt das Glück
Der Zweite Kummer und Leid
Der Dritte entsteht aus diesen beiden
Damit auch die Tür geöffnet werde
Die zur Erkenntnis führt
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Tochter des Lichts …
Kapitel 2
Die Suche …
Erinnerungen …
Nur drei Monde …
Kapitel 3
Zauber …
Zeichen …
Begegnung mit dem Mob …
Kapitel 4
Sturm …
Kapitel 5
Kurz zuvor in Antiquerra …
Taherehs Geschenk
Der Kreis schließt sich …
Heimkehr …
»Im Grunde ist unsere alte Erde Antiquerra nur eine Insel in einem zeitlosen Raum. Doch sie birgt ein Geheimnis, eines, das noch viel größer ist als wir bisher geahnt haben.« ― Luczin zu Kieran, während einem ihrer vielen Gespräche, die den Ereignissen folgten.
Kapitel 1
Tochter des Lichts …
Meister Kieran trat durch die offene Tür seines Turms hinaus ins Freie. Nach ein paar Schritten blieb er stehen, die Hände um seinen Stab geklammert. Nie in seinem Leben hatte sich der Lichtmagier so leer gefühlt wie heute, nicht einmal damals, als er mit der Fata Lena und den Getreuen durch die Klagsümpfe gewandert war. Kierans Blick schweifte hinüber zum Waldrand und blieb an der Eiche hängen, deren Blätter im aufgehenden Licht der Sonne golden aufstrahlten. »Gustav«, flüsterte er, »ich bin zu alt und müde.«
Ein Windstoß wehte ein Eichenblatt zu ihm herüber. Kieran fing es auf. Wie pures Gold glänzte es in seiner Hand, und es erinnerte ihn an die Strahlenkönigin, deren flammenden Lichtkristall er in der Burg hinter seinem Turm hütete. Kieran seufzte schwer auf, als er an sie dachte. Er liebte die Strahlenkönigin Alyssa so sehr wie er ihre Schwester, die Schattenkönigin Tahereh, fürchtete. Dabei verstand er sie beide nicht, jetzt weniger denn je. Und er fühlte sich so schuldig, dass er sich am liebsten verkrochen hätte.
Wie so oft in den letzten Tagen schweiften Kierans Gedanken wieder zurück in die Zeit vor mehr als fünfzehn Jahren, als er die Feen und Magier mit feurigen Worten auufgerufen hatte, zu den Menschen zu gehen und deren Evakuierung nach Antiquerra vorzubereiten. Damals glaubte er, der Fata, die einst so viel auf sich genommen hatte, um die Strahlenkönigin aus der Gewalt ihrer Schwester zu befreien, damit Ehre zu erweisen. Doch in Wahrheit tat er es wegen dem Geheimnis, das ihn mit ihr verband und das ihn fast erdrückte, weil er es nicht preisgeben durfte.
Kieran ließ das goldene Eichenblatt aus seinen Händen gleiten und setzte sich an den grob gezimmerten Tisch neben dem Eingang des Turms. Stöhnend barg er sein Gesicht in den Händen. Nach seinem Aufruf zur Rettung der Menschen hatte er mit allem gerechnet, aber nicht mit Alyssas heißem Zorn. Sie, die er immer als die Gütige betrachtet hatte, stieg aus ihrem Wolkenschloss zu ihm herunter und wies auf die brennenden Schwerter ihrer Lichtkrieger. Die Menschen hätten sie entzündet, schrie sie, durch ihren rücksichtslosen Umgang mit der Erde, die sie trug. Mit Gift hätten sie diese getränkt, um ihr den Atem zu nehmen; ihre Geschöpfe manipuliert; ihren Boden mit nicht enden wollenden Kriegen überzogen und dem Planeten so die Seele geraubt. Mit Tränen in den Augen sprach Alyssa davon, wie die Menschen tief in den Eingeweiden ihrer Erde gebohrt hätten, solange bis es ihr den Lebenssaft entzog, sodass jetzt von dem einst fruchtbaren Planeten kaum mehr als eine Hülle übrig geblieben sei. Nie würde sie zulassen, dass die Menschen dasselbe der alten Erde Antiquerras antaten. Alyssa befahl ihm, seine Feen und Magier zurückzurufen und die Menschheit ihrem Schicksal zu überlassen. Alles was Kieran ihr daraufhin entgegenhielt, konnte sie nicht erweichen, weder sein Hinweis auf die Unschuld derjenigen, die das Erbe ihrer Väter ausbaden sollten, noch sein Versprechen, nur diejenigen zu retten, die Demut im Herzen trugen. Auch mit seinem leidenschaftlichen Appell an ihrer aller Pflicht, das Leben ― auch das menschliche ― zu bewahren, richtete er nichts aus. »Wer sonst, wenn nicht wir?«, flehte er, doch sie lächelte nur.
»Jedes Leben, das ich nähre, führt in meiner Schwester Schoß, wusstest du das nicht?«
In den Tagen und Wochen danach konnte sich Kieran nicht entschließen, ihren Willen zu erfüllen. Stattdessen hoffte er darauf, dass die Strahlenkönigin ihre Meinung noch ändern würde. Doch dann verschlossen sich die Weltentore, und er wusste, es war zu spät.
Drei Monde blieben ihm, um den Feen und Magiern, die bereits in der Welt der Menschen lebten, den Grund zu erklären. Aber wieder zögerte er, denn wie sollte er ihnen übermitteln, dass sie durch seine Schuld dem Tod geweiht waren?
Ein Band der Hoffnung wurde ihm von unerwarteter Seite gereicht, als ihm Tahereh eines Nachts im Traum erschien. Die dunkle Königin sah ihn an, mitfühlend fast, und machte ihm dann ein Angebot: Wenn eine Fee, die geboren war im höchsten Stand des Lichts an der Schwelle des Abstiegs, ihr im Lauf des achtzehnten Lebensjahrs den Schlüssel brachte, den die Tränen der Fata Lena einst benetzt hatten, dann würde sie mit ihrer Schwester kämpfen, solange bis das Feuer auf den Schwertern der Lichtkrieger erlosch. Dies würde Alyssas Zorn besänftigen und sie versöhnen, sodass die Weltentore wieder geöffnet werden konnten ― für alle. Doch sie stellte eine Bedingung: Die bezeichnete Fee, die Tochter des Lichts, musste allein zu ihr kommen, begleitet höchstens von einem einzigen Getreuen. Taherehs Schattenfeen, die Grungalp, würden sie vor den Toren Lacrimoas erwarten und zu den Klagsümpfen bringen. Von dort aus sollten sie den Juncta, den zwei Seelenvögeln folgen, die sie bis in ihr Schattenreich geleiten würden.
Als Kieran am Morgen darauf eine von Taherehs Tränenperlen in seinem Bett fand, sah er ihr Angebot bestätigt. In aller Eile übermittelte er nun die Botschaft an alle Feen und Magier, damit auch diejenigen auf der Erde der Menschen Hoffnung schöpfen konnten.
In der Folgezeit beschlich ihn allerdings immer wieder das quälende Gefühl, dass Tahereh mit ihrem Angebot eigene Ziele verfolgte. Es lag daran, dass er ihren Grungalp nicht traute, die zu oft Krankheit und Verderben brachten, und daran, dass die Schattenkönigin von zwei Seelenvögeln, den Juncta, gesprochen hatte. Von diesen wusste Kieran nichts, doch die Erwähnung erinnerte ihn an eine lange zurückliegende Begebenheit und an das Geheimnis, das er wahren musste. Wie ein Besessener forschte er, mehr als fünfzehn Jahre lang, doch er fand nirgendwo einen Hinweis auf die Juncta. Er fand auch keine Tochter des Lichts, keine Fee, die zur bezeichneten Stunde geboren worden war, und genauso blieb der Schlüssel verschwunden, den die Fata Lena einst um den Hals getragen hatte.
Vor drei Wochen jedoch änderte sich alles. Unten beim Wasserfall öffnete sich für einen kurzen Augenblick das Weltentor. Er hörte an dem Tag den Fels knirschen und rumpeln, und wenige Stunden später stand die Korriafee Alena vor ihm. Sie war eindeutig eine Tochter des Lichts, denn nur eine solche konnte nach dem Willen Taherehs die Sperre der Welten überwinden, um nach Antiquerra zu gelangen. Wie Schuppen fiel es ihm dann von den Augen, als er den Schlüssel um ihren Hals sah: All die Jahre hatte er nach dem falschen gesucht. Alena trug Nivens Schlüssel, den dieser damals aus Taherehs Schattenreich mitgebracht hatte, und der in den Jahren danach von den Tränen der Fata Lena benetzt worden war.
Die Juncta machten für Kieran nun plötzlich Sinn, und er verlor vollends den Mut. Er würde dieses Kind Alena, diese unschuldige Tochter des Lichts, die kaum etwas von ihrer Aufgabe wusste, weil sie in der Welt der Menschen groß geworden war, in den Tod schicken, und vielleicht auch seinen Freund, den Vampir Darian, der darauf bestand, sie zu begleiten.
Drinnen im Turm klapperten Töpfe, und der Duft von gekochtem Getreidebrei wehte Kieran um die Nase. Er hörte die Stimmen von Finley und Cara, die miteinander sprachen. Auf der Treppe zu den oberen Stockwerken klangen die Schritte ihrer Tochter Keona und ihres Ziehsohnes Wighard.
Kieran richtete sich auf. Sie durften ihn nicht so gebeugt sehen. Er ging hinüber zur goldenen Eiche, um den Geist Gustavs zu bitten, auf Alena und Darian aufzupassen, da ihm selbst dies verwehrt blieb. Angespannt lauschte er auf Antwort: »Das Schicksal webt die Fäden aus den Taten der Lebenden auf eigene Weise zusammen. So entsteht Hoffnung, und auch du, Lichtmagier Kieran, solltest dich daran festhalten«, flüsterte es in den Blättern.
Kieran nickte. Er hatte keine eindeutigen Worte erwartet. Während er wieder zum Turm hinüberging, straffte er den Rücken. Am Nachmittag würden sie Alena und Darian zu den Toren von Lacrimoa begleiten und dort den Grungalp übergeben. Bis dahin musste er allen eine Stütze sein. Wenn sie dann wieder zum Turm zurückkehrten, galt es die Zuversicht aufrechtzuerhalten und alles für die Ankunft der Menschen vorzubereiten. Kieran blieb einen Augenblick lang stehen, atmete tief ein und aus und fasste einen Entschluss: Wenn er Alena und Darian wiedersah und die Tore sich öffneten, dann würde er die Sorge um den flammenden Kristall und die Geschicke Antiquerras in die Hände von Finley legen. Der Junge war soweit, und vielleicht erfüllte Finley seine Aufgabe dann besser als er.
Drei Wochen zuvor …
Aus der Ferne erklangen die klagenden Töne einer Mundharmonika. Alena blieb stehen und lauschte, aber nicht lange, dann verfiel sie wieder in Laufschritt. Sie durfte den Raben nicht aus den Augen verlieren, musste ihm folgen, wenn sie auch nicht wusste, wohin. In ihrem Inneren pochte eine drängende Stimme: weiter, weiter, weiter …. Ihr keuchender Atem nahm dieses Gefühl rhythmisch auf, hielt ihre Beine in Bewegung. Während sie rannte, legte Alena eine Hand auf die Brust, um den kräftigen Schlag ihres Herzens zu spüren. Es half ihr, diese seltsame Nacht zu ertragen, die immer gespenstischer anmutete. Außer ihrem eigenen Atem hörte sie kein Geräusch. Nicht einmal ihre Schritte verursachten einen Laut. Aber der Geruch des faulendem Wasser in den Tümpeln am Rande des Wegs wurde stärker, gerade so, als ob es sie betäuben wollte.
Ihr werdet mich nicht aufhalten, hört ihr!
Beherzt tauchte Alena in die Nebelfetzen, welche im Mondlicht wie Spinnweben schimmerten. Sie hatte ein Ziel! Ihr war nicht klar welches Ziel, aber es lag wohl irgendwo da vorne hinter den Zwillingsbergen. Der Rabe flog darauf zu.
Plötzlich nahm die Musik der Mundharmonika einen völlig anderen Klang an. Irritiert blieb Alena stehen. Etwas stimmte nicht mehr! War das noch dieselbe Umgebung? Und wo war der Rabe? Sie sah ihn nicht! Wie sollte sie jetzt hier herausfinden? Panik rollte in zitternden Schüben durch ihren Körper, trieb ihr den Schweiß aus den Poren und ihren Herzschlag zur Höchstleistung an. Das Licht veränderte sich, wurde heller, konturenlos ― und dann …
»Verdammt!«, schimpfte Alena, tastete mit einer Hand zum Radiowecker und schaltete ihn aus. Mit noch immer klopfendem Herzen richtete sie sich auf, blieb ein paar Sekunden lang reglos sitzen und starrte auf das altmodische Muster ihres zerwühlten Bettlakens. Dann ließ sie sich unvermittelt wieder in die Kissen zurückfallen.
Die Morgensonne zauberte tanzende Lichtreflexe an die Zimmerdecke. Alena beobachtete die goldenen Flecke, ohne sie wirklich zu sehen. Zu deutlich spürte sie noch die Nachwirkungen der nächtlichen Bilder. Alena griff nach einem Zipfel der Bettdecke und presste ihn auf ihre feuchte Stirn, fing an zu grübeln. Der Traum hatte etwas zu bedeuten, zumal sie ihn nicht zum ersten Mal träumte. Aber was? Wollte sie vor etwas davonlaufen? Ah, das ging doch gar nicht! Das Leben gestaltete sich überall so schwierig wie hier. Der Vogel! … Das konnte ein Bild für seelischen Kummer sein und ja, den hatte sie seit dem Tod ihrer Eltern. Aber deshalb gleich eine Serie von Albträumen?
»Schluss jetzt«, sagte sie laut, um die Reste ihrer nächtlichen Hetze von sich abzuschütteln. Heute war schließlich ein besonderer Tag, und den wollte sie sich nicht verderben lassen.
Alena strampelte sich aus dem Bettlaken frei und stand auf. Gähnend tappte sie durch das Zimmer, um ins Bad zu gehen. Dabei fiel ihr Blick auf den Kalender neben der Tür. Den einundzwanzigsten Juni hatte sie rot eingekreist und mit Blümchen verziert. Dieser Tag war heute. Alena blieb stehen und strich lächelnd mit dem Finger über das Datum. Dann gab sie sich einen Ruck. Sie marschierte aus dem Zimmer und direkt gegenüber hinein ins Bad. Dort stützte sie sich erst einmal auf dem Waschbecken ab, als wenn sie der Standfestigkeit ihrer Beine zu dieser frühen Stunde noch nicht recht trauen würde. Eine Weile betrachtete sie ihr Gesicht im Spiegel. Es sah so verschlafen aus wie jeden Morgen. Das bis weit über die Schultern reichende, flachsblonde Haar hing in kleinen Löckchen ein wenig wirr um ihren Kopf. Einige eigenwillige, gekringelte Strähnen fielen ihr über die Augen und erschwerten eine klare Sicht. Alena strich sie langsam nach hinten. Wie so oft, wenn sie ihr schmales, an hell schimmerndes Porzellan erinnerndes Gesicht betrachtete, ärgerte sie sich wieder, dass es trotz der vielen Sonne kein bisschen Farbe annehmen wollte. Sie sah nicht krank aus, im Gegenteil. Aber mit dieser klaren, hellen Haut fiel sie auf. Alle anderen, die sie kannte, waren von der Sonne entweder rot oder braun gebrannt. Nur sie selbst sah sommers wie winters aus, als ob sie in den Schminktopf einer Geisha gefallen wäre. Unwillkürlich zog sie ihrem Spiegelbild eine Schnute. Dann rieb sie sich heftig die Wangen, bis sie sich röteten. Es kam ihr in den Sinn, wie die Eltern sie früher oft liebevoll »Feenherzchen« genannt hatten, wenn sie sich über ihren ungewöhnlich hellen Teint beklagte. Die Erinnerung daran versöhnte sie wieder ein wenig mit ihrem Spiegelbild. Sie lächelte, weil sie jetzt die Stimmen der beiden zu hören vermeinte: »Herzlichen Glückwunsch zum achtzehnten Geburtstag, Liebes.«
Es war jedoch ihre eigene melodische Stimme, die flüsternd erklang. Die Stimmen der Eltern würde sie nie mehr hören. Ein trauriger Schatten legte sich über Alenas Augen, die wie die unendliche Tiefe der smaragdgrünen See wirkten. Doch dann riss sie sich von ihrem Spiegelbild los. Es wurde Zeit, dass sie ihr Nachthemd mit der Straßenkleidung tauschte. Bald kam ihre Nachbarin Rosa Laun herüber, um zu gratulieren. Alena mochte Rosa sehr, empfand sie als der Familie zugehörig, immer schon. Doch jetzt, nach dem Unfalltod ihrer Eltern vor einem dreiviertel Jahr, noch mehr als zuvor.
Wie üblich duschte Alena in Rekordzeit, denn Wasser war kostbar in diesen Tagen und durfte nicht vergeudet werden. Zur Feier des Tages zog sie ihr Lieblingskleid mit den kurzen Ärmeln und dem weiten Tellerrock an. Es betonte ihre schlanke Figur und sie empfand es so bequem und luftig, dass es ihr nicht schwer fiel, dafür auf ihre kurze Jeans zu verzichten. Beschwingt lief sie danach die hölzerne Treppe hinunter ins Erdgeschoss, das aus einem einzigen großen Raum bestand. Links schmiegte sich die kleine Küchenzeile in eine Nische. Geradeaus nach vorne gelangte man direkt zur Eingangstür mit dem eigenartigen, goldglänzenden Schloss, dessen passender Schlüssel zu jeder Tages- und Nachtzeit an einer Kette um Alenas Hals hing. Hinter der Treppe befand sich der Ausgang zum Garten.
Obwohl die Sonne gerade erst aufging, wurde der Raum von grellem Licht durchflutet. Die Hitze des Tages kündigte sich bereits wieder an. Alena sah sich um und beschloss, sich nach dem Frühstück zuallererst um die Pflanzen zu kümmern.
Der Raum hatte nur eine spärliche Möblierung im Verhältnis zu seiner Größe. Es gab außer der Küchenzeile nur einen Esstisch mit sechs Stühlen, eine kleine Couchecke und einen Vitrinenschrank. Doch überall standen auf Stühlen, Hockern, Tischchen oder direkt auf dem Steinboden Töpfe mit Pflanzen. Viele Topfgewächse hingen sogar an Haken von der Decke. Das Zimmer wirkte daher weniger wie ein Wohnraum, sondern eher wie das undurchdringliche Dickicht eines Urwalds. Es wuchsen jedoch keine Blumen, mit denen Alena das Zimmer verschönern wollte. Sie zog hier Tomaten, Paprika, Gurken und viele weitere Gemüse- und Salatpflanzen, von denen sie sich ernährte. Jeder machte das so, seit vor Jahren auch in Deutschland die Versorgung infolge von anhaltenden Krisen und ständig wiederkehrenden Naturkatastrophen aufgrund des Klimawandels zusammengebrochen war. Die Lebensmittel wurden allerorts rationiert. Es gab immer weniger zu kaufen und wenn, dann zu horrenden Preisen. Wer die letzten drei Jahre überstanden hatte, musste auf Selbstversorgung setzen, und Alena nutzte dafür jedes Plätzchen. Sogar um die Couchecke herum hatte sie Töpfe mit Kürbissen gepflanzt, die an Stäben entlang bis zur Zimmerdecke rankten und sich dort festgetackert ausbreiteten. Zweimal in der Woche ging sie mit Fön und Pinsel bewaffnet durch ihr Pflanzenreich, um für die Bestäubung der Blüten zu sorgen. Bis jetzt hatte sich die Arbeit gelohnt, und sie konnte mit einem verhältnismäßig reichen Erntevorrat für den Winter rechnen.
Natürlich nutzte Alena auch den kleinen Garten für den Anbau von Obst und Gemüse, zumindest versuchte sie es. Der Ertrag blieb jedoch oft aus, trotz Hitzeschirmen und Schutzvlies für die Pflanzen. Es gab keine Bienen mehr, die für die Bestäubung sorgten. Das Gemüse wurde schon im Jungstadium von der Sonne verbrannt, und wenn es trotzdem noch wuchs, riss der Sturm es aus der Erde oder Regen und Hagel ersäuften es. Es gab aggressive und giftige Schädlinge, die ihr die geringe Ernte streitig machten. Die Vögel hatten auch Hunger und stibitzten bevorzugt die wenigen, mühsam durch Handbestäubung herangereiften Beeren. Doch wenigstens die Kartoffelernte schien sicher. Die ertragreichen Pflanzen wuchsen rundum geschützt in den großen Fässern im Keller ― eine unverfälschte Sorte, die ihr Vater von irgendwoher einmal mitgebracht hatte, vermutlich von einem der aufständischen Bio-Gärtner, die gegen die Saatgut-Industrie gekämpft und am Ende doch verloren hatten, weil ihre Sorten von deren genmanipulierten Pflanzen infiziert worden waren. Alena seufzte. Jetzt durften die patentierten Industriepflanzen nicht mehr angebaut werden, weil ihre Gifte den Boden verseucht und wichtige Insekten getötet hatten. Aber es war zu spät, und das mörderischen Klima tat ein übriges, dass draußen nur noch wenig gedieh, das die Menschen ernähren konnte.
Alena arbeitete hart um ihr tägliches Brot, aber sie verlor nicht den Mut, wie so viele aus der Stadt. Sie liebte ihr Haus, vor allem weil es glückliche Erinnerungen barg. Es stand als letztes Gebäude von älteren, aneinandergepappten Reihenhäusern auf der linken Seite der Wilhelmstraße. Mit seinem bröckelnden weißen Anstrich und den kleinen Fenstern sah es ein wenig verschlafen aus. Die in der Sonne blinkende Solaranlage auf dem Dach stand zu diesem Eindruck in krassem Widerspruch, doch Alena hatte sich längst daran gewöhnt. Ein rosenumrankter Torbogen, der allerdings mehr vertrocknete, blattlose Zweige als Blüten aufwies, führte durch einen winzigen, an eine Wüste erinnernden Vorgarten mit essbaren Agavensorten bis zum Eingang mit dem großen Holzschild, auf dem die Hausnummer 49 prangte. Darunter hatte Alenas Vater einen weiteren Holzscheit gesetzt, auf dem »Feenhäusle« zu lesen stand. »Das passt zu uns«, hatte er damals gesagt.
Das Haus neben dem Feenhäusle, die Nummer 47, gehörte Rosa, der besten und ältesten Freundin ihrer Mutter. Es sah nicht viel anders aus, nur hatte es keinen Torbogen, sondern eine einfache, jetzt bereits verbrannt wirkende Buchsbaumeinfassung als Abschluss des Vorgartens und einen offenen Zuweg zur Eingangstür. Statt Agaven wuchsen bei ihr widerstandsfähige Bananenstauden, deren Früchte jedoch kurz vor der Reife jedes Jahr über Nacht verschwanden. Alenas Vater hatte auch Rosas Haus einen Namen gegeben: Schmetterlingshain. Alena fand es passend.
Das Teewasser, das Alena aufgesetzt hatte, gab blubbernde Geräusche von sich. Sie schaltete den Herd ab und marschierte mit ihrer rot-weiß gepunkteten, bauchigen Teekanne zu einer der Fensterbänke. Ein paar Zweige Pfefferminze und Melisse wanderten in das Gefäß und bald erfüllte der würzige Duft des frisch gebrühten Tees den Raum. Kaum stand alles auf dem Frühstückstisch, da hörte Alena draußen Schritte. Schnell ging sie zur Tür, und als sie öffnete, schaute sie in das strahlende Gesicht von Rosa, einer lebhaften Frau Mitte Dreißig.
Rosa sah Alena in gewisser Weise ähnlich und wer die beiden nicht kannte, hätte vermuten können, dass sie verwandt waren. Es lag vor allem an der Form ihrer Ohren, die eher ein bisschen spitz statt rund wirkten, aber auch an ihrem Gang. Rosa schritt stets aufrecht, fast schwebend, wie Alena. Ihr Haar wuchs dicht und glänzend, doch während die langen Locken der Jüngeren wie gebürsteter Flachs leicht silbrig schimmerten, erinnerte Rosas Haar eher an die Farbe eines polierten Kupferkessels. Sie trug es kurz geschnitten, und es lag in sanften Wellen um ihren schmalen Kopf. Ihre Augen strahlten in einem dunklen Braun. Ihre Haut schimmerte ungewöhnlich hell, was Alena allerdings vehement bestritt, weil sie es nicht wahrhaben wollte. Wenn Rosa ihre eigene Haut zum Vergleich heranzog, um die Vorzüge heller Haut zu preisen, dann presste Alena regelmäßig ihren Braunfilter vor die Augen. Es blieb das einzige Thema, bei dem die beiden Frauen zu keiner Einigung kamen.
Rosas schmalgliedrige Hände, denen man nicht ansah, dass sie vor keiner Schmutzarbeit zurückscheuten, hielten jetzt einen kleinen Kuchen, in dessen Mitte eine Kerze montiert war. Den hob sie Alena entgegen. »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Liebes, und willkommen in der Erwachsenenwelt. Ab heute kann dir niemand mehr vorschreiben, was du zu tun und zu lassen hast, nicht einmal ich.«
»Danke, Rosa … was für ein hübscher Kuchen, und wie gut der riecht!« Alena bewunderte den einfachen Dinkelkuchen, der durch die Verzierung mit essbaren Blüten und Blättern ein festliches Gewand bekommen hatte. »Komm, der Tee ist schon fertig«, sagte sie dann und zog Rosa ins Haus.
Während sie gemeinsam den Geburtstagskuchen frühstückten, erzählte Alena, was sie für heute geplant hatte. Von ihrem seltsamen Traum sagte sie nichts. Sie wusste, dass Rosa ihn sehr ernst genommen hätte, vor allem da er wiederholt aufgetreten war, und sie wollte sie nicht beunruhigen. Für ausführliche Gespräche hatten sie jetzt sowieso nicht viel Zeit. Vielleicht ergab sich heute Abend eine Gelegenheit. Rosa bedauerte es zwar, dass sie nicht lange bleiben konnte, aber die Pflicht ging eben vor. Sie wollte zum Eberthof, der am Rande der Stadt neben der alten Bundesstraße lag und zu dem die Wiesen und Felder gehörten, die sich bis zum Waldrand hochzogen. Vor einigen Jahren hatten ein paar junge Leute diesen leer stehenden Bauernhof zur Bewirtschaftung für die Selbstversorgung übernommen. Alenas Eltern halfen damals beim Bau des riesigen Regenwassertanks, der hinter dem Hof in die Erde gegraben worden war. Auch Rosa trug von Anfang an durch ihr Wissen um Pflanzenanbau und Tiere viel dazu bei, dass das Hofprojekt bis jetzt leidlich klappte. Zumindest in den Dingen, die man beeinflussen konnte. Rosa und Alena halfen seither dort täglich abwechselnd bei der Arbeit und erhielten dafür im Gegenzug Milchprodukte vom Hof, Dinkelmehl und was sie sonst selbst nicht erzeugen konnten. Es war ein glückliches Arrangement für alle Beteiligten. Sie blieben mit ihrer kleinen Gruppe jedoch die einzigen, die hier, in dieser süddeutschen Kleinstadt noch versuchten, den Feldern wenigstens ein bisschen Nahrung abzutrotzen. Die Städter blieben der Hilflosigkeit verfallen und fürchteten den Misserfolg und die Gesundheitsgefahren bei der Arbeit im Freien mehr als alles andere. Nur früh morgens stürmten sie die wenigen Lebensmittelläden, deren Regale stets fast leer blieben. Mit hängenden Köpfen kehrten sie dann in ihre Wohnungen zurück, sparten Kalorien, indem sie sich wenig bewegten, und ernährten sich weiter mehr schlecht als recht von den mickrigen Zimmertomaten und den wenigen Kartoffeln, die sie in Eimern und Fässern in den Wohnzimmern zogen.
Rosa brauchte mit dem Fahrrad eine gute Viertelstunde, um bis zum Eberthof zu gelangen. Sie hatte es deshalb eilig, denn draußen wurde es schon wieder brütend heiß, und sie wollte heute Brot backen, wofür sie fast den ganzen Tag einplanen musste.
Nachdem Rosa gegangen war, räumte Alena den Tisch ab und begab sich dann in den Garten zum hauseigenen Brunnen, um Wasser für die Pflanzen zu holen. Sie empfand es als großes Glück, dass sie nicht wie alle anderen auf die städtische Wasserversorgung angewiesen war, die derzeit wieder einmal rationiert wurde. Ja, sie konnte sich reich schätzen, denn immerhin hatte sie durch den Brunnen, der sich unter dem Garten mit einem großen Wasserauffangbecken verband, noch Wasser, sogar in Trinkqualität, und die altmodische Solaranlage auf dem Dach reichte aus, um das ganze Haus mit Strom und Wärme zu versorgen.
Es dauerte eine Weile bis alle Pflanzen in Garten und Haus gegossen waren und Alena sich fertigmachen konnte, um zum Friedhof zu gehen. Heute, an ihrem Geburtstag hatte sie ein besonderes Bedürfnis, das Grab ihrer Eltern zu besuchen. Bevor sie ging überprüfte sie noch einmal alle Räume des Hauses. Die von außen kaum einsehbare Hintertür zum Garten ließ sie offen, für alle Fälle. So konnte Rosa ins Haus gelangen, falls sie vor ihr zurückkam. Alena überlegte kurz, ob sie ihr Fahrrad nehmen sollte, das neben dem Eingang in der Garderoben-Nische stand. Sie entschied sich dagegen und griff nur nach ihrem Strohhut mit der breiten Krempe. Heute wollte sie alles etwas langsamer gestalten als sonst. Als die Eingangstür hinter ihr ins Schloss fiel, tastete sie nach dem Schlüssel um ihren Hals. Er war noch an seiner Kette und das beruhigte sie.
Vor dem Haus wandte sich Alena nach rechts und ging die asphaltierte Straße entlang, die durch die anhaltende Hitze an vielen Stellen tiefe, beulenartig aufgewölbte Risse bekommen hatte. Neben den Bodenöffnungen wuchsen zwischen Steinen und trockener Erde vereinzelt ein paar unverwüstliche Unkräuter. Alena achtet darauf, sie nicht zu zertreten, denn manche davon hatten heilende Kräfte. Auf dem Rückweg würde sie die wenigen Pflanzen zur Aufstockung von Rosas Wildkräuter-Vorrat einsammeln, aus dem die Freundin bei Bedarf immer Gesundheitstees oder Salben herstellte.
Die Rollläden an den Fenstern der Häuser, an denen Alena vorbeikam, waren fast alle geschlossen und sie wusste, dass viele der Wohnungen bereits seit längerem leer standen. Die Bewohner waren entweder durch Hitzekollaps oder an seuchenartig auftretenden Krankheiten verstorben. Alena hatte die meisten von ihnen gekannt, und sie empfand den Anblick ihrer Straße umso trostloser.
Kurz vor der Kreuzung wechselte sie automatisch auf die andere Seite, um den Fußgängerüberweg zu benutzen. Eine reine Gewohnheit, denn seit das landesweite Fahrverbot für private Kraftfahrzeuge erlassen worden war, blieb die Ampel dort wie überall in der Stadt ausgeschaltet.
Alena überquerte die Straße und ging weiter geradeaus, vorbei am Lebensmittelmarkt, vor dem ein großes Schild prangte, auf dem »Geschlossen« stand. Falls der Markt heute Nacht Waren bekommen hatte, so war an diesem Morgen bereits alles wieder verkauft. Die Kunden schienen es jedoch begriffen zu haben, denn Alena begegnete hier niemandem mehr. Selbst der Stadtbahnhof, den sie nur wenige Schritte später überquerte, lag einsam da ― nur eine der gelben Straßenbahnen wartete dort, doch ob sie fahren würde entschied sich wie immer erst mit der Zahl der Fahrgäste. Soweit Alena sehen konnte, saß bis jetzt noch niemand in dieser Bahn. Sie ging weiter durch den kleinen Stadtpark, der sich dem Bahnhof anschloss ― hier sahen sogar die wenigen Wüstenpflanzen erbärmlich aus ― und bog dann links in die Innenstadt. Obwohl hier zwei oder drei Geschäfte geöffnet hatten, waren auch in dieser Straße nur wenige Menschen unterwegs. Niemand wollte derzeit Geschenkartikel oder Kleidungsstücke kaufen. Diese Dinge mussten hintenan gestellt werden, solange es nicht genug zu beißen gab. Alena beobachtete eine ältere Frau, die verzweifelt an der Tür einer Bäckerei rüttelte. Die Jalousie war heruntergelassen, sodass man nicht ins Innere des Ladens blicken konnte, genauso wenig wie bei der schräg gegenüberliegenden Metzgerei. Es schien offensichtlich, heute gab es weder Fleisch noch Brot. Vielleicht morgen wieder oder übermorgen oder in ein paar Tagen ― wenn man frühzeitig genug aus den Federn fand. Alena bedauerte die Frau aus tiefstem Herzen, die nicht begreifen wollte, dass die Tür verschlossen blieb. Sie sah elend mager aus. Neben ihrem Mitgefühl spürte Alena aber auch Ärger auf all diese Leute, die trotz ihrer Not so lethargisch blieben. Es gab noch brachliegende Felder, die für die Dinkelkultur genutzt werden konnten. Klar, das bedeutete viel Aufwand: Sonnensegel mussten gesetzt werden; Wassergräben wie bei den alten Ägyptern angelegt und weitere Wasserauffangbecken gegraben werden, und vieles, das früher mithilfe von Maschinen erledigt wurde, wie das Säen, Ernten und Umgraben, blieb wegen der Klimaverordnungen ausschließlich fleißigen Händen überlassen. Und ob all die Mühen am Ende genügend Ertrag brachten, um über den Winter zu kommen, blieb stets bis zuletzt ungewiss. Aber die Angst der Städter vor dem Risiko war in dieser Krisenzeit ein denkbar schlechter Grund, die Feldarbeit abzulehnen. In Bezug auf die Hitzegefahren konnte man schließlich Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, und im Freien arbeiteten sie sowieso hauptsächlich morgens und abends. Außerdem gewöhnte man sich selbst an die derzeitigen Temperaturen zwischen zweiundvierzig und sechsundvierzig Grad. Man musste es, wenn man nicht verhungern wollte. Alena seufzte. Vielleicht rafften sich die Städter ja im nächsten Frühjahr auf, die Zeiten wurden nicht besser. Aber für die Frau von eben war es dann vielleicht schon zu spät.
Alena erreichte das Ende der Straße, bog jetzt nach rechts ab und überquerte nach einigen Metern auf der Rathausbrücke den Fluss, der die Stadt in zwei Hälften teilte. Sie sah zwei Jungs, die über die Mauerbegrenzung geklettert waren, um von dem schlammigen Wasser, das noch in dem kleinen Stadtflüsschen plätscherte, zu trinken. Am liebsten hätte sie ihnen zugerufen: »Tut das nicht … das Wasser macht euch krank.« Aber es war schon zu spät, und selbst wenn sie den Kindern ihre eigene kleine Flasche mit gesundem Wasser gegeben hätte, wären sie danach doch wieder an das Ufer gegangen, um dort weiterzutrinken. Sie hatte es schon oft so erlebt.
Alena ging jetzt ein wenig schneller, nicht nur, um die bedauernswerten Kinder nicht mehr sehen zu müssen, sondern auch, weil sie sich nach der kleinen Bank unter der Hängebirke sehnte, die das Grab der Eltern beschattete. Vielleicht hätte sie doch lieber das Fahrrad nehmen sollen. Die Sonne brannte ihr bereits heiß auf den Kopf, ihre Wangen glühten, und der Fahrtwind wäre angenehm gewesen. Im Geist markierte sie die Abschnitte ihres Wegs. Jetzt ging sie an der Herz-Jesu-Kirche vorbei, deren bunte Glasfenster im Licht funkelten. Eine Weile später erreichte sie das alte Kasernengelände, das schon lange eine private Nutzung gefunden hatte. Jetzt war es nicht mehr weit bis zur Gärtnerei vor dem Friedhof, die aufgrund des allgemeinen Wassermangels auf anspruchslose Wüstenpflanzen umgestiegen war, um wenigstens etwas verkaufen zu können. Alena atmete auf, als sie das schmiedeeiserne Tor sah, das den Eingang zum Friedhof markierte. Es stand offen, und sie ging hinein. Der erste Weg rechts vom Hauptweg führte zum Grab ihrer Eltern. Es lag direkt vor der Friedhofsmauer und war nicht bepflanzt, sondern mit einer schwarzen Marmorplatte abgedeckt, auf der die Namen und Jahreszahlen eingraviert waren:
Selina Bruck 2060 – 2098
Roman Bruck 2058 – 2098
Seitlich des Grabes wuchs die Hängebirke, unter der eine kleine Bank stand. Dort, im Schatten der überhängenden Zweige setzte sich Alena hin. Sie nahm ihren Sonnenhut ab, strich das verschwitzte Haar zurück, und holte aus der kleinen Tasche, die sie mitgenommen hatte, ihre Flasche Wasser. Gierig trank sie daraus. Dann prostete sie in die Luft. »Hi, Mum, Dad … heut ist mein achtzehnter Geburtstag. Den wollten wir ganz groß feiern, wisst ihr noch?« Alenas Augen wurden feucht, aber sie unterdrückte die Tränen.
Eigentlich verstand sie bis heute noch nicht, wie der Unfall, der ihren Eltern das Leben kostete, im letzten September