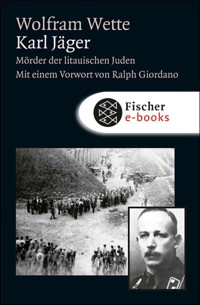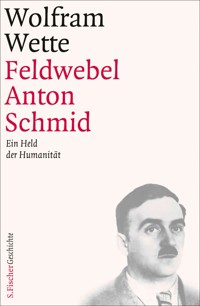
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dem einfachen Feldwebel Anton Schmid aus Wien gelang es, während der deutschen Besatzung in Litauen Hunderte jüdische Menschen zu retten. Wie Oskar Schindler requirierte er die Gejagten für vermeintlich dringende Arbeiten, verschaffte ihnen Papiere und bewahrte sie so vor dem Tod. Er riskierte es sogar, Internierte aus dem Ghetto von Wilna herauszubekommen – wofür er mit dem Leben bezahlte. Er flog auf, wurde vor ein Kriegsgericht gestellt und im April 1942 hingerichtet. Wolfram Wette erzählt erstmals die ganze Geschichte dieses weitgehend unbekannten Helden und beleuchtet den bis heute gehemmten Umgang mit seinem Andenken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Wolfram Wette
Feldwebel Anton Schmid
Ein Held der Humanität
Über dieses Buch
Dem einfachen Feldwebel Anton Schmid aus Wien gelang es, während der deutschen Besatzung in Litauen Hunderte jüdische Menschen zu retten. Wie Oskar Schindler requirierte er die Gejagten für vermeintlich dringende Arbeiten, verschaffte ihnen Papiere und bewahrte sie so vor dem Tod. Er riskierte es sogar, Internierte aus dem Ghetto von Wilna herauszubekommen – wofür er mit dem Leben bezahlte. Er flog auf, wurde vor ein Kriegsgericht gestellt und im April 1942 hingerichtet. Wolfram Wette erzählt erstmals die ganze Geschichte dieses weitgehend unbekannten Helden und beleuchtet den bis heute gehemmten Umgang mit seinem Andenken.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Die Zeit des Nationalsozialismus
Eine Buchreihe
Begründet und bis 2011 herausgegeben von Walter H. Pehle
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2013
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402583-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Statt eines Vorworts
Von Wien in den Hexenkessel von Wilna
Ein guter Mensch aus Wien
Anton Schmid im Krieg 1939–1941
Verfolgung und Ermordung der Wilnaer Juden in der zweiten Jahreshälfte 1941
Konfrontation mit dem mörderischen Geschehen im »Jerusalem des Ostens«
Das offene Geheimnis Ponary (Paneriai)
Rettung von Juden in Wilna
Die Rettung des Gefreiten Max Huppert und der Sekretärin Luisa Emaitisaite
Der barmherzige protestantische Kriegspfarrer Friedrich Huck
Anton Schmid rettet Hermann und Anita Adler
Rettung durch Arbeit in der Versprengten-Sammelstelle in Wilna
Fluchthilfe für mehr als 300 Juden in andere Städte
Unterstützung des jüdischen Widerstandes
Aufkeimender jüdischer Widerstand
Wie Anton Schmid den jüdischen Widerstand unterstützte
Die Frage der Waffen
Verhaftung, Todesurteil, Erschießung
Gehorsame Soldaten und ungehorsame Retter
Andere Retter in Wilna: Karl Plagge, Alfons von Derschwanden, Oskar Schönbrunner und Litauer
Eine Parallelgeschichte: Der »Judenschmuggel« der Obergefreiten Friedrich Rath und Friedrich Winking
Wehrmachtsoldaten, Polizisten und Judenmorde
Das Risiko
Von der Verdrängung zur ehrenden Erinnerung
Angefeindet: Witwe Stefanie und Tochter Gertrude Schmid
Nach 1945: Die nachhaltige Aufklärungsarbeit von Hermann Adler
Die lange Verdrängung des Rettungswiderstandes in Deutschland
Erinnerung an und Ehrungen von Anton Schmid in Israel, Österreich und Litauen
Eine Botschaft für die Zukunft
Feldwebel-Schmid-Kaserne – ein Traditionsfanal in Deutschland
Von Rendsburg über Munster nach Todendorf
Über anständige Christen, »Parteiheinis« und die Judenmorde
Anton Schmid – ein Held der Humanität
Anhang
Zwei Briefe von Anton Schmid an seine Frau
Quellen- und Literaturverzeichnis
Archivalien
Forschungsliteratur über Anton Schmid und Würdigungen
Berichte jüdischer Holocaust-Überlebender aus Wilna/Litauen
Krieg, Holocaust, Widerstand, Retter
Bildnachweis
Danksagung
Personenregister
Sachregister
In memoriam Arno Lustiger
* 7. Mai 1924 in Będzin, † 15. Mai 2012 in Frankfurt am Main
Holocaust-Überlebender und Historiker des Rettungswiderstandes
Statt eines Vorworts
Für die verfolgten Juden in Wilna/Litauen stellte der Name des Wehrmacht-Feldwebels Anton Schmid eine Verheißung dar. Der Unteroffizier aus Wien war für die Todgeweihten, die an der Existenz eines gerechten und gütigen Gottes zweifelten, die personifizierte Verkörperung ihrer Hoffnung auf Rettung vor der Vernichtung. So wundert es nicht, dass Schmid von Holocaust-Überlebenden in der rückblickenden Erinnerung verklärt wurde. Sie sagten über ihn: »Für uns war er so etwas wie ein Heiliger!«[1] Gemeint war damit, dass Schmid in einer ganz außergewöhnlichen, ja einzigartigen Weise das Gute verkörperte. Simon Wiesenthal, dem nach dem Kriege solches berichtet wurde, übernahm die ehrende Charakterisierung auch selbst. In einem Brief an den deutschen Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping aus dem Jahre 2000 schrieb er: »Seit Jahrzehnten ist für mich der Name Feldwebel Anton Schmid so etwas wie ein Heiliger.«[2] Übereinstimmend nennen die Überlebenden die »Herzensgüte« Anton Schmids als sein ausschlaggebendes Handlungsmotiv. Seine gelebte Humanität war es, die ihn von anderen unterschied.
Arno Lustiger, der aus der polnischen Stadt Będzin stammende Überlebende mehrerer Vernichtungslager und Todesmärsche, später ein prominenter Historiker des jüdischen Widerstandes[3], sah in Feldwebel Anton Schmid einen der herausragenden »Helden des Widerstandes« gegen den Holocaust. Nach seiner Überzeugung stellt Schmids Vermächtnis ein moralisches Kapital dar, dessen sich die deutsche und die österreichische Gesellschaft noch immer viel zu wenig bewusst geworden ist. Seinem letzten großen Werk[4] mit dem Titel »Rettungswiderstand« stellt Lustiger die folgende Würdigung voran: »Dieses Buch widme ich dem Feldwebel Anton Schmid, Marianne Cohn und allen anderen Helden des Rettungswiderstandes in Europa, die ihre Aktionen mit dem Leben bezahlten. Ihrer zu gedenken ist heilige Pflicht.«[5]
Der vormalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Paul Spiegel, nutzte seine Rede zum Feierlichen Gelöbnis von Rekruten der Bundeswehr am 20. Juli 2001 dazu, nicht nur an den Offizierswiderstand des 20. Juli 1944 zu erinnern, sondern auch an einen »anderen Widerstandskämpfer«, der in Wilna viele Juden gerettet hatte. Er würdigte ihn in folgender Weise: »Männer wie Anton Schmid sind die eigentlichen Helden der deutschen Militärgeschichte im vergangenen Jahrhundert. Denn sie wagten alles – um Anderer willen.« Spiegel fügte hinzu: »Sie waren Menschen mit Mut und Zivilcourage, bereit, alles zu wagen und auch einem übermächtigen Bösen zu trotzen. Deshalb gehören sie nicht nur zur Vergangenheit Deutschlands, sondern auch zu unserer Zukunft.«[6]
Andere Historiker betrachten Schmid als die »Ikone des Rettungswiderstandes«, weil er seine humane Hilfsbereitschaft für verfolgte Juden so konsequent wie kaum ein anderer praktizierte, den Einsatz des eigenen Lebens eingeschlossen. Jakob Knab, Sprecher der »Initiative gegen falsche Glorie«, die sich für ein demokratisches Traditionsverständnis in der Bundeswehr einsetzt, nannte Feldwebel Anton Schmid den wahrscheinlich »edelsten« aller Wehrmachtsoldaten.[7]
Tobijas Jafetas, hochbetagter Holocaust-Überlebender aus Wilna, fasste seine Hochachtung für Anton Schmid in die Worte: »Es war ein sehr anständiger Mensch. Er hat gesehen, wie man selektiert hat. Er hat protestiert.«[8] Und Hannah Arendt, die jüdische Gelehrte von Weltrang, formulierte angesichts eines Zeitzeugenberichts über die Rettungstaten des Feldwebels Schmid den bis heute aufwühlenden Gedanken: Wie vollkommen anders alles heute wäre, wenn es mehr solche Geschichten zu erzählen gäbe.[9]
In diesem Buch wird der Versuch unternommen, die Geschichte des Feldwebels Anton Schmid aus Wien nachzuzeichnen. Für den Historiker ist das ein äußerst schwieriges Unterfangen, da es für alle Lebensphasen dieses außergewöhnlichen Mannes an primären Quellen mangelt. Nicht umsonst beginnt Arno Lustiger seine Kurzbiographie von Anton Schmid mit dem Satz: »Über Anton Schmid zu berichten, zählt aufgrund der schwierigen Quellenlage zu den sehr problematischen Aufgaben der historischen Forschung.«[10]
Anton Schmid, geboren am 9. Januar 1900 in Wien, hingerichtet am 13. April 1942 in Wilna/Litauen.
Allgemein können wir beobachten, dass der »kleine Mann« in Uniform in der Regel kaum schriftliche Zeugnisse hinterlassen hat, die es dem Historiker ermöglichen, fundierte biographische Forschungen anzustellen.[11] Zwar hat die – seit den 1990er Jahren aufblühende – Beschäftigung mit den Feldpostbriefen und den Fotografien einfacher Soldaten gezeigt, dass sich bei einer gründlichen Auseinandersetzung mit diesen alltagsgeschichtlichen Quellen doch mehr über ihr Kriegserlebnis ermitteln lässt, als ursprünglich angenommen wurde.[12] Mit dem schriftstellerisch begabten Wehrmachtsoldaten Willy Reese haben wir sogar den Fall eines Frontsoldaten ohne Offiziersrang vor uns, der eine hochwertige literarische Darstellung der Kriegswirklichkeit hinterlassen hat, die posthum veröffentlicht wurde und entsprechende Aufmerksamkeit fand.[13] Aber eine solche Leistung hat großen Seltenheitswert.
Im Falle des Feldwebels Anton Schmid liegen die Dinge anders: Schriftliche Vorgänge entstanden bei seinen Rettungsaktionen nicht. Hinzu kommt, dass dieser Mann weder ein Tagebuch führte noch ein großer Freund des Briefeschreibens war. Jedenfalls sind nur zwei – allerdings sehr aufschlussreiche – Abschiedsbriefe von Anton Schmid an seine Familie überliefert, datiert vom 9. und vom 13. April 1942. Weitere schriftliche Zeugnisse von ihm, die uns über seine Motive und Überlegungen näheren Aufschluss geben könnten, sind nicht erhalten geblieben.[14] Zu diesem Bild passt die Mitteilung, dass Anton Schmid, der Handwerker und Kaufmann, wenig las und sich für das größere militärische und politische Geschehen um ihn herum anscheinend nur wenig interessierte. Die Informationen, die er benötigte, um das Geschehen in seinem nahen Umfeld zu verstehen, verschaffte er sich, indem er nicht wegschaute, sondern Gesprächskontakte zu Menschen aus seinem persönlichen Umfeld suchte, nämlich zu Wehrmachtsoldaten, Polizisten der SS, zu Angehörigen der deutschen Zivilverwaltung, verfolgten Juden und zu den russischen Kriegsgefangenen, die in seiner Dienststelle Zwangsarbeit leisteten.
Wer in der NS-Zeit in irgendeiner Weise Widerstand leistete, musste äußerst vorsichtig und verschwiegen handeln. Das galt für die widerständigen Offiziere des 20. Juli 1944 ebenso wie für die Deserteure, die Kriegs»verräter« oder die Judenretter. Für sie alle galt das Gesetz, unentdeckt zu bleiben und möglichst keinerlei Spuren zu hinterlassen.[15] In einer Zeit, in der das nationalsozialistische Regime die Vernichtung der europäischen Juden ins Werk setzte, war Judenhilfe in jenen Regionen Europas, in denen Krieg geführt wurde oder in denen eine deutsche Besatzungsherrschaft etabliert war, ein todeswürdiges Verbrechen.[16]
In den militärischen Befehlen, die den deutschen Soldaten vor dem Beginn des Russlandkrieges bekanntgemacht wurden – den heute sogenannten »verbrecherischen Befehlen« –, figurierten die Juden als Feinde im militärischen Sinne, die genau wie die Soldaten der Roten Armee mit Waffengewalt bekämpft und getötet werden sollten. Mit diesen Befehlen verfolgten Hitler und die Wehrmachtführung das Ziel, bei den Soldaten und Polizisten jene natürlichen Hemmschwellen abzubauen, die der Ermordung wehrloser Zivilisten entgegenstanden.
Historiker halten es in der Regel für aussichtslos, bei einer so extrem schmalen Quellenbasis, wie sie bei Feldwebel Schmid gegeben ist, eine biographische Arbeit überhaupt erst zu beginnen. Der Fall des Widerstandskämpfers Georg Elser, der am 8. November 1939 Hitler im Alleingang durch ein sorgfältig vorbereitetes Sprengstoffattentat töten und damit den Zweiten Weltkrieg verhindern wollte, ist ähnlich gelagert.[17] Auch er hat keine persönlichen Quellen hinterlassen. Gleichwohl haben gleich mehrere Historiker den Versuch unternommen, sich auf der Basis anderer Quellen, insbesondere der Vernehmungsprotokolle der Gestapo, Elser biographisch anzunähern.[18] Neuerdings gibt es ein Rundfunkfeature, in dem Elser nicht selbst zu Wort kommt und seine Stimme symbolisch durch Zitherklänge ersetzt wird.[19]
Wie im Falle des Hitler-Attentäters Georg Elser, so besteht auch bei Feldwebel Anton Schmid das gesteigerte Interesse der Nachgeborenen an der Lebensgeschichte eines einfachen Mannes aus dem Volke, der unter den extremen Bedingungen des Krieges und des Holocausts außergewöhnliche humane Rettungstaten vollbrachte. Wir wollen wissen, was diesen Mann bewegt hat, wie er dazu kam, die Signale, die ihm sein Gewissen gab, höher einzuschätzen als die militärische Befehlslage, und wie er das Risiko seiner Hilfeleistungen und Rettungshandlungen einschätzte. Daher greifen wir begierig nach anderen Quellen, in denen wir etwas über den Menschen Anton Schmid und seine mutigen Taten in Erfahrung bringen können.
Aber wo finden wir diese anderen Quellen? Man mag zunächst an Schmids Kriegskameraden denken, die mit ihm zusammen in Wilna stationiert waren, die aber, anders als er selbst, den Krieg überlebten und hernach vielleicht der Witwe Schmids oder einem interessierten Historiker etwas von ihren Erlebnissen mit Anton Schmid mitteilten. Tatsächlich hat sich jedoch nach 1945 kein einziger Wehrmachtsoldat oder Polizist zu erkennen gegeben, der etwas über Anton Schmids Dienstzeit im deutsch besetzten Wilna zu berichten gewusst hätte. Die verfügbaren Informationen stammen ausnahmslos nicht von Angehörigen der Wehrmacht, der deutschen Polizei oder der Zivilverwaltung, sondern ausschließlich von Überlebenden des Holocausts, die 1941/42 in Wilna mit Feldwebel Anton Schmid in Kontakt kamen, seine Hilfsbereitschaft in Anspruch nahmen, von ihm zunächst – zumindest temporär – gerettet wurden und die sich nach seinem Tode der Vernichtungsmaschinerie durch Flucht oder Untertauchen entziehen konnten und daher den Krieg überlebt haben.
In erster Linie ist hier der jüdische Schriftsteller Hermann Adler zu nennen, der sich zusammen mit seiner Frau Anita mehrere Monate lang in Schmids Wilnaer Dienstwohnung verstecken konnte und sich in dieser Zeit mit dem österreichischen Feldwebel anfreundete. Hermann Adler ist derjenige Augenzeuge und Mitstreiter Schmids, der am genauesten über ihn berichten konnte und der es sich nach dem Kriege zu seiner Lebensaufgabe machte, der interessierten Welt von den außergewöhnlichen Rettungstaten dieses unbekannten Feldwebels der Wehrmacht zu berichten.[20] Ohne die von ihm überlieferten Informationen hätte dieses Buch nicht geschrieben werden können.
Außer Hermann und Anita Adler haben auch der von Schmid gerettete jüdische Verfolgte Huppert sowie die beiden Frauen Luisa Emaitisaite[21] und Maria (Nachname unbekannt), die er als Arbeitskräfte in seiner Dienststelle beschäftigte und damit schützte, den Krieg überlebt. Sie haben jedoch keine Zeugenberichte hinterlassen und sind zu Lebzeiten auch nicht von Historikern befragt worden. Andere Überlebende des Wilnaer Ghettos haben dem Wiener Nazijäger Simon Wiesenthal auf dessen Befragen hin mündlich berichtet, was sie über Anton Schmid wussten.
Weitere Nachkriegsinformationen stammen von Mitgliedern des jüdischen Untergrundes in Wilna, also jener Widerstandsgruppen, die sich zum Jahresende 1941 hin allmählich zu formieren begannen. Hier sind insbesondere zu nennen Abba Kovner, der Partisanenführer, die Widerstandskämpferin Chaika Grossman und der Schriftsteller Avraham Sutzkever. Einige dieser Zeugenberichte sind in der Mappe Anton Schmid im Archiv der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem gesammelt, in welcher zugleich die Ehrung dieses Feldwebels im Jahre 1967 als »Gerechter unter den Völkern« dokumentiert wird.[22]
Ehrung Anton Schmids als Gerechter unter den Völkern. Urkunde der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem vom 1. Februar 1967.
Die militärischen Quellen, die erhellen könnten, wie das machtpolitische Umfeld aussah, das Anton Schmid im Jahre 1941 in Wilna vorfand, sind entweder vernichtet oder wenig aussagekräftig. Selbst das Todesurteil des Kriegsgerichts der Feldkommandantur Wilna konnte trotz intensiver Suche nicht aufgefunden werden. Es muss als verschollen gelten.
Über den Feldwebel Anton Schmid zu forschen und zu schreiben, bedeutet angesichts der schlechten Quellenlage also ein ungewöhnliches Risiko, gilt es doch, aus vielen kleinen Steinen ein Mosaik zusammenzustellen, das gleichwohl nur die Umrisse dieses Menschen zu erkennen gibt und manche blinde Stelle behält.
Nach 1945 wurde der Name Anton Schmid unter den Juden in aller Welt wegen seiner Rettungstaten bekannt und gerühmt. Mit dieser Kommunikation ging eine ausschweifende Legendenbildung einher. Sie ließ diesen Retter und seine Taten einerseits in hellstem Licht erstrahlen; auf der anderen Seite wurden die konkreten Sachverhalte dadurch eher verdunkelt als erhellt. Hierzu einige Beispiele:
Simon Wiesenthal jagte nach Kriegsende nicht nur Adolf Eichmann und andere NS-Verbrecher, sondern er sammelte in seinem Wiener Büro auch Informationen über den Judenretter Anton Schmid, dessen Name ihm im Zusammenhang mit seiner Suche nach dem aus Österreich stammenden Mörder der Wilnaer Juden, Franz Murer, bekannt wurde.[23] Wiesenthal konnte etliche Überlebende des Wilnaer Ghettos, die Schmid ihre Rettung verdankten, ausfindig machen und von ihnen erfahren, welche Hilfe Schmid für die verfolgten Juden dort geleistet hatte. Er habe diese Hilfe, so wurde ihm berichtet, »als seine Christenpflicht« angesehen. Agiert habe er als »eine geheime Ein-Mann-Hilfsorganisation«. Weiterhin gibt Wiesenthal die folgenden Erzählungen seiner Gesprächspartner wieder: »Unter höchster Lebensgefahr schlich er sich ins Ghetto, um verhungernden Juden Lebensmittel zu bringen. In seinen Taschen hatte er Flaschenmilch für Säuglinge versteckt. Er wusste, dass sich zahlreiche Juden in den Wäldern versteckt hielten; zwischen ihnen und den Angehörigen im Ghetto vermittelte er Nachrichten, er besorgte Brot und Medikamente, ja er entwendete sogar Waffen der Wehrmacht, um sie jüdischen Widerstandskämpfern zu geben.«[24] Das alles habe er getan, so berichtete ihm eine der Überlebenden, »ohne dafür Dank zu erwarten«. »Er tat es aus Herzensgüte. Für uns im Ghetto war der schlanke, ruhige Mann in seiner Feldwebeluniform so etwas wie ein Heiliger.«[25]
Einige der Informationen, die Wiesenthal in seinem Buch »Doch die Mörder leben« wiedergibt, haben mit der Wirklichkeit nur wenig zu tun. Schmid selbst hatte keine Möglichkeit, das Wilnaer Ghetto zu betreten, da hierzu eine Sondergenehmigung des Stadtkommissariats erforderlich war, über die er nicht verfügte. Lebensmittel und Medikamente konnte er also nicht persönlich ins Ghetto schmuggeln, sondern allenfalls den in seiner Dienststelle beschäftigten jüdischen Zwangsarbeitern mitgeben, wenn sie abends, nach getaner Arbeit, wieder ins Ghetto zurückkehrten. Bewaffnete jüdische Widerstandsorganisationen, die sich in den Wäldern des Wilnaer Umlandes versteckten, entstanden erst seit dem Frühjahr 1942, also nach der Verhaftung und Ermordung Schmids. Dass er aus Wehrmachtsbeständen Waffen stahl, um sie an den jüdischen Widerstand weiterzugeben, wird durch keine seriöse Quelle bestätigt, auch nicht durch die Erinnerungsberichte jüdischer Partisanenführer.[26] Schmid führte seine Rettungshandlungen auch nicht alleine aus, sondern er hatte eine kleine Anzahl von Mitwissern, denen er offenbar vertraute, nämlich seine Kraftfahrer, die in seiner Dienststelle arbeitenden Frauen Luisa und Maria sowie das jüdische Ehepaar Anita und Hermann Adler, das die Verbindungen zwischen ihm und den leitenden Personen des jüdischen Widerstandes im Ghetto herstellte.
Ein anderer Augenzeuge machte den Feldwebel aus Wien zu einem politisch denkenden Mann, der anscheinend über einen tiefen Einblick in die Struktur des nationalsozialistischen Herrschaftssystems verfügte. Gemeint ist der Wilnaer Partisanenführer Abba Kovner, der später nach Israel fliehen konnte und dort als Präsident des Schriftstellerverbandes wirkte. Im Jerusalemer Eichmann-Prozess im Jahre 1961 sagte Kovner unter anderem aus, Anton Schmid habe am Jahresende 1941 darauf hingewiesen, dass es einen gewissen Eichmann gäbe, der die ganze Judenvernichtung organisierte: »Nur Eichmann, dieser Hund, ist an allem schuld!« Hermann Adler wandte hiergegen ein, dass Schmid damals unmöglich den Namen Eichmann gekannt haben kann, da dieser Ende 1941 noch ein weithin unbekannter Beamter des Reichssicherheitshauptamts war.[27] Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass sich Schmid an die Jahre 1938/39 erinnerte, als Adolf Eichmann nach der Besetzung Österreichs als SD-Führer in Wien die »Zentralstelle für jüdische Auswanderung« aufbaute und dafür sorgte, dass in 18 Monaten etwa 150000 Juden Österreich verließen, und dass er auf irgendeinem Weg erfahren hatte, dass Eichmann seit Beginn des Russlandkrieges für die Organisation der Judendeportationen aus ganz Europa verantwortlich war.[28]
In das Reich der Legenden gehört die Behauptung, dass Schmid mit einem der zwei Wehrmacht-Lastkraftwagen, die ihm zur Verfügung standen, und selbst ausgestellten Fahrbefehlen mehrere führende Mitglieder des jüdischen Widerstandes in die weit entfernte polnische Hauptstadt Warschau gebracht habe, und damit in die Vorbereitung des späteren Warschauer Aufstandes eingegriffen habe.[29] Tatsächlich lag eine die Landesgrenzen überschreitende Dienstfahrt nach Warschau außerhalb der Möglichkeiten des kleinen Feldwebels. Er transportierte Wilnaer Juden, die dem Widerstand angehörten, nach Lida, Grodno und Białystok, von wo aus sie dann selbst ihren Weg nach Warschau suchen mussten.
Eine englischsprachige Zeitung machte Anton Schmid zum »Märtyrer des Todeszuges«, der im Alleingang aus Viehwaggons jüdische Männer, Frauen und Kinder geholt habe, welche für die Gaskammern bestimmt gewesen seien. Als »Aufseher« habe Schmid den Juden geholfen, in die dichten Wälder um Wilna zu fliehen, und er habe diese dort laufend mit Nahrungsmitteln versorgt.[30] Auch diese Geschichte ist der Phantasie des Verfassers entsprungen.
Mehr als andere hat der anonyme Verfasser des Berichts »Das Epos von Feldwebel Anton Schmidt« (sic!) die Legendenbildung beflügelt.[31] Denn die beiden verdienstvollen Historiker Léon Poliakov und Josef Wulf waren in diesem Falle so leichtsinnig, dieses Epos in ihr 1956 erschienenes Werk »Das Dritte Reich und seine Diener« aufzunehmen und ihm damit zu einer großen Leserschaft zu verhelfen. Das Epos enthält unter anderem die Schmid desavouierende Behauptung, er habe für eine Rettung 200 bis 4000 Dollar und einige tausend Rubel verlangt.[32]
Hermann Adler, Augenzeuge des Mordgeschehens in Wilna und Freund von Anton Schmid, der auch in dieser Angelegenheit als der verlässlichste Berichterstatter gelten kann, hat eine ausführliche Gegendarstellung zu diesem Epos verfasst.[33] Sie enthält viele wichtige Informationen. Unter anderem bestätigte er hier einmal mehr, dass Schmid das Ghetto nicht betreten konnte und dass er den widerständigen Juden keine Waffen lieferte. Adler nutzte den Anlass auch, um generell klarzustellen, dass Anton Schmid »aus reinem Idealismus« gehandelt und »nicht für Geld gerettet« habe.[34] Tatsächlich hatte die deutsche Besatzungsmacht den russischen Rubel für wertlos erklärt. Die Fehlinformation, dass Schmid für seine Rettungsaktionen Geld genommen habe, hatte insoweit Folgen, als sie anscheinend zu einer Verzögerung der Ehrung Schmids durch Yad Vashem führte.[36] Nicht klären lässt sich bislang die Frage, wie Schmid die Verpflegung seiner Flüchtlinge finanzierte. Möglicherweise konnte er Mittel aus dem Ghettoschatz benutzen, den die jungen Widerständler vertrauensvoll in seiner Dienstwohnung versteckten.
»Anton Schmid war eine Art Robin Hood des Wilnaer Ghettos.«[37] Auch diese Charakterisierung durch Eric Silver, der mit einem Buch über »Stille Helden« hervortrat, die Juden vor den Nazis retteten, ist unzutreffend. Schmid war kein Sozialrebell, der den Reichen nahm und den Armen gab, sondern ein Retter aus Menschlichkeit, den das Geld nicht interessierte. Silver schreibt weiter und charakterisiert damit nicht zuletzt auch seine eigenen Darlegungen: »Um ihn ranken sich Legenden. Überlebende gaben an, dass er jiddisch oder hebräisch mit ihnen gesprochen habe, Kibbuzim in Palästina besucht, mit Kriminellen verkehrt beziehungsweise nicht verkehrt habe.«[38]
Ein anderer Fabulierer versuchte Anton Schmid zum Kommunisten zu machen, der in Wilna mit dem kommunistischen Untergrund zusammengearbeitet habe. Der Historiker Stanislaw Okecki, Fachmann für die Geschichte von Österreichern in der polnischen Widerstandsbewegung, setzte die Behauptung in die Welt, Anton Schmid sei »Angehöriger einer Gruppe von Deutschen und Österreichern« gewesen, die in Białystok in einer »Antifaschistischen Organisation« wirkten. In einer Versammlung habe Schmid die unvermeidliche Niederlage Hitlers vorausgesagt und seiner – von kommunistischen Ideen inspirierten – Hoffnung Ausdruck verliehen, »dass wir nach dem Krieg mit gemeinsamen Kräften eine neue Welt aufbauen würden, in der es keinen Rassenhass gibt und alle Menschen, ökonomisch gleichgestellt, eine sozialistische Gesellschaft aufbauen«.[39] So schön diese politischen Visionen sein mögen: Belastbar belegen lassen sie sich nicht. In der Zeit des Kalten Krieges waren sie allenfalls geeignet, den Retter Anton Schmid auf die Feindseite zu stellen und ihn damit zu desavouieren.
Was sagen uns diese Legenden über den Feldwebel Anton Schmid? Sie zeigen, wie schon der österreichische Widerstandsforscher Siegwald Ganglmair richtig erkannt hat, »dass die Fantasie dort am stärksten wuchert, wo ihr durch Fakten keine Grenzen gesetzt sind«.[40] Einige Autoren wollen den Retter entwerten, indem sie ihm niedrige Motive oder eine negativ codierte politische Ausrichtung unterstellen oder ihn zum Landesverräter stempeln, der mit den Juden kollaboriert habe. Etliche Überlebende und viele andere Wohlmeinende benutzen den Feldwebel als eine Projektionsfläche. Sie stilisieren ihn zum überlebensgroßen Prototyp des guten Menschen, der einsam, mutig und aus humaner Überzeugung in einer mörderischen Umwelt die Fahne der Humanität hochgehalten und auf alle nur erdenkliche Weise den verfolgten Juden geholfen hat. Die Milchflasche für verhungernde Kinder und die Waffen für den jüdischen Widerstand stehen für diese idealisierende Verklärung.
Die Aufgabe des Historikers besteht auch hier darin, hinter die Legenden zu blicken und anhand des verfügbaren Quellenmaterials zu prüfen, was Anton Schmid tatsächlich getan hat. Dieses genaue Hinsehen verringert nicht etwa die Hochachtung vor seinen bewundernswerten humanitären Taten, sondern macht sie nachvollziehbarer und damit für die heute lebenden Menschen anschlussfähiger. Mit einem anderen Bild ausgedrückt: Je höher der Sockel für den Helden wird, desto weiter wird die Entfernung des Betrachters. Es kommt jedoch darauf an, die Distanz zwischen Held und Betrachter möglichst gering zu halten, damit die Nachgeborenen erkennen können, dass es selbst unter den extremen Bedingungen, die Anton Schmid 1941/42 in Wilna vorfand, Handlungsspielräume für humanes Handeln gegeben hat.
Fußnoten
[1]
Wiesenthal, Mörder, S. 328.
[2]
Den an ihn gerichteten Brief Wiesenthals zitierte Scharping in seiner Rede anlässlich der Umbenennung der Rüdel-Kaserne in Feldwebel-Schmid-Kaserne am 8. 5.2000. Zit. nach: Reader Sicherheitspolitik. Leitgedanken für den militärischen Führer. Ergänzungslieferung 7/00. II. Grundlagen des militärischen Dienstes. 5. Tradition der Bundeswehr. Thema: Beispielgebende Vorbilder. Hrsg. vom Bundesministerium der Verteidigung. Vollständiger Text: www.bundeswehr.de/index_.html.
[3]
Zur Vita Lustigers siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Arno_Lustiger.
[4]
Lustiger wurde am 17. 5. 1924 in Be˛dzin/Polen geboren und starb am 15. 5. 2012 in Frankfurt/Main.
[5]
Lustiger, Rettungswiderstand, Widmung gegenüber der Titelei.
[6]
Rede des Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dr.h. c. Paul Spiegel, anlässlich des Feierlichen Gelöbnisses von Rekruten des Wachbataillons des Bundesministeriums der Verteidigung, Berlin, am 20. 7. 2001. Dokumentiert in: http://www.zentralratdjuden.de/de/article/36.html. Ebenso in: http://www.zentralratdjuden.de/de/topic/257.html.
[7]
Jakob Knab in dem TV-Film von Frank Jordan: Bundeswehrkaserne. Ende des Nazi-Namens in Sicht. Bayerisches Fernsehen 20. 4. 2012, Abendschau. Siehe: http://www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/sendungen/abendschau/bad-reichenhall-kaserne-namen100.html.
[8]
Tobijas Jafetas in dem TV-Film von Patrick Baab: Zeitreise. Anton Schmid. Der zweimal verleugnete Held von Wilna. NDR 28. 8. 2012.
[9]
Arendt, Eichmann in Jerusalem, S. 275f.
[10]
Lustiger, Feldwebel Anton Schmid (2002), S. 45.
[11]
Siehe allgemein Wette, Krieg des kleinen Mannes, Einleitungsbeitrag.
[12]
Heer/Naumann, Vernichtungskrieg; Latzel, Deutsche Soldaten.
[13]
Reese, Unmenschlichkeit des Krieges.
[14]
Weitere Briefe sind nach Auskunft der Familie Schmids nicht erhalten geblieben. Siehe Ganglmair, Feldwebel Anton Schmid, Anm. 39.
[15]
Lustiger, Rettungswiderstand.
[16]
Vgl. zu diesem Komplex Dörner, Justiz und Judenmord, S. 249–263.
[17]
Kurzinformation: http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Elser.
[18]
Steinbach/Tuchel, Georg Elser; Ortner, Attentäter; Haasis, Attentäter; Hoch/Gruchmann, Georg Elser.
[19]
Hörspiel Glasl/Reithmaier, Zitherspieler (2012).
[20]
Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Exilarchiv 1933–1945, Frankfurt am Main, Nachlass Hermann Adler EB 2004/28 (NL 193), Unterlagen zu Anton Schmid. Siehe dazu das Quellen- und Literaturverzeichnis (Zeitzeugenberichte) mit den Texten von Hermann Adler.
[21]
Vermutlich ein in der Zeit der Verfolgung angenommener Name der jungen Frau. Der richtige Name ist nicht bekannt.
[22]
Yad Vashem Archive, Jerusalem/Israel, Sammlung »Gerechte der Völker«, Dossier M 31/55 Schmid Anton.
[23]
Vgl. Rabinovici, Der Fall Franz Murer, S. 97–122.
[24]
Wiesenthal, Mörder, Kap. 17: »Einer der sechsunddreißig Gerechten«, S. 328–331, hier: S. 328.
[25]
Ebda., S. 329.
[26]
Zum Beispiel Abraham Sutzkever und Chaika Grossman. Siehe dazu Kap. Die Frage der Waffen.
[27]
Brief Hermann Adlers, Basel, vom 29. 11. 1966 an den ZDF-Produzenten Werner Murawski, Mainz, betr. »Wien-Reise zur Fakten-Überprüfung für das Drehbuch ›Feldwebel Anton Schmid‹«, S. 1. In: Historisches Archiv des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF), Mainz, Akten zum Dokumentarfilm »Feldwebel Schmid«.
[28]
Siehe im Einzelnen: http://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Eichmann.
[29]
Info noch übernommen von Lustiger, Feldwebel Anton Schmid (2002).
[30]
Artikel »Martyr of the Death Train« (ohne Datum und Namen der Zeitung). In: Dokumentationszentrum des Bundes der Verfolgten des Nazi-Regimes, Wien (Simon Wiesenthal), Mappe Anton Schmid.
[31]
Veröffentlicht in Poliakov/Wulf, Das Dritte Reich und seine Diener, S. 523–529.
[32]
Ebda., S. 131. Die Fehlinformation wurde übernommen von Dvorjetski, Anton Schmidt [sic!]. In: Yad Vashem Bulletin, H. 3. Juli 1958, Anton Schmid, S. 19. In einem Brief vom 6. 11. 1966 an den israelischen Generalkonsul Dr. Ofer in Zürich äußerte sich Hermann Adler noch einmal sehr kritisch über den Beitrag von Dvorjetsky im Yad-Vashem-Bulletin. Der Bericht sei »ungefähr zu siebzig Prozent unvollständig oder unrichtig«. Insbesondere sei Schmids Unterstützung des Widerstandes nicht berücksichtigt. Nur er, Adler, und seine Frau, hätten Schmid »privat und aus nächster Nähe« gekannt und könnten daher Schmids Rettungstaten »als Augenzeugen und aus eigener Mitarbeit bezeugen«. In: Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Exilarchiv 1933–1945, Frankfurt am Main, Nachlass Hermann Adler EB 2004/28 (NL 193), Unterlagen zu Anton Schmid, B. 01.
[33]
Hermann Adler: »Klarstellung« zu dem Buchbeitrag »Das Epos von Feldwebel Anton Schmid« (ohne Datum, ca. 1956) in: Poliakov/Wulf: Das Dritte Reich und seine Diener, o.J., S. 523–529. In: Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Exilarchiv 1933–1945, Frankfurt am Main, Nachlass Hermann Adler EB 2004/28 (NL 193), Unterlagen zu Anton Schmid, A.03.07.
[34]
Hermann Adler am 17. 3. 1958 an Dr. Dvorjetski, Tel Aviv. In: Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Exilarchiv 1933–1945, Frankfurt am Main, Nachlass Hermann Adler EB 2004/28 (NL 193), Unterlagen zu Anton Schmid, B.01.
[36]
Silver, Helden, S. 202.
[37]
Ebda., S. 201.
[38]
Ebda.
[39]
Okecki, Teilnahme, S. 19. Weitere Publikationen Obeckis zum Thema listet Ganglmair, Feldwebel Anton Schmid, Anm. 3, auf.
[40]
Ganglmair, Feldwebel Anton Schmid, S. 25–40.
Von Wien in den Hexenkessel von Wilna
Ein guter Mensch aus Wien
Anton Schmid wurde am 9. Januar 1900 in Wien, III. Bezirk, Hauptstraße 77, geboren. Sein Vater Johann, geboren 1876 in Voitelsbrunn, Bezirk Nikolsburg, war Bäckergehilfe, seine Mutter Anna, geborene Thomas, Jahrgang 1876 wie der Vater, stammte ebenfalls aus Nikolsburg in Mähren. Beide Eltern waren katholisch, und so wurde auch der Sohn Anton am 13. Januar 1900 in der römisch-katholischen Kirche St. Rochus und Sebastian im III. Wiener Bezirk katholisch getauft und christlich erzogen.[41]
Über die ersten 39 Lebensjahre Anton Schmids wissen wir nicht allzu viel. Das Österreichische Biographische Lexikon von 1994 bringt in seinem Eintrag zu Anton Schmid nur die folgenden dürren Angaben über sein Leben bis 1939, als der Zweite Weltkrieg begann: Zuerst arbeitete er im Telefonwesen, absolvierte dann eine Lehre als Elektrotechniker.[42] 1928 eröffnete er in Wien, XX. Bezirk, Klosterneuburger Straße 78, ein mittelgroßes, gut eingerichtetes Elektrowarengeschäft, in dem hauptsächlich Radiogeräte verkauft und repariert wurden.[43]
Geburt und Taufe Anton Schmids. Transkription aus dem Taufregister des Wiener Pfarramts St. Rochus und Sebastian.
Die beiden österreichischen Schriftsteller Manfred Wieninger und Christiane M. Pabst stellten intensive biographische Studien über Schmid an. Sie berichten: »Über seine wahrscheinlich eher ärmliche Kindheit in Luegers[44] Wien wissen wir so gut wie nichts. Erst am 17. Oktober 1914 wird Anton Schmid biographisch wieder fassbar. An diesem Tag tritt er nämlich in der Wiener Telegraphenzentralstation seinen Dienst als Telegraphenjunge an. Bei den Postdienststellen 69 […] und 27 […] avanciert der junge Schmid zum Jungboten, dann zum Aushilfsdiener und schließlich zum ständigen Aushilfsdiener. Am 2. Juli 1918 wird er zum Militärdienst in der zweiten Ersatzkompanie des k.k. Schützenregiments Nr. 1 einberufen und macht schwere Kämpfe und schließlich den Rückzug an der italienischen Front mit. Am 29. Dezember 1918 nimmt er wieder seine Arbeit im Postamt 1020 auf, scheidet aber am 13. Juni 1919 durch Verzicht aus dem Postdienst aus. Die Gründe hierfür sind uns unbekannt, ebenso wie der weitere Lebensweg des jungen Schmid bis 1926, als er bei der Wiener Gewerbebehörde und bei der Wirtschaftskammer das freie Gewerbe des ›Handels mit technischen und elektrotechnischen Bedarfsgegenständen‹ anmeldet. Er eröffnet in der Spaungasse in der Arbeitervorstadt Brigittenau ein kleines Geschäft, das er einige Jahre später in die Hauptstraße dieses Bezirks, in die Klosterneuburger Straße, verlegt. Neben elektrischen Kleinteilen verkauft Schmid auch Radios und Fotoapparate, er entwickelt Filme und repariert Radios und elektrische Hausanlagen. Ende der dreißiger Jahre beschäftigt er bereits drei Mitarbeiter, zwei davon sind Juden.«[45]
Hermann Adler macht in seinem Brief aus dem Jahre 1966 die folgende interessante Mitteilung: »Angeblich war Schmid in seiner Jugend in ein jüdisches Mädchen verliebt, dessen Eltern sehr gut zu ihm waren. Diese Familie wanderte dann in das damalige Palästina aus.«[46] Bleibt zu ergänzen: Womit Anton Schmid das jüdische Mädchen aus den Augen verlor. Auf der Suche nach Menschen, die Anton Schmid persönlich kannten, stießen Wieninger und Pabst Ende der 1990er Jahre auf einen alten Herrn, der sich tatsächlich an Schmid erinnerte. Er sei, sagte er, »ein echt’s Weana Kind« gewesen, um ihn dann mit Tränen in den Augen so zu würdigen: »Auf alle Fälle war der Herr Schmid ein herzensguter Kerl, und er war auch ein herzensguter Kerl während der Hitler-Zeit.« Dann erinnerte sich der alte Mann aus Wien an Einzelheiten: »Auf der Ecke Pappenheimgasse/Klosterneuburger Straße war eine Bäckerei einer Jüdin, einer gewissen Tobor. Wie der Hitler da war, ist einer zu der Bäckerei hingegangen, ein so ein Nazi-Bua, und hat die Auslage eingehaut, und der Schmid ist dazugekommen und hat das gesehen und hat ihm ein paar Watschen runtergehaut. Auf das hinauf ist ein Wachmann gekommen – auf dem Pferd, damals hat es ja noch berittene Polizei gegeben – und hat den Schmid mit dem Säbel angreifen wollen, und der Schmid hat den Säbel genommen und hat ihn so abgebogen.« Wieninger und Papst ergänzen die Szene: »Unser Gewährsmann, der das heute noch aus dem Blickwinkel eines damals wohl sehr aufgeregten Halbwüchsigen erzählt, macht mit beiden Armen eine Bewegung, als würde er einen Expander abbiegen: »Auf das hinauf haben sie ihn in die Pappenheimgasse auf das Kommissariat geführt […].«[47]
Schmids Witwe Stefanie sagte einem Gesprächspartner nach dem Kriege, ihr Mann sei vor 1939 in Wien »ein in guten Verhältnissen lebender Mann« gewesen. Durch seine Heiterkeit habe er »viele Freunde« gehabt und sei »in der ganzen Umgebung beliebt« gewesen.[48] Stefanie Schmid berichtete weiterhin von den guten Kontakten, die Schmid zu den Juden seines Wohnviertels gehabt habe: »In der Nähe seines Hauses wurde in einer Wohnung an Samstagen und anderen Feiertagen jüdischer Gottesdienst abgehalten. Manchmal, wenn der ›zehnte Mann‹ fehlte, wurde Schmid zur Teilnahme an diesem Gottesdienst gebeten, da man ihn für einen Juden hielt. Schmid war zu gutmütig, um zu widersprechen; er ging mit und ersetzte bei diesem Gottesdienst den ›zehnten Mann‹.«[49] Nach jüdischem Brauch wird ein Gottesdienst nun dann abgehalten, wenn die Mindestzahl von zehn Personen (Minjan) anwesend ist. Der von Schmid gerettete Schriftsteller Hermann Adler berichtet, dass Schmid ihnen die Geschichte, dass er des Öfteren den »Minjanmann« gespielt habe, bereits in Wilna erzählt hatte, er sie damals aber für eine humoristische Darstellung gehalten habe, weil ein Christ ja nicht als Minjanmann gezählt werden dürfe.[50] Jetzt aber, nach der Bestätigung durch Schmids Witwe Stefanie, sah er, dass sie der Wahrheit entsprach.
Nach dem Einmarsch der Deutschen in Österreich im Jahre 1938 und der sogleich beginnenden Judenverfolgung war es für Schmid offenbar eine Selbstverständlichkeit, »zahlreichen Juden« aus seiner Nachbarschaft dabei behilflich zu sein, über die grüne Grenze in die Tschechoslowakei zu gelangen, wo sie sich sicherer fühlen konnten. Seine Frau erinnerte sich später, sie habe damals erst gar nicht den Versuch gemacht, »ihn davon abzuhalten«, weil dies ohnehin »zwecklos gewesen« wäre.[51]
Viele Wiener Juden flüchteten seinerzeit übrigens auch nach Westen, an den Bodensee, um von dort über die grüne Grenze in die Schweiz gelangen zu können. Im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet gab es ebenfalls Helfer und Retter, die Juden in die Schweiz und damit in Sicherheit brachten.[52] Der Schweizer Polizeihauptmann Paul Grüninger (1891–1972) aus Sankt Gallen erwies sich als ein besonders mutiger und erfolgreicher Helfer.[53] Er rettete unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg bis zu 3600 Jüdinnen und Juden das Leben, indem er ihnen durch Vordatierung der Einreisevisa und/oder Fälschung anderer Dokumente die Einreise in die Schweiz ermöglichte.
Der Privatmann Anton Schmid wäre im Jahre 1938 für seine Fluchthilfe für Wiener Juden in die Tschechoslowakei von den Nazis gewiss diffamiert, aber wohl kaum juristisch belangt worden. War es seinerzeit doch das Ziel der nationalsozialistischen Politik, die in Wien von Adolf Eichmann exekutiert wurde, möglichst viele Juden zur Emigration zu drängen. Daher halfen zu dieser Zeit in Deutschland gelegentlich sogar Gestapobeamte flüchtenden Juden beim Verlassen des Landes, indem sie diese mit ihren Autos bis zur Grenze brachten.
Für Anton Schmids Biographie zählt an dieser Stelle, dass er schon damals begriff, dass das nationalsozialistische Regime in Deutschland und nun auch in Österreich für die Juden eine akute Lebensgefahr darstellte. In dieser Situation signalisierte ihm sein Gewissen, dass er nicht tatenlos bleiben durfte, sondern zumindest jenen Juden, mit denen er seit Jahren in gutem Einvernehmen zusammengelebt hatte, helfen musste, in Sicherheit zu gelangen. Das war, betrachtet man das Wegschauen und Nicht-wissen-Wollen der meisten Deutschen und Österreicher, eine bemerkenswerte, eine ungewöhnliche Verhaltensweise dieses Wiener Elektrohandwerkers.
Wenn wir uns diese wenigen Zeugnisse, die wir über Anton Schmid in seiner Wiener Zeit bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges haben, noch einmal zusammenfassend vor Augen führen wollen, so ergibt sich das Bild eines heiteren Menschenfreundes mit offenen Augen und einem mitfühlenden Herzen, der mit seinen Nachbarn in Wien, auch den jüdischen, ein gutes Verhältnis pflegte und der womöglich in seiner Jugendzeit einmal in ein jüdisches Mädchen verliebt war. Als der Antisemitismus gewalttätig wurde und ein Nazi einer jüdischen Bäckereibesitzerin in der Nachbarschaft die Scheiben ihres Ladens einschlug, leistete er spontan Hilfe und legte sich dazu noch mit der Polizei an. In seinem kleinen Radiogeschäft hatte Anton Schmid zwei jüdische Angestellte. Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht 1938 in Österreich half er jüdischen Nachbarn bei ihrer Flucht in die Tschechoslowakei. Im Zuge dieser Erfahrungen entwickelte Schmid eine hohe Sensibilität für die Situation der jüdischen Mitbürger. Sie stellte eine wichtige Voraussetzung für seinen späteren Schritt in den Rettungswiderstand dar.
Schmid war ein Anti-Nazi, aber wahrscheinlich nicht in erster Linie aus politischen Erwägungen heraus, sondern eher gefühlsmäßig, weil er mit unverstelltem Blick und einfühlender Wahrnehmung die Judenverfolgung beobachte und aus seiner humanen Grundhaltung heraus ablehnte. Allerdings hätte er genauso auch anderen Verfolgten geholfen, wenn es nötig gewesen wäre, und das hat er später in Wilna auch getan. Hermann Adler geht so weit, zu sagen, Schmid sei »politisch völlig uninteressiert« gewesen. Er habe auch später nicht aus politischen Beweggründen geholfen und gerettet, sondern aus rein humanitären Erwägungen.[54] Bei anderer Gelegenheit schränkte Adler sein Diktum vom unpolitischen Schmid allerdings ein, wenn er die interessante Feststellung traf: »Er war ein österreichischer Monarchist und dazu noch Sozialdemokrat«.[55] Diese Information wird bestätigt dadurch, dass der überlebende Jude Salinger[56] nach dem Kriege nach Wien reiste, dort bei der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) vorsprach und um Unterstützung für Schmids Witwe und Tochter bat.[57]
Simon Wiesenthal, der sich nach Kriegsende für Anton Schmid interessierte und durch seine Recherchen das einzige Portraitfoto in die Hände bekam, das von ihm existiert, gewann dabei folgenden Eindruck von diesem Mann: »Man erkennt darauf sein intelligentes, anständiges Gesicht, seine sanften, traurigen Augen, dunkles Haar und einen kleinen Schnurrbart.«[58] Hermann Adler, der jüdische Schriftsteller, hat seinen Freund Anton Schmid, wie er ihn im Jahre 1941 in Wilna kannte, etwas genauer beschrieben: »Er war schlank, hochgewachsen, hatte braune Haare, einen Schnurrbart, sah Hitler ähnlich, ein Sportstyp, der ›Wein, Weib und Gesang‹ liebte.« Und weiter: Schmid habe 1941 schon »graue Fäden im Haar« gehabt und habe, obwohl er gerade mal knapp über 40 war, oft »wie ein Fünfzigjähriger« ausgesehen.«[59] Der »einfache Feldwebel« sei »schlicht und treuherzig« gewesen, ein im Denken und Reden »einförmiger und gesellschaftlich ungeschickter Mann«.[60] »Er war nicht religiös, er war kein Philosoph. Er las keine Zeitung« und »Bücher schon gar nicht. Er war kein geistiger Mensch […].«[61]
Alle Menschen, die Anton Schmid persönlich kannten und deren Berichte uns zugänglich sind, sagen übereinstimmend aus: »Seine alles überragende Charaktereigenschaft war die der Menschlichkeit.«[62] Konkret war damit offensichtlich gemeint, dass er die instinktive Fähigkeit hatte, sich in das Leid anderer hineinzuversetzen und ihnen, wenn es erforderlich war, zu helfen. Heute würden wir von einer Fähigkeit zur Empathie sprechen. So hat sich Anton Schmid übrigens auch selbst gesehen und in einem Brief an seine Frau beschrieben als einen Mann mit einem »weichen Herzen«, der im Zweifelsfall eher nach dem Gefühl denn aufgrund einer gründlichen rationalen Lageanalyse handelte.[63] Die Überlebenden aus Wilna haben neben der Herzensgüte auch den Mut Anton Schmids hervorgehoben[64], und das völlig zu Recht, wenn man das Risiko bedenkt, welches er ohne Bedenken für sich selbst einging.
Fußnoten
[41]
Daten entnommen aus: Geburts- und Taufbuch des Pfarramts St. Rochus und Sebastian Wien III. Eine Kopie des Eintrags wurde mir dankenswerterweise von der Pfarrei St. Rochus und Sebastian zur Verfügung gestellt.
[42]
Hillbrand-Grill, Anton Schmid, S. 243–244. Fälschlicherweise heißt es dort, Schmid sei »der Sohn eines Postbeamten« gewesen.
[43]
Adler, Klarstellungen, S. 2. In: Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt. Deutsches Exilarchiv 1933–1945. Nachlass Hermann Adler – EB 2004/38 (NL 193), B.02.02.
[44]
Karl Lueger (1844–1910), österreichischer Politiker, 1893 Begründer der konservativen Christlich-Sozialen Partei, Bürgermeister von Wien 1897–1910, hielt aufhetzende Reden gegen die Juden. Siehe dazu die Belege in: http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Lueger.
[45]
Wieninger/Pabst, Feldwebel Anton Schmid, S. 187–205, hier: S. 189f.; Kurzfassung dieses Beitrages u.d.T: Feldwebel Anton Schmid. In: Gedenkdienst 3/2002, www.gedenkdienst.at/index.php?id=309.
[46]
Brief Hermann Adlers vom 29. 11. 1966 an Werner Murawski, ZDF, Leiter Hauptabteilung Dokumentarspiel, Mainz, S. 2. In: [ZDF] Historisches Archiv des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF), Mainz, Akten zum Dokumentarfilm »Feldwebel Schmid«.
[47]
Ebda.
[48]
Diese Schilderung von Stefanie Schmid wird wiedergegeben in dem soeben zitierten Brief von Hermann Adler vom 29. 11. 1966 an Werner Murawski. In: [ZDF] Historisches Archiv des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF), Mainz, Akten zum Dokumentarfilm »Feldwebel Schmid«. S. 2.
[49]
Ebda.
[50]
Ebda.
[51]
Ebda., S. 2.
[52]
Siehe dazu Wette, Stille Helden.
[53]
Paul Grüninger wurde 1939 ohne Pension von seinem Dienst suspendiert und 1940 wegen Dienstpflichtverletzung zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. 1971 wurde Grüninger in die Liste der Gerechten unter den Völkern aufgenommen. Im Jahre darauf starb er verarmt. Erst 1995, 23 Jahre nach seinem Tode, hob das Bezirksgericht St. Gallen das Urteil gegen Paul Grüninger auf und sprach ihn frei. Siehe Stefan Keller: Grüningers Fall. Geschichten von Flucht und Hilfe. Zürich 1993, sowie den Eintrag: de.wikipedia.org/wiki/Paul_Gr%C3%BCninger.
[54]
Adler, Klarstellungen, S. 10. In: Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Exilarchiv 1933–1945, Frankfurt am Main, Nachlass Hermann Adler EB 2004/28 (NL 193), Unterlagen zu Anton Schmid, A.03.07.
[55]
Wolfgang Bauernfeind (Red.): Feldwebel Schmid. Die Geschichte einer Rettung. Nacherzählt von Anita und Hermann Adler (1989). Sendemanuskript, S. 21.
[56]
Salinger diente während des Krieges in Wilna in Feldwebel Schmids kleiner Dienststelle unter dem Tarnnamen Gefreiter Max Huppert. Siehe dazu Kap. »Die Rettung des Gefreiten…« in diesem Buch, S. 63ff.
[57]
Siehe dazu Kap. »Das Risiko« in diesem Buch, S. 153ff.
[58]
Wiesenthal, Mörder, S. 328.
[59]
Adler, Klarstellungen, S. 2. In: Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Exilarchiv 1933–1945, Frankfurt am Main, Nachlass Hermann Adler EB 2004/28 (NL 193), Unterlagen zu Anton Schmid, A.03.07.
[60]
Adler, Klarstellungen, S. 4.
[61]
Wolfgang Bauernfeind (Red.): Feldwebel Schmid. Die Geschichte einer Rettung … Sendemanuskript, S. 15.
[62]
Ebda.
[63]
Siehe den Abschiedsbrief Anton Schmids an seine Frau Stefanie vom 9. 4. 1942. In: Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Exilarchiv 1933–1945, Frankfurt am Main, Nachlass Hermann Adler EB 2004/28 (NL 193), Unterlagen zu Anton Schmid, D.01.01. Gedruckt in: VEJ 7, Dok. 232, S. 610.
[64]
Wiesenthal, Mörder, S. 330.
Anton Schmid im Krieg 1939–1941
Vom Kriegsbeginn am 1. September 1939 an gerechnet waren es nur noch wenige Monate bis zu Anton Schmids vierzigstem Geburtstag am 9. Januar 1940. Gleichwohl wurde er, wie andere Männer seines Jahrgangs, umgehend zur Wehrmacht eingezogen. Für den aktiven Militärdienst an der Front war er schon zu alt. Daher entsandte man ihn in das Landesschützenbataillon 17, einen militärischen Verband, der für Aufgaben im Rückwärtigen Heeresgebiet vorgesehen war. Wenig später fand er im Landesschützenbataillon XX/XVII Verwendung. Es wurde im Februar 1940 in der Stadt Stalowa Wola im südöstlichen Polen eingesetzt.[65]
Am 1. Juli 1941, wenige Tage nach dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion am 22. Juni, erfolgte in Eisenstadt – Hauptstadt des Burgenlandes in Österreich – die Neuaufstellung des Landesschützenbataillons (LSB) 898. Feldwebel Anton Schmid erhielt eine Versetzung in die 2. Kompanie dieses Verbandes, der zur 221. Sicherungsdivision gehörte. Diese kam noch im Juli 1941 im Rückwärtigen Heeresgebiet Mitte zum Einsatz. Ab dem 17. Juli 1941 übernahm das LSB 898 Wachaufgaben entlang von Bahnstrecken und Brücken sowie im Stadtgebiet der nordostpolnischen, später weißrussischen Stadt Białystok. Dort hatte das Ordnungspolizei-Bataillon 309 bereits am Tage des deutschen Einmarschs in die Stadt (27. Juni 1941) mindestens 700 Juden in der Synagoge eingesperrt und diese dann angezündet. Insgesamt ermordeten die deutschen Sicherheitskräfte an diesem Tage in Białystok mehr als 2000 Juden. In den beiden darauffolgenden Wochen liquidierte das Einsatzkommando 9 weitere 4000 Juden der Stadt.[66] Im Białowiezer Forst führten die Polizeibataillone 309 und 322[67] zu ebendieser Zeit Judenerschießungen durch.
Ob Angehörige des Landesschützenbataillons 898, dem Feldwebel Schmid angehörte, Zeugen dieser »Aktionen« wurden oder gar an diesen beteiligt waren, lässt sich nicht mehr ermitteln.[68] Bekannt ist, dass der Kommandeur der 221. Sicherungsdivision, Generalleutnant Johannes Pflugbeil, an eben jenem 17. Juli 1941 in Białystok eine Razzia befahl, bei der Polizeieinheiten und das Landesschützenregiment 45, zu dem auch Anton Schmids Einheit gehörte, Geiseln, »besonders Juden«, festnehmen sollten, die »bei geringster Unruhestiftung« zu erschießen waren.[69]
Anfang August wurde Schmids Bataillon in das Städtchen Slonim in Weißrussland verlegt, wo es auch für die Bewachung von Gefangenentransporten zuständig wurde.[70] In dem Dorf Petrolevichi – sieben Kilometer von dem Städtchen Slonim entfernt – hatte das Einsatzkommando 9 der SS-Einsatzgruppe B bereits am 14. Juli 1941 eine Vernichtungsaktion durchgeführt, der 1255 Juden zum Opfer gefallen waren, hauptsächlich junge Männer, Intellektuelle und Mitglieder des Judenrats.[71] Eine weitere Mordaktion, bei der 1153 Juden aus Slonim und dem Umland zu Tode kamen, fand am 6. August 1941 statt, also während des Aufenthalts des Landesschützenbataillons 898, dem auch Feldwebel Schmid angehörte.[72] Da die Polizisten des Einsatzkommandos 9 ihre Opfer auf dem Marktplatz des Städtchens in aller Öffentlichkeit zusammentrieben und sie dann mit Lastkraftwagen abtransportierten, darf vermutet werden, dass Nachrichten über die anschließenden Massenerschießungen trotz der angestrebten Geheimhaltung den dort stationierten deutschen Soldaten nicht verborgen blieben. Möglicherweise ist Anton Schmid also schon in Białystok oder später in Slonim mit den Judenmorden direkt oder indirekt in Berührung gekommen.
Am 24. August 1941 wurde das Landesschützenbataillon 898, dem Schmid angehörte, wieder aus dem Verbund der 221. Sicherungsdivision herausgelöst und in die litauische Stadt Vilnius (Wilna) verlegt, um dort ein anderes Landesschützenbataillon abzulösen und einen Teil von dessen Mannschaften zu übernehmen. Hauptmann Nikolaus Adam, der Kommandeur dieses LSB, übernahm nun zugleich das Amt des Ortskommandanten von Wilna.[73]
Feldwebel Schmid traf Anfang September 1941 in Wilna ein. Dort erhielt er den Befehl, die Versprengten-Sammelstelle der Feldkommandantur (FK) 814 zu übernehmen. Dies geschah, wie er in einem Brief an seine Frau Stefanie erwähnte, gegen seinen Willen.[74] Die Sammelstelle hatte den Auftrag, deutsche Soldaten, die im Rückwärtigen Heeresgebiet herumirrten und von der Feldgendarmerie aufgefunden wurden, zu verhören und alsbald wieder an die Front zu schicken. Schmids vorgesetzte Dienststelle, die Feldkommandantur in Wilna unter Oberstleutnant Max Zehnpfennig, war eine stationäre Behörde der Wehrmacht, die für die Versorgung der Fronttruppen wie auch der Soldaten in der rückwärtigen Militärverwaltung zu sorgen hatte.
Der FK 814 unterstanden Dutzende meist kleiner Dienststellen, die alle möglichen Spezialaufgaben erfüllten und häufig in großer Selbständigkeit ihren Tätigkeiten nachgingen.[75] Neben der Versprengten-Sammelstelle gab es mindestens 180 weitere Arbeitsstellen, in denen auch Juden Beschäftigung fanden, zum Beispiel die Unterkunftsverwaltung, die Wehrmacht-Versorgungsabteilung, das Quartieramt der Ortskommandantur, die Schutzpolizei, der Rundfunksender, der Gebietskommissar Wilna Stadt und Wilna Land, ein Kriegslazarett, ein Heeresbetriebsstofflager, das Deutsche Dienstpostamt, der Bahnhofsoffizier, die Heeresbaudienststelle, der Heereskraftfahrpark 562, die Pelzfabrik »Kailis«, die Wehrmachtschneiderstube, ein Verpflegungsamt, die Feldbauleitung usw. Die von Feldwebel Schmid geleitete Versprengten-Sammelstelle in der Eisenbahnstraße Nr. 15, der früheren Kolejowa-Straße, direkt gegenüber dem Wilnaer Hauptbahnhof gelegen, war eine kleine, eher belanglose Dienststelle, um die sich die Vorgesetzten nur wenig kümmerten. Das öffnete dem Feldwebel Schmid Handlungsspielräume.
Fußnoten
[65]
Die Verwendungen Anton Schmids in der Zeit zwischen Kriegsbeginn 1939 und seiner Versetzung nach Wilna im September 1941 wurden ermittelt auf der Basis der Wehrmachtakten im Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg i.Br. von Priemel, Rettung durch Arbeit (2002), S. 88 mit Anm. 421.
[66]
Vgl. den Eintrag »Bialystok Ghetto«, www.deathcamps.org/occupation/bialystok%20ghetto_de.html, sowie: http://de.wikipedia.org/wiki/Ghetto_Bialystok.
[67]
Vgl. Angrik/Voigt/Ammerschubert/Klein, Polizeibataillon 322, S. 346ff.
[68]
Priemel, Rettung durch Arbeit (2002), S. 88, Anm. 421, mit Nachweis der einschlägigen Quellen aus dem BA-MA.
[69]
Befehl Sicherungsdivision vom 17. 7. 1941, BA-MA RH 26-221/12 a, unpaginiert. Zit. nach Priemel, Rettung durch Arbeit (2002), S. 88 mit Anm. 421.
[70]
Vgl. Abramowitsch/Nolte, Leere in Slonim.
[71]
Nolte, Slonim 1941–1944 (2003), S. 237–247, sowie ders., Die andere Seite des Holocaust. Die Massaker der Deutschen im Osten zeigen den »archaischen« Charakter des großen Judenmords. In: DIE ZEIT Nr. 5, 24. 1. 2008, Seite »Zeitläufte«. Weiterhin: Enzyklopädie des Holocaust. Bd. III, München/Zürich 2. Aufl. 1998, S. 1321.
[72]
Meldung des Polizeiführers Mitte vom 14. 8. 1941 nach Berlin. Siehe Nolte, Slonim (2003), S. 245, Anm. 4.
[73]
Priemel, Rettung durch Arbeit (2002), S. 88.
[74]
Handschriftlicher Brief Anton Schmids an seine Frau vom 9. 4. 1942. In: Yad Vashem Archive, Jerusalem/Israel, Sammlung »Gerechte der Völker«, Dossier M 31/55 Schmid Anton.
[75]