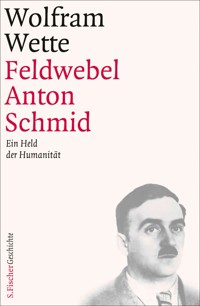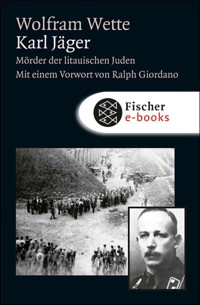
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Die Zeit des Nationalsozialismus. "Schwarze Reihe".
- Sprache: Deutsch
Die erste Biographie eines NS-Direkttäters "vor Ort" Karl Jäger war ein Direkttäter "vor Ort". Als SS-Standartenführer meldete er am 1.12.1941 die Exekution von 137.346 litauischen Juden, Litauen sei jetzt "judenfrei". Der "Jäger-Bericht" wurde zu einem Schlüsseldokument. Wer war dieser Polizeioffizier aus dem zweiten Glied? Wie wurde aus dem Musiker ein Massenmörder? Bis zu seiner Verhaftung 1959 lebte er unbehelligt. Er verübte Selbstmord im Zuchthaus Hohenasperg bei Ludwigsburg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Wolfram Wette
Karl Jäger
Der Mörder der litauischen Juden
Biografie
Wolfram Wette, geboren 1940, Dr.phil. 1971, Habilitation 1991. Er war Historiker am Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Freiburg (1971–95), seitdem freier Autor, seit 1998 ist er apl. Professor für Neueste Geschichte in Freiburg und seit 2001 Ehrenprofessor an der russischen Universität in Lipezk.Von seinen zahlreichen Büchern sind bei FTV erschienen:, »Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion 1941« ( Bd. 4437); »Stalingrad. Mythos und Wirklichkeit einer Schlacht« (11097); »Retter in Uniform. Handlungsspielräume im Vernichtungskrieg der Wehrmacht« (15221) ; »Zivilcourage« (15824), »Die Wehrmacht. Feindbilder, Vernichtungskrieg, Legenden« (15645), »Militarismus in Deutschland. Geschichte einer kriegerischen Kultur« (18149).
Impressum
Covergestaltung: Buchholz / Hinsch / Hensinger
Coverabbildung: Das VII. Fort von Kaunas, Ort zahlreicher Massenerschießungen (großes Foto); Portrait Karl Jäger (1888–1959)/Hessisches Hauptstaatsarchiv, Wiesbaden
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2011
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401370-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
»Es ist nicht leicht [...]
Vorwort
Teil I: Ein Täter aus der zweiten Reihe und seine Opfer
1. Das kleine Land Litauen als Testgelände für die Vernichtung der Juden
2. Forschungsstand, Quellenlage, Fragestellungen
3. Erinnerungen von jüdischen Opfern aus Kaunas
4. Zur Überlieferungsgeschichte des Jäger-Berichts
5. »Einer der effizientesten Massenmörder der neueren Geschichte« oder »ein ziemlich inkompetenter Polizeiführer«?
Teil II: Karl Jägers Werdegang von 1888 bis 1935
1. Kindheit, Jugend, Militärdienst im Ersten Weltkrieg
2. Der »Waldkircher Hitler«: Funktionsträger der NSDAP und der SS
3. »Korrekt bis zum Letzten«: Erinnerungen von Zeitzeugen
4. Jägers Karriere in der SS 1936–1941
5. Im Hauptamt des Sicherheitsdienstes der SS
6. SD-Schule Bernau: Antisemitische Indoktrination
7. Die Aufstellung des Einsatzkommandos 3 in Pretzsch
8. Die Befehlslage für die Einsatzgruppen und die Einsatzkommandos im Juni 1941
Teil III: Litauen im Juni 1941
1. Litauen, seine Juden und die »zeitweilige Hauptstadt« Kaunas
2. Die innenpolitische Sprengkraft des »Russenjahres« 1940/41
3. Die deutsche Wehrmacht erobert Litauen
4. Der Aufstand litauischer Nationalisten gegen die Rote Armee (22.–28. Juni 1941)
5. Pogrome der litauischen Nationalisten gegen die jüdische Bevölkerung von Kaunas
6. Der Totschläger von Kaunas: Judenmorde in aller Öffentlichkeit
7. Die Wehrmacht als Zuschauer und Wegschauer
8. Die SS als Anstifter zu »spontanen Selbstreinigungsaktionen«
9. Litauische Aktivisten-Front (LAF) – Speerspitze des mörderischen Antisemitismus
10. Deutsche Zivilverwaltung und litauische Kollaboration
11. Zwei von Tausenden: Die Ermordung des Buchhändlers Max Holzman und seiner Tochter Marie
Teil IV: Jägers Einsatz in Litauen 1941–1943
1. Jäger als Kommandeur des EK3 in Kaunas
2. Erste systematische Massenerschießungen in Kaunas am 4. und 6. Juli 1941
3. Errichtung des Ghettos Kaunas Mitte August 1941 und die »Aktion der Tausend«
4. Die Verfolgung und Ermordung der aus Frankfurt/Main nach Kaunas geflüchteten Familie Simon
5. Die »Intelligenz-Aktion« vom 18. August 1941
6. Das Rollkommando Hamann und die Ermordung der Juden auf dem litauischen Land: Das Beispiel Rokiskis (15./16. August 1941)
7. Vom »Paradeschießen« in Kaunas und Paneriai zum Widerstand
8. Massaker in Kedainiai, Jubarkas und Zagare
9. Die »Probe-Aktion« im Ghetto Kaunas am 17. September 1941 und ihre Folgen
10. Vernichtung Kranker: Die »Kleine-Ghetto-Aktion« vom 4. Oktober 1941
11. Ermordung geistig Behinderter
12. Die »Große Aktion« vom 29. Oktober 1941
13. Nach Kaunas deportiert und im IX. Fort ermordet: Juden aus Berlin, München, Frankfurt, Breslau und Wien
14. Das Massensterben sowjetischer Kriegsgefangener und ihr Ersatz durch »Arbeitsjuden«
Teil V: Von der Ausbeutung zur Vernichtung: Die zweite und dritte Phase der deutschen Judenverfolgung in Litauen (1942–1944)
1. Charakteristika der zweiten und dritten Phase
2. Die Ermordung des Komponisten Edwin Geist und der Selbstmord seiner Frau Lyda
3. Todesstrafe für schwangere Jüdinnen
4. Dritte Phase: Vom Ghetto zum Konzentrationslager Kaunas
5. Die »Kinderaktion« vom 27. und 28. März 1944
6. Der Umfang der Täterschaft Jägers
7. Jägers Albträume
Teil VI: Das Leben Jägers in den Jahren 1943 bis 1959
1. Verwendungen in den Kriegsjahren 1943–1945
2. Unter richtigem Namen: Bürger der deutschen Bundesrepublik (1949–1959)
3. »Ich war stets ein Mensch mit höherer Pflichtauffassung«: Verhaftung und Vernehmungen im Jahr 1959
4. Bilanzselbstmord
Teil VII: Verdrängung und späte Erinnerung
1. Geringes Interesse der Deutschen an der Geschichte der Judenmorde in Litauen
2. Jahrzehntelange Verdrängung der litauischen Kollaboration
3. Verdrängung und Abwehr in der Heimatregion Jägers
4. Orte der Erinnerung an den Holocaust in Litauen und in Deutschland
5. Emotionale Annäherung an das Grauen: Eine Litauen-Exkursion von Freiburger Studenten und Schülern
6. Holocaust-Überlebende aus Litauen in Jägers Heimatstadt Waldkirch
7. Die zweite Republik Litauen und die ausgelöschte jüdische Kultur
8. Karl Jäger: Wie ein feinsinniger Musiker zum Massenmörder wurde
Anhang
Der Jäger-Bericht
Ortsnamenkonkordanz zum Jäger-Bericht
Karten
Danksagung
Verzeichnis der Bildquellen und Dokumente
Quellen- und Literaturverzeichnis
Archivalien
Gedruckte Quellen
Erinnerungen von Opfern
Spezialliteratur zu den Judenmorden in Litauen während des Zweiten Weltkrieges
Allgemeine Literatur zu Holocaust, Zweiter Weltkrieg und Nachkriegszeit
»Es ist nicht leicht oder angenehm, in diesem Abgrund des Bösen zu graben. […] Man ist versucht, sich erschaudert abzuwenden und sich zu weigern, zu sehen und zu hören: Das ist eine Versuchung, der man widerstehen muss.«
Primo Levi[1]
Vorwort
Am 22. Juni 1941 überfällt die Wehrmacht die Sowjetunion (mit der Deutschland im August 1939 einen Nichtangriffspakt geschlossen hatte). Es ist der Eintritt in ein neues Zeitalter des Verbrechens von Menschen an Menschen, etwas, das wir uns angewöhnt haben, Holocaust oder Shoah zu nennen – die Vernichtung der Juden im deutsch besetzten Europa während des Zweiten Weltkrieges, eine Tötungsenergie, wie die Welt sie noch nicht erlebt hatte.
Jetzt treten die sogenannten Einsatzgruppen auf, über die ganze 2000 Kilometer lange Front zwischen Leningrad und Schwarzem Meer verteilte mobile Todeskommandos, die mit Hilfe einheimischer Helfer innerhalb von weniger als einem Jahr in den baltischen Staaten, in Russland, Weißrussland und der Ukraine über eine Million Menschen umbringen werden, überwiegend Juden. Es ist so etwas wie der »wilde Holocaust«, die Ouvertüre, der Genozid vor seiner Technisierung durch die Gaskammern und Hochöfen der stationären Todesfabriken Auschwitz, Treblinka, Belzec, Sobibor und Chelmno.
Ein Teil des Dramas, seine Initialzündung, wird der Untergang der Litauer Judenheit. Er vollzieht sich in weniger als einem halben Jahr, von Ende Juni bis Ende November 1941, und ist akribisch aufgezeichnet in einem Dokument, das in der Holocaustforschung kaum seinesgleichen haben dürfte: dem »Jägerbericht« vom 1. Dezember 1941, ein früher Einblick in das Zeitalter der neuen Massenvernichtung, eine in den »Ereignismeldungen« an die Berliner Vernichtungszentrale Reichssicherheitshauptamt übermittelte Chronik, wann und wo wie viele Menschen erschossen oder erschlagen worden sind.
Benannt worden ist der Bericht nach Karl Jäger (1888–1959), Kommandeur des Einsatzkommandos 3 der Einsatzgruppe A, mit Schwerpunkt in Kaunas. Es ist die Probe aufs Exempel – wann immer es ab jetzt der Mörder bedurfte, sie waren zur Stelle. Wobei der Radius des Vernichtungsapparates stets identisch war mit dem der deutschen Fronten, ob Vormarsch oder Rückzug – der territoriale Machtbereich der Wehrmacht bildet die Voraussetzung für den Holocaust.
Und Karl Jäger wird zu seinem pedantischen Protokollanten auf litauischem Boden, dem es auf die Ziffer hinter dem Komma ankommt. Nur dass er nicht Erbsen zählte, sondern Leichen.
Seine Biographie ist eingeschlossen in die Geschichte des deutschen Nationalsozialismus und seinen Zeitgeist, eine weithin exemplarische Sozialisierung im Schoße der deutschen Rechten, mit frühem Eintritt in die NSDAP, schon 1923. Es ist ein Dasein, das man vor diesem Hintergrund überblickhaft vereinfachen kann auf die Formel: Ein Musiker aus der südbadischen Kleinstadt Waldkirch wird zum Henker, ein Orgelbauer zum Buchhalter des Todes. Unheimlicherweise verlässt einem beim Studium dieser Vita nicht das dumpfe Gefühl, es hier mit einem zeitgenössisch austauschbaren Schicksal zu tun zu haben. Karl Jäger wird jedenfalls nicht mit Teufelshörnern und Pferdehuf geboren, wohl aber zu einem der effizientesten Massenmörder der neueren Geschichte werden. Wir müssen mit der Erfahrung fertig werden, dass es viele seinesgleichen gegeben hat.
Den Anfang des Großpogroms übernehmen die Litauer selbst, noch bevor die Tötungsmaschine der Deutschen angeworfen ist – der Mob bedarf keiner speziellen Aufforderung, er weiß sich einig mit den Siegern und ihrer Übermacht. So kommt es in den ersten vierzehn Tagen nach dem Einmarsch schon zu einem wahren Tötungsrausch, komprimiert zwischen dem 25. und 29. Juni 1941 – Mord auf offener Straße und in Anwesenheit grinsender Wehrmachtangehöriger; Massenerschießungen durch rasch zusammengestellte litauische Peletons; stählerne Brechstangen als Tötungswerkzeug. Die Kollaborationsbereitschaft von Teilen der Bevölkerung ist erschreckend.
Dann sehr rasch die Ausweitung des Verbrechens über die Kollaboranten hinaus, die Expansion der Vernichtung durch die mobilen Todeskommandos, darunter das Jägersche Nr. 3; die Ghettoisierung der Juden in Kaunas; dann Namen, die bis dahin keiner kannte, die nun aber zu schrecklicher Bedeutung kommen: Rokiskis, Kedainiai, Paneriai und Hunderte andere, sie alle mit dem gleichen Merkmal – Leichengebirge.
Über allem aber der Herr der killing fields, Anführer des Einsatzkommandos 3, der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes für den Generalbezirk Litauen – Karl Jäger.
Der hat ein Bewährungssyndrom, eine psychoneuralgische Störung, mit fürchterlichen Folgen für die Juden Litauens. Jäger ist der Älteste der Einsatzgruppen- und -kommandoführer, ohne den akademischen Bildungsstand seiner jüngeren »Kollegen«. Das erzeugt einen Druck, sich selbst und anderen fortwährend beweisen zu müssen, dass er »mithalten« kann und nicht zu alt ist für die »Aufgabe«, die er hat. Er musste »besser sein«, musste höhere Mordziffern als andere vorweisen, wenn er vor seinen gebildeteren Kameraden und Vorgesetzten bestehen wollte.
Und das kann er: 133346 ermordete Juden innerhalb von fünf Monaten, von Ende Juni bis Ende November 1941, so die jubelnde Bilanz des Jäger-Berichts, ein bürokratischer Fanfarenstoß, der Triumph einer persönlichen Vollzugsmeldung: »Ganz Litauen ist nunmehr judenfrei.«
Sein »Bericht« lag den Nürnberger Tribunalen (1945–1949) noch nicht vor, obwohl der Sowjetführung schon während des Krieges eine Ausfertigung in die Hände gefallen war. Und so übergab das sowjetische Außenministerium erst im Jahr 1963 das Dokument lustlos der Ludwigsburger Zentralen Stelle für die Aufklärung von NS-Verbrechen.
Da war Jäger schon seit vier Jahren tot.
Es ist eine Lektüre, die kein Mensch ohne Pausen und Unterbrechungen durchstehen kann. Was sich von Seite zu Seite immer mehr auftut, ist der kaum aushaltbare Gegensatz zwischen der entmenschten Statistik Karl Jägers und der blutigen Wirklichkeit dahinter durch die Zeugnisse der wenigen Überlebenden; der fürchterliche Kontrast zwischen der zahlenversessenen Bürokratie des Holocaust und seiner Individualisierung und Personifizierung durch die Entkommenen.
Aus dem Munde der Täter selbst erfahren wir nichts. Kein Wort, keine Silbe, kein Buchstabe, wie ihre Opfer entrechtet, ausgeraubt und schließlich umgebracht wurden – nur Schweigen. Schweigen über einen Ausrottungsfeldzug im Schatten der Wehrmacht, von logistischer Hilfe bis zu aktiver Beteiligung an den Exekutionen. Hatte es 1939/40 im besetzten Polen bei der sogenannten Flurbereinigung der SS (grausame »Umsiedlung« von Juden, mit Tausenden von Toten) noch offen geäußerte Empörung durch hohe Offiziere gegeben – davon jetzt keine Spur mehr.
Umso leuchtender die wenigen Gegenbeispiele von »unten«, wie das des Feldwebels Anton Schmid, der dem jüdischen Widerstand im Ghetto von Wilna half und dafür mit dem Leben bezahlen musste.
Das Neue, Ungeheuerliche, was da in die Geschichte der Menschheit einzieht, konnte aber selbst bei den Mördern nicht ganz ohne Wirkung bleiben – auch Karl Jäger musste zunächst mit inneren Hemmungen fertig werden. So hat er einem noch Schuldigeren, dem SS-Offizier, Chef der Einsatzgruppe A und Befehlshaber der Sicherheitspolizei Ostland, Heinz Jost, das Geständnis gemacht: Er sei ein verlorener Mensch, ihm nütze weder ein Sanatoriumsaufenthalt noch ein Urlaub, denn er fände keine Ruhe mehr, könne nicht mehr schlafen, und weder seiner Frau guten Gewissens gegenübertreten noch seine Enkel auf den Schoß nehmen, wenn er an die Erschießungen denke …
Wir kennen ähnliche Äußerungen von ehemaligen Angehörigen der Einsatzkommandos, ohne dass solche Hemmnisse faktische Folgen hatten. Es waren dann auch verschwindend wenige, die sich der Massentötungen an wehrlosen Männern, Frauen und Kindern verweigerten, ohne dass auch nur einer von ihnen dadurch einen Karriereknick hinnehmen musste, kein Einziger. Allerdings waren es wenige genug, und es bleibt die Frage, ob es bei größerer Verweigerung nicht sehr wohl zu drastischen Konsequenzen gekommen wäre.
Jägers innere Hemmnisse, wenn es sie denn tatsächlich gegeben hätte, haben zu keinem Zeitpunkt auch nur in die Nähe einer Verweigerung geführt. Eher wirkten sie noch über das »Soll« hinaus stimulierend.
Karl Jäger überstand den Zweiten Weltkrieg, er floh nach dessen Ende nicht und tauchte auch nicht unter, sondern lebte in der Nähe der alten Universitätsstadt Heidelberg unter seinem richtigen Namen, verschwieg aber seine Zugehörigkeit zu NS-Organisationen. Die Entnazifizierung stufte ihn als »nichtbelastet« ein.
Viele Sorgen seiner Landsleute wegen brauchte Karl Jäger sich damals in den 1950er Jahren nicht zu machen. Ihr überwiegender Teil hatte mit der Aufarbeitung des Dritten Reiches nichts im Sinn, und mit der eigenen Rolle darin schon gar nicht. Und so dauerte es denn auch noch vierzehn Jahre, bis Jäger festgenommen wurde – am 10. April 1959, wegen »Mordverdachts«. Man stockt …
Sein Verhalten in der Haft war charakteristisch für Täter seiner Gattung, und stimmt völlig überein mit meinen Beobachtungen bei den NS-Prozessen vor bundesdeutschen Schwurgerichten über Jahrzehnte hin. Genaue Erinnerungen bis in kleinste Details an alles jenseits des Tatbereichs, aber notorischer Gedächtnisschwund, sobald es um seine Rolle als Kommandeur des Einsatzkommandos 3 ging. Die leugnete er nicht, wollte aber mit den Erschießungen nichts zu tun gehabt haben, sondern nur ihr Chronist gewesen sein. Als hätten seine Männer aus eigenem Antrieb ein Massaker nach dem anderen verübt. Manchmal, so eine Einlassung von ihm, habe er mit Tränen in den Augen in seiner Dienststelle gesessen …
Das sind so die Augenblicke, in denen das Bedürfnis, nicht mehr weiterzulesen, übermächtig wird.
Nun endlich aber war er gefasst, nach später Fahndung. Zu einem Urteil kommt es dennoch nicht. In der Nacht vom 22. auf den 23. Juni 1959 erhängte sich der 73jährige in seiner Zelle mit einem Stromkabel.
Juristen der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen kommen in ihrem Abschlussbericht vom 30. Oktober 1959 zu dem Ergebnis: Für die Vernichtung der Juden Litauens müsse, neben Hitler, Himmler und Heydrich, der SS-Standartenführer Karl Jäger verantwortlich gemacht werden. Eine höhere Einstufung in die Täterhierarchie kann es nicht geben.
Juristisch aber hat er gerade mal mit drei Monaten und zwölf Tagen Untersuchungshaft gebüßt – zwischen Verhaftung und Freitod.
Deutschland, deine Täter …
In seiner Heimatstadt Waldkirch wurde von diesem Selbstmord kaum Notiz genommen. Dort war Jäger bei Besuchen freundlich begrüßt und von niemandem behelligt worden. Dunkle Gerüchte wurden ignoriert, und so sollte es lange bleiben.
Mit anderen Worten, die Mehrheit der südbadischen Kleinstadt verhielt sich wie die übrige Nation in der Nachkriegszeit – sie forderte den Schlussstrich. Nicht Karl Jäger war für sie das Problem, sondern jene Nestbeschmutzer, die Aufklärung forderten über die Biographie des erfolgreichsten unter den damaligen Einsatzkommandochefs.
Stark angefeindeter Oberbeschmutzer aber, die Persona non grata weit übers Örtliche hinaus, war und ist der Waldkircher Bürger Wolf ram Wette, Autor dieses und zahlreicher anderer Bücher im Dienste der Aufklärung über den Nationalsozialismus und seine Folgen. Er hat die Personalie Karl Jäger zum »Fall« gemacht, was ihm nachgewiesener maßen bestimmte Kreise auch über fünfundsechzig Jahre nach dem Untergang des Dritten Reiches sowohl heimlich wie auch offen übelnehmen.
Und so widerspiegelt sich im Mikrokosmos Waldkirch der Makrokosmos der ganzen deutschen Nachkriegsgesellschaft: Angstbesetzte Verdrängung, sprachlose Abwehr, tiefe innere Beziehungslosigkeit zur Welt der Opfer, und sei ihr Leid auch noch so überwältigend dokumentiert, Gefühlskälte, Generationenkonflikte – beschwiegene Schuld. Wette schreibt: »Hier wird der Grundkonsens der Demokratie gefährdet.« Ja!
Ich habe das die »zweite Schuld« genannt, die nach der ersten unter Hitler. Das aber nicht bloß als eine rhetorische oder moralische Kategorie, sondern als fest im Schoß der Gesellschaft verankerter »großer Frieden mit den Tätern«. Von wenigen Ausnahmen abgesehen sind sie straffrei davongekommen, sie konnten ihre Karrieren auch unbeschadet fortsetzen – eine Fehlgeburt der Bundesrepublik Deutschland.
Da atmet man auf, wenn die Rede ist von historisch interessierten Bürgern, die im Rahmen einer städtischen Kulturwoche mit dem Thema »Waldkirch 1939 – davor und danach« das Tabu »Karl Jäger« gebrochen haben. Und wenn ich lese, wie Schülerinnen und Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Überlebenden begegnet sind, die nach Waldkirch eingeladen waren, dann wird mir ganz warm ums Herz. Die »Deckel-zu«-Fraktion ist stark, hat inzwischen aber an Boden verloren.
Und Litauen – heute?
Die exemplarische Haltung unterscheidet sich von der der Waldkircher kaum – Wahrnehmung der Vergangenheit und Auseinandersetzung mit ihr erfolgen hochselektiv.
Dabei steht die Opferrolle unter Moskauer Herrschaft (1940–1941 und 1944–1989) ganz im Vordergrund, während die deutschen Jahre (1941–1944) nahezu kollektiv verschwiegen werden. Und damit absichtsvoll auch der Holocaust an den Juden Litauens.
Diese Sichtweise bestätigt sich beispielhaft an einer an der Außenwand des traditionsreichen Polizeigebäudes in Kaunas angebrachten Gedenktafel. Sie erinnert an die »Russenjahre«1940/41 und 1944–1989, blendet aber die drei Jahre unter deutscher Besatzung völlig aus. Kein Wort davon, dass hier auch Karl Jäger bis zu seiner Versetzung vom 1. August 1943 residiert hatte.
Obwohl den Litauern bald entgegen ihren Hoffnungen klarwurde, dass die neuen Herren dem Land keine Selbständigkeit geben würden, sondern der einheimischen Verwaltung einfach die deutsche übergestülpt wurde – der litauische Widerstand war, wenn überhaupt, schwach. Hier war vielleicht mehr so etwas wie eine lokale Komplizenschaft zwischen Mördern, ein arbeitsteiliger Korpsgeist des schlechten Gewissens entstanden. Die Viertelmillion insgesamt umgebrachter litauischer Juden liegt nicht nur wie ein Stein auf der deutschen Geschichte, sie war und ist bis heute auch die schwerste Hypothek des Baltenstaates, Quelle jenes »Schweige- und Leugnungskartells«, das immer noch in Kraft ist, obwohl auch dort neue Generationen herangewachsen sind.
Seit 1998 gibt es zwar eine internationale Kommission zur Erforschung nationalsozialistischer und sowjetischer Verbrechen in Litauen, an der unterschiedlichen »Rangordnung« beider hat sich im öffentlichen Bewusstsein des Landes jedoch wenig geändert. Längst verklärt ein Kult heroischer Taten gegen die Sowjetherrschaft die eigene Geschichte, während gleichzeitig jede Selbstkritik als nationale Schande denunziert wird.
Im Herbst und Winter 1941 geschah übrigens am Rande von Kaunas ein anderes Großverbrechen, für das die Wehrmacht allein verantwortlich war: das Massensterben sowjetischer Kriegsgefangener in der Nähe des Flughafens – Berge von Leichen, dahingerafft von Hunger und Entkräftung. Die Zahl der Toten wird auf etwa 75000 geschätzt, ein Bruchteil der rund drei Millionen Rotarmisten, die in deutscher Gefangenschaft umgekommen sind.
Die jüdische Gemeinde Litauens ist heute bis auf 4000 geschrumpft – von ehemals 240000 des Jahres 1939. Damit sind sechs Jahrhunderte jüdischer Geschichte nahezu ausgelöscht, und ihr Buch so gut wie geschlossen. Ein Lehrstuhl jüdischer Studien an der vierhundert Jahre alten Universität in der Hauptstadt Vilnius ist dabei nur ein schwacher Hoffnungsstrahl.
Aber die Suche nach der Wahrheit geht weiter.
Sie ist das Motiv des Buches, und für mich auch ein Akt von Zivilcourage. Als Überlebender des Holocaust bedanke ich mich dafür bei Autor und Verlag.
Beide haben sich um die Opfer verdient gemacht.
Ralph Giordano
Teil I:Ein Täter aus der zweiten Reihe und seine Opfer
1.Das kleine Land Litauen als Testgelände für die Vernichtung der Juden
Litauen lag weder damals, während des Zweiten Weltkrieges, im Brennpunkt des deutschen Interesses, noch ist dies heute der Fall. So ist hierzulande nur wenig bekannt, dass die Ermordung des jüdischen Bevölkerungsteils dieses Landes seinerzeit rascher, radikaler und vollständiger betrieben wurde als anderswo. Das kleine Land Litauen stellte so etwas wie ein Testgelände dar, auf dem SS-Einsatzkommandos, Polizeiverbände und Zivilverwaltung in Komplizenschaft mit der Wehrmacht und einheimischen Kollaborateuren erprobten, wie weit sie bei ihren Mordaktionen gehen konnten, ohne auf Widerstand in den eigenen Reihen oder bei der Bevölkerung des militärisch besetzten Landes zu stoßen, und wie schnell und gründlich sie bei ihrem grausamen Vernichtungswerk vorgehen konnten.
Über das Mordgeschehen in Litauen informieren aus Tätersicht detaillierte Berichte eines SS-Führers, dem Kommandeur des Einsatzkommandos 3 (EK3) SS-Standartenführer Karl Jäger. Das EK3 war eine jener zunächst mobilen, dann stationären Mordeinheiten, die nach dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 unmittelbar hinter den deutschen Heeresverbänden in die eroberten Gebiete einzogen. Die Einsatz- und die Sonderkommandos der SS begannen sogleich damit, eine große Anzahl von Juden zu erschießen. Da die Mörder von Mord nicht reden wollten, umschrieben sie die Massaker mit dem beschönigenden Begriff »Aktionen«.
Vom 1. Dezember 1941 an war Jäger zugleich Kommandeur der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes (KdS). Dabei handelte es sich um eine stationäre Dienststelle mit Sitz in Kaunas[2], der zweitgrößten Stadt des Landes, die in der Zeit zwischen den Weltkriegen die zeitweilige Hauptstadt Litauens gewesen war. Jäger lieferte seinen Vorgesetzten laufend detaillierte Berichte über die Exekutionstätigkeit seines Einsatzkommandos. Einige von ihnen sind erhalten geblieben. Der umfangreichste, als Geheime Reichssache klassifizierte Bericht vom 1. Dezember 1941, der von ihm selbst handschriftlich unterzeichnet wurde, trägt die Überschrift: »Gesamtaufstellung der im Bereich des EK.3 bis zum 1. Dez.[ember] 1941 durchgeführten Exekutionen.«[3]
Diese neun Maschinenseiten umfassende Vollzugsmeldung wird in der internationalen Holocaustforschung als ein Schlüsseldokument angesehen. Es gibt kaum eine Darstellung zur Vernichtung der europäischen Juden, in welcher der Jäger-Bericht nicht zitiert würde. Denn in keinem anderen Täterbericht wird das Mordgeschehen in einer bestimmten Region Osteuropas so detailliert aufgelistet wie im Jäger-Bericht. Ihm lässt sich entnehmen, wie das EK3 – unterstützt von einer großen Zahl litauischer Kollaborateure – in der zweiten Hälfte des Jahrs 1941 in einer Serie »Aktionen« die Juden in den litauischen Städten und auf dem flachen Lande systematisch ermordete. Der Bericht listet 71 Ortsnamen auf, in denen das EK3 in der besagten Zeit zuschlug, zum Teil mehrfach. In Kaunas gab es dreizehn Mordaktionen, in Wilna sogar fünfzehn.
Die Massenerschießungen begannen unmittelbar nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 und setzten sich in den nächsten fünf Monaten in gewissen Abständen, die keiner erkennbaren Regel folgten, fort. Der Höhepunkt der Mordaktionen lag zwischen Mitte August und Ende Oktober 1941. Litauen war bereits Ende 1941, wie Jäger seinen Vorgesetzten am 1. Dezember des Jahres triumphierend melden konnte, weitgehend »judenfrei«: 137346 jüdische Männer, Frauen und Kinder wurden nach seiner Rechnung bis zu diesem Zeitpunkt ermordet – von insgesamt etwa 200000 Juden, die damals in Litauen lebten, nicht gerechnet die jüdischen Flüchtlinge aus Polen, deren genaue Zahl unbekannt ist, die aber einige Zehntausend Menschen umfasst haben mag.
Anders als die anderen Chefs der zunächst mobilen, dann stationä ren Mordkommandos war der Führer des EK3 und spätere Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD ein pedantischer Protokollant der Exekutionen, die auf seinen Befehl und unter seiner Verantwortung durchgeführt wurden. Die Berichte lassen den gelernten Kaufmann und Buchhalter erkennen, aber auch den Karrieristen, der – nach eigener Aussage – mit seinen Erfolgszahlen einer in der SS verbreiteten Tendenz folgte, »nach oben hin zu glänzen«.[4] Die Historikerin oder der Historiker, die diese Dokumente lesen und zu verstehen versuchen, können ihnen die quantitative Dimension des Geschehens entnehmen: An welchem Tag und an welchem Ort in Litauen wie viele Menschen welchen Geschlechts und Alters durch Angehörige des EK3 und ihre Helfer erschossen wurden.
Einerseits prahlte Jäger mit der unvorstellbar hohen Zahl von über 137000 ermordeten Juden, andererseits zeigte er sich mit ihr auch unzufrieden. Wenn er alleine zu entscheiden gehabt hätte, ließ er seinen Vorgesetzten Stahlecker in Riga wissen, wäre er noch radikaler vorgegangen und hätte noch vor dem Jahreswechsel 1941/42 sämtliche litauischen Juden ausgerottet. Dem Führer der Einsatzgruppe A, SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei Dr.Walther Stahlecker, dem das EK3 unterstand, erklärte er, er hätte am liebsten auch die noch am Leben gebliebenen litauischen »Arbeitsjuden« einschließlich ihrer Familien »umgelegt«. Mit Arbeitsjuden waren diejenigen jüdischen Ghetto-Bewohner gemeint, die teils freiwillig, teils gezwungenermaßen Arbeitsleistungen für die deutsche Wehrmacht und für die deutsche Zivilverwaltung verrichteten. Aber, so klagte Jäger seinem Vorgesetzten, Wehrmachts- und Zivilverwaltungsstellen seien ihm in den Arm gefallen und hätten weitere Massenexekutionen verhindert, weil sie nach wie vor dringend deren Arbeitskraft benötigten. Nützlichkeitserwägungen war es also zu verdanken, dass vorläufig noch je 15000 Juden in den litauischen Großstädten Vilnius und Kaunas und knapp 5000 in der Stadt Siauliai (Schaulen) vor dem Zugriff des EK3 bewahrt wurden.
In Kaunas lebten im Sommer 1941 etwa 40000 Juden. Einige vermochten rechtzeitig vor dem deutschen Einmarsch in das Innere der Sowjetunion zu flüchten. Anderen gelang die Flucht in die litauischen Wälder. Wieder andere mussten ihre Flucht abbrechen und an ihren alten Wohnort zurückkehren. Nahezu die Hälfte der Kaunaser Juden, um die 20000, fiel bereits 1941, im ersten halben Jahr der deutschen Besatzung, den Mordaktionen zum Opfer. Die anderen wurden später ermordet. Nur wenige überlebten.
2.Forschungsstand, Quellenlage, Fragestellungen
Die historische Täterforschung hat sich mit Karl Jäger bislang kaum beschäftigt. Der Jäger-Bericht wird zwar immer wieder erwähnt. Aber näher interessiert hat sich für diesen SS-Führer aus der zweiten Reihe bislang niemand. Der im Jahr 2000 von den Historikern Ronald Smelser und Enrico Syring herausgegebene Sammelband Die SS. Elite unter dem Totenkopf präsentiert 30 Lebensläufe von hochrangigen SS-Führern, zu denen Jäger jedoch nicht gehörte.[5] In der von den Holocaust-Forschern Klaus-Michael Mallmann und Gerhard Paul publizierten Sammlung von 23 Karrieren der Gewalt, womit Täter aus der zweiten und dritten Reihe gemeint sind, wurde Karl Jäger ebenfalls nicht berücksichtigt.[6] Im Übrigen ist in der Holocaustforschung ein genereller Mangel an Biographien von SS-Führern zu beobachten, die an den Vernichtungsstätten das Kommando führten.
In der historischen Fachwissenschaft wie auch in der Öffentlichkeit fand der 1993 von dem amerikanischen Historiker Christopher Browning präsentierte Befund große Beachtung, dass es sich bei den einfachen Angehörigen der Polizeibataillone, die zusammen mit der SS zu den Exekutoren der Judenmorde gehörten, in der Regel um »ganz normale Männer« gehandelt habe, die keineswegs von einem mörderischen Antisemitismus geleitet gewesen seien.[7] Dieser Befund mag für die Angehörigen anderer Polizeibataillone gelten.[8] Allerdings gehörte Jäger auch nicht zu den einfachen Polizisten und Soldaten, die ihre jüdischen Opfer eigenhändig erschossen. Er gab vielmehr die Befehle, die andere ausführten. Daher stellt sich die Frage nach den Handlungsmotivationen von höherrangigen SS-Führern wie Karl Jäger, die im Reichssicherheitshauptamt (RSHA) und in speziellen Lehrgängen auf ihren Mordeinsatz vorbereitet wurden, anders als bei den einfachen Soldaten und Polizisten.
Der Motivforschung sind im Falle Karl Jägers allerdings enge Grenzen gesetzt, da neben den Exekutionsberichten von 1941/42 sowie einigen weiteren Meldungen des EK3 kaum aussagekräftige Quellen zur Verfügung stehen. Die Akten der Dienststelle Jägers in Litauen sind wahrscheinlich vernichtet worden, jedenfalls nicht greifbar. Es gibt keinen zusammenhängenden Aktenbestand, mit dessen Hilfe sich die Logik oder die Abfolge der Judenmorde in Litauen in der zweiten Jahreshälfte 1941 entschlüsseln ließen. Eine wichtige Quelle aus der Nachkriegszeit stellen die Vorermittlungen der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg gegen Jäger aus dem Jahr 1959 dar.[9] In diesem Aktenbestand befinden sich auch die Protokolle der damaligen Vernehmungen Jägers.[10] Allerdings sind sie nicht sonderlich aussagekräftig, da sich der Beschuldigte auf Gedächtnislücken berief, seine Täterschaft leugnete und sich ständig zu entlasten versuchte.
Nach dem Selbstmord Jägers am 22. Juni 1959 übernahm die Staatsanwaltschaft Frankfurt/M. den Fall EK3 und stellte selbst weitergehende Ermittlungen gegen Jägers Stellvertreter Heinrich Schmitz und weitere Angehörige des EK3 an.[11] Die umfangreichen Ermittlungsakten werden heute im Hessischen Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden verwahrt.[12]
Private Quellen, die uns über die Persönlichkeit Jägers, seine Charaktereigenschaften, seine familiären Verhältnisse, seine politische Einstellung und seinen beruflichen Werdegang näheren Aufschluss geben könnten, sind Mangelware. Ein persönlicher Nachlass existiert nicht oder ist nicht zugänglich. Weder die Nachkommen Karl Jägers noch andere Wissensträger waren bereit, dem Verfasser Briefe oder Bilddokumente zur Verfügung zu stellen.
Was zur Person von Karl Jäger gesagt werden kann, stammt im Wesentlichen aus seiner Personalakte, die früher im amerikanisch ver walteten Berlin Document Center verwahrt wurde und sich heute im Bundesarchiv Berlin befindet[13], sowie aus den bereits erwähnten Ermittlungsakten. Weiterhin konnten einige spärliche mündliche Informationen von Zeitzeugen aus Jägers Heimatstadt Waldkirch, die Jäger persönlich kannten, herangezogen werden. Sie stammen aus den Jahren 1989/90.
Nach dem Ende des Kalten Krieges tauchten in den osteuropäischen Archiven neue Dokumente zur Vernichtung der Juden in Osteuropa auf, die von deutschen Historikern aufgefunden und teilweise publiziert wurden.[14] Gleichzeitig hat eine empirische, auf archivarischen Quellen beruhende Erforschung der deutschen Vernichtungspolitik in den verschiedenen Regionen des osteuropäischen Raumes eingesetzt[15], darunter auch Litauens[16], die bereits Eingang in neuere Gesamtdarstellungen[17] gefunden hat.
Die Quellenlage ist also dürftig, aber alles in allem doch dicht genug, um ein ungefähres Bild von der Karriere, der Persönlichkeit und der Rolle Karl Jägers als höherer SS-Offizier in Litauen in den Jahren 1941–1943 zeichnen zu können.
Die forschende Beschäftigung mit einem Massenmörder wie Jäger stellt für den Historiker eine fortwährende nervliche Belastung dar. Mitunter fragt man sich, ob ein Täter wie er eine wissenschaftliche Beschäftigung mit seinen Untaten überhaupt »verdient« hat. Die Antwort ist eindeutig: Erstens haben die vielen Opfer seiner Vernichtungspolitik beziehungsweise die Überlebenden des Holocaust in Litauen und deren Nachkommen ein Anrecht darauf, dass das Geschehen in den Jahren 1941–1944 nicht vergessen wird. Zweitens lässt sich am Beispiel Jäger zeigen, wie unter den spezifischen Bedingungen seiner Zeit aus einem feinsinnigen Musiker ein Massenmörder werden konnte. Drittens folgt die historische Aufklärung über Karl Jäger und die Judenmorde in Litauen keineswegs nur antiquarischem Interesse, sondern sie weiß sich der Einsicht des Holocaust-Überlebenden Yehuda Bacon verpflichtet: »Niemand ist absolut böse, jeder hat einen Funken Menschlichkeit in sich. […] Jeder Mensch muss vorsichtig sein, denn jeder kann in seinem Leben in die Hölle abrutschen. Der Abgrund ist eine Gefahr für uns alle.«[18]
Harald Welzer stellt in seinen Anmerkungen zur Täterforschung aus sozialpsychologischer Sicht fest, dass es »im Fall der Shoah keine gesellschaftliche Gruppe gegeben hat, die sich als immun gegen die Bereitschaft zum Töten gezeigt hat«. Das lasse die Vermutung zu, dass »die meisten von uns unter Umständen wahrscheinlich bereit (sein könnten) zu töten«.[19] Niemand werde als Mörder geboren, vielmehr werde der Einzelne durch bestimmte Umstände und Bedingungen zu einem Menschen, der Morde begeht, auch Massenmorde.
Das bedeutet für den Fall des SS-Offiziers Karl Jäger, dass seine Sozialisation sowie das ideologische und institutionelle Umfeld, in dem er sich in den 1920er, 1930er und 1940er Jahren bewegte, genau betrachtet werden müssen. Erst dann wird man sich einer Antwort auf die Frage annähern können, wie es dazu kommen konnte, dass dieser musisch begabte und in kaufmännischem Denken geübte SS-Offizier in die Lage geriet, zum Henker des litauischen Judentums zu werden.
3.Erinnerungen von jüdischen Opfern aus Kaunas
Die Berichte Karl Jägers über die durchgeführten Exekutionen stellen kalte, technokratische Bilanzen der Judenmorde in Litauen dar. Wer über die Anzahl der Ermordeten hinaus auch etwas über deren Leidenswege erfahren möchte, über Verfolgung, Entrechtung, Ausraubung und Tötung, wird in den Hinterlassenschaften der Täter kaum Aufschlüsse entdecken. Er wird jedoch fündig in den Augenzeugenberichten der kleinen Anzahl von Überlebenden der Judenmorde in Litauen. Sie haben der Nachwelt aus eigener Anschauung, aus eigenem Erleben, Bericht erstattet. Manche von ihnen machten schon während der Ereignisse selbst, häufig unter größten Gefahren, Tagebuchaufzeichnungen. Andere sagten nach dem Kriege als Zeugen vor Staatsanwälten und Gerichten aus. Wieder andere begaben sich gleich nach Kriegsende daran, ihre Erinnerungen aufzuschreiben. Einige schwiegen über Jahrzehnte hinweg und fanden erst ein halbes Jahrhundert nach dem mörderischen Geschehen die Kraft, ihre Erlebnisse zu Papier zu bringen. Nicht selten folgten sie dabei dem Drängen ihrer Kinder.
Die Zeugnisse von Holocaust-Überlebenden aus Litauen sind für den Historiker, der sich für das Geschehen als Ganzes interessiert, also für Täter und Opfer zugleich, eine unentbehrliche Quelle. Selbstverständlich müssen diese Berichte, bei denen es sich zum Teil um traumatische Erinnerungen handelt, auch quellenkritisch gelesen werden.[20] Für die Überlebenden beispielsweise, die nach dem Kriege als Zeugen vor Gericht auftraten, war es nicht immer leicht, zwischen ihren persönlichen Erlebnissen, den Berichten anderer und Angelesenem zu unterscheiden.
In Hinblick auf die Judenmorde in Kaunas 1941 sind unter anderem die folgenden Erinnerungen zu nennen, die in deutscher oder englischer Sprache zugänglich sind: Die Berichte von Zwi Katz, David Ben-Dor, Jokubas Jossade, Solly Ganor, Avraham Tory, Alex Faitelson, Raja Kruk, Elena Kutorgiene-Buivydaite, Jehosjua Rosenfeld, Grigorijus Smoliakovas, Leo Lewinson, Renata Yesner und Helene Holzman.[21]
Die Geschichte des Ghettos Kaunas wurde in den 1990er Jahren vom United States Holocaust Memorial Museum in New York zum Gegenstand einer großen historischen Ausstellung gemacht.[22] An der Ausgestaltung des reich illustrierten Begleitbandes beteiligten sich Historiker, die durch einschlägige Forschungen ausgewiesen waren.
Ein besonders aussagekräftiger Augenzeugenbericht soll an dieser Stelle eigens hervorgehoben werden, nämlich die tagebuchähnlichen Aufzeichnungen der aus Deutschland stammenden und 1941–1945 in Kaunas lebenden Kunstmalerin Helene Holzman. Sie schrieb ihre Erlebnisse bereits im Jahr 1944 nieder, also unmittelbar nach dem Ende der deutschen Schreckensherrschaft in Litauen. Veröffentlicht wurde der Bericht erst im Jahr 2000 unter dem Titel Dies Kind soll leben.[23] Diese Aufzeichnungen bieten die unverhoffte Chance eines tiefen Einblicks in die mörderischen Vorgänge in Kaunas, die in der letzten Juniwoche 1941 begannen, allerdings mit der Einschränkung, dass Holzman weder Zugang zum Ghetto noch zu den deutschen Entscheidungsträgern hatte. Gleichwohl haben Historiker diese Erinnerungen zu Recht geradezu enthusiastisch begrüßt, da die Autorin etwas ganz Besonderes leistet: »Sie ist Augenzeugin und Historikerin des Geschehens zugleich, das verleiht den Aufzeichnungen jene einzigartige Mischung aus mitfühlender Beobachtung und kühlem Blick.«[24]
Selbstbildnis von Helene Holzman, Ende der 1920er Jahre. Das Original ist verschollen.
Helene Holzman wurde 1891 geboren, wuchs in Jena auf, wurde Malerin – Schülerin von Max Beckmann –, Buchhändlerin, Kunst- und Deutschlehrerin. Ihr Vater Siegfried Czapski war der engste Mitarbeiter und Partner von Ernst Abbé in der Führung der Zeiss-Werke in Jena.[25] Helene Czapski-Holzman war eine gebürtige Deutsche, die einen jüdischen Elternteil hatte. Verheiratet war sie mit dem jüdischen Buchhändler Max Holzman. Mit diesem und ihren beiden Töchtern Marie und Margarete übersiedelte sie Ende der 1930er Jahre nach Kaunas.[26] Dort betrieb ihr Mann einen Verlag und eine Buchhandlung. Die Familie wurde sogleich nach dem deutschen Überfall im Juni 1941 verfolgt.
Authentisch und eindringlich schildert Helene Holzman das Schicksal ihres Mannes und ihrer älteren Tochter, die beide ermordet wurden, sowie ihr eigenes bedrohtes Leben und das ungezählter anderer Verfolgter unter der deutschen Besatzung. Sie gibt aber nicht nur den Mitgliedern ihrer eigenen Familie, sondern auch vielen anderen Opfern ein Gesicht.
Die Augenzeugin lässt uns begreifen, dass hinter der Anonymität der Mordbilanzen einzelne Menschen stehen, Männer, Frauen und Kinder, die nichts verbrochen hatten, die aber verfolgt und ermordet wurden, nur weil sie Juden waren. Die Leserin und der Leser lernen die Entrechtung der Juden aus deren eigener Perspektive kennen, ebenso die willkürlichen und brutalen Verhaftungen, die Morde auf offener Straße und die systematisch geplanten Massenerschießungen. Sie bekommen einen Einblick in die Lage der Menschen, die in einem kleinen Ghetto zusammengepfercht waren, aber auch in die Normalität des Lebens außerhalb des Ghettos. Helene Holzman formuliert differenzierte Urteile über deutsche und litauische Menschen, leistet sich kaum eine Pauschalisierung. Hier beobachtet eine kluge Frau, die es versteht, sich anschaulich und präzise zugleich auszudrücken.
In der vorliegenden Täterbiographie über den SS-Standartenführer Karl Jäger werden diese beiden ganz unterschiedlichen Quellen genutzt: Einerseits die kalten Mordbilanzen, andererseits die Erinnerungen von überlebenden litauischen Juden und nichtjüdischen Litauern.
4.Zur Überlieferungsgeschichte des Jäger-Berichts
Interessant ist die abenteuerliche Überlieferungsgeschichte des Jäger-Berichts. Er lag den Nürnberger Militärtribunalen, die in den Jahren 1945 bis 1949 über deutsche Kriegsverbrecher zu Gericht saßen, noch nicht vor. Ein Exemplar des Berichts, nämlich die vierte von insgesamt fünf Ausfertigungen, war noch während des Krieges, bei der Rückeroberung Litauens durch die Rote Armee 1944, in die Hände der Sowjetunion gelangt, die darüber zunächst Stillschweigen bewahrte. Erst im Jahr 1963 stellte das sowjetische Außenministerium dieses einzigartige Dokument einer Behörde der Bundesrepublik Deutschland zu, nämlich der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen für die Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg.[27] Dort wurde die Quelle gründlich geprüft und für echt erklärt.
Es dauerte dann noch einmal etliche Zeit, bis das Dokument in Deutschland in vollem Wortlaut publiziert wurde und damit einer interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung stand. Der damalige Leiter der Zentralen Stelle, Oberstaatsanwalt Adalbert Rückerl, druckte den Jäger-Bericht als Faksimile im Anhang zu seinem 1971 veröffentlichten Buch über die NS-Prozesse der letzten 25 Jahre ab.[28] Vermutlich wählte er die Form des Faksimile-Abdrucks, um diese ebenso beeindruckende wie erschütternde Quelle aus sich heraus wirken zu lassen sowie, um die eigenhändige Unterschrift Jägers zu dokumentieren.
Eine Publikation des Berichts in transkribierter Form erfolgte im Jahr 1988 in dem Buch von Ernst Klee, Willi Dreßen und Volker Rieß mit dem Titel: »Schöne Zeiten«. Judenmorde aus der Sicht der Täter und Gaffer.[29] Einen weiteren, von Jäger am 9. Februar 1942 mit eigener Hand geschriebenen und unterzeichneten Bericht über die bis dahin von seinem Einsatzkommando 3 durchgeführten Exekutionen veröffentlichte der Autor dieses Buches 1990 als Faksimile in seinem Buch Politik im Elztal.[30] Das 2003 von Vincas Bartusevicius, Joachim Tauber und Wolfram Wette herausgegebene Werk Holocaust in Litauen. Krieg, Judenmorde und Kollaboration im Jahr 1941 enthält beide Berichte als Faksimile und in Transkription.[31] Ein weiterer Bericht Jägers vom 10. September 1941 mit dem Titel Gesamtaufstellung der im Bereiche des E.K. 3 bis jetzt durchgeführten Exekutionen wurde 2003 in einer offiziellen litauischen Publikation veröffentlicht.[32]
5.»Einer der effizientesten Massenmörder der neueren Geschichte« oder »ein ziemlich inkompetenter Polizeiführer«?
Neben dem Aspekt der exakten Buchführung über Judenmorde in Litauen ist es die Sache selbst, die dem Jäger-Bericht zu seiner internationalen Bedeutung verhalf, nämlich die Ungeheuerlichkeit der in ihm geschilderten Massenmorde. Nach dem Diktum des Historikers Hans-Heinrich Wilhelm, der in seiner Dissertation die Taten der Einsatzgruppe A untersuchte und dabei auch ausführlich das EK3 behandelte, war Jäger »wahrscheinlich einer der effizientesten Massenmörder der neueren Geschichte«.[33]
Der Historiker Knut Stang äußert demgegenüber den Verdacht, Jäger habe mit seinem Bericht in erster Linie renommieren und Karriere machen wollen. Er habe keineswegs eine besondere organisatorische Begabung gehabt. Der Tatbestand, dass Litauen trotz Jägers »Inkompetenz« als Polizeiführer sogar als »Paradefall« einer erfolgreichen Umsetzung der Vernichtungspolitik angesehen wurde, rühre daher, dass die radikalen Unterführer des EK3 schalten und walten konnten, wie sie wollten.[34] Diese Deutung der Rolle Jägers wurde in neueren Forschungen bestätigt.[35]
An dieser Stelle ist allerdings zu fragen: Könnte Jäger nicht beides gewesen sein, ein karrieresüchtiger Aufschneider und ein Massenmörder zugleich, der dadurch besonders effizient war, dass er – im Sinne von Auftragstaktik – seinen Mordkommandos freie Hand ließ?
Teil II:Karl Jägers Werdegang von 1888 bis 1935
1.Kindheit, Jugend, Militärdienst im Ersten Weltkrieg
Karl Jäger wurde am 20. September 1888 in Schaffhausen geboren, einer Stadt in der Nord-Schweiz, unmittelbar an der deutschen Grenze gelegen, bekannt durch den dortigen Rheinfall.[36] Bereits als dreijähriges Kind kam er zusammen mit seinen Eltern nach Waldkirch in Südbaden, einer kleinen Stadt 20 Kilometer nordöstlich der Universitätsstadt Freiburg im Breisgau. Sein Vater war dorthin als Musikschullehrer und als Dirigent der Stadtmusik berufen worden.[37] Zwei Jahrzehnte lang, von 1903 bis 1923, führte Vater Matthäus Jäger in Waldkirch den Taktstock.
Sohn Karl, ebenfalls musikalisch begabt, wurde am Klavier, an der Violine und am Tenorhorn ausgebildet. Er besuchte die erweiterte, achtjährige Volksschule, anschließend eine Handels- und Gewerbeschule sowie ein Musik-Konservatorium. Nach der Schulzeit volontierte er zunächst in der Waldkircher Orgelfabrik Wilhelm Bruder und später in verschiedenen Leipziger Klavierfabriken.
Im Jahr 1913 trat er in die Waldkircher Musikwerkfabrik Gebrüder Weber ein, in welcher Orchestrione, also mechanische Musikinstrumente, hergestellt wurden.[38] Ein Jahr später, 1914, heiratete er Emma Weber, die Tochter des alteingesessenen örtlichen Orchestrion-Fabrikanten Weber, und schaffte damit einen sozialen Aufstieg. Später wurde er sogar Prokurist der Firma. Mit seiner Frau Emma hatte er drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Im gleichen Jahr, in dem Jäger heiratete, verübte seine Mutter Selbstmord. Über die Hintergründe gab es in Waldkirch alle möglichen Spekulationen, aber keine zuverlässigen Informationen. Als seine Mutter starb, war Karl Jäger 26 Jahre alt. Ihr Tod muss ihn schwer getroffen haben.
Prägender als die Ausbildung zum Musiker und Orgelbauer scheint für Karl Jäger seine Militärzeit gewesen zu sein. Im Jahr 1908 meldete sich der Zwanzigjährige als Zweijährig-Freiwilliger und ließ sich beim Feldartillerie-Regiment 86 in Freiburg zum Soldaten ausbilden. Das militärische Milieu sagte ihm zu, wie man daran ablesen kann, dass er in den Jahren 1912 und 1914 freiwillige Reserveübungen ableistete. Bei Kriegsbeginn 1914 wurde er sogleich eingezogen und rückte mit dem Freiburger Artillerie-Regiment an die Westfront. Vier Jahre lang war Jäger Frontsoldat. Er wurde als Meldereiter, Geschütz- und Zugführer sowie als Artillerie-Beobachter bei der Infanterie eingesetzt. Zunächst stieg er zum Unteroffizier auf und wurde schließlich Feldwebel und Offiziers-Stellvertreter. Wegen »vorbildlichen Verhaltens im feindlichen Feuer« erhielt er das Frontkreuz sowie das Eiserne Kreuz I. und II. Klasse. Obwohl zweimal leicht verwundet, konnte er schon bald nach Kriegsende wieder in das heimatliche Waldkirch zurückkehren, rechtzeitig zum Weihnachtsfest des Jahres 1918.[39] Er war nun 30 Jahre alt. Wie Millionen anderer deutscher Männer auch, war er von den Kriegserfahrungen und vom Leben im Militär für sein weiteres Leben tiefgreifend geprägt.
2.Der »Waldkircher Hitler«: Funktionsträger der NSDAP und der SS
Es erging ihm wie vielen anderen nationalistisch eingestellten Männern jener Zeit: Er hatte in den Nachkriegsjahren große Schwierigkeiten, mental den Absprung vom militärischen Milieu zu finden und sich wieder in das zivile Erwerbsleben zu integrieren. Jäger entsprach durchaus dem Typus des »soldatischen Mannes«[40], der in den Jahren der Weimarer Republik dem Dunstkreis militaristischer Kreise geradezu zwanghaft verbunden blieb. Von 1924 an engagierte er sich in der illegalen Schwarzen Reichswehr und zwar in einer Einheit, die ein Hauptmann namens Damm befehligte (Freischar Damm).[41] Dabei handelte es sich um einen nordbadischen Ableger der Orgesch – benannt nach dem bayerischen Forstrat Georg Escherich –, einem Zusammenschluss rechtsradikaler und antisemitischer Selbstschutzverbände mit Schwerpunkt in Süddeutschland. Die Freischar Damm wurde schon 1921 durch den badischen Innenminister Adam Remmele verboten, lebte aber offenbar in der Illegalität weiter.[42]
Ihrem Selbstverständnis nach bildete die illegale und geheime, aber von der Reichswehrführung unterstützte Schwarze Reichswehr eine Heeresreserve für den von den deutschen Nationalisten erwarteten und erwünschten Zukunftskrieg.[43] Ihren personellen Kern bildeten ehemalige Freikorpskämpfer, die politisch rechtsradikal eingestellt waren und der Republik dezidiert feindlich gegenüberstanden. Über ihren militärischen Zweck hinaus erstrebte die Schwarze Reichswehr staatsfeindliche politische Ziele, nämlich die Errichtung einer nationalen Diktatur.[44] Damit war sie ein Teil jenes politischen Milieus, aus dem der Nationalsozialismus emporstieg. Jäger blieb in der Truppe des Hauptmanns Damm bis zu deren faktischer Auflösung im Jahr 1927.
Ungefähr gleichzeitig mit seinem paramilitärischen Nachkriegsengagement begann sich Jäger für die Bewegung Adolf Hitlers zu begeistern. Bereits im Jahr 1923, als die drei Jahre zuvor gegründete Partei noch eine politische Splittergruppe war, wurde er Mitglied der NSDAP und baute in seiner – vom politischen Katholizismus geprägten – Heimatstadt Waldkirch eine Ortsgruppe auf. Im gleichen Jahre versuchte Hitler in München einen Putsch gegen die Republik. Die Regierung des Landes Baden nahm dies zum Anlass, die NSDAP im gesamten Land zu verbieten, und zwar unter Berufung auf das bereits 1921 erlassene Reichsgesetz zum Schutz der Republik.[45]
So wurde auch die NSDAP-Ortsgruppe Waldkirch im Jahr 1925 wieder aufgelöst. In den Jahren 1925 bis 1930 setzte Jäger seine politische Tätigkeit in einer Nachfolgeorganisation fort, die sich Deutsche Partei im völkisch sozialen Block nannte. Er entfaltete eine rege politische Werbetätigkeit im gesamten Bezirk Waldkirch. Seitdem war Jäger – eigenem Zeugnis zufolge – im ganzen Elztal als »Waldkircher Hitler« bekannt, und innerhalb der NSDAP gehörte er zu den »alten Kämpfern«.[46]
Als es ihm im Jahr 1930 gelang, in Waldkirch erneut eine Ortsgruppe der NSDAP