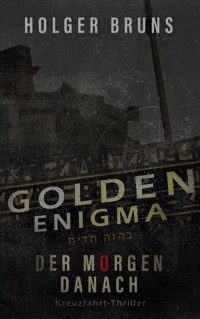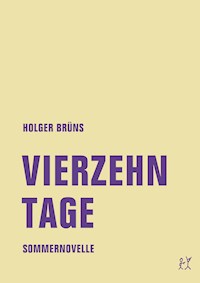15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Albino Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1984. Tom ist Anfang zwanzig, macht seinen Zivildienst im Göttinger Klinikum. Er verliebt sich in Felix. Der hat Häuser besetzt, wohnt in einer großen autonomen Hausgemeinschaft und ist mit Katja zusammen. Sie beginnen eine Beziehung, die auf die Probe gestellt wird, als Felix positiv auf HIV getestet wird. Nach einem Jahr findet sich Tom in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem sterbenden Mann, anstatt in kollektiven Zusammenhängen die Welt zu verändern. Das Ende kommt anders als erwartet. Während Tom noch versucht, Zweisamkeit und Tod mit den Ideen von Gemeinsamkeit und Leben in Einklang zu bringen, erfährt die Wahrhaftigkeit seiner Beziehung zu Felix einen jähen Bruch. Holger Brüns' Roman "Felix" erzählt in knapper und präziser Sprache von einer Liebe, die mit hehren Idealen beginnt, aber an einer großen Lüge scheitert. Indem er die Handlung in der autonomen Szene der BRD der Achtziger verortet, schreibt er der Geschichte die Frage, wie politisch das Private ist, unmittelbar ein, und indem er seinen Erzähler zum Fragenden in einer Welt der steilen Thesen macht, verdeutlicht er die Aktualität des Zeitgeists von damals: Hausbesetzungen, Anti-AKW-Aktionen, Hamburger Kessel und die Anfänge der Aids-Krise werden zur Folie für aktuelle Wohnraum-Debatten, Fridays for Future, G20 und die Covid-Pandemie. Ein kämpferischer Roman über die immerwährende Frage, wie wir zusammenleben und trotzdem frei sein können – als Individuen, als Paar, als Gesellschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
FELIX
HOLGER BRÜNS
FELIX
ROMAN
1. Auflage
© 2022 Albino Verlag, Berlin
Salzgeber Buchverlage GmbH
Prinzessinnenstraße 29, 10969 Berlin
Umschlaggestaltung: Robert Schulze
unter Verwendung einer Illustration
von istockphoto.com/ulimi
Satz: Robert Schulze
Printed in the Czech Republic
ISBN 978-3-86300-346-3
Mehr über unsere Bücher und Autor*innen:
www.albino-verlag.de
Inhalt
ALS LIEBE. ALS GANZES.
1 HAMBURG: HERBST 1985
2 GÖTTINGEN: FRÜHSOMMER 1984
3 SÜDFRANKREICH: SPÄTSOMMER 1984
4 GÖTTINGEN: HERBST 1984
5 GÖTTINGEN: HERBST 1985
6 GÖTTINGEN UND UMGEBUNG: DEZEMBER 1984 BIS SEPTEMBER 1985
7 GÖTTINGEN, UMGEBUNG: OKTOBER 1985 BIS APRIL 1986
8 PORTUGAL: FRÜHLING 1986
9 BROKDORF UND HAMBURG: JUNI 1986
10 HANNOVER UND GÖTTINGEN: SEPTEMBER 1986
11 BERLIN: OKTOBER 1986
12 GÖTTINGEN: NOVEMBER UND DEZEMBER 1986
13 BERLIN: APRIL 1987
DANK
NACHWEISE DER ZITATE IM TEXT
ALS LIEBE. ALS GANZES.
«… wenn wir also, sagte feder noch mal, suchte weiter den weg zur frage, den knick, in gleicher, gemeinsamer zielsetzung, arbeit aufs ziel hin, jeder seins als unseres, jeder sich als uns, einander gleich werden, leben von gleich zu gleich, ja zugleich, was sei dann, woher, die liebe zu einem, zu einer, in leidenschaft, eigenartig, auch ängstlich, besonders – gesondert? von was denn? aber es läuft so noch immer. (…) was drängt sich da vor, warum? ich will doch nichts extra. wir wollen doch alles, die klasse, uns, wirklich den aufstand des menschen. aber ich lieb den typ. wie mein leben. ach müll. denn wenn er nun stirbt, sterben doch wir nicht, ich nicht, der angriff. und doch. finster. als wäre dann sein tod auch meiner. mein leben auch seins. aber eben genau nur seins. nicht unsres. nicht ihr. nicht wir. was ist das? wie geht das? o mühsam, warte. ich will keine liebesgeschichte. sondern uns. als liebe. als ganzes. nah.»
Christian Geissler
«kamalatta. romantisches fragment»
1HAMBURG
HERBST 1985
Losgefahren ohne Plan. Ins Blaue hinein. Vier Tage Zeit. Felix und ich in seinem alten VW-Bus. Von Göttingen nach Hamburg. Erste Station im Wendland bei Freunden. Weiter über Lauenburg, Büchen, Mölln und Ratzeburg. Herrliche Herbsttage. Die Wälder schon verfärbt, die Sonne wärmt noch. Um die Mittagszeit suchen wir Seen. Zum Baden ist es zu kalt. Wir krempeln die Hosen hoch, halten die Füße ins Wasser.
Neben uns steht ein schwarz-rot-gold bemalter Pfosten. In der Mitte des Sees ist unsere Welt zu Ende. Zonengrenze. Immer wieder kommen wir auf dieser Reise nicht weiter, hören Wege plötzlich auf, zerteilt ein Zaun die Landschaft. Auch auf der anderen Seite sind Dörfer, Wälder und Seen. Dazwischen liegt ein Streifen gepflügtes Land, Wachtürme und Stacheldraht.
Zwei Nächte haben wir im Auto geschlafen. In einem Dorf hinter Ratzeburg wirbt eine Pension mit einer Terrasse zum See. Wir leisten uns ein Zimmer. Die Wirtin, nicht unfreundlich, lässt sich Ausweise zeigen und kassiert im Voraus. Zwei junge Männer, der eine mit schulterlangen Haaren, der andere kurz geschoren mit einem Ring im Ohr, die aus einem zerbeulten VW-Bus steigen, da ist man besser vorsichtig. Ihr Mann, der uns in dem kleinen Biergarten mit Blick aufs Wasser das Essen bringt, fragt leutselig nach dem Woher und Wohin, stellt, als er die Rechnung bringt, zwei Schnäpse auf den Tisch.
Am nächsten Tag verlassen wir die Pension nach dem Frühstück und fahren an die Ostsee. Wieder halten wir die Füße ins Wasser, laufen Stunden am Strand entlang. Es ist bereits dunkel, als wir zum Auto zurückkommen. Die Heizung ist beim VW-Bus immer das Problem. Entweder lässt sie sich nicht ausstellen oder sie ist ganz kaputt. Unsere hat sich jetzt, pünktlich zu Beginn der kühleren Tage, entschlossen, nicht mehr zu heizen. So ziehen wir, bevor wir losfahren, mehrere Pullover übereinander. Trotzdem wird es schnell kalt und wir legen die Schlafsäcke über die Beine. Wir haben eine Kassette in den Player geschoben. Ton Steine Scherben. Die Texte können wir auswendig, laut singen wir mit.
«Ich hab’ geträumt, der Winter wär’ vorbei
Du warst hier und wir waren frei
Und die Morgensonne schien
Es gab keine Angst und nichts zu verlieren
Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren
Das war das Paradies
Der Traum ist aus. Der Traum ist aus.
Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird»
Dichter Nebel liegt über der Landschaft. Die Scheinwerfer fressen helle Bahnen ins weiße Nichts. Kurz vor Hamburg wird der Nebel dünner. Als wir schließlich das Auto auf einem Parkplatz an der Elbe abstellen, leuchtet der Mond am wolkenlosen Himmel. Wir steigen aus und springen eine ganze Weile am Strand herum, hüpfen und rennen um die Wette, bis uns wieder warm ist. Wir stehen und schauen auf den Fluss, auf das dunkle Wasser, den Mond und die Sterne, Felix hinter mir, die Arme um meine Brust geschlungen. Ich spüre seinen Atem im Nacken.
Villen ziehen sich den Hang hinauf. Zwischen zehn und halb elf abends kommen die Hundebesitzer zu einer letzten Runde an die Elbe hinunter. «Danach ist hier niemand mehr bis zum nächsten Morgen», so sagt Felix, der hier schon öfter übernachtet hat. Es gibt eine Bushaltestelle hundert Meter weiter. Von dort kann er am nächsten Morgen in zwanzig Minuten im Krankenhaus sein. Gern hätte ich ihn begleitet, aber er lässt nicht mit sich handeln. «Ich muss da allein hin. Du kannst mir nicht helfen.» Und ich verstehe ihn. Wie das Testergebnis auch ausfällt, positiv oder negativ, baldiger Tod oder langes Leben, ich verstehe, dass Felix erst eine Weile für sich sein, nicht sofort darüber reden will.
Felix kann leise sein. Als ich am nächsten Morgen aufwache, ist er schon weg, der Platz neben mir leer, seine Bettdecke, in die ich mein Gesicht vergrabe, noch warm. Im Auto ist es kalt, die Fenster beschlagen. Herunterlaufendes Kondenswasser hat Bahnen auf das Glas gemalt. Durch schmale Streifen zeigt sich blauer Himmel. Ich schiebe die Seitentür auf. Die Sonne glitzert in Tautropfen an bunten Blättern und langen Grashalmen. Im silbrigen Wasser der Elbe zieht ein Containerschiff vorbei und lässt die Wellen höher auf den Sand laufen. Ich gehe hinter die Büsche zum Pissen. Auf dem Parkplatz steht einsam ein blauer Opel. Der hat gestern Nacht schon dort gestanden, als wir ankamen.
Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Ist aber auch egal, Felix und ich sind erst am Mittag verabredet. Ich nehme eine alte Decke aus dem Auto, lege sie auf den feuchten Sand. Ein kleiner Schlepper fährt Richtung Hafen. In einiger Entfernung stehen drei Möwen am Wasser. Sie heben abwechselnd ein Bein. Das ist alles.
Gegen Mittag ziehen Wolken auf. Plötzlich ist es grau. Ich räume die Decke ins Auto, fahre los. Hamburg, Elbchaussee. Durch Altona nach Ottensen, einige Male im Kreis, bevor ich an dem Café vorbeifahre, in dem wir verabredet sind. Die Suche nach einem Parkplatz dauert eine weitere Viertelstunde. Als ich den VW-Bus abschließe, fallen erste Tropfen.
Das Café ist eigentlich eine großen Erdgeschosswohnung, mehrere Räume, die Türen sind ausgehängt, die Türrahmen farbig gestrichen. Einige Wände sind schwarz, andere weiß, bunte surrealistische Bilder. Möbel abgenutzt, alte Sofas, Sessel, dazwischen kleine runde Kaffeehaustische mit Stühlen. Duft von Kaffee und Zigaretten. Leise Musik, Gemurmel. Es ist gut besucht. Ich setze mich an einen freien Tisch, bestelle eine Schale Milchkaffee und hole mir eine Zeitung.
Eine große schlaksige Frau mit langen dunklen Haaren wandert ruhelos durch die Räume. Auf irgendeinem Trip hängen geblieben, spricht sie leise mit sich selbst. Andere scheint sie kaum wahrzunehmen. Umso überraschender, als sie an einem der Tische stehen bleibt, um nach Tabak zu fragen. Schnell und ohne hinzusehen, dreht sie eine dünne Zigarette. Das angebotene Feuerzeug nimmt sie nicht in die Hand. Sie streicht ihre Haare zur Seite, beugt sich zu den Sitzenden hinunter und lässt sich Feuer geben. Dann nimmt sie ihre Wanderung wieder auf. Ein rotgestrichener Türrahmen hat magische Wirkung. Sie steht davor, macht einen kleinen Schritt, zuckt zurück, schüttelt den Kopf, steht versunken. Holt Anlauf, macht einen Schritt vorwärts und prallt gegen ein unsichtbares Kraftfeld. Langsam dreht sie um, geht wieder durch die Räume, bis sie den roten Türrahmen von der anderen Seite erreicht, wo sich das Spiel wiederholt. Anscheinend ist sie hier bekannt. Niemand schenkt ihr Beachtung.
Plötzlich steht Felix vor dem Tisch, zwei Gläser Sekt in der Hand. Ein Lächeln huscht über sein Gesicht, als er sich setzt und mir wortlos eines der Sektgläser zuschiebt. Er hebt sein Glas, hält es mir hin. Wir stoßen schweigend an und trinken. Die Gläser sind von außen beschlagen. Felix dreht sich eine Zigarette. Als ich ihm Feuer gebe, nimmt er meine Hand mit dem Feuerzeug in seine beiden Hände und hält sie fest. Eine Weile klebt die Zigarette in seinem Mundwinkel. Er legt sie in den Aschenbecher. Ich könnte heulen. «Ja, ist so», sagt Felix und trinkt noch einen Schluck Sekt. «Positiv. Ich bin HIV-positiv.» Wir beobachten die Frau, die leise mit sich spricht, zwischen ihr und uns der unüberwindliche rote Türrahmen. Als sie sich umdreht und im Nachbarraum verschwindet, rollen ein paar Tränen über mein Gesicht. Mit einer Hand wischt Felix sie ab. «Nicht weinen. Ist nicht schlimm. Wird schon.» Wir trinken aus und gehen.
Es hat aufgehört zu regnen. Die Sonne kommt hinter den Wolken hervor. Die Luft frisch, nicht kalt. Ziellos gehen wir durch die Straßen. Vor einem Kaffee stehen Tische und Stühle in der Sonne. Ein junger Mann wischt sie mit einem Handtuch trocken. Wir setzen uns, bestellen noch einmal Sekt. Wir reden nicht viel. Was gibt es da auch zu reden? Ob ein, zwei oder drei Jahre, Felix wird sterben und ich werde ohne ihn leben müssen.
Wir holen das Auto, kaufen auf dem Weg noch ein Sixpack Bier und fahren zu unserem Parkplatz an der Elbe zurück. Wir machen die Seitentür und die Heckklappe des Bullis auf. Die Sonne steht so niedrig, dass sie ins Auto scheint. Auf der Matratze sitzend trinken wir Bier und spielen Backgammon. Nach dem dritten Spiel schläft Felix ein und ich gehe ein Stück am Wasser entlang.
Ich setze mich in die offene Seitentür und mache das letzte Bier auf. Felix blinzelt. Ich kuschele mich neben ihn unter die Bettdecke. So liegen wir, bis die Sonne untergegangen ist und die Luft feucht wird. «Ich habe Hunger, lass uns was essen gehen.» Ich bin ein bisschen betrunken, da ist essen vielleicht gar nicht so schlecht. «Das Auto lassen wir hier. Ich glaube, an der S-Bahn ist ein Italiener.» Wir schließen den VW-Bus ab und gehen Hand in Hand Richtung S-Bahn. Straßenlaternen flammen auf, streuen Licht. An der Betonwand einer Garage steht mit gelber Farbe gesprüht: «Ihr wolltet doch immer strahlende Kinder – jetzt habt ihr sie.» Daneben ein Atomzeichen. In Brokdorf, ein Stück die Elbe hinauf, wird ein neues Atomkraftwerk gebaut. Felix zeigt auf den Spruch und sagt: «Eigentlich ist doch egal, woran man stirbt.» Ich versuche es mit Trotz: «Du stirbst nicht.» Aber Trotz hat bei Felix noch nie funktioniert: «Doch, ich sterbe. Besser, du gewöhnst dich an den Gedanken.»
Der Italiener an der S-Bahn hat aus unerfindlichen Gründen geschlossen. Auf der anderen Seite der Bahn ist ein Imbiss, in dessen Fenster sich gebratene Hühner an Spießen drehen. «Das finde ich eigentlich noch besser als Italiener.» Wir bestellen halbe Hähnchen mit Pommes und zwei große Bier, stellen uns an einen Stehtisch und schauen auf den Eingang zur S-Bahn. Ein leerer Platz, Bäume am Straßenrand, wenige Menschen. Der Wirt bringt Bier und Essen, bleibt einen Moment neben uns stehen. Felix nickt ihm zu und hebt den Daumen, da geht er wieder hinter seinen Tresen. Im Radio läuft NDR 2. Eine Frau zieht die Tür auf und bestellt zwei ganze Hühner zum Mitnehmen. Ein alter Mann kauft drei kleine Fläschchen Mariacron. Der Wirt lässt den Verschluss eines weiteren Flachmanns knacken und füllt den braunen Inhalt in zwei Gläser: «Na komm, Erwin, einer geht aufs Haus!» Sie stoßen an und unterhalten sich leise. Das Radio bringt Nachrichten. Wir trinken jeder noch ein großes Bier, laufen durch Straßen bis zur Elbe hin. Down to the river.
Zwischen alten Hafenschuppen eine schummrige Kneipe. Die Zwiebel. Über Holztischen rustikale Lampen aus Messing. Vor ein paar Jahren haben hier noch Netze und präparierte Fische an der Wand gehangen, haben Hafenarbeiter hier getrunken. Inzwischen lange Haare und zerrissene Lederjacken, junge Leute zwischen zwanzig und dreißig. Statt Schlager und Seemannslieder die Doors und die Rolling Stones.
«Ich kann kein Bier mehr trinken». Felix bestellt zwei doppelte Wodka auf Eis. Die nächsten zwei hole ich. Mit dem halben Huhn und den fettigen Pommes als Grundlage trinken wir weiter. Kurz nach zwölf auf dem Weg zum Auto, schwankt das Kopfsteinpflaster erheblich unter uns und ich brauche eine ganze Weile, bis der Schlüssel in die Tür des Busses passt. Felix raucht noch eine Zigarette vor der Tür. Ich bin eingeschlafen, bevor er neben mir unter die Decken gekrochen kommt.
Am nächsten Morgen bin ich als Erster wach. Wo gestern noch Tau glitzerte, ziert heute Raureif die Grashalme und ein leichter Dunst liegt über der Elbe. Die Blätter an den Bäumen sind noch bunter geworden. Es könnte ein wunderbarer Tag sein. Nein, es ist ein wunderbarer Tag. Obwohl wir gestern so viel getrunken haben, fühle ich mich klar und frisch. Als Felix wach wird, fahren wir in ein Café am Rotherbaum zum Frühstück. Alles ein bisschen schicker, mit Stoffservietten neben den Tellern und frisch gepresstem Orangensaft.
Nach dem Frühstück fahren wir zur Hafenstraße. Ich weiß nicht genau, in welchem Haus Axel wohnt, der vor einem halben Jahr von Göttingen hierhergezogen ist. Klingelschilder gibt es natürlich nicht. Wir fragen zwei Leute, die aus einem der Häuser kommen, aber die zucken nur die Schultern. Schnell geben wir auf. So wichtig ist es nun auch wieder nicht. Wir sitzen auf der Balduintreppe, vor uns die breite Straße, dahinter die Elbe. «Was haben sie in der Klinik gesagt?» «Es wäre besser, wenn ich mir einen Arzt in Göttingen suchen würde. Sie haben mir welche aufgeschrieben.» «Und was soll passieren? Musst du Tabletten nehmen oder so was?» «Es gibt verschiedene Meinungen.»
Auf dem Trockendock von Blohm+Voss liegt ein großer Frachter. Die Kräne drehen sich, Menschen sind nicht zu sehen, sie arbeiten wohl im Inneren des Schiffs. An einer Stelle wird geschweißt, ein Funkenregen fällt an der Bordwand herab. Die Fährschiffe nach Övelgönne und Teufelsbrück sehen auf dem breiten Fluss wie Spielzeug aus. Auf einer Bank aus rohen Brettern sitzt eine Gruppe Punks und trinkt Bier. Fünf Hunde jagen sich die abschüssige Wiese hinauf und hinunter mit lautem Gebell. «Lass uns nach Göttingen fahren. Ich will nach Hause.»
2GÖTTINGEN
FRÜHSOMMER 1984
Göttingen. Eine Universitätsstadt, rund hundertdreißigtausend Einwohner, davon ein gutes Viertel Studenten. Es gibt Hausbesetzer und die Anti-AKW-Bewegung, den Kommunistischen Bund Westdeutschlands und die Alternative Liste, die Autonomen, die Antiimps, Punks, Hippies und Ökos. Es gibt Überschneidungen, es gibt Allianzen und Freundschaften, strategische Kooperationen, neue und alte Feindschaften. Es gibt mehre Burschenschaften und an der Uni den RCDS. Dreißigtausend Studenten schließen sich in den ersten Semestern ihres Studiums der einen oder anderen Gruppe an, bevor sie in ihre akademische Laufbahn und aus den politischen Zusammenhängen verschwinden, in andere Städte umziehen oder als Ökobauern aufs Land gehen. Sie werden zuverlässig durch neue Erstsemester ersetzt. Nicht anders als in Freiburg oder Heidelberg, Tübingen oder Marburg.
Göttingen hat eine große autonome Szene, entstanden Anfang der Achtzigerjahre aus der Besetzung der leerstehenden Gebäude der alten Universitätskliniken, der Augenklinik, der Inneren. Seit deren Räumung haben sich die ehemaligen Hausbesetzer über die ganze Stadt verteilt. Der grüblerische Selbstzweifel ihrer Diskussionen zieht mich an. Wie sie bin ich überzeugt, dass die Gesellschaft uns von unseren ursprünglichen Bedürfnissen entfremdet hat. Dass Macht, Hierarchie, Besitz und Konsum ein schleichendes Gift in unserem Zusammenleben sind. Wenn wir die Gesellschaft verändern wollen, müssen wir damit bei uns selbst anfangen. Dafür brauchen wir herrschaftsfreie Räume, in denen wir uns ausprobieren können. Das selbstverwaltete Jugendzentrum Innenstadt, ist ein solcher Ort experimenteller Freiheit. Die Jugendzentrumsinitiative, die Juzi, hatte sich den grauen Kasten an der Bürgerstraße erkämpft. Ich bin im Vorstand des Trägervereins, kümmere mich um die Veranstaltungen.
Gerade zwanzig geworden, wohne ich seit zwei Jahren in einer WG. Die letzten Schuljahre waren quälend uninteressant. Ohne großen Ehrgeiz bin ich so durchgerutscht. Im März vor einem Jahr habe ich Abitur gemacht und nach einem langen Sommer der Freiheit meinen Zivildienst im Klinikum begonnen. Mein Aus- beziehungsweise Einkommen scheint zunächst gesichert. Wer weiß, was danach kommt. Ich könnte mir vorstellen, mich nach dem Zivildienst an einer Schauspielschule zu bewerben. Keine Ahnung, ob es das wirklich ist. Ich nehme mir die Zeit, herauszufinden, was wichtig ist und wie mein Leben aussehen soll.
Zwischen politischer Arbeit und Zivildienst bleibt noch viel Platz. Gerade im Sommer, wenn die Tage lang sind, liege ich, wie alle anderen auch, ganze Nachmittage auf der Wiese oder am Baggersee, klettere mit Freunden nachts über die Mauer des Botanischen Gartens, um unter den großen Bäumen im Mondschein zu kiffen und Wein zu trinken. Oder ich hüpfe im Podium zu lauter Musik auf der Tanzfläche herum.
PODIUM
Das Podium ist eine Diskothek, in der ich, seit ich sechzehn bin, zwei bis drei Nächte die Woche verbringe. Die langgestreckte Halle war früher mal ein angesagter Jazzclub, den sogar mein Vater aus seiner Studentenzeit kannte. Ich denke, die dunklen, verrauchten Räume haben keine Ähnlichkeit mehr mit damals. Vorne steht ein Billardtisch, dann kommt die Theke mit Barhockern und hinten eine kleine Tanzfläche mit DJ-Pult. Eine Diskokugel dreht sich und oft liegt der Geruch von Marihuana in der Luft.
Zwei Uhr nachts. Ein gewöhnlicher Tag mitten in der Woche. Es beginnt sich ein wenig zu leeren. Von den Gästen kenne ich ungefähr zwei Drittel. Das Personal sowieso. Ich sitze mit Gabi hinten neben dem DJ. Wir beobachten die Tanzenden, trinken Bier und rauchen. Als Matze «Tainted Love» von Soft Cell auflegt, springt Gabi auf die Tanzfläche. Mir ist heute nicht so nach tanzen, außerdem brauche ich ein neues Bier. Ich gehe an den Tresen, lasse mir ein Flensburger geben und setze mich nach vorne, beobachte die Jungs, die um den Billardtisch stehen.
Die Tür geht auf und auf einmal wird der Abend interessant. Im Klinikum, auf der Inneren, arbeitet ein Pfleger, in den ich mich ein bisschen verguckt habe. Ich habe die Schwestern auf Station gefragt: Er heißt Felix, und sie glauben, er hat eine Freundin, aber von der erzählt er nie etwas. Schon länger habe ich ihn nicht mehr gesehen. Vielleicht hat er die Station gewechselt. Jetzt kommt er zur Tür herein.
Er scheint ein bisschen betrunken, schaut sich kurz um. Wie so oft, wenn ich jemanden interessant und sexy finde, versuche ich, mein Interesse nicht zu deutlich zu zeigen. Auch wenn hier alle wissen, dass ich schwul bin, Fremden gegenüber bin ich vorsichtig, zumal wenn ich sicher bin, dass sie hetero sind. Wie zum Beispiel bei Felix. Und so ist er es, der mich eine Viertelstunde später, nach einer Runde durch den Laden mit einem Bier in der Hand, anspricht: «Hi, was machst du denn hier?» «Lustige Frage – wie oft warst du schon hier?» «Zwei, drei Mal. Ich gehe nicht so oft in Diskos.» «Das ist hier quasi mein Wohnzimmer. Da könnte ich eher dich fragen, was du hier machst.» «Hast du aber nicht.» «Stimmt. Also: ich trinke Bier und unterhalte mich, oder ich spiele ich Billard, oder …» In dem Moment kommt Gabi verschwitzt von der Tanzfläche. Sie nimmt mir das Bier aus der Hand und trinkt einen kräftigen Schluck. Dann angelt sie sich eine Zigarette aus der Schachtel, die ich gerade in der Hand halte, und zündet sie sich an. Ich hatte eigentlich Felix eine Zigarette anbieten wollen, jetzt stehe ich etwas verlegen zwischen den beiden. Bestimmt denkt Felix, Gabi ist meine Freundin. Sie streicht sich die Haare aus der Stirn: «Ich bin Gabi, und wer bist du?» «Ich bin Felix.» Und mit einer Drehung zu mir sagt er: «Jetzt fehlt nur noch dein Name.» «Tom, ich bin Tom.» «Ach, ihr kennt euch gar nicht?», fragt Gabi. «Vom Sehen. Felix arbeitet auch im Klinikum», antworte ich. Provin kommt zur Tür herein und stürzt gleich auf Gabi und mich zu, um uns die neusten Geschichten von seiner Wohnungssuche zu erzählen. Das ist als Inder in Göttingen nicht ganz einfach, wenn man in kein Studentenheim ziehen will, aber auch nicht viel Geld hat. Felix steht noch eine Weile neben uns, dann geht er nach hinten auf die Tanzfläche. Ich gehe nach Hause, als ich mein Bier ausgetrunken habe. Schließlich ist es kurz nach drei. Um acht muss ich auf der Arbeit sein. An diesem Abend sprechen wir nicht viel miteinander. Aber das war der Anfang. Der Anfang ist meist belanglos.
KLINIKUM
Ich habe mir keine großen Gedanken gemacht, wo ich meinen Zivildienst machen wollte, hatte mir ein oder zwei Stellen angeschaut, aber das Universitätsklinikum in Göttingen schien mir am unkompliziertesten. Ich kann in meiner WG wohnen bleiben, und das Amt übernimmt die Kosten für die Miete. Das erste halbe Jahr ist man beim Krankentransport und danach sucht man sich irgendeine andere Stelle im Haus. Mit den beiden Punks von der Blutbank habe ich schon gesprochen, da könnte ich arbeiten. Aber noch schiebe ich Betten durch die langen Flure des Klinikums.
In dem riesigen Neubau mit seinen zwei Bettenhäusern arbeiten mehrere tausend Menschen, liegen tausendvierhundert Patienten, die hoffen, wieder gesund zu werden. Ich bringe sie von Station zu verschiedenen Untersuchungen oder hole sie von dort wieder ab. Es ist keine anspruchsvolle Aufgabe. Es gibt Stationen, die lieben ihren Zivi. Da gibt es morgens Kaffee und nachmittags ein Stück Kuchen. Wenn eine der Pflegerinnen Geburtstag hat, auch mal ein Glas Sekt. Auf anderen Stationen ist man nur am Rennen, dauernd geht der Pieper. Man steht am nächsten Telefon, um sich die neuen Aufträge abzuholen, und wenn man dann mit einem Bett in den Flur einbiegt, steht die Oberschwester schon in der Tür: «Die vom CT haben schon dreimal angerufen. Wo bleibst du denn?» Aber solche Stationen sind die Ausnahme. Wenn man erst einmal ein paar Wochen dabei ist, weiß man, wie man sie vermeidet und den Hauptamtlichen überlässt, die es schließlich auch gibt. Als Zivi arbeitet man selten länger als ein oder zwei Wochen auf der gleichen Station.
Alle zwei Monate habe ich eine Woche lang Nachtschicht. So ein schlafendes Krankenhaus ist ein besonderer Arbeitsplatz. Ich fange um halb zehn an, da brennt in den Fluren noch helles Neonlicht. Die Reinigungskräfte machen es aus, wenn sie mit ihren Staubsaugern und Wischmop-Eimern weiterziehen. Allmählich wird es ruhig. In den Schwesternzimmern, die auch so heißen, wenn zwei Pfleger drinsitzen, riecht es nach Kaffee. Oft brennt eine einzelne Klemmlampe über dem Schreibtisch und der Rest des Raumes liegt im Dunklen. Die Bettenhäuser atmen, manchmal in ruhigen, gleichmäßigen Zügen, manchmal unregelmäßig, von Nachtklingeln und schlaflosen Patienten unterbrochen, die im Morgenmantel über den Flur schlurfen.
Im großen Mittelgebäude mit den Untersuchungsräumen herrscht völlige Stille. Die Wartebereiche, in denen sich tagsüber zwischen großen Pflanzen in Hydrokultur die Patienten drängeln, liegen in Dunkelheit, die Gänge im schummrigen Licht der Notbeleuchtungen. In regelmäßigen Abständen leuchten grellgrüne Schilder, die die Fluchtwege anzeigen. Aus der Dämmerung leuchten Inseln der Geschäftigkeit. Die größte natürlich die Notaufnahme im Untergeschoss. Dort ist es hell und hektisch. Durch die großen Türen, die nach draußen führen, weht der Wind. In der Einfahrt stehen Krankenwagen, an deren offenen Türen Rettungssanitäter warten und rauchen. Auch in einem der OPs, im Notfalllabor oder auf der Blutbank kann es nachts hektisch werden.
In der Einsatzzentrale der Bettenschieber, schräg gegenüber der Notaufnahme, wird auch geraucht. Hier treffen sich die älteren Festangestellten, und heimlich wird ein Bier getrunken. Ich verbringe die Nächte wie die meisten Zivildienstleistenden lieber in irgendwelchen Stationszimmern oder sitze mit einem Kaffee aus dem Automaten in der leeren Cafeteria im Eingangsbereich.
Die erste Nacht fällt manchmal schwer, aber am Freitag hat man den Rhythmus raus. Die Müdigkeit kommt zwar immer noch gegen halb drei, ist aber nicht mehr so bleiern wie am Montag. Ich bin mit dem Blutfahrrad unterwegs. Das ist ein Klappfahrrad, mit je einem Korb vorne und hinten für den Transport von Blutkonserven, Proben für das Labor oder Dokumenten, die dringend von einer Station zur anderen müssen. Es macht Spaß, mit dem Fahrrad durch die leeren Gänge zu fahren. Vor den Automatiktüren muss man abbremsen, weil sie sich nur langsam öffnen. Die Kunst ist es, schnell zu fahren, ohne beim Bremsen schwarze Spuren auf dem Linoleum zu hinterlassen, sonst gibt es am nächsten Tag Ärger mit den Reinigungskräften.
Es ist eine ruhige Nacht. Ich war ein paarmal im Labor, habe von der Notaufnahme vergessene Unterlagen auf Station gebracht und im Wartebereich vor der Augenklinik sogar ein bisschen geschlafen. Kurz vor drei kommt eine Fahrt von der Blutbank zur Onkologie rein. Als ich in der Tür des hell erleuchteten Büros der Blutbank stehe, sitzt Felix am Tisch und füllt den Lieferzettel aus, überträgt die Seriennummern der Konserven auf ein Formular. Ich stehe schon fast neben ihm, als er hochschaut. «Hi, was machst du denn hier?» «Lustige Frage.» Sein Grinsen lässt mich im Unklaren, ob er sich erinnert, dass unser Gespräch vor einer Woche im Podium genauso angefangen hat. «Ich dachte, du arbeitest auf der Inneren?» «Habe ich. Ich studiere noch und jobbe, wo es eben geht. Jetzt halt mal auf der Blutbank.» Er gibt mir die Konserven. «Ist heute viel los bei dir?» «Nee, ich habe mich eben sogar eine halbe Stunde aufs Ohr gelegt.» «Wenn du magst, dann komm doch wieder, wenn du das Blut weggebracht hast. Ich setz ’nen Kaffee auf.» «Ja, gern, wenn nichts dazwischenkommt.»
Die Onkologie ist im Erdgeschoss, Bettenhaus Zwei, der Weg nicht weit, und ich hoffe inständig, dass nicht gleich der Pieper losgeht, während ich vor dem Fahrstuhl warte. Aber alles ruhige, kein neuer Auftrag. Monika auf der Onkologie hat Stress, findet aber Zeit, mir eine Tafel Schokolade zuzustecken. Zehn Minuten später bin ich wieder bei Felix auf der Blutbank. Die Kaffeemaschine röchelt noch, aber es stehen schon zwei Becher davor. Ich lege die Tafel Schokolade daneben. Dann stehen wir mit den Kaffeebechern draußen auf der Feuerleiter und rauchen. Wir spielen mit einer Pappscheibe im Flur Frisbee. Wir essen die ganze Schokolade.