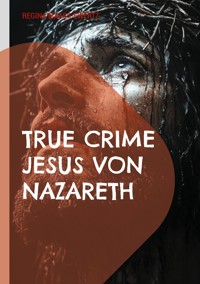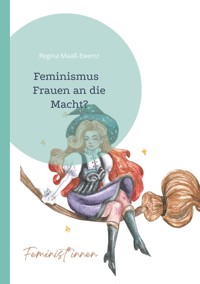
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Feminismus, einst eine Bewegung für Gleichberechtigung, heute oft ein ideologischer Kampfplatz. Frauenquoten in Wirtschaft und Politik sollen Fairness schaffen, doch fördern sie wirklich Gerechtigkeit oder nur neue Ungleichheiten? In einer Zeit, in der Moral und Identität über Leistung gestellt werden, drängt sich eine unbequeme Frage auf: Sind Frauen tatsächlich die besseren Menschen? Dieses Buch räumt mit Mythen auf und zeigt, warum kein Geschlecht eine moralische Überlegenheit für sich beanspruchen kann. Zwischen Ideologie, biologischen Unterschieden und gesellschaftlichen Erwartungen hinterfragt die Autorin kritisch die modernen Narrative und plädiert für echte Gleichberechtigung, ohne Dogmen und Quoten. Ein provokantes, aber notwendiges Buch für alle, die den Diskurs über Geschlechtergerechtigkeit neu denken wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort:
Feminismus – Fortschritt oder Fiebertraum?
Feminismus – allein das Wort löst bei vielen entweder zustimmendes Nicken oder dramatisches Augenrollen aus. Je nach Perspektive ist es die größte gesellschaftliche Errungenschaft seit der Erfindung des Rades oder der Grund, warum der Stammtisch von heute vorwiegend aus Männern besteht, die sich über "Quotenfrauen" echauffieren. Doch bevor Sie Ihr Urteil fällen, lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf das werfen, was Feminismus ist, was er sein könnte – und was er manchmal zu werden droht.
Feminismus, ursprünglich eine Bewegung für Gleichberechtigung, hat im Laufe der Jahre so einige Wandlungen durchgemacht. Was einst mit mutigen Frauen begann, die für ihr Wahlrecht, gleiche Bildungschancen und die Möglichkeit, eigenständig ein Bankkonto zu eröffnen, kämpften, ist heute oft ein buntes Potpourri aus Themen, die zwischen ernsthaft und skurril schwanken. Gendergerechte Ampelmännchen? Natürlich wichtig. Aber was ist mit den Ampelfrauen? Und wo bleibt die Ampel für all jene, die sich weder als Mann noch Frau sehen?
In dieser Debatte gibt es viele Wortführerinnen – einige davon gebildet, diplomatisch und voller Empathie. Und dann gibt es jene, die mit erhobenem Zeigefinger durch Talkshows wandeln, Männer pauschal als Unterdrücker brandmarken und zwischendurch noch eine Ode an die toxische Weiblichkeit verfassen. Der Feminismus war schon immer vielseitig, aber Hand aufs Herz: Manchmal wird aus der Idee von Gleichberechtigung ein lauter Wettbewerb, wer den moralisch korrektesten Lifestyle propagiert.
Humor beiseite, natürlich bleibt Feminismus in seinen Grundzügen wichtig. Es gibt weltweit noch immer unzählige Orte, an denen Frauenrechte mit Füßen getreten werden. Aber während in manchen Ländern Mädchen darum kämpfen, überhaupt zur Schule gehen zu dürfen, streiten wir in westlichen Talkshows darüber, ob "Chef*innen" oder "Chefinnen" die politisch korrektere Schreibweise ist.
Und dann ist da die Frage der Quotenfrauen. Ist es wirklich Empowerment, eine Frau in eine Führungsposition zu hieven, nur weil sie auf dem Formular das richtige Kästchen angekreuzt hat? Oder verwandeln wir damit den Feminismus in eine Farce, indem wir Kompetenzen durch eine Checkliste ersetzen? Vielleicht sollten wir fragen, ob es nicht wichtiger ist, warum jemand aufsteigt, statt nur wer.
Am Ende bleibt eine spannende Frage: Entwickelt sich der Feminismus zu einer ernsthaften Bewegung für Gerechtigkeit – oder sind wir bereits dabei, ihn in eine Form von allgemeiner Hysterie zu verwandeln, bei der es mehr um Lautstärke als um Inhalte geht?
Nun, das werden wir in den kommenden Kapiteln erkunden. Doch bevor wir beginnen: Nehmen Sie sich einen Tee, einen Kaffee oder, wenn nötig, einen Schnaps. Es könnte eine Reise mit einigen Lachern, Kopfschütteln und vielleicht ein paar Erkenntnissen werden.
Viel Spaß beim Lesen – und behalten Sie Ihren Humor!
Feminismus – Von Höhen, Tiefen und einer ordentlichen Portion Chaos
Dieses Buch hat kein Interesse daran, Feminismus auf ein Podest zu heben, ihm Heiligenschein und Flügel zu verleihen und zu rufen: "Hier ist die perfekte Lösung für alle Probleme der Welt!" Stattdessen schaut es genauer hin: auf die Herausforderungen, die Fehler und die Stolpersteine einer Bewegung, die gleichzeitig polarisiert und inspiriert. Denn machen wir uns nichts vor: Feminismus ist nicht der gemütliche Sessel, in den man sich kuschelt, sondern eher der unbequeme Stuhl, der einen zwingt, Haltung zu bewahren – ob man will oder nicht.
Der Feminismus kämpft seit jeher mit dem Spagat zwischen dem Wunsch nach Veränderung und der harten Realität, dass Veränderung verdammt anstrengend ist. Manchmal fühlt es sich an, als ob er mit einer Abrissbirne gegen Betonmauern rennt, während die Zuschauer*innen (keine Sorge, ich werde Sie in diesem Buch nicht weiter mit Gendersternchen belästigen, es sei denn, Sie stehen drauf, gegängelt zu werden) am Rand entweder begeistert jubeln oder entsetzt das Weite suchen. Aber genau das macht ihn aus: seine unbequeme, anstrengende, unperfekte Stärke.
Dieses Vorwort hat keine Mission, Sie zu überzeugen. Es will nicht Ihre Seele bekehren oder Sie dazu bringen, sofort "Feminist*in" in Ihre Instagram-Bio zu schreiben. Vielmehr soll es Sie einladen: Stellen Sie Fragen. Staunen Sie über Erfolge. Schütteln Sie den Kopf über Widersprüche. Und vielleicht, nur vielleicht, sehen Sie am Ende, dass es weniger darum geht, immer alles richtig zu machen, sondern darum, nicht in stiller Akzeptanz zu verharren.
Natürlich hat Feminismus auch seine Macken – wie jede Bewegung, die etwas Großes anstrebt. Linke Ideologien und feministische Träume überschneiden sich oft, und das aus gutem Grund. Beide haben ein gemeinsames Ziel: Die Welt nicht nur zu verwalten, sondern sie grundlegend zu verändern. Dabei wird gern gegen konservative Strukturen getreten, die sie als Stolpersteine auf dem Weg zur Gerechtigkeit betrachten. Doch während sie nach Gleichheit streben, schleicht sich gelegentlich die Frage ein: Werden die Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit noch von der Realität getragen oder gleiten sie manchmal ins Absurde ab?
Seien wir ehrlich: Feminismus und linker Aktivismus haben eine Art Hassliebe zu Hierarchien. Beide wollen sie abbauen, aber manchmal scheinen sie dabei neue zu schaffen. Und während sie mit Ernst und Nachdruck für wichtige Anliegen eintreten, ist es schwer, nicht zu schmunzeln, wenn Gendersterne und Intersektionalitätsdebatten plötzlich wichtiger wirken als tatsächliche Veränderungen vor Ort.
Am Ende bleibt die Frage: Ist Feminismus die große Revolution, die unsere Welt braucht – oder entwickelt sich der aktuelle Hype doch eher zu einer kulturellen Hysterie, die mehr Lärm als Fortschritt erzeugt? Wie dem auch sei, ich lade Sie herzlich ein, sich auf diese Reise durch die unbequemen Wahrheiten und spannenden Widersprüche einer Bewegung zu begeben, die trotz aller Kritik unbestreitbar relevant bleibt.
Kollektivistische Ansätze
Linke Ideologien neigen dazu, die Gesellschaft als Kollektiv zu betrachten und gemeinschaftliche Lösungen zu bevorzugen. Feminismus als Bewegung setzt ebenfalls auf kollektives Handeln, um systemische Probleme wie Geschlechterungleichheit zu bekämpfen.
Sowohl linke Ideologien als auch der Feminismus haben eines gemeinsam: einen ausgeprägten Hang zu utopischen Visionen, die bei manchen Begeisterung auslösen und bei anderen ein Stirnrunzeln. Die Linke malt sich eine Welt ohne Klassenunterschiede aus – eine Gesellschaft, in der jeder Mensch gleich viel besitzt und niemand mehr auf Yacht-Urlaube verzichten muss, weil alle schon eine Yacht haben. Der Feminismus wiederum träumt von einer Welt ohne geschlechtsspezifische Unterdrückung, wo Karriereleitern für Frauen genauso stabil sind wie für Männer und nicht plötzlich in luftiger Höhe abbrechen.
Diese Träume ergänzen sich wunderbar: Beide wollen eine gerechtere, schönere, bessere Welt schaffen. Der Weg dahin? Nun, da wird es manchmal etwas holprig. Während die Linke von Umverteilung und Revolution schwärmt, plädiert der Feminismus für strukturelle Veränderungen und gelegentlich auch für einen fetten Schlag mit der Gleichstellungskelle. Es ist wie bei einem chaotischen Teamprojekt: Das Ziel ist klar, aber über den Weg dorthin wird leidenschaftlich gestritten.
Am Ende sind linke Ideologien und feministische Träume wie ein rebellisches Dream-Team: Sie zoffen sich, sie ergänzen sich, und manchmal reißen sie gemeinsam Mauern ein. Ob der Traum wirklich in Erfüllung geht, wird die Zeit zeigen. Aber eines ist sicher: Ohne ein bisschen Träumerei bleibt die Welt nur ein grauer Büroalltag.
Utopische Träume – Oder: Wenn Theorie und Praxis sich zanken
Sowohl linke Ideologien als auch der Feminismus haben eine Vorliebe für große, utopische Visionen. Die Linke träumt von einer Welt ohne Klassenunterschiede, wo der Begriff "soziale Gerechtigkeit" endlich mehr bedeutet als warme Worte in Wahlprogrammen. Der Feminismus wiederum kämpft für eine Welt ohne geschlechtsspezifische Ungleichheiten, in der weder gläserne Decken noch gläserne Böden Frauen in ihrer Entwicklung behindern.
Doch wie bei jeder guten Utopie steckt der Teufel im Detail. Während die Linke manchmal so sehr in Umverteilungsfantasien schwelgt, dass sie den Realitätscheck vergisst, schießt der Feminismus hin und wieder übers Ziel hinaus. Das Ergebnis sind dann Maßnahmen, die mehr gut gemeint als gut gemacht sind – ein Paradebeispiel dafür: die heiß diskutierte "Quotenfrau".
Und was ist mit der "Quotenfrau"?
Ja, sie ist ein kontroverses Thema, und das nicht ohne Grund. Aber Hand aufs Herz: Wer hat in der Schule nicht mal beim Nachbarn abgeschrieben, um das Ziel ein bisschen schneller zu erreichen? Quotenfrauen sind, nüchtern betrachtet, genau das – eine Abkürzung, die Frauen in Machtpositionen bringen soll. Ob das immer der richtige Weg ist, sei dahingestellt.
Denn hier liegt das Problem: Eine Abkürzung mag für den Moment hilfreich sein, aber sie lehrt selten die Fertigkeiten, die für den langen Weg gebraucht werden. Wenn es nur darum geht, Plätze zu füllen, anstatt echte Talente zu fördern, läuft die Maßnahme Gefahr, nicht mehr als ein Feigenblatt zu sein. Schlimmer noch, sie schafft neue Vorurteile, indem Frauen, plötzlich unter Generalverdacht stehen, nur "wegen der Quote" dort zu sein.
Der Nachteil der Quotenfrau liegt also auf der Hand, und genau das wird später im Buch ausführlicher erörtert. Für jetzt genügt es zu sagen, dass Abkürzungen zwar verlockend sein mögen, aber selten der Weg sind, der wirklich langfristig Bestand hat. Denn Kompetenz lässt sich nicht durch Zahlen auf einem Blatt Papier ersetzen – und Machtpositionen sind kein Schulaufsatz, bei dem das Abschreiben reicht, um zu bestehen.
Das Fazit? Die Diskussion um Quotenfrauen bleibt eine Gratwanderung zwischen Notwendigkeit und Risiko – ein heißes Eisen, das wir später noch gründlich anfassen werden.
Früher haben sich raffinierte Frauen zumindest noch die Mühe gemacht, sich hochzuschlafen – heute reicht es, Quotenfrau zu sein. Was ist nun besser? Darüber lässt sich streiten.
Aber Spaß beiseite: Es reicht nicht, einfach eine Quotenregelung zu erfüllen, um in Politik und Wirtschaft wirklich erfolgreich und verantwortungsvoll zu agieren.
Denn eine „Quotenfrau“ allein genügt aus mehreren Gründen nicht: Führungspositionen verlangen Fachwissen, strategische Denkfähigkeit und Führungsstärke. Ohne diese Fähigkeiten werden Frauen durch Quoten auf bloße Platzhalter reduziert – ein Rückschlag für Feminismus und Gleichstellung. Der Fokus muss auf der Förderung von Kompetenzen und Karrieren liegen, nicht nur auf Zahlen und Geschlecht.
Wer nur wegen einer Quote in eine Führungsrolle kommt, riskiert, von Kollegen, Untergebenen oder Wählern nicht ernst genommen zu werden. Respekt entsteht durch Leistung, nicht durch Quoten.
Kompetenz und Qualifikation sind entscheidend
Eine verantwortliche Position verlangt Fachwissen, Führungsqualitäten und die Fähigkeit, strategische Entscheidungen zu treffen. Ohne die entsprechenden Fähigkeiten reduziert die Quote Frauen auf reine Platzhalter, was dem Feminismus und der Idee von Gleichstellung langfristig schaden könnte.
Eine echte Veränderung verlangt nicht nur eine höhere Beteiligung von Frauen, sondern auch die Förderung ihrer Kompetenzen und Karrieren.
Respekt und Akzeptanz innerhalb der Organisation
Eine Frau, die ausschließlich aufgrund einer Quote in eine Führungsposition gelangt, läuft Gefahr, nicht ernst genommen zu werden – weder von Kollegen noch von Untergebenen oder Wählern.
Ohne das Vertrauen, dass sie ihre Rolle verdient und fachlich gerechtfertigt ausfüllt, ist es schwer, Führungsverantwortung effektiv wahrzunehmen.
Symbolpolitik statt Strukturwandel
Die Quote allein bekämpft nicht die tieferliegenden Ursachen der Geschlechterungleichheit, wie etwa fehlende Förderung, stereotype Rollenbilder oder ungleiche Bildungs- und Karrieremöglichkeiten. Eine Frau in einer Spitzenposition kann ein wichtiges Signal sein, aber ohne strukturelle Veränderungen bleibt die Maßnahme oberflächlich.
Verantwortung und Wirksamkeit
Eine Führungsposition bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für die eigene Karriere, sondern auch für das Unternehmen, die Organisation oder das Land. Frauen in Machtpositionen müssen genauso wie ihre männlichen Kollegen in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen, Risiken abzuwägen und Erfolge vorzuweisen. Die bloße Erfüllung einer Quote bietet keine Garantie für die nötige Verantwortung oder Wirksamkeit. Quotenfrauen werden oft als "Token" wahrgenommen – als Symbol für Diversität, ohne dass man ihnen die gleiche Kompetenz zuschreibt wie ihren männlichen Kollegen.
Diese Stigmatisierung kann Frauen in ihrer Position schwächen und sie unter zusätzlichen Druck setzen. Es ist wichtig, dass Frauen ihre Position durch Leistung und Qualifikation stärken können, nicht allein durch eine Regelung. Die Quote kann helfen, ein Ungleichgewicht kurzfristig zu korrigieren, aber sie ist kein langfristiger Ersatz für echte Chancengleichheit. Bildung, Mentoring-Programme, transparente Rekrutierungsprozesse und die Beseitigung von Vorurteilen sind notwendig, um Frauen systematisch zu fördern und zu unterstützen.
Fazit: Die Quote ist wie ein Korkenzieher: ein nützliches Werkzeug, um etwas zu öffnen, aber sie macht den Wein nicht besser. Sie schafft Möglichkeiten und Sichtbarkeit, aber eine Führungsposition erfordert mehr als nur das Erfüllen einer Regelung. Frauen in Machtpositionen brauchen die richtigen Kompetenzen, echte Unterstützung und vor allem Akzeptanz, um Verantwortung zu übernehmen und wirklich etwas zu verändern. Am Ende sollte das Ziel nicht sein, einfach nur die Zahlen schön aussehen zu lassen, sondern eine nachhaltige Gleichstellung zu erreichen – basierend auf Leistung, Respekt und fairen Chancen. Denn Gleichstellung ohne Substanz? Das ist wie ein Sekt ohne Sprudel.
Unterschied zwischen Emanzipation und Feminismus
Der Unterschied zwischen Emanzipation und Feminismus? Stellen Sie sich vor, sie wären zwei Schwestern mit unterschiedlichen Missionen: Die eine, Emanzipation, räumt Hindernisse aus dem Weg und fordert Freiheit und Eigenständigkeit. Die andere, Feminismus, geht einen Schritt weiter, kämpft für strukturelle Veränderungen und soziale Gerechtigkeit. Beide eint das Ziel von Fortschritt und Gleichberechtigung, doch jede bringt ihren eigenen Fokus und Stil mit in den Ring. Gemeinsam sorgen sie dafür, dass wir in Sachen Gleichstellung vorankommen – nur eben auf unterschiedlichen Wegen.
1. Was bedeutet Emanzipation?
Emanzipation stammt vom lateinischen Begriff "emancipatio" ab und bedeutet wörtlich „Freilassung“ oder „Befreiung“. Ursprünglich bezog sich der Begriff auf die rechtliche und soziale Freilassung von Personen, etwa in der Antike bei der Entlassung von Sklaven oder Unmündigen in die Selbstständigkeit.
Heute steht Emanzipation für die Befreiung von sozialen, kulturellen oder rechtlichen Einschränkungen, die eine Person oder eine Gruppe daran hindern, ihre Rechte oder ihr volles Potenzial zu verwirklichen.
Ziel: Individuelle und kollektive Selbstbestimmung.
Emanzipation betrifft nicht nur Frauen, sondern jede Gruppe oder Person, die nach Gleichberechtigung und Freiheit strebt, z. B. Arbeiter oder ethnische Minderheiten.
2. Was ist Feminismus?
Feminismus ist eine soziale, politische und (*intellektuelle) Bewegung, die sich speziell für die Gleichstellung der Geschlechter und gegen die Diskriminierung von Frauen einsetzt. Der Feminismus betrachtet systematische Ungleichheiten und patriarchale Strukturen als Hindernisse für die Gleichberechtigung.
Ziel: Die Überwindung der gesellschaftlichen, rechtlichen und kulturellen Benachteiligung von Frauen sowie die Schaffung von Chancengleichheit.
Feminismus geht über die persönliche Befreiung hinaus und zielt darauf ab, bestehende Machtstrukturen zu analysieren und zu verändern.
Die Hauptunterschiede auf einen Blick:
Aspekt
Emanzipation
Feminismus
Fokus
Allgemeine Befreiung von Unterdrückung
Spezifisch: Gleichstellung der Geschlechter
Anwen- dungsbereich
Individuell und uni- versell
Geschlechtergerechtig keit
Perspektive
Persönliche Freiheit und Autonomie
Politische und gesellschaftliche Veränderungen
Adressat
Alle Gruppen
sierte Frauen Geschlechter und marginali
Ziel
Selbstbestimmung
chaler Veränderung Strukturen patriar
Zusammenfassend:
• Emanzipation ist ein breiterer Begriff, der jede Form von Befreiung anspricht, sei es auf individueller oder kollektiver Ebene.
• Feminismus ist eine spezialisierte Bewegung innerhalb dieser Idee, die die Gleichstellung der Geschlechter als Ziel hat.
Während also jede feministische Handlung eine Form der Emanzipation sein kann, ist nicht jede emanzipatorische Handlung automatisch feministisch. Beide Konzepte ergänzen sich jedoch und möchten zur Entwicklung einer gerechten Gesellschaft beitragen.
Im Folgenden erkläre ich, warum ich den Begriff „intellektuell“ im Zusammenhang mit heutigen Feministinnen mit einer gewissen Skepsis betrachte – und ja, das ist so charmant formuliert, wie es klingen soll.
Der Begriff „intellektuell“ hat seine Wurzeln im Lateinischen, wo „intellectus“ so viel wie „Verstand“ oder „Einsicht“ bedeutet. Also, zumindest theoretisch. In der Praxis könnte man meinen, er sei heute zu einem Accessoire geworden, das sich manche wie eine schicke Handtasche umhängen, ohne sich Gedanken über den Inhalt zu machen.
Was bedeutet „intellektuell“ wirklich – Bezug auf Verstand?
Im Kern geht es um die Fähigkeit, zu denken – und zwar nicht nur, um passende Zitate für Social-Media-Posts zu finden. Es geht um das Erkennen komplexer Zusammenhänge, logisches Argumentieren und die Anwendung von Wissen. Anders gesagt: Intellektuell zu sein bedeutet mehr, als einfach nur „ein Buch in der Nähe“ zu haben.
Man könnte meinen, der Begriff sei ein Kompliment, aber in manchen feministischen Diskursen gleicht er eher einer höflichen Umschreibung für: „Ich bin nicht sicher, ob das Handeln mit der Theorie mithalten kann.“ Vielleicht liegt es daran, dass „intellektuell“ heute oft mit „viel reden, wenig sagen“ verwechselt wird.
Natürlich, dies alles ist nur ein kleiner Seitenhieb – oder ist es doch eine komplexe Analyse? Entscheiden Sie selbst. Aber bitte mit „intellectus“.
Beispiel:
Eine intellektuelle Diskussion befasst sich mit Themen, die analytisches Denken erfordern.
Ein intellektueller Mensch ist jemand, der gerne über Ideen, Konzepte oder Theorien nachdenkt.
Doch, nicht jeder, der gerne liest, kann automatisch intellektuell denken – sonst wären ja alle, die im Wartezimmer des Arztes mit Zeitschriften blättern, plötzlich Philosophen. Und auch nicht jeder, der Abitur und Studium auf dem Lebenslauf stehen hat, ist intellektuell auf der Höhe. Schließlich hat manch einer das Studium auch nur als Herausforderung genutzt, um sich vor anderen zu profilieren – man muss ja nicht immer alles verstehen, Hauptsache ich bin wer.
Der Begriff „geistig anspruchsvoll“ wird oft verwendet, um Dinge zu beschreiben, die mehr Verstand und weniger körperliche oder emotionale Anstrengung erfordern.
„Intellektuelle Arbeit – das ist Forschen, Schreiben, Planen, also Kopfzerbrechen im Gegensatz zu körperlicher Arbeit, die oft unterschätzt wird. Dabei muss ein Handwerker mindestens genauso klug denken wie ein Theoretiker – nur macht er’s halt ohne Kaffeetasse in der Hand. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Aliens greifen an, die Menschheit wird halbiert, und wir müssen von vorn anfangen. Wer wird uns retten? Der Handwerker, der ein Haus aus Schutt und Asche baut, oder der Intellektuelle, der über das perfekte Design grübelt, während er sich fragt, wo der Strom für den Laptop herkommt?
„Intellektuell“ beschreibt alles, was mit Verstand, Denken und dem geistigen Abtauchen in Wissen und Kultur zu tun hat – also eigentlich das Gegenteil von einem Dauerzustand à la „Ich habe keine Ahnung, aber ich habe eine starke Meinung dazu“.
Synonyme:
• Geistig
• Rational
• Denkend
• Analytisch
Die Fähigkeit, eigenständig zu denken und Zusammenhänge zu verstehen, erfordert, dass man sich nicht einfach unkritisch den Vorstellungen anderer anschließt oder gedankenlos deren unlogische Ideologien verbreitet. Und genau hier liegt der Haken: Wenn das Denken so einfach wäre wie das Teilen eines Memes, wären wir alle ein bisschen mehr „intellektuell“ – aber leider ist es das nicht.
Und hier beginnt das eigentliche Problem: Wenn sich Menschen für intellektuell halten, es aber gar nicht sind, weil sie wie jeder andere auf Ideologien hereinfallen und – schwupps – ihren eigenen Kopf ausschalten. In seinem Buch Psychologie der Massen erklärt Gustave Le Bon anschaulich, wie leicht es ist, Massen zu manipulieren. In der Masse verschwimmen Intelligenz und Hysterie zu einem einheitlichen Brei, in dem jeder glaubt, die Wahrheit gepachtet zu haben – und das Gehirn bleibt zu Hause.
Das führt zu einer wunderbar simplen Erklärung für die hysterischen und hasserfüllten Demos gegen „rechts“, bei denen Intellektualität wie eine vergessene Erinnerung wirkt, während der Mob im Gleichschritt unter gleicher Fahne marschiert – hatten wir alles schon.
Da marschieren Omas gegen rechts Seite an Seite mit maskierten Antifas und liefern sich mit Polizisten und Polizistinnen heiße Gefechte – Verstand? Fehlanzeige. Angeführt von Politikern und Politikerinnen, die eigentlich ein besseres Beispiel vorgeben sollten – aber statt Weisheit zu verbreiten, rufen sie lieber zu Hass und Hetze auf, als ob sie das Drehbuch für einen schlechten Thriller schreiben. Oder von Künstlern und Schauspielern, die für Geld plötzlich alles zu machen scheinen – als würden sie in einer Reality-Show leben, in der der Preis für „die richtige Haltung“ immer höher wird. Diese vermeintlichen „Vorbilder“ scheinen zu vergessen, dass wahre Größe nicht darin besteht, einen Shitstorm zu überstehen, sondern darin, ihn erst gar nicht zu entfachen.
„Gutmenschen“ – Die Grünen, Linken und ihre moralische Überlegenheit im Superhelden-Style
Ah, die Grünen und Linken – die selbsternannten Ritter der Gerechtigkeit. Warum halten sie sich ausgerechnet für die „Gutmenschen“? Nun, vielleicht liegt es daran, dass sie sich in ihrem Kampf für das Gute so oft wie Superhelden in Umhängen fühlen. Mit einem grünen Cape gegen den Klimawandel und einem roten Schild für soziale Gerechtigkeit kämpfen sie tapfer an vorderster Front – zumindest in ihren eigenen Fantasien. Sie sind die wahren Helden der Menschheit, die die Welt retten, ein Veggie-Burger nach dem anderen, und gleichzeitig die moralische Überlegenheit mit sich führen, als wäre sie ein neuer Trend.
Aber ehrlich gesagt, der „Gutmensch“-Stempel könnte auch daher kommen, dass sie sich so sicher sind, dass ihre Haltung immer die richtige ist, dass sie vergessen, wie viel Platz für unterschiedliche Meinungen in einer echten Debatte bleibt. Man könnte fast meinen, sie hätten das Handbuch „Wie man der Welt erklärt, was moralisch richtig ist“ in der Tasche. Selbstkritik kennen diese Leute nicht. Schuld sind immer die anderen. Aber keine Sorge, wenn ein misslungener Tweet für Ärger sorgt, stürzen sie sich dennoch mit großer Geste in die vermeintliche Selbstreflexion – natürlich nicht ohne den obligatorischen Schuss „Aber eigentlich bin ich hier der Held!“ Wirkliche Einsicht? Fehlanzeige. Stattdessen wird die Verantwortung großzügig umverteilt, während sie sich selbst weiterhin ins beste Licht rücken.
Die Geschichte liefert zahlreiche Beispiele dafür, dass linkes Gedankengut gepaart mit starker Ideologie selten wirklich funktioniert hat – vor allem dann nicht, wenn man versucht, anderen Menschen seine Meinung mit Nachdruck aufzuzwingen. Von utopischen Experimenten, die in totalitäre Regimes umschlugen, bis hin zu politischen Bewegungen, die mehr an ideologischen Dogmen als an praktischen Lösungen interessiert waren, zeigt sich immer wieder: Zwang führt selten zu den gewünschten Ergebnissen. Wo Ideologie und Realität kollidierten, blieb oft nur die Ernüchterung. Denn was passiert, wenn man glaubt, die einzige wahre Wahrheit gepachtet zu haben? Genau, es endet meist in einem mächtigen Chaos, in dem niemand wirklich gewinnen kann.
Was vielen Menschen zu Recht gerade wirklich Sorgenfalten bereitet, ist die Tatsache, dass sich insbesondere Feministinnen aus dem linken Spektrum zunehmend mit extremen Mitteln und Handlungen versuchen, ihre Ideologien durchzusetzen – koste es, was es wolle. Und das geht oft weit über das Ziel hinaus, Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit zu fördern. Es wird mit einer Emotionslosigkeit und Brutalität vorgegangen, die alles andere als förderlich für den gesellschaftlichen Dialog sind. Denn es geht nicht nur um die Sache selbst, sondern auch um die verheerenden Nebenwirkungen für den Wohlstand und das Leben von Menschen – besonders der älteren Generation, die bei solch radikalen Maßnahmen zu oft unter die Räder kommt. Hier wird mit eiserner Hand und wenig Rücksicht auf die Folgen eine Ideologie durchgeprügelt, die eher den gesellschaftlichen Frieden gefährdet, als ihn zu fördern. Die Frage, die sich aufdrängt, ist: Wie viel Schaden darf für ein ideologisches Ziel eigentlich in Kauf genommen werden?
Da muss man sich wirklich fragen: Wer oder was hat diese wohlstandsverwöhnte Generation eigentlich so verrohen lassen? War es die unaufhörliche Flut von „Du kannst alles erreichen, wenn du nur an dich glaubst“-Ratgebern? Oder doch die Influencer, die uns beibringen, dass das wahre Leben in der perfekten Insta-Story stattfindet? Vielleicht war es aber auch das ununterbrochene Leben im Luxus, das uns glauben ließ, alles müsse immer bequem und „woke“ sein. Oder – und jetzt kommt der wahre Knaller – sind unsere Schulen und Universitäten längst von grün-links verpeilten (Leerkörpern) unterwandert, die, anstatt den Kindern Lesen und Schreiben beizubringen, nur noch Ideologie verbreiten? Es scheint, als hätten sich einige Pädagogen eher in die Rolle von Aktivisten als von Lehrern eingewählt. Denn was braucht man schon in der heutigen Welt? Lesen, Schreiben – und die perfekte Meinung. Vielleicht hilft ja eine Portion „Realitätscheck“ – am besten ohne ideologische Filter. Aber keine Sorge, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht kommt der Tag, an dem Vernunft wieder der neueste Trend wird.
Es ist doch wirklich an Lächerlichkeit kaum noch zu überbieten, wenn uns 17-jährige Rotzer, die nicht einmal ihr eigenes Zimmer aufräumen können, ernsthaft den Fleischkonsum verbieten wollen. Diese jungen „Götter des schlechten Geschmacks“ haben es plötzlich gepachtet, uns vorzuschreiben, wie wir unsere Ernährung zu gestalten haben – als hätten sie in den letzten wenigen Jahren der Existenz ihre kulinarische Weisheit erlangt. Vielleicht sollten wir ihnen auch gleich die Weltrettung überlassen, schließlich haben sie ja schon die Lösung für den Klimawandel: einfach auf die Straße kleben. Dass sie dabei die hart arbeitende Bevölkerung von ihrer Arbeit abhalten und Krankenfahrzeuge bei ihren Einsätzen behindern, kapiert die Horde nicht. Hauptsache, dabei ist alles, was irgendwie nach Protest aussieht. Und warum überhaupt fahren die Leute zur Arbeit? Wenn wirklich alle genau gar nichts mehr tun würden, hätten wir doch gleich eine Menge CO2 eingespart. Da kann man nur hoffen, dass diese Erleuchtung bald auch bei den Autobauern ankommt – vielleicht sollte man einfach alle Autos in "Lastenfahrrad" umbenennen, damit der Stau von morgen wenigstens einen guten „grünen“ Geschmack hat.
Das Problem ist nur: Wer verdient die Kohle, die diese übereifrigen Jugendlichen so gerne für Blödsinn zum Fenster rauswerfen? Denn es scheint, als würde das Geld für ihre „Weltrettungs“-Proteste irgendwo in der Luft verpuffen – in etwa so, wie der CO2-Ausstoß, den sie zu verhindern glauben. Wer sorgt eigentlich dafür, dass das tägliche Brot auf den Tisch kommt, wenn keiner mehr arbeitet, weil alle nur noch gegen alles protestieren? Ein bisschen weniger Theorie und ein bisschen mehr Praxis wäre hier wohl nicht nur für die Jugendlichen, sondern für die ganze Gesellschaft ein echter Gewinn.
Und apropos Autos abschaffen – aber sich mit Papas dickem SUV die 10 Meter bis zur Schule kutschieren lassen und keinen gemeinsamen Karibik-Urlaub auslassen…passt doch! Das ist natürlich der wahre Weg zur Nachhaltigkeit: die Welt retten, indem man sich die CO2-Bilanz direkt auf den nächsten Flug bucht. Wo wäre der Spaß, wenn man nicht gleichzeitig „umweltbewusst“ sein könnte und dabei das Leben wie ein VIP genießt? Klar, der CO2-Fußabdruck wird nicht kleiner – aber Hauptsache, man kann auf Instagram zeigen, wie man sich die Welt rettet, während man in der ersten Klasse fliegt.
Das beste Beispiel für diese Doppelmoral liefert uns die gute Luisa Neubauer. Klimaaktivistin durch und durch, die anderen das Autofahren und Fliegen verbieten will, während sie selbst von einer Klima-Konferenz zur nächsten mit dem Flieger chattet – natürlich immer schön mit der „Nachhaltigkeit“-Sticker auf der Tasche, als ob das irgendwie die CO2-Emissionen neutralisieren würde. Sie ist wahrlich ein hervorragendes Vorbild für unsere Jugend. Scherz. Denn wenn man den Planeten retten will, sollte man natürlich zuerst einmal dafür sorgen, dass man sich selbst die besten Flugmeilen sichert. Schließlich kann man ja nicht ernsthaft erwarten, dass der Klimawandel mit weniger Klimakonferenzen oder flugfreier Zeit bekämpft wird, oder?
So, nun genug über die grünen Wunderkinder gescherzt. Jetzt kommen wir zum ernsten Teil: Hier einige Beispiele, warum linke Ideologien in der Vergangenheit schon oft in die Hose gegangen sind, obwohl sie doch so „gut“ klingen, wenn man sie auf dem Papier liest. Doch leider zeigt die Geschichte, dass das Leben oft etwas komplexer ist als ein paar hübsche Worte auf einem Plakat oder den geistigen Ergüssen einer Ulrike Herrmann – zu der ich später noch komme.
Nachfolgend einige Negativbeispiele:
1. Die Sowjetunion (1917–1991)
• Hintergrund: Der Marxismus-Leninismus, der die Grundlage der Sowjetunion bildete, verfolgte die Idee einer klassenlosen Gesellschaft und die Abschaffung des Privateigentums zugunsten einer staatlich geplanten Wirtschaft.
• Ergebnis: Die zentralisierte Wirtschaftsplanung führte zu Ineffizienz, Ressourcenverschwendung und einer stagnierenden Wirtschaft. Hinzu kamen autoritäre Herrschaft, politische Repression und Millionen von Todesopfern durch Säuberungen und Hungersnöte.
• Konsequenzen: Die Sowjetunion zerfiel 1991, und viele frühere Sowjetstaaten übernahmen marktwirtschaftliche Modelle.
2. Maoistisches China (1949–1976)
• Hintergrund: Unter Mao Zedong wurde versucht, durch den „Großen Sprung nach vorn“ und die Kulturrevolution eine klassenlose Gesellschaft aufzubauen. Privateigentum und traditionelle Strukturen wurden abgeschafft.
• Ergebnis: Der „Große Sprung nach vorn“ führte zu katastrophalen Fehlentscheidungen in der Landwirtschaft, was eine der größten Hungersnöte der Geschichte zur Folge hatte (ca. 15–45 Millionen Tote). Die Kulturrevolution zerstörte Bildungseinrichtungen und kulturelles Erbe.
• Konsequenzen: Nach Maos Tod wurden viele seiner wirtschaftlichen und sozialen Reformen zurückgenommen.
3. DDR (Deutsche Demokratische Republik, 1949–1990)
• Hintergrund: Die DDR war ein sozialistischer Staat, der auf der Grundlage von Planwirtschaft und staatlicher Kontrolle errichtet wurde.
• Ergebnis: Die wirtschaftliche Effizienz war gering, es gab Versorgungsengpässe, und die Lebensqualität war im Vergleich zur Bundesrepublik deutlich niedriger. Politische Repression und Überwachung durch die Stasi unterdrückten abweichende Meinungen.
• Konsequenzen: Der Zusammenbruch des Ostblocks und die Wiedervereinigung Deutschlands machten das Ende der DDR unvermeidlich.
• In der DDR herrschte mit der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED)