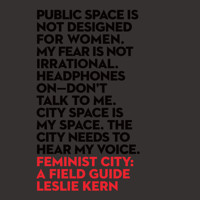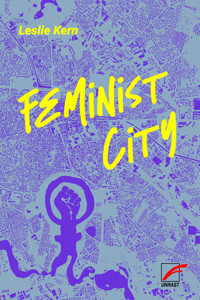
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unrast Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Stadt ist ein ständiger Schauplatz des Kampfes zwischen den Geschlechtern. Feministische Fragen nach Sicherheit und Angst, bezahlter und unbezahlter Arbeit, Rechten und Repräsentation demontieren das, was wir für selbstverständlich halten und über Städte und Freiräume zu wissen glauben. Doch vielleicht liegt in der Stadt ja auch unsere beste Chance, neue soziale Beziehungen zu gestalten, die auf Fürsorge und Gerechtigkeit basieren? Um gemeinsam gerechtere, nachhaltigere und solidarischere Städte zu schaffen, müssen die Barrieren, die Frauen unterdrücken (sollen), überwunden, muss städtischer Raum beansprucht werden. Mit "Feminist City" kartiert Leslie Kern die Stadt aus neuen Blickwinkeln. Sie schreibt über die Freuden und Gefahren des Alleinseins, widmet sich Themen wie Angst, Mutterschaft, Freundschaft und Aktivismus. Sie entwirft einen feministischen, intersektionalen Ansatz, mit dem Städte historisch neu betrachtet werden können und der uns die Augen öffnet für Wege in eine lebenswerte urbane Zukunft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Für Maddy
Leslie Kern
Feminist City
aus dem Englischen übersetzt von Emilia Gagalski
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Leslie Kern: Feminist City
1. Auflage, Dezember 2020
eBook UNRAST Verlag, Januar 2021
ISBN 978-3-95405-074-1
© UNRAST-Verlag, Münster
www.unrast-verlag.de – [email protected]
Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)
Titel der Originalausgabe: Feminist City: A Field Guide
© 2019 Between the Lines, Toronto, 2019
www.btlbooks.com
Übersetzt und gedruckt mit freundlicher Unterstützung des
Canada Council for the Arts.
Übersetzt mit freundlicher Unterstützung der
Ontario Book Publishers Organization und Ontario Creates.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: David Hellgermann, Münster
Satz: Andreas Hollender, Köln
Inhalt
Einleitung: Stadt der Männer
Ungebührliche Frauen
Wer gestaltet die Stadt?
Freiheit und Angst
Feministische Geografie
Kapitel 1: Stadt der Mütter
Die Flåneuse
Ein öffentlicher Körper
Der Platz der Frau
Die Stadt als Alternative
Gentrifizierung und Mutterschaft
Die nicht sexistische Stadt
Kapitel 2: Stadt der Freundinnen
Freundschaft als Lebensweise
Stadt der Mädchen
Freundschaft und Freiheit
Räume für queere Frauen
Freundinnen bis zum Schluss
Kapitel 3: Stadt der Einzelnen
Persönlicher Raum
Ein Tisch für eine Person
Das Recht, allein zu sein
Frauen in der Öffentlichkeit
Toilettengespräche
Frauen nehmen Raum ein
Kapitel 4: Stadt des Protests
Das Recht auf Stadt
DIY-Sicherheit
Geschlechterrollen im Aktivismus
Aktionstourismus
Protestlektionen
Kapitel 5: Stadt der Angst
Die weibliche Angst
Die Gefahr (ver)orten
Der Preis der Angst
Sich zur Wehr setzen
Kühne Frauen
Intersektionalität und Gewalt
Stadt der Möglichkeiten
Danksagungen
Anmerkungen
EinleitungStadt der Männer
Ich habe ein altes Foto von meinem kleinen Bruder und mir am Trafalgar Square in London, auf dem wir von einem Dutzend Tauben umgeben sind. Nach unseren zusammenpassenden Topfhaarschnitten und Schlagcordhosen zu urteilen, schätze ich mal, es ist aus dem Jahr 1980 oder 1981. Vergnügt werfen wir den Tauben Körner hin, die unsere Eltern an einem Automaten gekauft haben. Heutzutage gibt es diese Automaten nicht mehr, weil es strengstens missbilligt wird, die Tauben zu füttern, aber damals war es eines der Highlights unseres Ausflugs zur Familie meines Vaters. Wir waren im Zentrum von allem, unsere Aufregung war unübersehbar. Und in unseren strahlenden Gesichtern erkenne ich den Beginn unserer gemeinsamen, lebenslangen Liebe zu London und dem Stadtleben. Josh und ich kamen im Zentrum von Toronto zur Welt, aber unsere Eltern zogen uns in der Vorstadt Mississauga auf. Obwohl Mississaugas Bevölkerung die Stadt zu einer der größten und vielfältigsten Städte in Kanada macht, war sie in den 1980ern im Wesentlichen eine autozentrierte, vorstädtische Einkaufslandschaft. Mein Bruder und ich zogen beide, sobald es uns möglich war, wieder nach Toronto und ließen die Vorstadt schneller zurück, als wir »Yonge-University-Spadina Line«[1] sagen konnten. Doch unsere Erfahrungen des Großstadtlebens gingen ziemlich weit auseinander. Ich bezweifle, dass Josh jemals beim nach Hause Gehen einen Schlüsselbund so in der Faust hielt, dass die einzelnen Schlüssel aus der Faust herausragten, oder angerempelt wurde, weil er zu viel Platz mit einem Kinderwagen einnahm. Da wir Race, Religion, Bildung, Klassenzugehörigkeit und einen beträchtlichen Anteil unserer DNA teilen, muss ich darauf schließen, dass das Geschlecht den entscheidenden Unterschied macht.
Ungebührliche Frauen
Frauen wurden schon immer als Problem für die moderne Stadt angesehen. Während der industriellen Revolution wuchsen die europäischen Städte schnell und ein chaotischer Mix von sozialen Klassen und Immigrant*innen tummelte sich auf den Straßen. Die viktorianischen Gesellschaftsnormen dieser Zeit sahen strikte Grenzen zwischen Klassen und eine strenge Etikette vor, die dazu da war, die Unschuld von hoch angesehenen weißen Frauen zu schützen. Diese Etikette wurde durch den zunehmenden Kontakt zwischen Frauen und Männern und zwischen Frauen und den städtischen Menschenmassen durchbrochen. »Der Ehrenmann und, schlimmer noch, die Edeldame, waren gezwungen, auf die niederen Ränge zu treffen und wenig feierlich und ungeschützt gestoßen und geschubst zu werden«, schreibt Kulturhistorikerin Elizabeth Wilson.[2] Das »umkämpfte Terrain« des viktorianischen Londons habe Frauen Raum gegeben, damit sie »sich als Teil einer Öffentlichkeit behaupten konnten«, insbesondere was die Debatten zu Sicherheit und sexueller Gewalt angeht, erklärt Historikerin Judith Walkowitz.[3] Doch diese chaotische Übergangszeit bedeutete, dass es immer schwieriger war, den sozialen Status zu erkennen, und eine Dame auf der Straße musste befürchten, die schlimmste aller Beleidigung zu erfahren: irrtümlich für eine ›Prostituierte‹ gehalten zu werden.
Diese Bedrohung der vermeintlich natürlichen Rangunterschiede und der wankenden Barrieren der Standesehre bedeutete, dass für viele Zeitgenoss*innen das Stadtleben an sich eine Gefahr für die Zivilisation darstellte. »Der Status der Frauen«, erklärt Wilson, »wurde zum Maßstab für Urteile über das Stadtleben.«[4] Die sich ausweitenden Freiheiten von Frauen trafen also auf die moralische Panik vor allen möglichen Dingen, von Sexarbeit bis hin zu Fahrrädern. Das umliegende Land und die neuerdings expandierenden Vororte stellten sicher, dass es einen geeigneten Rückzugsort für mittlere und obere Schichten und, was am wichtigsten war, Sicherheit und weiterhin Respekt für Frauen gab.
Während einige Frauen vor dem Chaos geschützt werden mussten, galt es, andere Frauen wiederum zu kontrollieren, umzuerziehen und vielleicht sogar zu verbannen. Die wachsende Aufmerksamkeit gegenüber dem Stadtleben machte die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse sichtbarer und immer weniger annehmbar für die Mittelklasse. Natürlich waren es die Frauen, denen man die Schuld dafür gab, da sie ja in die Stadt gekommen waren, um Arbeit in Fabriken und als Haushaltshilfen zu finden, und so, laut Engels, die Familie »auf den Kopf gestellt« hätten. Der Zugang von Frauen zu bezahlter Arbeit bedeutete für sie ein wenig Unabhängigkeit und natürlich weniger Zeit für häusliche Verpflichtungen in ihrem eigenen Zuhause. Armen Frauen wurde häusliches Versagen vorgeworfen und dass ihre Unfähigkeit, ihr Zuhause sauber zu halten, die ›Demoralisierung‹ der Arbeiterklasse befördere. Diese Demoralisierung äußerte sich in Form von schlechten Angewohnheiten und anderen Arten von problematischen privaten und öffentlichen Verhaltensweisen. All das wurde als zutiefst unnatürlicher Zustand erachtet.
Natürlich war das größte soziale Übel die Prostitution, denn sie besaß das Potenzial, die Familie zu zerstören, die Fundamente der Gesellschaft zu erschüttern und Krankheiten zu verbreiten. Im damaligen Verständnis, bevor die Keimtheorie aufkam, nahm man an, dass Krankheiten durch von Luft übertragene Miasmen entstehen, die durch giftige Abwassergerüche übertragen werden. Das Konzept eines ›moralischen‹ Miasmas tauchte ebenfalls auf: die Vorstellung, dass man sich durch bloße Nähe zu denjenigen, die sie in sich trugen, mit der Verderbtheit anstecken konnte. Schriftsteller*innen dieser Zeit waren entsetzt über die alltägliche Anwesenheit der ›Straßenprostituierten‹, die ganz offen ihrem Tagesgeschäft nachgingen und anständige Männer in eine lasterhafte Welt verführten. Auch Frauen waren »permanent der Verlockung ausgesetzt und, einmal ›gefallen‹, war eine Frau, so dachten viele Reformer, zu einem Leben zunehmender Erniedrigung und einem frühen und tragischen Tod verurteilt.«[5]
Viele Leute, etwa Charles Dickens, betrachteten die Emigration dieser ›gefallenen Frauen‹ in die Kolonien als Lösung für das Problem, denn dort hätten sie die Möglichkeit, irgendwann vielleicht einen von den vielen übrig gebliebenen Siedlern zu heiraten, sodass ihre Ehre wiederhergestellt wäre. Dort wiederum lieferte die Notwendigkeit, weiße Siedlerinnen vor der Gefahr des ›Eingeborenen‹ zu beschützen, eine Begründung für die Bekämpfung und Vertreibung Indigener[6] Bevölkerungen in den sich verstädternden Gebieten. Berühmte Romane aus dieser Zeit schildern sensationelle Geschichten von Entführungen, Folterungen, Vergewaltigungen und Zwangsverheiratungen von weißen Frauen durch räuberische, rachsüchtige ›Barbaren‹. Diese neuen befestigten Siedlerstädte manifestierten die Transformation von unzivilisiertem Grenzgebiet in Zivilisation und die Unschuld und Sicherheit der weißen Frauen würde diese Metamorphose vervollständigen.
Auf der Kehrseite wurden Indigene Frauen als Gefahr für diese städtische Entwicklung gesehen. Ihre Körper trugen die Fähigkeit, die ›Barbarei‹ zu reproduzieren, welche die Kolonisator*innen eindämmen wollten. Sie hatten in ihren Gemeinschaften wichtige Positionen der kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Macht inne. Die Entmachtung dieser Indigenen Frauen durch die Einführung europäischer patriarchaler Familien- und Regierungssysteme und die zeitgleiche Entmenschlichung dieser Frauen als primitiv und promiskuitiv legten den Grundstein für die legalen wie geografischen Prozesse der Enteignung und Vertreibung.[7] So war die Degradierung und Stigmatisierung von Indigenen Frauen Teil des Urbanisierungsprozesses. In Anbetracht der heutigen, außergewöhnlich hohen Zahl der Gewalttaten gegenüber Indigenen Frauen und Mädchen in den Kolonialstädten der Siedler*innen ist offensichtlich, dass diese Einstellungen und Praktiken ein dauerhaftes, verheerendes Erbe hinterlassen haben.
Spulen wir vorwärts in die heutige Zeit: Bemühungen, Frauenkörper zu kontrollieren, um Maßnahmen der Stadtentwicklung voranzutreiben, sind alles andere als Vergangenheit. In der jüngsten Geschichte haben wir beobachten können, wie Frauen of Color und Indigene Frauen, die Sozialhilfe erhalten oder in anderer Weise als vom Staat abhängig angesehen werden, zu Sterilisationen gezwungen oder genötigt wurden. In den 1970er- und 1980er- Jahren kursierte das rassistische Klischee der Schwarzen ›Welfare Queen‹[8] als Teil des Narrativs der scheiternden Städte. Es wurde zudem mit der moralischen Panik vor Teenagerschwangerschaften und mit der Annahme in Verbindung gebracht, dass Teenie-Mütter sich einreihen würden in die Liste der besagten Sozialhilfebetrügerinnen und kriminell veranlagte Kinder zur Welt bringen würden. Gegenwärtige Bewegungen zur Bekämpfung von Sexarbeit sind in ›Anti-Menschenhandels-Kampagnen‹ umbenannt worden, in denen der Menschenhandel zu einer neuen Form von sexualisierter städtischer Bedrohung wird. Leider wird Sexarbeiter*innen, die nicht von Menschenhandel betroffen sind, wenig Respekt und Unterstützung im Rahmen dieser neuen Agenda zugestanden.[9] ›Anti-Adipositas-Kampagnen‹ haben es auf Frauen als Individuen und Mütter abgesehen, da ihre Körper und die Körper ihrer Kinder als Symptome moderner städtischer Probleme, etwa die Abhängigkeit vom Auto und Fastfood, angesehen werden.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Körper von Frauen immer noch als Ursprung für oder Zeichen von städtischen Problemen betrachtet werden. Während junge weiße Mütter als für die Gentrifizierung verantwortlich diffamiert wurden, beschuldigen Befürworter*innen der Gentrifizierung alleinerziehende Mütter of Color und Immigrantinnen der Reproduktion der städtischen Kriminalität und der Verlangsamung der städtischen ›Revitalisierung‹. Die Arten und Weisen, wie Frauen mit den sozialen Belangen der Stadt in Verbindung gebracht werden können, scheinen unbegrenzt.
Während ich einräume, dass einige der übertriebenen viktorianischen Ängste über Reinheit und Sauberkeit nachgelassen haben, erleben Frauen die Stadt weiterhin immer auch als eine Reihe von – physischen, sozialen, wirtschaftlichen und symbolischen – Hindernissen, die ihr alltägliches Leben auf eine zutiefst (wenn auch nicht nur) geschlechtsspezifische Art und Weise formen. Viele dieser Hindernisse sind unsichtbar für Männer, weil sie ihnen in ihren eigenen Erfahrungen nur selten begegnen. Das bedeutet, dass die vornehmlichen Entscheidungsträger*innen in Städten, von denen noch immer der Großteil männlich ist, Entscheidungen treffen – von städtischer Wirtschaftspolitik bis hin zu Gebäudekonzeptionen, von Schulplatzierungen bis hin zu Sitzplätzen in Bussen, von Überwachung bis hin zum Schneeräumen im Winterdienst – ohne eine Ahnung davon zu haben oder sich darum zu kümmern, was für Auswirkungen diese Entscheidungen auf Frauen haben. Die Stadt ist so angeordnet, dass die traditionelle Geschlechterrolle des Mannes begünstigt und unterstützt wird. Die männliche Erfahrung gilt als ›Norm‹ und es wird wenig Rücksicht darauf genommen, dass die Stadt Hürden für Frauen aufstellt und deren alltägliche Erfahrung des Stadtlebens ignoriert. Das meine ich mit »Stadt der Männer«.
Wer gestaltet die Stadt?
Als ich, noch während ich an diesem Buch arbeitete, das Hochglanz-Alumni-Magazin der University of Toronto in den Händen hielt, war ich außergewöhnlich aufgeregt, denn die Titelstory lautete: »The Cities We Need«[10] (dt. Die Städte, die wir brauchen). Der derzeitige Präsident der University of Toronto ist ein Stadtgeograf, sodass ich hohe Erwartungen hatte. Die Zeitschrift enthielt vier Artikel zu städtischen ›Anforderungen‹: Bezahlbarkeit, Zugänglichkeit, Nachhaltigkeit und mehr Spaß. Großartige Themen. Doch jeder der Artikel war von einem weißen Mann mittleren Alters geschrieben. Die meisten Expert*innen, die von den Autoren zitiert wurden, waren Männer, einschließlich des omnipräsenten Richard Florida, dessen übergroßer Einfluss auf die Stadtpolitik auf der ganzen Welt durch sein (wie er selbst zugab) äußerst mangelhaftes kreatives Klassenparadigma vielmehr für viele der derzeitigen Bezahlbarkeitsprobleme, mit denen Städte wie Vancouver, Toronto und San Francisco zu kämpfen haben, verantwortlich ist. Ich würde gerne sagen, dass ich überrascht oder enttäuscht war, aber resigniert trifft es wohl am besten. Wie die feministische Wissenschaftlerin Sara Ahmed es auf den Punkt bringt: »Die Zitierung ist eine andere Form der akademischen Bezüglichkeit. Weiße Männer werden als Zitierbezüglichkeiten reproduziert. Weiße Männer zitieren andere weiße Männer: Das ist das, was sie schon immer getan haben […]. Weiße Männer als gut ausgetretener Pfad; je mehr wir auf diesem Weg gehen, desto mehr folgen wir diesem Weg.«[11] Die städtische Forschung und Planung ›folgt diesem Weg‹ nun schon für lange Zeit.
Ich bin längst nicht die erste feministische Autorin, die das zu bedenken gibt. Es existiert mittlerweile eine lange Tradition von Frauen, die über das Stadtleben schreiben (wie Charlotte Brontë in Villette), Frauen, die sich für die Bedürfnisse von Frauen in der Stadt einsetzen (wie die Sozialreformerinnen Jane Austin und Ida B. Wells) und Frauen, die ihre eigenen Konzepte für Häuser, Städte und Nachbarschaften entwickeln (wie Catherine Beecher und Melusina Fay Peirce). Feministische Architekt*innen, Stadtplaner*innen und Geograf*innen intervenierten durch gründliche empirische Forschung zu geschlechtsspezifischen Erfahrungen in ihren jeweiligen Bereichen grundlegend. Aktivist*innen drängten unnachgiebig zu wichtigen Veränderungen in den Bereichen Städtebau, Methoden des Polizierens[12] und Dienstleistungen, um den Bedürfnissen von Frauen besser zu entsprechen. Und doch wird eine Frau weiterhin in der Nacht die Straßenseite wechseln, wenn ein Fremder hinter ihr geht.
Die grundlegende Arbeit von feministischen Stadtforscher*innen und Schriftsteller*innen, welche mir vorangegangen sind, stellt das Fundament dieses Buches. Als ich am Graduiertenkolleg feministische Geografie für mich ›entdeckte‹, machte es bei mir Klick. Plötzlich nahmen die theoretischen Einsichten der feministischen Theorie eine dritte Dimension an. Ich verstand auf ganze andere Weise, wie Macht operiert, und gewann mehr und mehr neue Einsichten in meine eigenen Erfahrungen, die ich als Frau zunächst in der Vorstadt und dann in der Stadt gemacht habe. Ich folgte meinem neuen Weg und ich bin stolz darauf, mich heute als feministische Geografin zu bezeichnen. Im Laufe dieses Buches treffen wir auf ›urban thinkers‹, städtische Akteur*innen, die alles untersucht haben, von der Frage, wie Frauen sich durch die Stadt bewegen, über den geschlechtsspezifischen Symbolismus der Stadtarchitektur, bis hin zur Rolle von Frauen in der Gentrifizierung. Doch ich möchte nicht mit der Theorie, der Politik oder dem Städtebau anfangen, sondern mit dem, was die Poetin Adrienne Rich als »Geografie« bezeichnet, die unserem Körper und Alltag »am nächsten ist«.[13]
»Fang mit dem Stofflichen an«, schreibt Rich. »Fang mit dem weiblichen Körper an. […] Nicht, um ihn zu überwinden, sondern um ihn zurückzuerobern.«[14] Was erobern wir hier zurück? Wir erobern persönliche, gelebte Erfahrung, Bauchgefühl und hart erkämpfte Wahrheiten zurück. Rich nennt es »den Versuch, als Frau vom Zentrum aus zu sehen«, oder Politik, die Fragen von Frauen stellt.[15] Keine essenzialistischen Fragen, die auf der falschen Annahme einer biologischen Definition von Frausein beruhen. Es geht um Fragen, die aus dem Alltag entstehen, aus der verkörperten Erfahrung derjenigen, die sich selbst als Teil der dynamischen und veränderlichen Kategorie ›Frau‹ begreifen. Für uns wirft das Stadtleben Fragen auf, die zu lange unbeantwortet geblieben sind.
Als Frau sind meine alltäglichen Erfahrungen in der Stadt zutiefst geschlechtsspezifisch. Meine Geschlechtsidentität prägt die Art und Weise, wie ich mich durch die Stadt bewege, wie ich meinen Alltag bestreite, und die Optionen, die mir offenstehen. Mein Geschlecht ist mehr als mein Körper, aber mein Körper ist der Ort meiner gelebten Erfahrung, an dem sich meine Identität, meine Geschichte und die Orte, an denen ich gelebt habe, in mich einschreiben, auf meinen Leib einwirken und einen Abdruck auf ihm hinterlassen. Dies ist der Ort, von dem aus ich schreibe. Es ist der Ort, an dem meine Erfahrungen mich dazu bringen, zu fragen: »Warum passt mein Kinderwagen nicht in die Straßenbahn?«, »Warum muss ich einen Umweg von einer halben Meile nach Hause nehmen, weil der direkte Weg zu gefährlich ist?«, »Wer holt mein Kind vom Zelten ab, wenn ich bei einem Protest gegen den G-20-Gipfel verhaftet werde?«. Das sind nicht nur persönliche Fragen. Sie verweisen auf den Kern der Frage danach, warum und wie Städte Frauen ›auf ihren Platz‹ verweisen.
Ich fing an, dieses Buch zu schreiben, als die ›MeToo‹-Bewegung regelrecht explodierte.[16] Als Folge von investigativer Berichterstattung, die langjährige Missbrauchstäter und Belästiger in Hollywood aufdeckte, meldeten sich unzählige Frauen und einige Männer zu Wort, um ihre Geschichten über das Übel der sexuellen Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz, im Sport, in der Politik und im Bildungswesen zu erzählen. Das Leid der sexuellen Belästigung hat seit den Beschuldigungen, die Anita Hill[17] äußerte, nicht mehr solche Aufmerksamkeit in den Medien, Institutionen und der Politik erhalten. Während sich die Rhetorik, die dazu benutzt wird, Opfer und Informant*innen zu diskreditieren, seit den Gerichtsprozessen unter der Leitung von Clarence Thomas nicht merklich geändert hat, überzeugen die (beinahe wortwörtlichen!) Berge an Beweisen gegen die schlimmsten Täter und misogynsten Institutionen viele davon, dass sich etwas ändern muss.[18]
Überlebende dieser Übergriffe bezeugen die langjährigen, lebensverändernden Folgen der kontinuierlichen körperlichen und psychischen Gewalt. Ihre Geschichten stehen im Einklang mit der umfangreichen Literatur zu den Ängsten von Frauen in Städten. Die konstante unterschwellige Gefahr der Gewalt, gepaart mit täglichen Belästigungen, prägt das Leben von Frauen in Städten auf unzählige bewusste und unbewusste Arten und Weisen. Genauso wie die Belästigungen am Arbeitsplatz Frauen aus Machtpositionen herausdrängen und ihre Beiträge zur Wissenschaft, Politik, Kunst und Kultur ausradieren, schränkt das Schreckgespenst der städtischen Gewalt die Möglichkeiten, die Macht und die wirtschaftlichen Chancen von Frauen ein. Genauso wie die Arbeitsbedingungen Belästigungen strukturell ermöglichen, Täter schützen und Opfer bestrafen, sind städtische Umgebungen so strukturiert, dass patriarchale Familienformen, nach Geschlecht getrennte Arbeitsmärkte und traditionelle Geschlechterrollen unterstützt werden. Und obwohl wir glauben wollen, dass die Gesellschaft sich über die strikten Grenzen der Geschlechterrollen hinausentwickelt hat, erleben Frauen und andere marginalisierte Gruppen weiterhin, dass ihr Leben durch die sozialen Normen, die in unseren Städten errichtet wurden, eingeschränkt ist.
›MeToo‹-Berichte von Überlebenden sexueller Gewalt enthüllen die nach wie vor bestehende Vorherrschaft von dem, was feministische Aktivist*innen ›Vergewaltigungsmythen‹ nennen: eine Reihe an falschen Vorstellungen und Fehleinschätzungen, die sexuelle Belästigung und Gewalt teilweise dadurch aufrechterhalten, dass sie Opfern die Schuld dafür geben. Vergewaltigungsmythen sind der Hauptbestandteil dessen, was wir jetzt ›Rape Culture‹ (dt. ›Vergewaltigungskultur‹) nennen. »Was hattest du an?« und »Warum hast du es nicht gemeldet?« sind zwei klassische Fragen des Vergewaltigungsmythos, mit denen ›MeToo‹-Überlebende konfrontiert werden. Vergewaltigungsmythen haben auch eine Geografie. Diese wird in die mentale Karte der Sicherheit und Gefahr integriert, die Frauen in ihren Köpfen haben. »Was hast du in dieser Gegend gemacht?«, »Warum warst du nachts allein unterwegs?«, »Warum hast du eine Abkürzung genommen?«. Wir nehmen diese Fragen vorweg und sie prägen unsere mentale Landkarte ebenso sehr wie jede konkrete Bedrohung. Diese sexistischen Mythen dienen dazu, uns daran zu erinnern, dass von uns erwartet wird, dass wir unsere Freiheit, in der Stadt zu gehen, zu arbeiten, Spaß zu haben und Raum einzunehmen, begrenzen. Sie sagen: Die Stadt ist nicht für dich gemacht.
Freiheit und Angst
Etwa ein Jahrzehnt nach dem rauschhaften Taubenfüttern waren Josh und ich wieder zurück in London, nun alt genug, um allein die U-Bahn zur Tottenham Court Road und Oxford Street zu nehmen. Wahrscheinlich wollten meine Eltern einfach nur eine Art kulturell belebende Erfahrung machen, ohne alle fünf Minuten gefragt zu werden, wann wir shoppen gehen. Wie die Tauben, denen man dabei zusehen konnte, wie sie raffiniert durch das U-Bahnnetz zu ihren neuen Lieblingsfutterquellen navigierten, brachten wir uns bei, uns selbst unseren Weg durch die Stadt zu denken und fühlen. In jener Zeit vor den Smartphones hatten wir nur eine Karte des U-Bahnnetzes und unsere Instinkte zur Verfügung, die uns leiteten. Wir hatten nie Angst. Die Schilder und Ansagen zu Sicherheit und Überwachung beschwörten weit entfernte Nachrichtenmeldungen über Bombenanschläge der IRA herauf, aber das war nichts, was ein Paar kanadischer Kinder in ihren Ferien interessierte. Am Ende des Ausflugs waren wir (in unseren Köpfen) clevere kleine Stadtentdecker, nur einen oder zwei Schritte davon entfernt, richtige Londoner zu sein.
Ungefähr ein Jahr vor diesem Ausflug waren wir zum ersten Mal in New York City. Das dürfte 1990 gewesen sein, einige Jahre bevor die ›Null-Toleranz‹-Politik des damaligen Bürgermeisters Rudy Giuliani die disneymäßige Umgestaltung des Times Square und anderer ikonischer Orte vorantrieb. Uns wurde zwar die Freiheit gewährt, gemeinsam in den großen Läden der Fifth Avenue umherzustreifen, aber es war keine Option, hier allein mit der U-Bahn zu fahren. Tatsächlich glaube ich, dass wir während unseres gesamten Ausflugs nicht ein Mal die U-Bahn genommen haben, auch nicht mit unseren Eltern. New York war ein komplett anderes Kaliber als Toronto oder London. Für unsere Eltern war die Aufregung dieser Stadt gekoppelt mit einem Gefühl der Bedrohung, die viel realer schien als ein IRA-Anschlag.
Ich denke, ich lernte damals, dass eine Stadt – ihre Gefahren, ihr Nervenkitzel, ihre Kultur, ihre Anziehung und Weiteres – ebenso in der Vorstellung wie in ihrer materiellen Form existiert. Die imaginierte Stadt ist geprägt durch Erfahrungen, Medien, Kunst, Gerüchte und unsere eigenen Sehnsüchte und Ängste. Das harte, gefährliche New York der 1970er und 1980er herrschte in den Köpfen unserer Eltern vor. Das war ein anderes als das, welches wir 1990 erlebten, aber es prägte unser Wissen über diesen Ort, bzw. das, was wir über ihn zu wissen glaubten. Und in der Tat war diese Andeutung der Gefahr faszinierend. Sie machte New York zu New York: nicht Toronto, London und sicherlich nicht Mississauga. Die Energie und der Sog der Stadt waren aufs Engste mit dem Gefühl, dass alles hätte passieren können, verknüpft.
Es sind diese gemischten Gefühle von Aufregung und Gefahr, Freiheit und Angst, Möglichkeit und Bedrohung, die das feministische Denken und Schreiben über Städte so sehr prägen. Bereits in den 1980er-Jahren behauptete meine zukünftige Doktormutter kühn: »Der Platz der Frau ist in der Stadt«.[19] Gerda Wekerle argumentierte, dass nur dichte, dienstleistungsreiche städtische Umgebungen die ›Doppelbelastung‹ von Frauen, die mit der bezahlten und unbezahlten Arbeit einhergeht, abfedern können. Gleichzeitig schlugen Soziolog*innen und Kriminolog*innen aufgrund der extremen Angst von Frauen vor städtischer Kriminalität Alarm, eine Angst, die nicht durch aktuelle Zahlen der außerhäuslichen Gewalt gegen Frauen erklärt werden konnte.[20] Feministische Aktivist*innen haben aufgrund von Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum bereits Mitte der 1970er-Jahre zu den ersten ›Take Back the Night‹-Demos (dt. Erobern wir uns die Nacht zurück) in Städten in ganz Europa und Nordamerika aufgerufen.
Im Alltag treffen die Aussagen »Die Stadt ist nicht für Frauen gemacht« und »Der Platz der Frau ist in der Stadt« beide gleichermaßen zu. Wie Elizabeth Wilson bezeugt, strömen Frauen schon seit Langem trotz der Feindseligkeiten in die Städte. Sie sagt, dass »es vielleicht eine Überbetonung der Beschränkung auf die private Sphäre im viktorianischen Frauenbild gegeben hat«, und merkt an, dass einige Frauen selbst in dieser Ära strikter Geschlechternormen dazu imstande waren, die Stadt zu erkunden und neue Rollen als öffentliche Persönlichkeiten einzunehmen.[21] Scheiß auf die Gefahren. Die Stadt ist der Ort, an dem sich für Frauen Möglichkeiten auftaten, Möglichkeiten, die in kleinen Städten und ländlichen Gegenden gänzlich unbekannt waren. Es gab neue Möglichkeiten, zu arbeiten. Aus engstirnigen Geschlechternormen auszubrechen. Die heterosexuelle Ehe und die Mutterschaft zu umgehen. Nach nicht traditionellen Karrieren und öffentlichen Ämter zu streben. Außergewöhnliche Identitäten zu leben. Soziale und politische Anliegen in die Hand zu nehmen. Neue Verwandtschaftsnetzwerke und vor allem Freundschaften zu knüpfen. Sich an Kunst, Kultur und Medien zu beteiligen. All diese Optionen sind für Frauen in Städten so viel zugänglicher.
Weniger greifbar, aber nicht weniger wichtig sind die psychischen Vorzüge der Stadt: Anonymität, Energie, Spontaneität, Unvorhersehbarkeit und, ja, sogar Gefahr. In Charlotte Brontës Villette reist die Heldin Lucy Snowe alleine nach London und erlebt, während sie »den Gefahren der Straßenübergänge« trotzt, »ein vielleicht vernunftwidriges, aber ganz und gar wirkliches Vergnügen«.[22] Ich sage nicht, dass Frauen es mögen, Angst zu haben, aber dass eines der Vergnügen des Stadtlebens auf der der Stadt innewohnenden Unbekanntheit und dem eigenen Mut beruht, dieser Unbekanntheit zu begegnen. Es ist wirklich so, dass diese Unvorhersehbarkeit und dieses Chaos für Frauen, die die Sicherheit der vorstädtischen Gleichförmigkeit und sich wiederholender ländlicher Rhythmen ablehnen, gerade das ›authentische Stadtleben‹ ausmachen können.[23] Natürlich ist es etwas einfacher, das städtische Chaos aufregend zu finden, wenn man die Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen, wenn man möchte. In jedem Fall hat die Angst vor Kriminalität Frauen nicht von den Städten ferngehalten. Dennoch ist sie einer von vielen Faktoren, der das Leben von Frauen in Städten auf bestimmte Weise prägt.
Dieses Buch nimmt sich Fragen von Frauen zur Stadt an und schaut auf das Gute und das Schlechte, den Spaß und die Angst, um das, was wir über die Städte um uns herum zu wissen meinen, aufzumischen. Um die sozialen Beziehungen der Stadt – zwischen Menschen verschiedener Geschlechter, Herkünfte, Sexualitäten, Bildungsgrade und zwischen Menschen mit und ohne Behinderung usw. – mit frischem Blick zu betrachten. Um die Diskussion über andere, weniger sichtbare Arten von städtischer Erfahrung zu entfachen. Um den Raum zu eröffnen, um auf kreative Weise darüber nachzudenken, was eine feministische Stadt hervorbringen könnte. Um feministische Geografie in einen Dialog zu bringen, mit dem alltäglichen Wesentlichen, dem Versuch, in der Stadt zu überleben, zu gedeihen, zu kämpfen und Erfolg zu haben.
Feministische Geografie
2004 war ich gerade auf dem Weg zu einer der größten jährlichen Geografie-Konferenzen in Chicago, als ich las, dass die langjährige antifeministische Kolumnistin der Tageszeitung Globe & Mail, Margaret Wente[24], ebenfalls die feministische Geografie ›entdeckt‹ hatte: Angesichts der Tatsache, dass der Hass auf Männer und die Erforschung der eigenen Hauptstädte eindeutig zwei ganz unterschiedliche Fachgebiete sind, könne man wohl kaum annehmen, dass feministische Geografie ein berechtigter Forschungsgegenstand ist. Wente benutzte ihre Ungläubigkeit, um ihren Anhänger*innen ihre regelmäßig wiederverwertete Behauptung zu präsentieren, dass die Geistes- und Sozialwissenschaften wertlose Unternehmungen voller erfundener Disziplinen und Fake-Akademiker*innen seien.
Die absichtlich ignorante Wente hatte keine Lust, zu verstehen, dass die Geografie die feministische Analyse um eine faszinierende Dimension ergänzt. Selbstverständlich muss man gewillt sein, über ein Niveau der Geografie, wie es in der Sekundarstufe I gelehrt wird, hinauszugehen: Es geht nicht darum, Karten mit Buntstiften auszumalen oder Kontinente auswendig zu lernen. In der Geografie geht es um die Beziehung des Menschen zur Umwelt, sowohl zu der, die von Menschen gebaut ist, als auch zu der natürlichen. Eine geografische Perspektive auf Geschlechterrollen bietet die Möglichkeit, zu verstehen, wie Sexismus konkret funktioniert. Der Zweite-Klasse-Status von Frauen wird nicht nur durch ein metaphorisches Verständnis der ›getrennten Sphären‹ verstärkt, sondern auch durch eine tatsächliche, materielle Geografie der Ausgrenzung. Männliche Macht und Privilegierung werden aufrechterhalten, indem die Bewegungsfreiheit von Frauen und ihr Zugang zu verschiedenen Räumen eingeschränkt werden. Wie die feministische Geografin Jane Darke in einem meiner Lieblingszitate sagt: »Jede Siedlung ist eine Einschreibung der sozialen Beziehungen der sie errichtenden Gesellschaft in den Raum … Unsere Städte sind in Stein, Ziegel, Glas und Beton gemeißeltes Patriachat.«[25]
Ein Patriarchat, das in Stein gemeißelt ist. Diese simple Aussage über die Tatsache, dass gebaute Umwelten die Gesellschaften spiegeln, die sie erbauen, scheint offensichtlich. In einer Welt, in der alles, von der medikamentösen Behandlung bis zu Crashtest-Dummys, von kugelsicheren Westen bis zu Küchenarbeitsplatten, von Smartphones bis zu Bürotemperaturen, nach den Standards designt, getestet und festgelegt wird, die durch männliche Körper und Bedürfnisse bestimmt werden, sollte dies keine besonders große Überraschung sein.[26] Die Leiterin der Städteplanung in Toronto, Lorna Day, stellte kürzlich fest, dass die städtischen Richtlinien für Windeinwirkungen von einem »durchschnittlichen Menschen« ausgehen, dessen Größe, Gewicht und Erscheinung einem erwachsenen Mann entspricht.[27] Man würde ja nie denken, dass sexistische Voreingenommenheiten die Höhe und Position von Wolkenkratzern oder die Entwicklung eines Windtunnels beeinflussen, aber so ist es.
Was manchmal sogar noch weniger offensichtlich erscheint, ist die Kehrseite: Sobald unsere Städte gebaut sind, formen und beeinflussen sie soziale Beziehungen, Macht, Ungleichheit und so weiter. Steine, Ziegel, Glas und Beton sind doch keine Akteure, oder doch? Sie versuchen doch nicht bewusst, das Patriarchat aufrechtzuerhalten? Nein, aber ihre Form unterstützt die Festlegung der Bandbreite von Möglichkeiten für Individuen und Gruppen. Ihre Form trägt dazu bei, dass einige Dinge normal und richtig erscheinen und andere ›fehl am Platz‹ und falsch. Kurzum, physische Orte wie Städte sind wichtig, wenn wir über gesellschaftlichen Fortschritt nachdenken wollen.
Der geschlechtsspezifische Symbolismus der städtischen Umgebung ist eine Erinnerung daran, wer die Stadt erbaut hat. Die feministische Architektin Dolores Hayden greift in ihrem Artikel aus dem Jahr 1977 mit dem brisanten Titel: »Skyscraper Seduction, Skyscraper Rape« (dt. Verführung und Vergewaltigung durch Wolkenkratzer) die männliche Macht und die Fortpflanzungsfantasien an, die sich in der Entwicklung von immer größer werdenden städtischen Gebäuden verkörpern. Die üblichen männlichen Denkmäler der militärischen Macht aufgreifend, ist der Wolkenkratzer ein Monument männlicher unternehmerischer Wirtschaftsmacht. Hayden argumentiert, dass sich der Büroturm einreihe, in die »Prozession phallischer Monumente der Geschichte – darunter Pfähle, Obelisken, Turmspitzen, Säulen und Wachtürme«, da Architekten die Sprache des Sockels, Schafts und der Spitze benutzten und nach oben stoßende Gebäude kreierten, die mittels Scheinwerfern Licht in den Nachthimmel ejakulieren.[28] Die phallische Fantasie der Wolkenkratzer, so Hayden, verberge die Realität der Gewalt des Kapitalismus, die sich in zu Tode gekommenen Bauarbeitern, in Insolvenzen und der Bedrohung durch Feuer, Terrorismus und einstürzende Gebäude manifestiert. Wie die feministische Geografin Liz Bondi es ausdrückt, geht es weniger um die Symbolik des Phallus, sondern vielmehr ist seine Vertikalität eine Ikone der Macht aufgrund des »männlichen Charakters des Kapitals«.[29]
Die Sprache der Architektur greift auf die Vorstellung der binären Gegensätzlichkeit der Geschlechter zurück, bei der verschiedene Formen und Eigenschaften als maskulin oder feminin beschrieben werden. Bondi vertritt die Ansicht, dass diese Kodierungen der städtischen Umwelt »den Geschlechterunterschied als ›natürlich‹ interpretieren und dadurch eine bestimmte Version der Geschlechtsunterscheidung universalisieren und legitimieren.«[30] Über spezifische architektonische Eigenschaften hinaus sind Geschlechternormen zusätzlich durch die Aufteilung von Orten in Arbeitsplatz und Zuhause, in öffentlich und privat kodiert. Die anhaltende Unterrepräsentation von Frauen in Berufen der Architektur und Planung bedeutet, dass die Erfahrungen von Frauen von und an diesen Orten schnell übersehen werden oder nur mittels überholter Stereotype berücksichtigt werden. Wie Bondi anmerkt, ist es jedoch in zweierlei Hinsicht unzureichend, Frauen einfach nur in solche Berufe ›einzubringen‹ oder ihre Erfahrungen miteinzubeziehen. Da die Erfahrungen von Frauen durch eine patriarchalische Gesellschaft geprägt sind, stellt das Abrunden der scharfen Kanten dieser Erfahrung durch die Stadtgestaltung noch keinen Angriff auf das Patriarchat selbst dar. Und zweitens lässt die Annahme einer Einheit unter Frauen andere bedeutende Marker sozialer Unterschiede außen vor.
Historisch gesehen ging es der feministischen Geografie – wie dem akademischen Feminismus im Allgemeinen – darum, ›Frauen‹ zu einer männlich dominierten Disziplin ›hinzuzufügen‹. Der Titel von Janice Monk und Susan Hansons klassischer Intervention aus dem Jahr 1982 findet treffende Worte für diese Ausrichtung des Fachbereichs: »Wie es gelingen kann, nicht länger die Hälfte der Menschen in der Humangeografie auszugrenzen.«[31] Jedoch fehlte es diesem Ansatz, die Ausgrenzung durch Hinzufügung zu bekämpfen, stets an transformativer Macht.
In den 1970ern und 1980ern forderten Schwarze und Feministinnen of Color wie Angela Davis, Audre Lorde und die Frauen des Combahee River Collective die Mainstream-Frauenbewegung dazu auf, die unterschiedlichen Formen der Unterdrückung, denen Frauen jenseits der weißen heterosexuellen Mittelklasse ausgesetzt waren, nicht länger außer Acht zu lassen. Ihre Arbeit führte zur Entwicklung der intersektionalen feministischen Theorie, die auf einem Konzept aufbaut, das die Schwarze feministische Wissenschaftlerin Kimberlé Crenshaw 1989 geprägt hat und welches im Laufe 1990er-Jahre durch Schwarze Feministinnen wie Patricia Hill Collins und bell hooks weiterentwickelt wurde.[32] Intersektionalität führte zu einem radikalen Umdenken in der Art und Weise, wie der Feminismus die Beziehungen zwischen verschiedenen Systemen der Privilegierung und Unterdrückung, einschließlich des Sexismus, Rassismus, Klassismus, der Homophobie und des Ableismus, verstand.
Feministische Geograf*innen sahen sich in einer Disziplin, die durchdrungen war von der Geschichte des Erforschens, des Entdeckens und des Imperialismus, mit einem besonders steinigen Terrain konfrontiert. Die maskulinen, kolonialen Bilder von unerschrockenen Entdeckern, die eine ›neue Welt‹ vermessen, durchziehen noch immer den Fachbereich der Geografie. Stadtgeograf*innen spüren das nächste interessante Wohnviertel auf, um es zu untersuchen, und die nächste soziale Gruppe, um sie zu klassifizieren, während Städteplaner*innen technische, rationale und objektive Entscheidungen darüber anstreben, wie Menschen in Städten leben sollten. Feministische Stadtforscher*innen drängten darauf, dass Frauen als gültige und in mancherlei Hinsicht eigenständige Subjekte der Stadt anerkannt werden. Doch ihren frühen Arbeiten fehlte es an intersektionaler Analyse dessen, wie Geschlechterverhältnisse mit Race, Klasse, Sexualität und (Nicht-)Behinderung zusammenhängen.
Während sie den transdisziplinären Entwicklungen des akademischen Feminismus folgten, stützten sich feministische Geografinnen oftmals auf ihre eigenen Erfahrungen, um zu erforschen, wie Geschlechterrollen mit anderen sozialen Ungleichheiten verknüpft sind und welche Rolle der Raum in der Strukturierung von Unterdrückungssystemen spielt. Das frühe Werk von Gill Valentine zum Beispiel ergründete zunächst die Angst von Frauen vor Gewalt an öffentlichen Orten, wandte sich aber zügig der Erforschung von lesbischer Erfahrung an alltäglichen Orten, etwa der Straße, zu. Valentine war aufgrund ihrer lesbischen Identität jahrelang beruflicher Schikane ausgesetzt, doch ebneten Werke wie das ihre den Weg für Unterdisziplinen wie Gender-Geografie, lesbische Geografie und queere sowie trans Geografie. Laura Pulido und Audrey Kobayashi beschrieben ihre Erfahrungen als Frauen of Color in diesem Wissenschaftszweig, um anzuprangern, dass die Geografie eine weiße Wissenschaft ist, und um Feministinnen dazu zu bringen, die implizite weiße Ausrichtung ihrer Forschungsgegenstände und -konzepte zu untersuchen. Auch aktuelle Werke von Wissenschaftlerinnen wie der Schwarzen feministischen Geografin Katherine McKittrick und der Indigenen feministischen Geografin Sarah Hunt kritisieren die nach wie vor bestehenden anti-Schwarzen und kolonialen Haltungen, die in feministischen und kritischen Stadtgeografien in unseren Diskursen, Methoden und der Wahl der Forschungsgebiete zum Ausdruck kommen.[33]
Städte durch eine feministische Perspektive zu betrachten, bedeutet für mich, sich mit einer Reihe von verketteten Machtverhältnissen auseinanderzusetzen. ›Frauenfragen‹ zur Stadt zu stellen, bedeutet so viel mehr, als nur Fragen zum Thema Geschlecht zu stellen. Ich muss mich fragen, ob mein Wunsch nach Sicherheit zu einer zunehmenden polizeilichen Kontrolle von Gemeinschaften of Color führen könnte. Ich muss mich fragen, wie mein Bedürfnis nach Zugänglichkeit mit Kinderwägen mit den Bedürfnissen von behinderten und alten Menschen solidarisch vereinbart werden kann. Ich muss mich fragen, ob mein Wunsch, den städtischen Raum für Frauen zu ›beschlagnahmen‹, nicht koloniale Praktiken und Diskurse aufrechterhalten könnte, die die Bestrebungen von Indigenen behindern, Land, das ihnen genommen und kolonisiert wurde, wieder zurückzuerobern. Eine intersektionale Herangehensweise erfordert genau solche Fragestellungen und einen gewissen Grad an Reflektion über meine eigene Position.
Von meinem eigenen Körper und meinen eigenen Erfahrungen auszugehen, bedeutet, von einem recht privilegierten Ort auszugehen. Als weiße, körperlich nicht beeinträchtigte cis Frau, weiß ich, dass ich in den meisten Fällen den richtigen Körper habe, um mich durch die nach-industrielle, freizeit- und konsumorientierte moderne Stadt zu bewegen. Ich spreche Englisch in einem englischsprachigen Land. Ich habe eine offizielle Staatsbürgerschaft in zwei Staaten. Mein Status als Siedlerin auf Indigenem Land wird selten infrage gestellt. Ich bin keine Christin, aber jüdisch zu sein, fällt in Kanada nicht auf und ist für die meisten nicht sichtbar, obwohl eine erneute Zunahme von antisemitischer Rhetorik und Gewalt mich dies mit einer wachsenden Vorsicht schreiben lässt. Im Allgemeinen bin ich mir, als jemand, der zum Broterwerb über Gentrifizierung schreibt, dessen bewusst, dass mein Körper als Zeichen der erfolgreichen ›Umstrukturierung‹ gelesen wird und dafür steht, dass ein Ort respektabel, sicher, bürgerlich und erstrebenswert ist.
Mein Körper steht vielleicht auch für Gefahr oder Ausschluss für People of Color, Schwarze, behinderte, Indigene oder trans Menschen, für welche Orte, die durch Weißsein und normative Körper dominiert werden, nicht einladend sind. Meine Anwesenheit könnte darauf hindeuten, dass eine kleinliche Beschwerde beim Manager oder ein lebensbedrohlicher Anruf bei der Polizei nicht weit entfernt sind. Mein Komfort wird wahrscheinlich für meine Umgebung und für die Stadt im Allgemeinen Vorrang vor ihrer Sicherheit haben. Während ich die meisten Eigenschaften, die mich auf diese Weise kennzeichnen, nicht ändern kann, kann ich mir darüber bewusst sein, was mein Körper signalisiert, und den Impuls kontrollieren, darauf zu bestehen, dass der gesamte städtische Raum mir gehört. Wenn meine Gegenwart zu einer weiteren Marginalisierung von bereits ums Überleben kämpfenden Gruppen führen sollte, muss ich unbedingt darüber nachdenken, ob meine Gegenwart dort notwendig ist.
Dieses verkörperte Privileg verhindert nicht geschlechtsspezifische Ängste und Ausschlüsse in meinem Leben. Diese Privilegien, die ich innehabe, überlagern sich eher mit meinen Erfahrungen als Frau und prägen diese. In diesem Buch versuche ich, transparent zu machen, was mein eingeschränkter Blickwinkel offenlegt und was er verdeckt. Ich arbeite mit dem Anspruch, mir bewusst zu machen, dass alles Wissen situiert ist – d.h. dass alles Wissen von irgendwoher kommt. Das macht es für mich erforderlich, anzuerkennen, dass meine Sichtweise selbst dort, wo ich eine ›Insiderin‹ bin (oder war), zum Beispiel in meiner Heimatstadt Toronto, nicht maßgeblich ist.[34] In vielen anderen Städten, über die ich schreibe, bin ich eine Outsiderin, das heißt, dass ich mich davor hüten muss, saloppe Stereotype oder problematische Bilder von Städtegemeinschaften zu entwickeln, zu denen ich nicht gehöre. Außerdem muss ich die Tatsache deutlich machen, dass ich meine städtischen Erfahrungen und geografische Expertise in Städten des globalen Nordens und westlichen Forschungseinrichtungen gewonnen habe. Auch wenn ich relevante Beispiele und Fallstudien aus einer größeren Bandbreite an Orten zusammengetragen habe, bin ich nicht in der Lage, ›Frauenfragen‹ gerecht zu werden, die in Städten des globalen Südens oder Asiens aufkommen. Diese Kluft ist ein andauerndes Problem in feministischer Stadtgeografie, das viele als wesentliche Herausforderung für Wissenschaftler*innen des 21. Jahrhunderts identifiziert haben.[35]