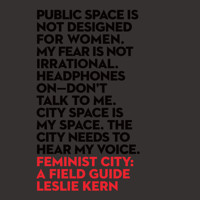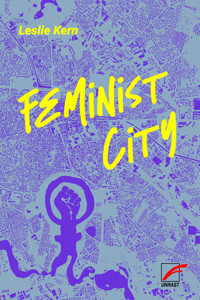15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unrast Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gentrifizierung – was genau ist das eigentlich? Irgendwas mit Verdrängung in der Stadt? Und können wir etwas dagegen tun? Essayistisch und kurzweilig geschrieben vermittelt Leslie Kern einen umfassenden Überblick zu den Debatten über Gentrifizierung seit den 1950er-Jahren: was umfasst sie, wer profitiert von ihr und wer wird durch sie verdrängt? Wir begleiten die Autorin auf ihren Reisen nach Toronto, New York, London und Paris, wo sie den Mythen und Lügen der neuen Krise der Städte auf den Grund geht und dabei deutlich macht, dass die gewaltvolle Verdrängung eng mit Klassismus, Rassismus und Sexismus verbunden und eine Fortsetzung des kolonialen Projekts ist. Doch: Steigende Mieten, Zwangsräumungen, zunehmende Polizeipräsenz und zerfallende Communitys sind nicht unumgänglich und Widerstand lohnt sich. Kern tritt für eine dekoloniale, feministische und queere Praxis der Anti-Gentrifizierung ein, die neben dem Recht auf Stadt für alle auch die Rückgabe von Land und Entschädigungen für Vertriebene fordert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Leslie Kern ist Autorin von drei Büchern über Städte, darunter Feminist City (Unrast Verlag). Sie lehrt an der Mount Allison University in Kanada Geografie mit einem Fokus auf urbane, soziale und feministische Bewegungen, schreibt auf ihrem Blog lesliekerncoaching.com und twittert über Feminismus, urbane und akademische Themen unter @LellyK.
Leo Kühberger ist Historiker, Kulturanthropologe und Übersetzer und lebt in Graz. Er forscht und schreibt vor allem zur Geschichte und Theorie sozialer Bewegungen. Hauptberuflich ist er Eisenbahner.
Leslie Kern
Gentrifizierung lässt sich nicht aufhalten und andere Lügen
aus dem Englischen übersetzt von Leo Kühberger
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar
Leslie Kern:
Gentrifizierung lässt sich nicht aufhalten und andere Lügen
Titel der Originalausgabe: Gentrification Is Inevitable and Other Lies
© 2022 Leslie Kern.
Erstveröffentlichung bei Between the Lines, Toronto, Kanada, 2022
www.btlbooks.com
Übersetzt und gedruckt mit freundlicher Unterstützung des Canada Council for the Arts.
eBook UNRAST Verlag, April 2023
ISBN 978-3-95405-151-9
© UNRAST Verlag, Münster 2023
www.unrast-verlag.de | [email protected]
Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung
sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner
Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter
Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: David Hellgermann, Münster
Satz: Andreas Hollender, Köln
In liebevoller Erinnerung an meinen Vater,einen freundlichen und großzügigen Mann
Inhalt
Gentrifizierung ist ...
Gentrifizierung ist natürlich
Gentrifizierung ist eine Frage des Geschmacks
Gentrifizierung ist eine Frage des Geldes
Gentrifizierung ist eine Frage der Klasse
Gentrifizierung ist eine Frage der physischen Verdrängung
Gentrifizierung ist eine Metapher
Gentrifizierung ist unvermeidlich
Lasst uns eine andere Geschichte erzählen
Endnoten
Danksagung
Ich danke Amanda Crocker, meiner Verlegerin bei Between the Lines, für ihre unermüdliche Unterstützung und ihr in jeder Phase der Entstehung dieses Buches hilfreiches Feedback. Leo Hollis von Verso Books war mit seinen Überlegungen und Vorschlägen ebenfalls eine ungeheure Unterstützung. Ein großes Dankeschön geht an die Mitarbeiter*innen dieser beiden unabhängigen Verlage, die hinter den Kulissen in der Gestaltung und im Marketing großartige Arbeit leisten. Nadine Ryan leistete beim Lektorat hervorragende Arbeit, und alle verbliebenen Fehler sind mir anzulasten.
Den Mi’kmaq habe ich zu danken, da ich seit 2009 auf ihrem Land Gast sein darf. Ich fühle mich geehrt, dass ich während des Schreibens dieses Buches auf dem Land der Mi’kmaq leben, arbeiten und lernen durfte.
Ich bin dankbar, dass ich Kolleg*innen, die ich mittlerweile zu meinen Freund*innen zähle, wie Winifred Curran habe, deren eigene Forschungen und Bereitschaft zur Zusammenarbeit viele meiner Projekte bereichern konnten. Michael Fox ging das Risiko ein, einer Nicht-Geografin an einem Institut für Geografie einen Job zu geben, und er setzte sich dafür ein, dass ich dort bleiben konnte. Roberta Hawkins hatte die Geduld, zu warten, bis die Arbeit an diesem Buch beendet ist, damit wir uns wieder in die gemeinsame Arbeit stürzen können.
Meine Freund*innen waren und sind die größten Unterstützer*innen meiner Arbeit, und trotz der Entfernung, einer Pandemie und der Achterbahn des Lebens sind sie eine große Bereicherung für mein Leben: Jennifer Kelly, Kris Weinkauf, Katherine Krupicz, Sarah Gray, Cristina Izquierdo, Michelle Mendes, Katie Haslett, Jane Dryden, Shelly Colette und Lisa Dawn Hamilton.
Ich möchte auch meiner Familie danken, die mich immer ermutigt hat, in meinem Beruf und in meinem Leben nicht stehenzubleiben, sondern weiterzugehen: Dale Kern, Ralph Kern, Josh Kern, Geof Dunn, Kathy Saunders, Charmaine Peters und meine Großeltern, Tanten, Onkel und Cousins und Cousinen.
Meine Tochter Maddy ist für mich immer eine große Inspiration, und hoffentlich kann ich das auch für sie sein. Mein Partner Peter sorgt mit seiner bedingungslosen Liebe und Fürsorge dafür, dass ich auf dem Boden bleibe. Ich danke euch allen!
Gentrifizierung ist …
Ich lebte früher in The Junction, einem von sich kreuzenden Eisenbahnlinien durchzogenen, abgelegenen Stadtteil im Westen von Toronto. Die Industriegeschichte dieses Viertels war allein schon durch die Geräusche und Gerüche, die von den Gummi-, Farb- und Fleischfabriken herrührten, allgegenwärtig. Auch heute, an einem heißen Nachmittag, mögen einem diese Gerüche noch in die Nase steigen, aber mittlerweile konkurrieren sie mit den Gerüchen aus den schicken Cafés und veganen Bäckereien. Mir ist schon klar, dass es ein Klischee ist, wenn man davon redet, wie trostlos das eigene Viertel doch einmal war, aber es gibt einen Grund, warum wir dieser Erzählungen überdrüssig sind: So viele unserer Stadtteile werden nun vor unseren Augen umgestaltet.
Was ich in The Junction beobachten konnte, ist Teil einer ganzen Reihe von Veränderungen, die jenen Orten und Communitys widerfahren, die eine Stadt einmal interessant und besonders und zum Schauplatz von Protest und Fortschritt gemacht haben. Diese Veränderungen werden heute als Gentrifizierung bezeichnet und dieses Buch handelt von den Kämpfen gegen die Gentrifizierung, die alles unter sich begräbt, was vielen von uns am Leben in der Stadt lieb und teuer ist.
Bevor ich im Jahr 2000 dorthin zog, hatte ich, obwohl ich seit über zwanzig Jahren in Toronto lebte, noch nie von The Junction gehört. Das Viertel war ein merkwürdiger Ort: Zwischen 1904 und 1998 war es ›trocken‹, sprich der Ausschank von Alkohol war untersagt, und durch die Nähe zu den alten Schlachthöfen war es attraktiv für Migrant*innen aus Malta, Italien und Polen, die in der Fleischindustrie schufteten. Aktive Industrieanlagen und fleischverarbeitende Betriebe befanden sich direkt neben verlassenen Fabriken und brachliegenden Flächen, nur wenige Straßenzüge von den überaus praktischen Angeboten der zentralen Einkaufsmeile entfernt. Die Filiale eines Videoverleihs, ein Lebensmitteldiscounter und die Post waren die einzigen Geschäfte, die ich als Studentin und frischgebackene Mutter aufsuchte. Die Pfandleihhäuser und das eigenartige Überangebot an Werkstätten, die Polstermöbel reparierten, waren für mich weniger einladende Orte.
Was wir stattdessen zu bieten hatten, waren eine überdurchschnittlich hohe Luftverschmutzung, öffentliche Parks, die mit weggeworfenen Nadeln übersät waren, und eine weitgehend vergessene, migrantisch geprägte Bevölkerung, überwiegend aus der Arbeiter*innenklasse und mit niedrigen Einkommen. Ich sage ›weitgehend vergessen‹, weil The Junction im Gegensatz zu anderen Stadtteilen von Toronto, die wegen des Drogenkonsums, der Wohnungslosigkeit und der Sexarbeit stigmatisiert wurden, nur selten in den Nachrichten auftauchte. Es war kein Ort, der als ›fremd‹ oder angsteinflößend imaginiert wurde. Wer nicht selbst innerhalb dieses Dreiecks aus Eisenbahnlinien wohnte, hatte einfach keine Vorstellung von diesem Ort. Als ich auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung gewesen war, war in den Inseraten für The Junction stets von »High Park North« die Rede, um eine Assoziation zu dem vornehmen Stadtteil und dem schönen Park im Süden herzustellen. Das war ein ziemlich kreativer Prozess der Namensgebung, um die Tatsache zu verschleiern, dass es sich eben nicht um High Park handelte.
Aber es gab trotzdem eine Menge junger Familien, gute Schulen und passable, wenn auch kleine Grünflächen, die über das Wohngebiet verstreut waren. Schlussendlich reden wir über eine Stadt in Kanada, wo die öffentlichen Ausgaben für die städtische Infrastruktur in der Regel nicht so weit zurückgefahren wurden, dass völlig unbewohnbare Orte entstanden wären. Auch wenn meine Kellerwohnung, in der sich die Mäuse tummelten, so einiges zu wünschen übrig ließ, lernte ich schnell andere Mütter mit Kindern im Alter meiner Tochter kennen und traf auf eine hilfsbereite Community. In den ersten Jahren gab es hin und wieder Zeichen der Veränderung: hier ein interessantes neues Geschäft, da eine Veranstaltung. Aber nur wenig davon schien von Dauer zu sein. Es war ein bisschen ›artsy‹, aber alles andere als hip.
Mitte der 2000er Jahre begann sich jedoch alles zu ändern. Die große Zahl an neuen Geschäften und Restaurants bot der bisherigen Abwärtsentwicklung die Stirn und bescherte dem Viertel ungewohnte Aufmerksamkeit. Auf einmal war das Viertel ›im Kommen‹ und wurde schnell Torontos neuester Hotspot. The Junction lag plötzlich im Trend. Altes und Neues kam hier zusammen. Ein Reiseziel. Die Medien der Stadt berichteten in ihren wöchentlichen Sparten ›Was tun?‹ und ›Wo essen?‹ über Veranstaltungen, Bars, Geschäfte und Restaurants in unserem Stadtteil. Die Aufregung erreichte ihren vorläufigen Höhepunkt, als die Online-Redaktion der New York Times 2009 eine Geschichte mit dem Titel »Der Problemkiez von Toronto wird hip«[1] brachte.
Der Artikel erzählte eine Aschenputtel-Geschichte, die wie ein Märchen über den Gegensatz von Vorher und Nachher funktioniert. In diesem und anderen Artikeln wurde die ›alte Junction‹ als heruntergekommenes, dreckiges Viertel beschrieben. Ein giftiges Wrack, zu marode, um repariert zu werden, in der Vergangenheit steckengeblieben und im Niedergang begriffen. Mit diesen Adjektiven lässt sich sicherlich eine packende Geschichte einer Metamorphose erzählen. Aber sie erfüllen auch einen anderen Zweck. Indem das Viertel als kaputt, verwahrlost und dreckig dargestellt wird, erscheinen die Veränderungen durch die Gentrifizierung als notwendig, gut und wünschenswert. Das Viertel als einen Ort zu beschreiben, der gerettet werden muss, macht aus der Gentrifizierung einen Helden.
Der Reisereporter der New York Times erklärte seinen Leser*innen, dass sich »Junge Leute und Künstler*innen die noch niedrigen Immobilienpreise zunutze machen und sich in den leeren Schaufenstern und einstöckigen Häusern der Junction einmieten«. Diese Held*innen leisten, wie es scheint, gute Arbeit: »Block für Block verwandeln sie diesen Teil der Dundas Street West von einer schäbigen Problemgegend in eine lebhafte Insel voller schräger Buchläden, veganer Restaurants und nachhaltiger Cafés. (…) Wo sich früher ein Pornoladen an den anderen reihte, finden sich jetzt Geschäfte mit gesunden und biologischen Lebensmitteln.«[2] Der Schatten aus Dreck, Armut und Pornografie, der über der Gegend lag, weicht dem verheißungsvollen Strahlen der Bücher, veganen Cafés und Bio-Lebensmittel.
In diesem Hype um die Wiederauferstehung der Junction dachte fast niemand an diejenigen, die nun nicht mehr willkommen waren oder aus ihrer Nachbarschaft verdrängt wurden. Ein Blick in die Kommentarspalten diverser Blogs im Internet machte deutlich, dass es für diese Bewohner*innen nur wenig Sympathie gab. Vielmehr waren sich die Kommentator*innen sicher, dass, wenn die fetttriefenden Imbissbuden, dreckigen Donut-Läden und Brachflächen erst verschwunden wären, auch die ›Freak-Show‹ die Stadt verlassen würde, wie jemand die Anwesenheit von Menschen, die mit psychischen Erkrankungen, Wohnungslosigkeit und Behinderungen zu kämpfen haben, nannte.[3]
War die Veränderung, die die Junction erfuhr, der Wandel von einem Arbeiter*innenviertel und einer Industriezone zu einem hippen, lebenswerten Stadtteil, bloß eine quasi natürliche Phase im Laufe städtischer Entwicklung? Ist es eine Frage des ökonomischen Einmaleins, dass auf Jahrzehnte des Niedergangs unvermeidlich ein Aufschwung folgt? Gab es auf der kulturellen Ebene etwas, das die Junction so interessant machte, dass sich die jungen Hipster davon angezogen fühlten? Und während sich die Gentrifizierung ihren Weg bahnt, welchen Schaden richtete sie dabei an, falls sie einen anrichtete? Aus den Antworten auf diese und andere Fragen über einen Stadtteil wie die Junction entstehen dann die Geschichten, die wir uns erzählen, wie und warum Gentrifizierung passiert. Diese Geschichten, mit ihren jeweiligen Held*innen und Bösewichten, Widersprüchen und überraschenden Wendungen, Ungereimtheiten und Darsteller*innen, die allzu sehr klischeehaft wirken, sind das Thema dieses Buches.
Wenn ihr, wie auch ich, bei diesen Geschichten über Gentrifizierung eine Mischung aus Frustration, Hilflosigkeit, Wut und Mitgefühl empfindet, dann ist es genau das richtige Buch für euch. Bis vor gar nicht allzu langer Zeit kam der Begriff Gentrifizierung fast ausschließlich in akademischen Debatten vor. Mittlerweile wollen immer mehr Menschen verstehen, was in ihrem Stadtteil passiert, und sich darüber klar werden, was sie selbst damit zu tun haben. Aber genau dann, wenn man denkt, dass man verstanden hat, was Gentrifizierung ist, nimmt diese eine neue und beängstigendere Gestalt an. Dieses Buch liefert eine Grundlage, um zu verstehen, wie die Gentrifizierung historisch entstanden ist, aber, und das ist noch wichtiger, ich werde zudem einen Rahmen bieten, um zu verstehen, wie, wo und warum Gentrifizierung heute passiert.
Es wird um heikle Fragen von Verantwortung, Rechenschaft und Macht gehen. Das Buch geht auch Themen auf den Grund, die in den Debatten über Gentrifizierung häufig ausgeklammert werden, wie Race, Kolonialismus, Gender und Sexualität. Vor allem aber soll uns dieses Buch in Erinnerung rufen, dass es zahlreiche Beispiele erfolgreichen Widerstands gegen die Gentrifizierung gibt. Ganz egal, in welcher Form man mit Gentrifizierung zu tun hat, gibt es Möglichkeiten, sich mit diesen Kämpfen – genau jetzt – solidarisch zu zeigen.
Jedes der Kapitel beleuchtet eine andere Perspektive auf Gentrifizierung, eine andere Geschichte sozusagen, die einen anderen Ausschnitt dieses schwer zugänglichen Themas darlegt. Ich mache mich auf die Suche danach, was diese Geschichten zu Tage fördern und was nicht, was sie beinhalten und was sie weglassen, worauf sie ihren Fokus legen und was sie außen vor lassen. Ich wähle diesen Zugang, weil ich davon überzeugt bin, dass Geschichten wichtig sind. Sie prägen die Art und Weise, wie wir unsere Vergangenheit und Gegenwart wahrnehmen, sie ermöglichen die Fähigkeit zu Empathie mit anderen, und, was am wichtigsten ist, sie setzen den Rahmen dafür, was wir uns als Ergebnis überhaupt wünschen und vorstellen können. Ich interessiere mich vor allem dafür, ob die Geschichten, die wir über die Gentrifizierung ersinnen, eine Vision oder zumindest auch nur das Anklingen einer Möglichkeit enthalten, dass es eine Stadt geben kann, in der Gentrifizierung nicht als unabwendbar erscheint.
Anfänge
In den späten 1990er Jahren lebte und arbeitete ich im Norden von London, ohne zu wissen, dass ich ganz in der Nähe des Stadtteils wohnte, in dem der Begriff Gentrifizierung ursprünglich geprägt worden war. Islington war, so wie ich es in Erinnerung habe, voller typischer georgianischer Reihenhäuser und hatte eine belebte Hauptstraße mit Geschäften und Pubs, die von Fans des FC Arsenal frequentiert wurden, und eine Menge Cafés und Restaurants. Die Sozialwohnungen und das Gefängnis Pentonville waren für mich einfach ein Teil dessen, was ich für einen typischen Stadtteil von Nord-London hielt.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch nie von Gentrifizierung gehört und keine Vorstellung davon, dass Islington früher einmal eine überbevölkerte, dreckige und von Armut geprägte Gegend gewesen war. In der Mitte des 19. Jahrhunderts waren viele Bewohner*innen aus der Innenstadt Londons wegen großer öffentlicher Infrastrukturprojekte wie dem Bau der U-Bahn verdrängt worden. Sie mussten in den Norden der Stadt ausweichen und zwängten sich in die kleinen Wohnungen der vormals mondänen Bürgerhäuser von Islington. Mitte des 20. Jahrhunderts galt Islington dann als eine von mehreren Gegenden, die von städtischer Armut heimgesucht wurden. Nachdem die Bomben des Zweiten Weltkriegs für große Zerstörungen gesorgt hatten, wurden viele der Reihenhäuser durch Sozialwohnungen ersetzt, wodurch sich die Lebensbedingungen etwas verbesserten.
In den 1960er Jahren wurden die verbliebenen georgianischen Häuser, die zwar etwas heruntergekommen, aber stabil genug gewesen waren, um den Krieg zu überstehen, nach und nach für Menschen aus der Mittelschicht attraktiv. Die Londoner Soziologin Ruth Glass bemerkte diese langsame Zunahme an Familien mit mittleren Einkommen, die in »schäbige, bescheidene Reihenhäuser und Cottages«[4] zogen. Sie setzten die maroden Reihenhäuser durch ihre eigene Arbeitskraft nach und nach wieder instand. Im Laufe der Zeit erfuhren die Häuser einen beträchtlichen Wertzuwachs. Im Jahr 1964 prägte Glass den Begriff Gentrifizierung, um diese ökonomische und demografische Entwicklung zu beschreiben. Der Begriff verweist schon auf den für sie wichtigsten Aspekt dieses Prozesses: eine Veränderung der Klassenzusammensetzung. Das Viertel wurde von den Gentry[5], den Wohlhabenderen, immer mehr nach ihren Vorstellungen, ihrem Geschmack und ihren Vorlieben umgestaltet.
Von Anfang an stellte Glass die Verdrängung als das entscheidende, wenn auch oft diskutierte Merkmal der Gentrifizierung in den Vordergrund. Glass dazu: »Sobald dieser Prozess der ›Gentrifizierung‹ in einem Gebiet beginnt, setzt er sich unaufhörlich fort, bis alle oder die meisten der bisherigen Bewohner*innen aus der Arbeiter*innenklasse vertrieben sind und sich der gesamte soziale Charakter des Viertels geändert hat.«[6] Glass bezeichnete diesen Vorgang als »Invasion« und erwähnte, dass Teile von Notting Hill, einem von Arbeiter*innen, die aus der Karibik zugewandert waren, dicht bevölkerten Stadtteil in West-London, sich bereits verändert hatten. Für die Frage, worüber wir eigentlich sprechen, wenn wir über Gentrifizierung sprechen, ist es noch immer von zentraler Bedeutung, dass zahlreiche Menschen verdrängt werden und der »gesamte soziale Charakter« eines Stadtteils verändert werden könnte.
Menschen aus der Mittel- und Oberschicht eigneten sich wahrscheinlich schon immer Räume an und gestalteten sie nach ihren Bedürfnissen und Wünschen um. Was an Islington aber bemerkenswert erschien, war, dass dies in einer urbanen und von Arbeiter*innen dicht bewohnten Gegend passierte, und mit Häusern, die, wie Glass bemerkte, ein umgekehrtes Verhältnis zwischen ihrem gegenwärtigen sozialen Status und ihrem Wert und ihrer Größe hatten. Anders gesagt: Ihr sozialer Status war hoch, während sich der Wert und die Größe eher bescheiden ausnahmen. Diese Leute aus der Mittelschicht zogen nicht aus der Stadt weg und waren auch nicht auf der Suche nach einer größeren oder moderneren Wohnung. Vielmehr blieben sie in der Stadt oder kehrten in die Stadt zurück und suchten nicht moderne Wohnungen oder die Ruhe der Vorstadt, sondern etwas anderes. Was sie da genau suchten, ist nicht ganz klar. Aber im Vergleich zu Entwicklungen wie der Suburbanisierung scheint die Gentrifizierung von anderen Hoffnungen und Ängsten getrieben zu sein.
Die Verdrängung von migrantischen oder rassifizierten Communitys oder Menschen aus der Arbeiter*innenklasse war zu diesem Zeitpunkt weder für England noch für andere Länder etwas Neues. Sogenannte ›Elendsviertel‹ oder ›Slums‹ waren schon immer Ziel der von den Regierungen forcierten Stadterneuerungsprojekte, die darauf abzielten, diese Communitys loszuwerden und den frei gewordenen Bereich anderen Communitys oder neuen Nutzungen wie Autobahnen oder Einkaufszentren zuzuführen. Der Prozess der Gentrifizierung aber, zumindest konnte Glass das damals so beobachten, ist im Gegensatz zu diesen Formen der Stadterneuerung nicht von oben verordnet und staatlich finanziert und es werden dabei auch nicht ganze Stadtteile dem Erdboden gleichgemacht.
Vielmehr kamen weiße Menschen aus der Mittelschicht aus freien Stücken in scheinbar wenig attraktive Gegenden und veränderten durch die Renovierung der Häuser und die Umgestaltung der Umgebung nach und nach den Stadtteil. Selbstverständlich gibt es, wie wir später im Buch noch sehen werden, einen Zusammenhang zwischen einer Stadterneuerung von oben und Gentrifizierung, aber Letztere schien sich davon doch in einem solchen Maße zu unterscheiden, dass diese Entwicklungen einen eigenen Begriff notwendig machten.
Seit 1964 nahm die Gentrifizierung, wie sie von Glass beschrieben wurde, jedoch ganz unterschiedliche Formen an und entwickelte sich in verschiedene Richtungen. Zum Teil entsprechen diese Entwicklungen, die als Gentrifizierung verstanden werden, ganz und gar nicht dem Szenario, das wir vor Jahrzehnten in Islington erlebten.
Nicht die Gentrifizierung eurer Eltern
Nach etwas mehr als einem Jahr im Londoner Norden kehrte ich Ende 1999, in Begleitung eines kleinen Menschen in einem Kinderwagen, nach Toronto zurück. Sich im Gewirr belebter Straßen zurechtzufinden ist schwer genug, aber ich wurde andauernd irgendwo aufgehalten, weil sich überall auf den Gehsteigen der Innenstadt Baustellen breitgemacht hatten. Ich manövrierte den Kinderwagen durch einen Parcours aus Reklametafeln, die alle die unmittelbar bevorstehende Eröffnung eines weiteren glitzernden Wohnturms ankündigten, der ganz sicher der ›letzte Schrei modernen Wohngefühls‹ sein würde. Ich war genervt, aber ich muss zugeben, dass ich von diesem Bauboom, der meine Stadt eine Zeit lang in eine Hauptstadt der Baukräne verwandelte, auch fasziniert war.
Ich hatte zwar noch keine Ahnung von Gentrifizierung, aber man musste nun wirklich kein*e Stadtforscher*in sein, um zu erkennen, für wen diese Eigentumswohnungen gebaut wurden. Schlussendlich lief ich an jeder Straßenecke in eines dieser grinsenden, jungen, weißen Gesichter. Das waren die Gesichter von Menschen, die offensichtlich kein Problem damit hatten, Hunderttausende Dollar auf den Tisch zu legen, um in einem Ein-Zimmer-Würfel hoch über der Autobahn zu wohnen. Das war noch einige Jahre, bevor ich mir genügend Wissen angeeignet hatte, um selbst diese Verbindung herstellen zu können, aber durch irgendetwas schienen die bunten Reihenhäuser in Islington und die Giganten aus Glas und Stahl, die sich jetzt in meiner Stadt nach oben kämpften, miteinander verbunden.
Die Form der Gentrifizierung, die von Glass beschrieben wurde, bei der ein Haus nach dem anderen erfasst wird, passiert noch immer, sie wird aber mittlerweile von vielen anderen Formen der Veränderung in den Schatten gestellt, die eine vollständige gesellschaftliche Transformation nach sich ziehen. Diese beschränken sich nicht darauf, dass einzelne Familien Immobilien erwerben, noch ist diese Entwicklung nur auf den Wohnbereich beschränkt. Diese Veränderungen sind größer, gehen schneller vonstatten und sie sind wohl auch gefährlicher. Der Bau von zehn Gebäuden mit jeweils dreihundert Eigentumswohnungen fühlt sich im Vergleich zur langsamen, atmosphärischen Veränderung, wenn ein paar Familien ihre Altbauwohnungen renovieren, eher an wie der Einschlag eines Asteroiden.
Die Gentrifizierung wird mittlerweile von Kräften betrieben, die um ein Vielfaches gewaltiger sind als eine durchschnittliche Hausbesitzerin aus der Mittelschicht: Stadtregierungen, Bauträger, Investor*innen, Spekulant*innen und digitale Plattformen, die ganz woanders ihren Firmensitz haben, aber immer neue Wege finden, Profit aus dem städtischen Raum zu schlagen. Die altmodische Gentrifizierung der 1960er Jahre erscheint im Vergleich zu der Maschinerie, die sich heute über unsere Städte hermacht, geradezu idyllisch.
Auch die Symbole der Gentrifizierung sind heute ganz andere als die, die Ruth Glass 1964 beschrieb. Reihenweise abschließbare Schlüsselkästen vor Hauseingängen sind beispielsweise ein untrüglicher Hinweis darauf, dass es hier eine Menge Wohnungen gibt, die nur kurzfristig vermietet werden. Das Geräusch der Rollkoffer, die über das Kopfsteinpflaster rattern, ist ein akustisches Indiz für eine durch den Tourismus beförderte Gentrifizierung, was beispielsweise von den Bewohner*innen historischer Stadtteile von Amsterdam als nervtötendes Zeichen der Veränderung wahrgenommen wird.[7] Alte Fabrikgebäude sind nicht mehr der Gradmesser für den Niedergang einer Stadt, sondern ein hipper Wohnsitz für jede und jeden, ob Künstler*in oder Börsenmakler*in. Sogar die bauliche Aufwertung von Sozialwohnungen kann ein Warnhinweis auf die Gentrifizierung sein, da im Zuge dieser ›Sanierungen‹ meist auch Wohnungen zu marktüblichen Preisen geschaffen werden, die für Bewohner*innen der Sozialwohnungen unerschwinglich sind.
All das legt nahe, dass Gentrifizierung heute auf sehr viele verschiedene Weisen stattfindet. Es reicht nicht aus, sich nur anzusehen, welche Entscheidungen die Käufer*innen von Häusern treffen, auch wenn die Fragen des Geschmacks und der Vorlieben der Mittelschicht weiterhin wichtig sind. Es scheint dringlicher zu sein, sich mit der zunehmend aktiven Rolle von Regierungen und Unternehmen zu beschäftigen, die Gentrifizierung forcieren und von ihr profitieren. Städte fördern mittlerweile ganz offen Investitionen der Mittel- und Oberschicht und sogar von Investor*innen, indem sie politische Maßnahmen beschließen, die einer ganz bestimmten Form der Entwicklung von Immobilien und Gewerbe den Weg ebnen.
Einige Zutaten dieses stadtpolitischen Rezepts sind so erwartbar, dass wir sie von San Francisco bis Shanghai finden können. Viele Städte verfolgen von der Revitalisierung des alten Hafens über Einkaufsmeilen, die auf die Bedürfnisse von Fußgänger*innen zugeschnitten sind, bis zu neuen Grünflächen und Kunst- und Kulturprojekten bemerkenswert gleichartige Pläne, um die, wie sie hoffen, passenden Annehmlichkeiten zu schaffen, dass sich Menschen mit der gewünschten Mischung aus finanziellen und kulturellen Ressourcen angesprochen fühlen. Auch wenn nicht alle diese Anstrengungen als Gentrifizierung bezeichnet werden können, sind sie häufig Teil einer ganzen Reihe von Maßnahmen und räumlichen Eingriffen, die Städten und Stadtteilen ein neues Image verpassen sollen, damit andere Bevölkerungsgruppen angesprochen werden.
Zugleich haben Lokalregierungen Wege und Mittel der Kooperation mit dem privaten Sektor gefunden, wodurch sie die Geschwindigkeit der Veränderung in den Innenstädten und darüber hinaus erhöhen konnten. Anreize für Investor*innen wie Steuererleichterungen oder die Möglichkeit, dass sie die abgewohnten Sozialwohnungen ›sanieren‹ und als Gegenleistung neue Wohnungen zu marktüblichen Preisen in der Gegend errichten dürfen, tragen dazu bei, dass gigantische neue Wohnprojekte aus dem Boden gestampft werden. Manchmal ist es der Staat selbst, der durch seine Stadtsanierungsprojekte die Armen bewusst in alle Winde zerstreut und informelle Unterkünfte zerstört, um Platz für die Art von Eigentum zu schaffen, die dann reiche Investor*innen und die neue Mittelklasse anziehen.
Ist der Begriff Gentrifizierung angesichts dieser ganz unterschiedlichen Taktiken und Strategien, die von mächtigen Akteur*innen zum Einsatz gebracht werden, überhaupt noch passend? Bereits 1984 stellten Forscher*innen wie Damaris Rose besorgt fest, dass Gentrifizierung ein »chaotischer Begriff«[8] geworden war, der so weit über seine ursprüngliche Bedeutung hinaus ausgedehnt wurde, dass er seine Bedeutung verlor. Die alternativen Begriffe hingegen, die in politischen und stadtplanerischen Diskussionen auftauchen, bleiben vage und verschleiern die Verdrängung und die Machthierarchien.
Revitalisierung, Reurbanisierung, Stadterneuerung, Wiederbelebung und Sanierung sind die Begriffe der Wahl, verwendet von Stadtplaner*innen, Politiker*innen, Bauträgern, Immobilienmakler*innen, Kreditinstitutionen und all den anderen, die sich für großflächige, von der Stadt und Bauträgern getragene Maßnahmen starkmachen, mit dem Ziel, dass wieder Geld in die Stadt fließt. Diese Begriffe gehen dem leidigen Thema der Veränderung der Klassenzusammensetzung aus dem Weg. In der Wortschöpfung von Ruth Glass steckt diese Dimension aber sehr wohl. Wenn wir beim Thema Gentrifizierung auch über soziale Ungerechtigkeit reden wollen, sollten wir den Begriff beibehalten.
Wie sich die Gentrifizierung auf die Menschen auswirkt
Wir müssen, wenn wir verstehen wollen, welche Folgen Gentrifizierung für viele Menschen hat, über soziale Ungerechtigkeit reden. Unabhängig davon, ob Menschen nun physisch aus ihrem Stadtteil verdrängt werden oder nicht, haben viele den Eindruck, dass die Gentrifizierung einen erheblichen Einfluss auf ihre Lebensqualität und ihr Zugehörigkeitsgefühl hat. Für diejenigen, die durch Zwangsräumungen, steigende Mieten, den Abriss von Häusern oder Projekte der ›Stadterneuerung‹ umgesiedelt werden, können die Folgen verheerend sein und über Generationen hinweg nachwirken. Es ist einfach, sich die Traumata geflüchteter Menschen, die durch Kriege oder Naturkatastrophen zwangsweise vertrieben werden, bewusst zu machen, aber es scheint um einiges schwieriger zu sein, das Leid zu erkennen, das durch die Verdrängung verursacht wird, die Tag für Tag überall in unseren Städten stattfindet.
Auch wenn sich Wissenschaftler*innen und politisch Verantwortliche über das Ausmaß der Verdrängung infolge der Gentrifizierung uneins sind, berichten Menschen von überall her, dass die Veränderungen in ihrem Stadtteil dazu führten, dass diese nun weniger divers, nicht mehr bezahlbar und weniger einladend sind. Die Folgen sind sehr unterschiedlich. Viele Wissenschaftler*innen sehen einen Zusammenhang zwischen Gentrifizierung und dem noch immer bestehenden rassistisch bedingten Wohlstandsgefälle, dem Verschwinden von Sozialwohnungen, zunehmender polizeilicher Überwachung und dem ungleichen Zugang zu guten Schulen, Grünflächen, sauberem Wasser und öffentlichen Dienstleistungen. Der allmähliche Verlust öffentlichen Raums zugunsten privatisierter, durch Kameras und Sicherheitspersonal überwachter Räume, die bloß dem Konsum dienen, wird ebenfalls mit der Gentrifizierung in Verbindung gebracht.
Wenn wir über die Folgen der Gentrifizierung, insbesondere die Verdrängung, reden, reden wir eigentlich über eine ganze Menge verschiedener Dinge. Physische Verdrängung kann ganz verschiedene Ursachen haben, etwa steigende Mieten, höhere Immobiliensteuern, Zwangsräumungen oder der Abriss oder Verkauf von Sozialwohnungen. Die physische Verdrängung ist aber nicht die einzige problematische Folge der Gentrifizierung. Da’Shaun Harrison, eine Aktivistin aus Atlanta, versteht Gentrifizierung als eine Form der Gewalt, und sie beschreibt den Schmerz, den man empfindet, wenn man aus seiner eigenen Nachbarschaft verdrängt wird: »Menschen, mit denen ich gemeinsam aktiv war, können ihre Miete, die immer weiter steigt, nicht mehr bezahlen. Schwarze Kinder werden von weißen Typen, die durch unseren Stadtteil joggen und ängstlich ihren Kinderwagen oder die Leine ihres Hundes umklammern, mit Blicken der Abscheu und des Entsetzens bedacht.«[9] Selbst wenn die Bewohner*innen nicht gezwungen sind umzuziehen, können sie einen Verlust an Gemeinschaft, Zugehörigkeit und Verbundenheit mit diesem Ort erfahren, wenn sich ihre Nachbar*innen, die lokalen Unternehmen und die gebaute Umgebung auf eine Art und Weise verändern, dass sie sich wie Außenseiter*innen fühlen und vielleicht sogar als solche behandelt werden.
Wie sich Gentrifizierung auf Menschen auswirkt, unterscheidet sich nicht nur von einem Ort zum anderen, sondern auch je nach betroffener Bevölkerungsgruppe. Es liegt auf der Hand, dass einige Menschen große Vorteile aus der Gentrifizierung ziehen können, auch wenn wir uns in diesem Buch nicht allzu lange damit aufhalten werden, was in den Profiteur*innen vorgeht. Wenn wir über diejenigen sprechen, die von Verdrängung, Ausgrenzung und Gewalt betroffen sind, dann müssen wir auch auf die Unterschiede achten, die durch Begriffe wie ›die Arbeiter*innenklasse‹ oder ›die Minderheiten‹ übertüncht werden können. Die konkreten Folgen der Gentrifizierung hängen davon ab, wie Menschen im Hinblick auf die herrschenden Machtsysteme entlang von Gender, Race, Sexualität, Alter und Ability verortet sind. Frauen bekommen beispielsweise Gentrifizierung auf eine Art und Weise zu spüren, die ihre zentrale Rolle in der Carearbeit, die höhere Wahrscheinlichkeit, alleinerziehend zu sein, die längere Lebenserwartung und die Folgen der genderbedingten Lohnunterschiede widerspiegelt.
Über die Veränderung der Klassenzusammensetzung hinaus
Wir können die Logik der Gentrifizierung nicht begreifen, wenn wir sie nur unter dem Blickwinkel der Kategorie Klasse betrachten. Es ist zwar unbedingt notwendig, dass die Verdrängung aufgrund der Klassenzugehörigkeit ein Teil der Erzählung bleibt, dabei werden aber Gender, Race, Kolonialismus, Ability, Alter und Sexualität häufig als zweitrangig abgetan. Dank der harten Arbeit von Aktivist*innen, Wissenschaftler*innen, Autor*innen, Künstler*innen und kritischen Stadtplaner*innen wird Gentrifizierung zunehmend als ein Prozess begriffen, der sich auf alle Formen von Machtverhältnissen stützt, um die Verdrängung und Transformation eines Ortes durchzusetzen.
Der Autor und Journalist Ta-Nehisi Coates bringt beispielsweise die Gentrifizierung in amerikanischen Städten mit dem historischen und noch immer andauernden Raub des Vermögens und der Ressourcen Schwarzer Amerikaner*innen in Verbindung, von der Sklaverei über Jim Crow, die Praxis des Redlining[10] bis zur Gentrifizierung unserer Tage. In einem Interview aus dem Jahr 2019 sagte er Folgendes: »Gentrifizierung ist nur eine schöne Umschreibung für Diebstahl. Die Lösung ist ziemlich einfach: Hört auf zu stehlen! Das ist das eine. Und gebt zurück, was ihr gestohlen habt! Das ist das andere.«[11] Diese Perspektive zwingt uns, über eine Darstellung, die nur die Klassenverhältnisse im Blick hat, hinauszugehen, und zu verstehen, wie Ungleichheit aufgrund von Race in der Gentrifizierungsgeschichte eine treibende Kraft darstellt, worauf ich später noch ausführlicher eingehen werde.
Auch die Bedeutung der Kategorie Gender verdient eine größere Aufmerksamkeit. Die feministische Stadtgeografin Winifred Curran meint, dass die Genderverhältnisse für die Gentrifizierung keineswegs nebensächlich sind.[12] Vielmehr bestimmt Gender maßgeblich, wie, wann und wo Gentrifizierung stattfindet. Die steigende Erwerbsquote von Frauen im späten 20. Jahrhundert hatte einen großen Einfluss auf die räumlichen Arrangements, die von Frauen und ihren Familien bevorzugt wurden. Das Leben in der Stadt stellte für viele eine Verbesserung gegenüber der Vorstadt dar, wo es angesichts fehlender Transportmöglichkeiten nahezu unmöglich ist, bezahlte und unbezahlte Arbeit unter einen Hut zu bekommen. Für andere wiederum verschlimmerte die Gentrifizierung die bestehenden Nachteile für Frauen auf dem Wohnungsmarkt, führte zu Verdrängung, Wohnungslosigkeit und einem erhöhten Risiko, Gewalt zu erfahren.
Die bedrückende Geschichte und Gegenwart des Kolonialismus macht deutlich, dass es an der Zeit ist, die Geschichte neu zu schreiben, und zwar von Grund auf. Begriffe wie Grenze, Pionier*in, Invasion, Siedler*in, Kolonisator*in und Dschungel waren lange Zeit fixe Bestandteile der Literatur der Gentrifizierung. Nur wenige Stadtgeograf*innen hielten mal inne und dachten darüber nach, inwiefern die Gentrifizierung und andere Formen der Stadtentwicklung nicht nur metaphorisch Erweiterungen der Kolonisierung sind, indem sie die historische Vertreibung Indigener Menschen durch den kolonialen Städtebau und die noch immer bestehenden Praxen der Marginalisierung und Enteignung im städtischen Raum heute untermauern.
Für den Amerikanisten und Indigenen Aktivisten Nickt Estes ist die Gentrifizierung in den kolonialen Siedlerstädten, wo »die Ureinwohner*innen, die nicht im Reservat leben, die unvollendete Aufgabe des Kolonialismus repräsentieren«[13], eine der Entwicklungen, die explizit ›anti-indianisch‹ sind. Die eigentumszentrierte Logik der Gentrifizierung stärkt die kolonialistische Kontrolle des Raums, während durch die Verdrängung im Zuge der Gentrifizierung die Präsenz Indigener beseitigt und die Vorstellung gestärkt wird, dass Indigene Menschen keine Ansprüche auf urbane Räume hätten.
Es soll nicht vom eigentlichen Thema ablenken, wenn wir versuchen, sich gegenseitig überlappende Faktoren wie Race, Gender und Kolonialismus zu verstehen. Eine intersektionale Analyse kann nicht nur einen Beitrag leisten, um die Folgen der Gentrifizierung besser zu analysieren, sondern bietet auch Hoffnung auf politisches Eingreifen. Curran fragt: Wenn es bei all den Texten über Gentrifizierung schlussendlich darum geht, diese Entwicklung aufzuhalten oder zumindest das Leben der Menschen zu verbessern, die davon betroffen sind, sollten wir dann nicht allen Formen der Ungleichheit Aufmerksamkeit schenken? Wenn dem so ist, dann müssen wir uns fragen: Worüber sprechen wir nicht, wenn wir über Gentrifizierung sprechen?
Eine Macht, die nicht aufzuhalten ist?
Rebecca Solnit, die von sich selbst sagt, dass sie Städte liebt, beklagt in ihrem aufrüttelnden Buch Hollow City die Folgen der Gentrifizierung in San Francisco:
»Was hier geschieht, zersetzt das Herz der Stadt von innen: Die Infrastruktur wird größtenteils ausgebaut und nicht abgerissen, aber das Leben darin wird ausgehöhlt. Die Vielfalt, das kulturelle Leben, die Erinnerungen und die Vielschichtigkeit des Lebens werden trockengelegt. Was dann übrig bleibt, mag durchaus wie die Stadt aussehen, die sie gewesen ist, oder eine schönere, glänzendere und sauberere Ausgabe davon, aber das, was diese Stadt beinhaltete, ist verloren.«[14]
Solnits Befürchtungen dürften allen, die in ihrer Stadt Veränderungen beobachten und sich deswegen sorgen, nur allzu bekannt sein. Autor*innen, die sich die Stadt zu ihrem Thema machten, haben uns mit ihren düsteren Warnungen und ergreifenden Lobeshymnen dazu gebracht, uns mit der Leere auseinanderzusetzen, die nach der Gentrifizierung entsteht. Da ist es schwer, hoffnungsvoll zu bleiben, und selten nur stolpern wir über gute Nachrichten.
Für viele scheint die Gentrifizierung eine unausweichliche Entwicklung zu sein. Ich kann es sehr gut nachempfinden, wenn sich angesichts der Gentrifizierung Gefühle von Überforderung und Verzweiflung breitmachen. Die Erzählung der Unvermeidlichkeit spielt allerdings nur denjenigen in die Hände, die aus der Gentrifizierung Nutzen ziehen. Wir bleiben dann isoliert und frustriert in unserer Blase, ohne zu wissen, dass es Alternativen gibt und der Kampf vieler Communitys durchaus von Erfolg gekrönt wurde.
Von direkten Aktionen wie Hausbesetzungen oder der Besetzung von Brachflächen bis zur Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung in Form von Community Land Trusts[15]: Es gibt viele Beispiele erfolgreicher Initiativen, um Wohnraum zu erhalten und die Gentrifizierung abzuschwächen. Soziale Bewegungen wie Black Lives Matter, Bewegungen gegen sexualisierte Gewalt oder auch die Umweltbewegung machen sich den Kampf gegen Gentrifizierung zu eigen, weil ihnen sehr bewusst ist, dass prekäre Wohnverhältnisse, Verdrängung und Gewalt miteinander verbunden sind. Mir ist es wichtig, dass wir, wenn wir über Gentrifizierung reden, auch darüber reden, wie Widerstand aussehen kann und welche alternativen Ansätze es gibt, einen Stadtteil zu entwickeln oder in diesen zu investieren, ohne dass dies zu Verdrängung führt.
… und andere Lügen
Ich möchte in diesem Buch anhand einiger Geschichten, sieben um genau zu sein, erläutern, wie wir Gentrifizierung begreifen können. Ich denke nicht, dass es sich bei auch nur einer dieser Geschichten um eine Lüge im eigentlichen Sinne handelt. Einige davon tragen jedoch die Gefahr in sich, dass sie die Möglichkeit von Veränderung oder Gerechtigkeit im Keim ersticken. Andere wiederum sind nicht unbedingt falsch, sondern eher unvollständig oder davon bestimmt, dass sie eine bestimmte Sichtweise bevorzugen. Meine Hoffnung ist, dass jede dieser Geschichten euch ermöglicht, dass ihr über die Gentrifizierung auf eine Art und Weise nachdenkt, die ihr bisher nicht in Betracht gezogen habt. Das Schlusskapitel beinhaltet dann eine Reihe von Grundsätzen und Methoden, die euch als Ausgangspunkt für weitere Überlegungen und eigenes Handeln dienen können.
Ich nehme nicht an, dass meine Version dieser Entwicklungen die beste oder gar die wahrhaftigste Geschichte erzählt, aber ich denke, dass dieses Buch Anlass zur Hoffnung bietet, dass wir die Erzählung von der Unvermeidbarkeit der Gentrifizierung umschreiben können. Am Ende dieses Buches, so hoffe ich, werdet ihr mir darin zustimmen.
Gentrifizierung ist natürlich
Mit großer Begeisterung folge ich auf Instagram einigen Accounts mit historischen Fotos von Toronto. Besonders mag ich dabei diese Vorher-Nachher-Aufnahmen, die das Vergangene, heutzutage also alles vor 1990, dem Neuen gegenüberstellen. Es ist faszinierend zu sehen, wie viel sich verändert hat, und noch interessanter ist es, wenn man sich ansieht, was einfach nur über die Relikte der Vergangenheit gelegt wurde.
Wenn man sich auf diese Bilder einlässt, könnte man den Eindruck gewinnen, dass diese Veränderungen Teil eines natürlichen Wachstumsprozesses sind, der organisch und vielleicht sogar durch eine Art städtische DNA vorbestimmt scheint. Die Stadt breitet sich aus, sie wächst in die Höhe, sie wird immer dichter und sie bewegt sich immer schneller. Sie scheint, wie es beim Wachstum eines jeden Organismus der Fall ist, ihrer natürlichen Bestimmung zu folgen. Die Vorstellung von der Stadt als Organismus ist in der Tat verlockend und erlaubt es uns, ihr schlagendes Herz, ihre Nervenzentren, Arterien und Venen wie unsere eigenen zu denken.
Die Übertragung von Vorstellungen und Begriffen aus der Natur auf die gebaute Umwelt führt leider dazu, dass die nur allzu menschengemachten Fundamente dieser Orte, die wir unser Zuhause nennen, ausgeblendet werden. Sich auf natürliche Prozesse zu beziehen scheint praktisch zu sein, um einem derart komplexen Ungetüm wie einer Stadt Sinn zu verleihen, aber es ist auch ein effektiver Weg, Machtverhältnisse unsichtbar zu machen.
Die erste Geschichte über Gentrifizierung, die ich in diesem Buch erzählen werde, richtete großen Schaden an, und deshalb müssen wir ihr etwas entgegensetzen. Daher begegne ich der Vorstellung, dass es sich bei der Gentrifizierung um einen natürlichen, also erwartbaren, unvermeidbaren und normalen Prozess handelt, mit der Frage, wer davon profitiert und wer verliert, wenn wir fragen: »Aber ist das nicht einfach nur natürlich?«
Es ist leicht nachzuvollziehen, warum es so verlockend ist, auf die Evolution, die Gesetze der Physik und den Anthropomorphismus zurückzugreifen, um zu verstehen, wie sich Städte verändern. Menschen lieben Metaphern. Durch Metaphern können wir zwischen verschiedenen Arten von Dingen und Ideen eine Verbindung herstellen und sie dadurch in einem anderen Licht sehen. Gerade als Autorin habe ich nichts gegen Metaphern einzuwenden. Aber eine Metapher ist nicht dasselbe wie eine Erklärung, und hier begeben wir uns schnell auf Glatteis, wenn wir beispielsweise über Städte als sich entwickelnde Organismen sprechen.
Die Evolutionstheorie ist überaus wichtig, um die schwindelerregend komplexe und dynamische Welt der Lebewesen zu erklären und ihr einen Sinn zu geben. Eine Erklärung hat etwas Beruhigendes. Sie gibt uns ein gewisses Maß an Stabilität, Vorhersehbarkeit und Gewissheit. Die ›Gesetze‹ der Evolution bringen Ordnung in eine sich permanent verändernde Umwelt. Daher ist es kein Wunder, dass wir diese Gesetze gerne auch auf andere komplexe Systeme anwenden, unter anderem auf unsere Städte.
Im Alltag verwenden wir das Wort ›Entwicklung‹ gerne als Synonym für Veränderung. Der englische Begriff ›evolve‹ meint jedoch zudem eine positive oder wünschenswerte Veränderung, wie beispielsweise eine Zunahme der Komplexität (von Organismen), der Effizienz (von Technologien) oder des Wissens und der Erfahrung (menschliches emotionales Wachstum). Anders gesagt, es handelt sich dabei um keinen neutralen Signifikanten. Noch wichtiger ist unter Umständen aber, dass der Begriff untrennbar mit der Theorie, wie sich Arten in Reaktion auf ihre Umwelt verändern und anpassen, verbunden ist. Die Evolutionstheorie wurde indessen auf eine Art und Weise auf Städte und vor allem auf Prozesse der Gentrifizierung angewandt, die weit über die Verwendung von Synonymen und Metaphern hinausgeht.
Die Verfechter*innen dieser Sichtweise gehen dabei nicht unbedingt subtil vor. »Gentrifizierung ist eine natürliche Entwicklung«[1] lautete 2014 etwa die Schlagzeile eines Kommentars im TheGuardian, in dem sich der Autor Philip Ball auf die Arbeit des Wissenschaftlers Sergio Porta stützt, um zu argumentieren, dass »problematische« Londoner Stadtteile wie Brixton und Battersea einen evolutionären Prozess durchliefen, der sie von kriminellen und drogenverseuchten Vierteln zu hippen Szenevierteln entwickelte. Ball beschreibt Städte dabei als »natürliche Organismen« und die Gentrifizierung der »schwierigen« Londoner Gegenden als »beinahe ein Naturgesetz«. Porta und seine Kolleg*innen, die in einem Peer-Review-Journal mit dem interessanten Namen »Physics and Society« veröffentlichen, behaupten, dass sie eine Formel gefunden hätten, mit der sich Gentrifizierungsprozesse vorhersagen lassen.
Sie konzentrieren sich dabei auf die physischen Merkmale eines Stadtteils und behaupten, dass anhand der Geometrie des Straßennetzes und seiner Anbindung an die Hauptverkehrsstraßen berechnet werden könne, wie wahrscheinlich es ist, dass es zu Prozessen der Gentrifizierung kommt. Ihr Argument lautet, dass Städte gewissen Naturgesetzen gehorchen und diese über den willentlichen Eingriffen von Stadtplaner*innen, Politiker*innen und Bauträgern stehen: »So gesehen untersuchen die Forscher*innen die Evolution von Städten ähnlich wie Biolog*innen die Evolution in der Natur – fast so, als ob die Stadt selbst ein natürlicher Organismus wäre.«[2] Basierend auf diesen Annahmen kommt Porta zu dem Schluss, dass Gentrifizierung für Städte eigentlich gesund ist, denn »sie ist Ausdruck ihrer Anpassungsfähigkeit, eine Facette ihrer Resilienz.«[3]
Die Bewohner*innen von Brixton und Battersea, die schon lange dort leben, würden ihre Resilienz hingegen wohl anders definieren, nämlich als eine Facette ihrer Fähigkeit, eine Welle von Veränderungen zu überstehen, die über Jahrzehnte diese Schwarzen, multikulturellen Arbeiter*innenviertel auf verschiedene Weisen bedroht hat. Die Sprache der Evolution und der wünschenswerten Anpassung ist in diesen Fällen auch wegen des rassistischen Kontexts ganz besonders bitter, weil hier Menschen of Color von weißen Gentrifiern verdrängt werden.
Die Bewohner*innen und lokalen Unternehmen befürchten steigende Mieten und Verdrängung, wenn millionenschwere ausländische Investor*innen Orte wie den Brixton Markt aufkaufen oder Battersea mit Luxus-Hochhäusern überziehen.[4] Folashade Akande, der einen Stand am Brixton Market betreibt, sagte zur New York Times: »Die ganzen Einheimischen, die Angehörigen von Minderheiten, werden vertrieben. (…) Ich versuche, so lange wie möglich zu bleiben.«[5] In Vauxhall-Nine Elms-Battersea, einem Gebiet, das angeblich ›voller Möglichkeiten steckt‹ und dafür – zumindest von konservativen Politiker*innen – gepriesen wird, stehen die Luxuswohnungen, die von Spekulant*innen erworben wurden, leer, während Menschen in ›bezahlbaren‹ Gebäuden ihre Wohnungen durch gesonderte, für Arme bestimmte Eingänge betreten und den »Lärm und Dreck der Bauarbeiten für Londons neue Kanalisation über sich ergehen lassen müssen.«[6]
Die Erzählung von der ›Gentrifizierung als natürliche Anpassung‹ setzt voraus, dass den Bewohner*innen entsprechender Gebiete weniger Bedeutung beigemessen wird als ihrer städtischen Umgebung – falls sie in dieser Geschichte überhaupt von Bedeutung sind. Es ist, als wären solche Veränderungen nicht durch die Entscheidungen von Menschen bestimmt, sondern davon, wo die Gegend liegt, wie die Straßen angeordnet sind und welche Gebäude sich dort befinden – und als würden diese Veränderungen auf eine abstrakte, räumliche Weise erfahren werden und nicht von Menschen, deren tägliches Leben und körperliches wie emotionales Wohlbefinden bedroht sind.
Ungeachtet der Einwände derjenigen, die gegen ihre Verdrängung kämpfen, hat die Erzählung der natürlichen Evolution einen gewissen Reiz. Sie spricht das tief verwurzelte kulturelle Bedürfnis an, komplexe Phänomene auf eine Reihe von Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu reduzieren, die von unveränderlichen Gesetzen geleitet werden und auf die wir keinen Einfluss haben. Das macht ja alles so viel einfacher! Was bringt es schließlich, die Gesetze der Physik einer Stadt infrage zu stellen? Genauso gut könnte man der Schwerkraft trotzen.
Mich interessiert, was diese Geschichte alles anrichtet. Dazu sollten wir uns vor Augen führen, worin die Folgen, ob nun beabsichtigt oder nicht, dieser ›Naturgesetze‹ bestehen. Erstens spricht uns das von jedweder Verantwortung frei. Wenn so etwas wie die Gentrifizierung einfach ein Gesetz der Physik ist, dann trägt niemand daran Schuld und niemand muss sich verantwortlich fühlen, etwas dagegen zu unternehmen. Zweitens suggeriert das Wort ›natürlich‹, dass es gut und richtig ist. Diese Veränderungen sind also nicht nur unabwendbar, sondern auf lange Sicht auch noch von Vorteil. In der westlichen Weltsicht wird Veränderung als Fortschritt begriffen, und Fortschritt ist gut, weil er uns in eine rosigere Zukunft führt. Drittens kehren wir damit in den tröstlichen Arm des Status quo zurück. Wir können uns beruhigt zurücklehnen, weil die Dinge so laufen, wie sie laufen sollen.
Die ökologische Stadt
Die Naturalisierung der Stadt begann schon lange vor den Debatten um Gentrifizierung. Es ist einfach, Autor*innen zu finden, die Städte mit lebenden Organismen vergleichen, mit einem pulsierenden Herz, Nervenzentren, Kreisläufen, Entsorgungs- und Verdauungssystemen und Zyklen von Wachstum und Zerfall. Die Ideen von Jane Jacobs, der einflussreichen Kritikerin der Stadtplanung, dass der städtische Wandel aus komplexen, alltäglichen urbanen Prozessen entsteht, werden häufig als Ausdruck einer organischen Sicht auf die Stadt verstanden, im Gegensatz zu von oben nach unten verlaufenden, geplanten, modernistischen Visionen der Stadt.[7]
Lange vor den Arbeiten von Jacobs in den 1960er Jahren waren im 19. Jahrhundert Philosoph*innen wie beispielsweise Patrick Geddes darum bemüht, Konzepte der Biologie wie die Evolution sowohl auf die Stadt als auch auf die Gesellschaft insgesamt anzuwenden. Geddes glaubte, dass man in der Stadtplanung Erkenntnisse über die Interaktion des Menschen mit seiner Umwelt in die Tat umsetzen könne. Er verwendete zudem Metaphern wie ›chirurgische Eingriffe‹ und ›Entfernung von Unkraut‹, um zu beschreiben, wie er mit Slums umgehen würde, indem nämlich die heruntergekommensten Häuser ›chirurgisch‹ entfernt werden sollten, damit die verbliebenen Mietshäuser und Innenhöfe mehr Licht und frische Luft bekommen.[8]
Der berühmte Stadtforscher und Architekturkritiker Lewis Mumford, der von Geddes’ Arbeiten beeinflusst war, verwendete im 20. Jahrhundert organische Metaphern, um seinem Standpunkt Nachdruck zu verleihen, dass ein unkontrolliertes, technologisch und ökonomisch getriebenes Wachstum der Stadt destruktiv wäre und es regional abgestimmter Planung bedürfe, die die Städte und ihre Umgebung als miteinander verbundene organische Einheiten begreift. Mumford verglich die ideale Stadt mit einer Zelle, die einen neuen Zellkern und eine neue Zelle bildet, bevor sie sich zu weit ausdehnt und ihre Funktionsfähigkeit verliert.[9]
Wenn man die Stadt als einen Körper oder Teil eines Körpers begreift, dann wird man sich wahrscheinlich fragen, was mit diesem Körper alles nicht stimmt. Daher ist die Rede von Krankheiten oder die Verwendung von Metaphern aus der Medizin weit verbreitet. Unkontrolliertes Wachstum wird dann gerne mit einem Tumor verglichen, während fehlendes Wachstum ein Indiz für allgemeinen Verfall oder eine schleichende Krankheit sein könnte. ›Krankheit‹ oder andere Metaphern aus der Medizin werden regelmäßig verwendet, wenn von gesellschaftlichen Problemen die Rede ist, und gesellschaftliche Probleme werden nur allzu gerne auf urbane Räume übertragen.
Die Kommunikationswissenschaftlerin Julia Todoli beschäftigt sich mit Krankheits-Metaphern in der Stadtplanung, die verwendet werden, um Eingriffe, die auf verarmte Communitys und Arbeiter*innenviertel abzielen, zu rechtfertigen.[10] In einer Fallstudie über ein Sanierungsprojekt im spanischen Valencia in den frühen 2000er Jahren stellte Todoli fest, dass die Architekt*innen und Stadtplaner*innen Begriffe wie ›Operation‹, ›großer Eingriff‹, ›Reinigung‹, ›Amputation‹, ›Metastasen‹ oder Formulierungen wie ›den Patienten töten‹ und ›chirurgische Eingriffe‹ verwendeten, um zu beschreiben, was für die Fertigstellung des Projekts ›notwendig‹ war.
Todoli behauptet nun, dass die Verwendung dieser Sprache einen Nebel aus Metaphern bildet, um die tatsächlichen Absichten und Folgen der Stadtplanung zu verschleiern. Das ist auch insofern praktisch, weil ein Problem auf eine solche Art und Weise dargestellt werden kann, dass in der Folge eigentlich nur eine bestimmte Art der Lösung möglich ist. Denn wenn etwas krank oder infiziert ist, dann muss es ja gesäubert, operiert oder gar amputiert werden. Architekt*innen und Stadtplaner*innen nehmen symbolisch den Platz von Ärzt*innen ein, die über mehr gesellschaftliche Anerkennung verfügen und größeres Vertrauen genießen.
Einige der bedeutendsten Stadtforscher*innen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die Vertreter*innen der sogenannten Chicagoer Schule, bedienten sich ebenfalls der Sprache der Evolutionstheorie, um die Stadt als eine Art natürliches System darzustellen. Die Chicagoer Schule wird infolgedessen auch als ökologische Schule bezeichnet. Forscher wie Ernest Burgess und Robert E. Park, die von 1915 bis 1935 am Institut für Soziologie der University of Chicago tätig waren, beobachteten mit großer Aufmerksamkeit die Muster des demografischen Wandels entlang der Kategorie Klasse und – in geringerem Ausmaß – Race in ihrer überwiegend von blue-collar-Arbeiter*innen und Migrant*innen geprägten Stadt.[11] Sie traten allerlei Hypothesen entgegen, die davon ausgingen, dass die Möglichkeiten eines Menschen von persönlichen Eigenschaften oder seinen Genen abhängig seien. Stattdessen richteten sie ihr Augenmerk auf gesellschaftliche Strukturen und die Umwelt als entscheidende Faktoren im Hinblick auf Kriminalität oder soziale Mobilität.
Burgess’ Theorie über das Wachstum von Städten bediente sich vieler Konzepte aus der zunehmend akzeptierten Evolutionstheorie, die durch das Werk Der Ursprung der Arten von Charles Darwin im späten 19. Jahrhundert populär geworden war. Er behauptete, dass Großstädte wie Chicago durch die Ausdehnung konzentrischer Kreise oder Zonen, die unterschiedliche soziale Klassen beherbergen, wachsen. Das Zentrum mit seinen Geschäften sei von »Elendsvierteln« oder Zonen des »Übergangs« umgeben. Dann folgten die »Arbeiter*innenwohnungen«, danach die »Vorstädte der Mittelschicht« und schließlich die Bungalowsiedlungen der Wohlhabenden.
Die Größe, Kosten und die Qualität der Wohnung nahmen, je weiter man sich nach außen bewegte, zu. Burgess ging davon aus, dass Communitys, sobald sie eine gewisse Beständigkeit und soziale Mobilität erreicht hätten, stadtauswärts ziehen und von neu zugewanderten Migrant*innen ersetzt werden würden. Beispielsweise zogen Italiener*innen und Jüd*innen, die einst in der Gegend der Near West Side gewohnt hatten, schließlich in Vororte wie Cicero, Oak Park, Evanston und Highland Park.