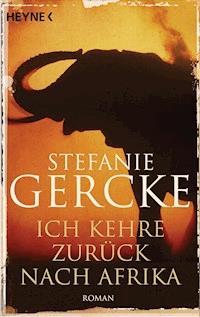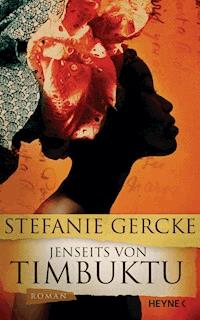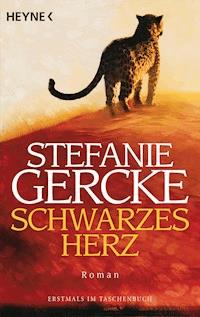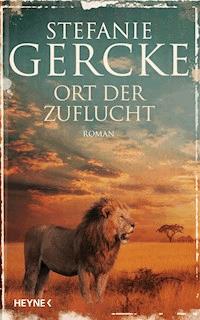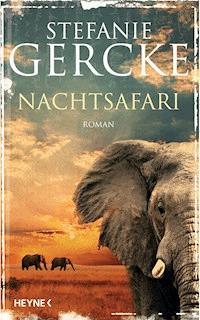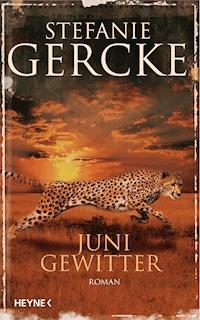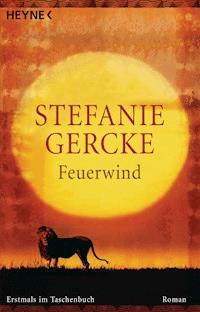
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Sinne betörend, die Fantasie beflügelnd, alles verzehrend
Nach dem Bestseller „Schatten im Wasser“ wird die epische Südafrikageschichte um Catherine und ihre Farm Inqaba fortgeschrieben.
Als der Zulukönig Cetshwayo im Winter 1878 an einem geheimen Ort seinen inneren Rat zusammenruft, ist der unheilvolle Wind, den der weiße Mann gesät hat, längst zu einem Sturm geworden. Die Schwarzen fühlen sich bedroht von weißen Siedlern, die wie Heuschrecken über das Land herfallen. Noch steht Inqaba, die Farm von Catherine und Johann, unter dem Schutz des Königs, doch als ein geheimer Unbekannter mit Intrigen und Waffen die Zulus aufhetzt, scheint das Paradies der Steinachs bedroht. Und weil Catherines Sohn Stefan gegen alle Widerstände sein geliebtes Zulumädchen Lulamani geheiratet hat, steht die Familie bald zwischen allen Fronten. Zudem macht Catherine sich größte Sorgen um ihre unbeugsame Tochter Maria, die sich gegen den Willen der Eltern auf den langen Weg nach Deutschland gemacht hat, um dort Medizin zu studieren. Briefe kommen erst nach Wochen an, und so ahnt Maria im kalten fernen Hamburg nicht, dass schon ein Funke genügt, um ihre Heimat in Brand zu stecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1034
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Für H. H., meinen Mann und besten Freund
1
Es war der Flügelschlag eines Schmetterlings der Familie Papilionidae, der noch auf seine wissenschaftliche Entdeckung und einen Namen wartete, der die Katastrophe auslöste. Der Falter war zitronengelb und schwarz gemustert und leichter als eine Feder. Sein Leben, das bei Sonnenaufgang dieses Tages begann, sollte kaum länger währen als das einer Sternschnuppe.
Er erwachte aus seinem Schöpfungsschlaf unter den schützenden Blättern der Weinenden Burenbohne, einem prächtigen Baum mit filigranen roten Blüten, entschlüpfte der Puppenhülle, schüttelte sich, und während die Sonne aus dem Morgendunst stieg, wartete er, bis sich seine eleganten Flügel entfaltet hatten. Der tiefblaue Himmel schillerte tausendfach in den Facetten seiner Netzaugen, der berauschende Blütenduft seines Schlafbaums kitzelte seine Sinnensorgane. Behutsam breitete er seine Schwingen aus, öffnete sie und schloss sie mehrmals, drehte sich ein wenig wie ein eitles Mädchen, und dann, zum ersten Mal in seinem Leben, erhob er sich in die Luft und tanzte so leicht wie ein Hauch hinüber zur purpurroten Blüte am Ende des Zweigs.
Es wäre auch gar nichts passiert, der Schmetterling hätte sich am Nektar gelabt und wäre davongegaukelt, hätte der Windstoß, der an den warmen Hängen der Drakensberge als schwacher Luftzug geboren worden war und auf seinem Weg in die Täler an Kraft gewonnen hatte, nicht den Baum geschüttelt. Er tat es durchaus nicht so stark, dass es rauschte, nur ganz sanft, wie ein Streicheln, aber die rote Blüte wippte, als der Schwalbenschwanz sie erreichte, und er musste heftig mit den Flügeln schlagen, um nicht abzurutschen.
Das verdorrte Blatt, das unterhalb der Blüte saß, löste sich, trudelte zu Boden und landete auf der letzten Glut eines schlecht gelöschten Lagerfeuers. Ein Funke, ein einziger Funke, glühte auf, das Blatt entflammte, der Wind hob es auf, spielte ein wenig damit und trug es hinüber zu dem goldgelben, zundertrockenen Gras, wo er es sanft herniederschweben ließ, bis es auf dem Gefieder eines Vogels landete, der zwischen den Halmen Körner pickte.
Das hätte das Ende der Geschichte sein können. Die Vogelfedern waren glatt und geschlossen, hätten sich nicht entzündet, aber der Vogel erschrak und flatterte zornig, das brennende Blättchen zerstob in einen Funkenregen, entzündete ein Grasbüschel, der Wind blies mit einem Luftwirbel hinein, eine Flamme flackerte auf, und das Feuer war geboren.
Es kroch den kurzen Weg zur Weinenden Burenbohne, versengte die Flügel des Schmetterlings, er stob hoch, und im letzten Augenblick seines kurzen Lebens verwandelte er sich in einen leuchtenden Stern, ehe er als Sternschnuppe verglühte.
Das Feuer verbreitete sich gierig, fraß das Gras, verschlang kleinere Büsche, übersprang einen Pfad, züngelte an dem großen Kaffirbaum hoch, der mit einem lauten Knall explodierte. Es wuchs, wurde hungriger, Funken sprühende Feuerteufel tanzten über das Grasmeer, vereinigten sich zu flammenden Säulen, und der Brand geriet außer Kontrolle.
Lulamani hörte das Knallen, mit dem der Baum starb, und zuckte hoch. Sie war so vertieft darin gewesen, mit einem Stein die Hornhaut an ihrer Ferse wegzupolieren – etwas, was sie jeden Tag tat, weil sie immer barfuß lief, sich einfach nicht an europäische Schuhe gewöhnen konnte, wie ihr Mann es wünschte –, dass sie den flüchtigen Rauchgeruch vorher nicht wahrgenommen hatte. Unruhig schnuppernd hob sie die Nase, ahnte nicht, dass gerade zu diesem Zeitpunkt die Feuersbrunst die alte Schirmakazie erreichte, deren tief herunterhängende Krone hunderte von Blutwebervögel mit ihrem gewaltigen Nestgebilde wie mit einem Teppich überzogen hatten.
In der Zeitspanne eines Lidschlag brannte das ausgetrocknete Nistmaterial lichterloh. Die in den Nestern gefangenen Jungvögel kreischten, die Alten flatterten hoch und fielen mit loderndem Gefieder vom Himmel, die Grüne Mamba, die sich eben ein Küken geholt hatte, verbrannte mit dem Vogel im Rachen. Die ungeborenen Jungen in den Eiern kochten in ihren Dottern und zerplatzten schließlich. Das Kreischen wurde schnell leiser, dann verstummte es ganz, und nur das Röhren des Feuers war zu vernehmen. Es hatte nur wenige Minuten gedauert, und die riesige Vogelkolonie hatte sich in Rauch aufgelöst.
Der Wind ernährte sich von der Hitze des Feuers, wurde zum Sturm, wirbelte Klumpen von brennendem Nestgeflecht und glühende Äste meilenweit, und bald brannte der ganze Hügelzug.
Lulamani sah die schwarze Wolke, glaubte im ersten Augenblick an ein Gewitter, erkannte aber schnell den gelbroten Widerschein eines Feuers auf der Unterseite der Wolke. Angst schoss ihr in die Glieder, sie zog die Kinnschleife ihres Sonnenhuts fest, schürzte ihren weiten Rock und kletterte flink wie ein Affe in den Wipfel des nächsten Baums. Oben angekommen, reckte sie den Hals. Als ihr bewusst wurde, was um sie herum geschah, geriet sie in Panik. Feuer, nichts als Feuer, so weit sie sehen konnte. In einem immer engeren Halbkreis raste es auf sie zu, fauchend, spuckend, knurrend, schwarzen Rauch ausstoßend wie ein riesiges, gefräßiges Tier. Ihr Blick flog über die brennende Landschaft, sprang von Brandherd zu Brandherd, stieß immer wieder an Flammenwände, die kein Durchkommen erlaubten, fand nur einen Ausweg. Den Fluss, dessen gegenüberliegendes Ufer keine hundert Yards entfernt war. Gelänge es ihr nicht, über den Fluss zu fliehen, würde sie in Kürze vom Feuer eingeschlossen sein.
Von Furcht gepackt, kletterte sie von ihrem luftigen Ausguck nach unten, griff öfter daneben und lief Gefahr, auf dem steinigen Grund aufzuschlagen, konnte sich aber jedes Mal gerade noch abfangen. Endlich war sie auf dem untersten Ast angelangt, wollte eben den Baumstamm hinunterrutschten, um zum rettenden Wassersaum zu laufen, als eine Herde von Elefanten aus dem Dickicht brach.
Unter ohrenbetäubendem Trompeten preschten die grauen Riesen in einer Staubwolke den Pfad entlang zum Flussufer. Lulamani fand in letzter Sekunde Halt an einem Ast, umklammerte ihn mit Armen und Beinen, hing aber nur wenige Zoll über den wogenden grauen Rücken. Die Erde bebte unter ihren Tritten, der Baum schwankte. Sie presste ihr Gesicht an die raue Borke. Ihr weiter Rock bauschte sich im Feuerwind, einer der Dickhäuter verfing sich mit dem Rüssel im Stoff und riss ihn ihr bis zur Taille auf. Lulamani schrie, es gelang ihr aber, sich weiter hochzuziehen, bis sie schwer atmend der Länge nach auf dem Ast lag.
Kreischend den Rockfetzen schwingend, stürmte der Elefant der Herde nach, die bereits die Flussmitte mit einer Bugwelle wie von einem Geschwader Schiffe durchpflügte. Dutzende von Hyänen rannten in ihrer merkwürdig geduckten Haltung aus dem rauchenden Busch, gerieten immer wieder in die Bahn kopflos dahingaloppierender Büffel, wurden zur Seite ins flammende Gras geschleudert oder starben unter den trommelnden Hufen. Die Luft erzitterte von den Todesschreien, das Gebrüll der Büffel brandete gegen den Baum. Lulamani schrie, bis ihre Lungen brannten, als hätte sie Feuer geschluckt.
Die Hitze wurde stärker. Ihre Haut kribbelte, schon spürte sie, wie sie Blasen zog. Wimmernd schaute sie zum Fluss. Eine alte Landschildkröte stapfte mit rauchendem Schild schwerfällig über die abschüssige Böschung, ließ sich von den Huftritten der fliehenden Tiere nicht beirren, erreichte lebend das Ufer, zog Beine und Kopf ein und rollte einfach hinunter ins Wasser. Lulamani glaubte eine Dampfwolke zu sehen, als der rauchende Panzer der Schildkröte gelöscht wurde.
Staunend beobachtete sie dann, wie die Schildkröte mit ihren krallenbewehrten Füßen den Rücken eines Flusspferds bestieg und so in gemächlichem Tempo sicher über den Fluss getragen wurde. Dabei kam Lulamani die rettende Idee. Vorsichtig ließ sie sich vom Ast hinunterrutschen, bis sie nur an ihren Händen direkt über der brüllenden Büffelherde baumelte. Sie schloss die Augen und begann mit ihrer Großmutter Mandisa zu sprechen, wie sie es immer tat, wenn sie Sorgen hatte oder Hilfe brauchte.
Vor einem Jahr hatte Mandisa mit großer Freude gespürt, dass ihre Zeit gekommen war heimzugehen. Sie sehnte sich nach ihrem Mann, den Verwandten und vielen Freunden, die vor ihr gegangen waren und schon so lange auf sie warteten. Sie rief ihre Familie und legte sich nieder, um zu sterben. Freudig und leichten Herzens machte sie sich auf den Weg ins Reich der Schatten.
Kurz nachdem Mandisas Schatten ihren Körper verlassen und sich zu ihren Ahnen gesellt hatte, erschien Lulamani eine besonders schöne Felsenpython, die sich am Ende der Veranda ihres Hauses sonnte. Sie war wohlgenährt und hatte glänzende, herrlich gezeichnete Schuppen, und die junge Zulu war sich absolut sicher, dass sie die Seele ihrer Großmutter verkörperte, die gekommen war, um über sie zu wachen. Sie bot der Schlange ein Schälchen Milch an, am nächsten Tag dann die Augen eines schwarzen Lamms, die als besondere Köstlichkeit galten, und machte es sich zur Gewohnheit, jeden Morgen, gleich nachdem sie Haus und Hof gefegt hatte, hinüber zum Hühnerstall zu laufen, das schönste Ei auszusuchen und ihrer Großmutter hinzustellen.
Dann hockte sie sich nur wenige Fuß von der Python entfernt nieder, nannte sie Umakhulu, erzählte ihr von ihrem Tag, ihrem Mann, der so anders war als ein Zulu, von seinen merkwürdigen Angewohnheiten, dass er sich jeden Morgen die Haare aus dem Gesicht schabte und eine kleine Hose unter seiner langen trug. Eines Tages sprach sie auch von der Hoffnung, bald ein Kind zu bekommen. Die Schlange zeigte nie Scheu, sondern blieb ruhig liegen, wiegte sachte ihren Kopf und blickte sie aus ihren wissenden dunklen Augen an.
»Hilf mir, Umakhulu, besänftige Inyati, den mächtigen Büffel, verwandle seine Wut in Kraft«, rief Lulamani jetzt, und dann ließ sie sich fallen. Sie landete auf dem Nacken eines Büffelbullen, bekam tatsächlich die Hörner zu fassen, schlang ihre Beine um den mächtigen Hals und presste sich mit Oberkörper und Gesicht in das fettige, stinkende Fell.
Es war ein Höllenritt durch ohrenbetäubenden Lärm, beißenden Rauch und wirbelnde Asche. Sie fühlte die Hitze des Feuers auf ihrem Rücken, atmete die Angst der Tiere ein, konnte ihre eigene kaum bezähmen. Mit einem gewaltigen Sprung warf sich ihr Büffel mitten ins brodelnde Getümmel im Fluss, wurde prompt unter Wasser gedrückt, tauchte blökend wieder auf, und Lulamani musste schreien, um wieder atmen zu können.
Irgendwie entgingen ihre bloßen Beine den Zähnen der zuschnappenden Krokodile, irgendwie gelang es ihr, in dem mörderischen Gedränge nicht herunterzufallen, nicht zu ertrinken, nicht erdrückt zu werden. Nach einer Ewigkeit, wie es ihr schien, während die Wellen über ihr zusammenschlugen, erreichte ihr Büffel das gegenüberliegende Ufer. Spuckend und hustend hing sie an seinem Hals. Das Tier versuchte, sich die steile Böschung hinaufzukämpfen, wurde aber von dem Strom seiner um sich tretenden Artgenossen mitgerissen und seitwärts gedrückt, genau in die zähnestarrenden Kiefer mehrerer Krokodile.
Lulamani, die von ihrem Mann gelernt hatte, auf einem Pferd zu reiten, nicht wie eine weiße Dame, sondern rittlings wie ein Mann, wie es auch Katheni, seine Mutter, tat, brachte es fertig, den blindlings rennenden Büffel durch festen Druck ihrer Knie und energischem Reißen an seinen Hörnern die Böschung hinauf und an den Rand dieses tierischen Mahlstroms zu lenken. Sie passte den Moment ab, in dem sich vor ihr eine Lücke auftat, rief ihre Großmutter an und sprang. Der Aufschlag auf dem harten Boden raubte ihr fast die Sinne, aber ihr Überlebenswille war stark, sie schaffte es, auf die Füße zu kommen, und stürzte auf den nächsten Baum zu. Sie wurde gestoßen und getreten, stolperte, fiel hin, krabbelte auf allen vieren weiter, aber sie schaffte es.
Schreiend rannte sie förmlich den Stamm hoch, hing schließlich hilflos keuchend an einem Ast, riss den Hut vom Kopf und warf ihn weg. Er schwebte hinunter, landete auf dem braunen Meer der Büffelrücken und verschwand unter den dröhnenden Hufen. Ausgelaugt, durstig und noch immer voller Angst, beschloss sie, so lange auf dem Baum abzuwarten, bis klar wurde, wohin das Feuer trieb. Erschöpft schloss sie die Augen.
Feurige Ascheflocken wirbelten durch die Luft wie Schwärme von Glühwürmchen, verfingen sich in ihren Kraushaaren, schwelten dort weiter, bis die Glut ihre Kopfhaut erreichte und sie versengte. Sie schüttelte den Kopf, fuhr sich mit beiden Händen ins Haar. Auch das Fell eines Warzenschweins fing Feuer. Schrill quiekend rannte es mit rauchendem Rücken ins Wasser, geradewegs in die aufgesperrten Kiefer einer der großen Panzerechsen. Das Wasser kochte, der Schaum färbte sich rot, Lulamani erschauerte und verbarg ihr Gesicht.
Den Büffeln folgte die Elefantenherde, die in kopfloser Panik umgedreht und mit erderschütterndem Getöse wieder aufs Feuer zugerannt war, nun abdrehte und an ihr vorbeigaloppierte. Mit ohrenzerreißenden Trompetenstößen schrien die Kühe nach ihren Kälbern, drängten schwächere Tiere wie die zierlichen Impalas beiseite oder trampelten sie einfach nieder. Die Elefanten walzten in ihrem Wahnsinnsgalopp Büsche und kleinere Bäume einfach um, rammten immer wieder den Stamm ihres Baumes. Mit jedem Stoß schwankte sie in der luftigen Höhe, und mehr als einmal fehlte nicht viel, und sie wäre wie eine überreife Frucht heruntergeschüttelt worden.
Das Mädchen drückte ihren Rücken fest gegen den Baumstamm, verankerte ihre Füße in einer breiten Astgabel, hakte ihre Arme um die kräftigsten Äste neben ihr und versuchte, durch den Rauch das andere Ufer auszumachen. Ihre Augen tränten, und sie musste wieder husten. Für einen Moment war der Rauch so dicht, dass sie nichts sehen konnte, dann riss der Wind ein Loch in den Vorhang, und was sie sah, erfüllte sie mit Grauen: Bäume loderten wie Fackeln, es regnete brennendes Gras, ein Feuerteppich bedeckte das Land, so weit sie blicken konnte.
Mitten in diesem Inferno knallte ein Schuss.
Für ein paar kurze Sekunden wurde das Brausen des Feuers zu einem Flüstern, schienen alle Lebewesen die Luft anzuhalten, auch Lulamani. Ihr Puls ging schneller. Wieder krachten Schüsse. Menschen waren in der Nähe, vielleicht sogar ihr Mann oder ihr Vater, vielleicht auch beide, denn sie wollten gemeinsam auf die Jagd gehen. Aufgeregt reckte sie den Hals.
Die Jäger befanden sich offenbar nordöstlich, aber der einzige Weg zu ihnen war durch die Tiermassen blockiert, und keine dreißig Schritt entfernt kauerte ein Leopard. Sein Schwanz schlug aufgeregt hin und her. Sie musterte ihn flüchtig. Von der großen Raubkatze ging kaum Gefahr aus. Sie war auf der Flucht wie sie, und außerdem gab es genug Beute direkt vor ihrer Nase, das Tier musste sich nicht erst die Mühe machen, hinter seinem Mittagessen herzulaufen. Eine in Panik geratene Büffelherde schätzte sie allemal als größere Bedrohung ein als einen hungrigen Leoparden.
Sich festklammernd, zerrte sie ihr zerrissenes Kleid über den Kopf und ließ es achtlos fallen. Es landete auf den Hörnern eines Büffels und fiel ihm über die Augen. Vergeblich versuchte er, es mit wütendem Schwenken seines mächtigen Kopfes wegzuschleudern. Blind preschte er davon, das Kleid wehte wie ein Banner zwischen seinen Hörnern. Trotz ihrer verzweifelten Lage musste Lulamani kichern, schluckte dabei Rauch und bekam prompt wieder einen Hustenanfall. Noch immer hustend, band sie ihr über dem Knie mit Schleifen zusammengehaltenes Beinkleid in der Taille fest. Erleichtert reckte sie die Arme. Jetzt hatte sie die Bewegungsfreiheit, die sie brauchte. Sie wischte sich über den Mund und kletterte höher, um sich einen besseren Überblick über ihre Lage zu verschaffen. Vier Paviane, die sich gegenseitig umklammernd in der Baumkrone hockten, schnatterten aufgeregt, rührten sich aber nicht vom Fleck.
Von ihrem neuen Ausguck sah sie deutliche Anzeichen, dass der Strom der fliehenden Tiere allmählich versiegte. Die, die den rettenden Fluss noch nicht erreicht hatten, würden es nicht schaffen. Die Feuerwalze, die alles Lebende vor sich hertrieb, war schneller.
Die Zunge klebte ihr am Gaumen, beide Mundwinkel waren aufgerissen. Sie leckte sich über die spröden Lippen, was diese seltsamerweise nur noch trockener zu machen schien. Wenn sie nicht bald etwas zu trinken bekam, würde sie zu schwach für die Flucht werden, aber noch konnte sie es nicht wagen, die Sicherheit des Baums zu verlassen. Der Leopard hatte Gesellschaft von zwei Artgenossen bekommen. Eine der Großkatzen hatte bereits ein Springbockjunges gerissen, die zwei anderen duckten sich schwanzpeitschend zum Sprung. Trocken schluckend suchte Lulamani ihre unmittelbare Umgebung nach etwas Grünem, Saftigem ab, das sie kauen konnte, um ihren Durst zu lindern. Aber es gab nur Verdorrtes und Verbranntes. Sie schluckte wieder und blinzelte zum Himmel.
Nur ab und zu schimmerte gespenstisch die blasse Sonnenscheibe durch die Rauchschwaden, zeigte ihr, dass über dem Inferno ein knisternd trockener, sonniger Tag strahlte. Bald würde der Mittag überschritten sein, und schneller als ihr lieb war, würde Elezimpisi anbrechen, die Hyänenzeit. Es war die Zeit zwischen Hell und Dunkel, zwischen Tag und Nacht, wenn die sterbende Sonne rote Schatten auf die Hügelhänge warf und die Hyänen sich zusammenrotteten, um auf Jagd zu gehen.
Sie hoffte auf eine klare Nacht mit hellem Mondschein. Er würde es ihr leicht machen, ihren Weg zu finden. Sollten die Wolken aber den Mond verschlucken, die Nacht undurchdringlich schwarz werden, wagte sie nicht, sich auszumalen, was geschehen konnte. Furchtsam schaute sie sich um.
So weit sie blicken konnte, lagen tote oder sterbende Tiere im Busch herum. Gelegentlich blökte eins oder schrie, wenn es versuchte, seinen zerschmetterten Körper aufzurichten. Über ihr huschten die Schatten der Geier, die sich auf den Bäumen sammelten, und das hohe, aufgeregte Lachen jagender Hyänen kam bedrohlich näher. Jedes Raubtier in mehreren Meilen Umkreis hatte gerochen, dass hier ein reich gedeckter Tisch wartete. Schon hörte sie das tiefe Gebrüll des Königs der Steppe, dieses urweltliche Röhren, das einem die Haare zu Berge stehen ließ und das einem nicht verriet, ob der Löwe in unmittelbarer Nähe oder eine Meile entfernt war. Angst lief ihr wie tausend Ameisen über den Rücken. Sie wartete.
Die Hyänen waren die Ersten, und sie kamen in einem großen Rudel. Unter Lulamani begann ein grausiges Schauspiel.
Jaulend stritten sich die Tiere um die fettesten Brocken, bissen sich gegenseitig weg, heulten, lachten ihr irres Lachen, während Knochen krachten und Blut ihr getüpfeltes Fell rot färbte. Es dauerte nicht lange, und mehrere Löwen tauchten auf. Lulamani zählte neun Weibchen, zwei halbwüchsige Männchen und den Rudelführer, ein sehr großes Tier mit prachtvoller, schwarzer Mähne. Alle waren erbärmlich dünn, ihre Flanken eingefallen, das gelbe Fell hing in großen Falten von ihren Körpern. In der herrschenden Dürre war ihre Beute in den vergangenen Monaten mager gewesen.
Fauchend fuhren die ausgehungerten Löwenweibchen zwischen die Hyänen und fletschten ihre Furcht erregenden Zähne. Die gefleckten Aasfresser sprangen winselnd zurück, strichen mit eingezogenem Schwanz in sicherer Entferung um die zunehmend in Raserei geratenden Löwen. Die großen Katzen rissen die Bäuche ihrer Beute auf, schlangen die Innereien herunter, kauten auf den Läufen noch lebender Büffel, knurrten, fauchten, brüllten, bissen um sich, schlugen sich gegenseitig mit Prankenhieben aus dem Weg. Rudel von Schakalen näherten sich in geduckter Haltung, schrien in markerschütternd schrillen Tönen, die in langgezogenem Heulen endeten und die Lulamani die Haare zu Berge stehen ließen. Sie flog am ganzen Leib, musste ihren Unterkiefer festhalten, um sich nicht durch ihr Zähneklappern zu verraten.
Am späten Nachmittag hatten sich die Löwen voll gefressen. Bluttriefend tauchten sie aus den ausgeweideten Kadavern auf, leckten halbherzig über ihr bis zur Schwanzspitze rot gefärbtes Fell, taten steifbeinig ein paar Schritte und fielen dann einfach um. Der große Pascha mit der prächtigen, schwarzen Mähne rollte auf den Rücken, riss sein Maul auf, gähnte, dass Lulamani jeden seiner beeindruckenden Reißzähne sehen konnte, und schlief ein. Nicht lange danach waren auch die Hyänen satt und trabten mit seltsamen Knurrlauten davon. Nun kamen die Schakale und stritten sich kreischend um die Reste, schleppten sie stückweise weg, bis nur noch Knochen übrig waren.
Fliegen setzten sich in Schwärmen auf die Kadaver, fielen über die Löwen her, labten sich an dem Blut, das deren Fell durchtränkte, krochen ihnen in die Augenwinkel, in die Nasenlöcher und ins geöffnete Maul. Die großen Katzen regten sich nicht, nur das sanfte Heben und Senken der prallen Bäuche zeugte davon, dass sie lebten.
Irgendwann trat endlich Stille ein. Lulamani wagte es, tief durchzuatmen, wartete aber noch. Als erneut eine Gewehrsalve in der Ferne krachte und die Löwen sich nicht einmal rührten, kehrte ihr Mut zurück. Sie brach einen kräftigen Ast ab und schleuderte ihn hinunter auf die wie tot daliegenden Raubkatzen. Der Ast prallte am Bauch des prächtigen Männchens ab. Das Tier zuckte nur kurz mit der Pranke. Noch einmal rollte ein Schuss durch die Hügel, und Lulamanis Augen flogen zu dem riesigen Löwen. Er zeigte nicht die geringste Reaktion.
»Hilf mir, Umakhulu«, wisperte sie, rutschte auf der rauen Borke des Baumstamms hinunter und huschte schnell wie ein Schatten an den schlafenden Raubkatzen vorbei ins Dickicht. Als sie sich in sicherer Entfernung befand, blieb sie stehen, orientierte sich kurz am Nachhall der Schüsse und machte sich schleunigst auf den Weg.
Ein zartblauer Schleier legte sich über ganz Zululand, erreichte bald Inqaba. Sihayo, der vor seiner Hütte saß, das von Nomiti gebraute Bier trank, dabei seinen Kampfstock liebevoll mit Hippopotamusfett einrieb und nachrechnete, ob er genug Rinder sein Eigen nannte, um sich eine weitere Frau kaufen zu können, roch den Rauch, legte den Kampfstock beiseite und stieg schnurstracks auf den nächsten Baum, um zu erkunden, was da hinter den Hügeln los war. Der Anblick, der sich ihm bot, alarmierte ihn aufs Höchste.
Schwarze Rauchwolken, vom Widerschein des Feuers auf der Unterseite rot angeleuchtet, wälzten sich aus Südwesten heran. Nach seiner Einschätzung würden sie in Kürze auch Inqaba erreichen.
Eilig rutschte er vom Baum, lief zur Hütte, holte die große Feuertrommel heraus, klemmte sie sich zwischen die Knie, rieb seine Handflächen aneinander, und dann schlug er den ersten Trommelwirbel, der alle, die ihn vernahmen, zu höchster Aufmerksamkeit mahnte.
Kurze, harte Schläge waren es, und die bauchige Trommel dröhnte und schickte ihre dringende Warnung in alle Himmelsrichtungen. Bald kam die Antwort aus dem nächstgelegenen Umuzi, nacheinander fielen immer mehr Trommeln ein, bis sich ihre Stimmen vereinigten, übers Land rollten und die Menschen in Alarm versetzten.
Die Häuptlinge ließen als Erstes ihre Rinder aus der Gefahrenzone treiben und befahlen ihren Frauen, breite Feuerschneisen um die Umuzis zu roden. Alle Bemühungen der Stammesregenmacher hatten bisher kein Wasser vom Himmel locken können, und die Indunas flehten König Cetshwayo an, die königliche Regenmacherzeremonie zu veranlassen. Zum zweiten Mal war schon die Regenzeit ausgefallen, und statt des Regenwinds wehte der Inyakatho, der die Wolken verjagte, Hitze brachte und klaren Himmel.
Doch der König, von Natur aus geizig, schwankte noch, mehrere seiner edlen Rinder zu opfern, wie es die Ahnen verlangen würden. Selbst als der Wind drehte, und trockene, heiße Luft aus der Kalahari sich wie ein Leichentuch über das Land legte, zögerte er. Zululand und seine Menschen stöhnten. Ein Sturm war geboren.
Vier Monate zuvor war dieser Sturm noch ein Wind gewesen. Sein unheilvolles Brausen hatte nur einer vernommen. Cetshwayo, König der Zulus.
Ende Juli 1878, an einem sonnigen Wintertag, der so klar war, dass man in die Zukunft sehen konnte, rief der König die sechs mächtigsten Mitglieder seines innersten Rats zu sich. Die Wände des Schwarzen Hauses im Zentrum seiner Residenz, in dem er seine Indunas und die Häuptlinge der großen Clans empfing, hatten Ohren, das wusste er schon seit langem, und da seine Worte nur diese sechs Männern erreichen sollten, versammelte er sie an einem geheimen Ort tief im Herzen Zululands im Schatten eines ausladenden Mahagonibaums. Der Busch knisterte, Zikaden sirrten.
Kein Lüftchen regte sich.
»Setzt euch. Es geht um den Wind«, verkündete der König und ließ sich auf seinem geschnitzten Stuhl nieder, zog das prächtige Leopardenfell, das seinen hoch gewachsenen Körper bedeckte, über der Brust zurecht. »Hört ihr den Wind? Er spricht mit Jakots Stimme.«
Er hob die Hand, und die Menschen hörten auf zu atmen, Insekten verstummten, sogar die Zikaden schwiegen. Eine schwarze Stille senkte sich über Zululand.
Erst hörten die Männer nur ein Zischen, das ihr Schweigen erfüllte, ein hohes, schneidendes Pfeifen. Allmählich aber wurde es zu einem wilden Heulen, das aus der Tiefe des blauen Himmels zu kommen schien und in ihren Ohren schmerzte wie ein Stich mit dem Assegai. Das Heulen schwoll an zu einem Orkan, der knatternd durch die Palmen fuhr, in den Kronen der Bäume rasselte und so viel Staub aufwirbelte, dass das Licht für einen langen Augenblick nicht mehr zu sehen war. Es wurde dunkel über dem Land, und seine Zukunft versank in dieser Dunkelheit.
»Es sind Jakot Hlambamanzis Worte, die ihr vernehmt. Er ist schon mehr als ein volles Menschenalter im Reich der Schatten, aber das Echo seiner Prophezeiung hallt noch heute über die Hügel Zululands«, rief ihr König durch das Brausen des Orkans.
Als der Augenblick vorbei war, und das Licht wieder zurückkehrte, wagten die Räte zu antworten. »Wir hören ihn«, flüsterten sie furchtsam.
Der König senkte seine Hand. »Als mein Onkel, König Dingane, sein Zeichen unter den Vertrag gesetzt hatte, der den Umlungus Port Natal zusammen mit allem Land vom Tugela bis zum Umzimvubu-Fluss im Westen und bis zum Meer im Norden zu ihrer immer währenden Verfügung zusprach, ging Jakot durch das Tor der Ferne und sah, was kommen würde, und das ist es, was er Dingane, meinem Ahnen, voraussagte.«
Wieder machte er eine Pause und ließ die Worte einsinken. Als er fortfuhr, war seine Stimme das Grollen eines Löwen. »Erst werden die Umlungus die Zulus höflich um Land bitten, um sich niederzulassen, so weissagte Jakot, sie werden Häuser bauen und ihre Kühe auf unserem Land weiden lassen, ihre Zauberer, die sie Missionare nennen, werden die Zulus durch Hexerei unterwerfen. Schließlich werden ihre Soldaten mit Feuerstöcken kommen und unsere Krieger töten, und bald wird sich das stolze Volk der Zulus in ein Volk von Amakafulas, landlosen Dienern, verwandeln, und du wirst ihr König sein. Das sage ich, Hlambamanzi, und so wird es kommen.«
König Cetshwayo schwieg, versuchte mit seinem Blick die staubverhangene Ferne zu durchdringen, suchte die sanften Konturen der grünen Hügel seines Landes, das Himmel hieß, aber der Horizont war verschwunden. Als er endlich wieder sprach, war seine Stimme ein scharfes Flüstern.
»Nun höre ich den Donner, ich sehe die schwarzen Wolken. Es sind Jakots Worte, die dichter werden und lauter. Sie ballen sich zusammen und sammeln noch Kraft, doch bald wird ihr Donner alles übertönen, und Blitze werden unsere Welt in Brand setzen.« Mit brennendem Blick sah er seine Räte an, einen nach dem anderen, und jeder von ihnen senkte den Kopf.
»Und es war Shaka Zulu«, hub der König wieder an, »mein Großvater, der mächtigste König aller Menschen schwarzer Haut, der die Umlungus mit den Schwalben verglich, denn wie diese Vögel bauen sie Häuser aus Schlamm dort, wo sie ihre Jungen groß ziehen. Im Mond der Schaumzikaden, wenn die Sonne hoch steht und die Schatten kurz werden, ziehen sie fort, und die Schwalben fallen über Zululand her. Aber sobald der Umsinsibaum seine blutroten Kronen trägt, die kühlen Morgennebel unsere Täler füllen, sammeln sich die Schwalben und verschwinden im Himmel. Dann kehren die Umlungus zurück.«
Das Kinn auf seine Brust gedrückt, schaute er mit gerunzelten Brauen auf seine Ratsmitglieder. »Ihr wisst, dass es schon einige Weiße gibt, die hier ihre Steinhäuser errichtet haben. Jantoni Simdoni, den die Umlungus John Dunn nennen, der mein Berater ist und den ich in unser Land eingeladen habe, und Jontani von Inqaba, der großen Mut zeigte, als er den Sohn meines Vaters vor einem Leoparden rettete. Aber es gibt auch Missionare, die mit Erlaubnis meines Vaters ihre Häuser hier gebaut haben. Sie kaufen unsere Töchter, machen Kinder mit ihnen, um Sklaven zu haben, und stehlen ihre Seelen. Die Haut dieser Kinder hat die Farbe von Exkrementen einer kranken Kuh, und das Reich unserer Schatten ist ihnen bis zum Ende der Zeit verschlossen.«
Er machte eine Pause, seine Augen glühten vor Hass. »Diese Männer führen Krieg gegen uns, auch wenn ihre Hände keine Waffen tragen. Wir werden die Häuser dieser Umlungus zerstören und ihre Bewohner über die Grenze jagen. Wir werden verhindern, dass die Schwalben über Zululand herrschen.«
»Yebo«, stimmten die Häuptlinge ihm frohgemut zu und stellten sich die reiche Beute vor, die ihnen winkte.
In diesem Augenblick glitt der Schatten eines riesigen Adlers über Ondini. König Cetshwayo hob seinen Blick und folgte dem Flug des majestätischen Vogels. Hoffnung leuchtete auf seinen Zügen. Er reckte sich zu seiner vollen, beeindruckenden Größe. »Ngqungqulu, König der Vögel, Verkünder des Krieges«, röhrte er und streckte seine geballte Faust zum Firmament, »du bist der Herrscher des Himmels, und ich bin der König des Volkes, das Himmel heißt. Bayete! Ich grüße dich!«
»Bayete!«, riefen seine Männer mit wilder Freude.
Auch Andrew Sinclair sah den Adler. Auf der Suche nach guten Jagdgründen hatte er sich auf seinem Erkundungsritt drei Stunden von seinem Lager entfernt und hörte aus reinem Zufall das Bayete-Gebrüll im Busch. Er glitt aus dem Sattel, legte seinem Pferd beruhigend die Hand über die Nüstern, damit es nichts Fremdes wittern und ihn verraten konnte, und schlich sich neugierig heran. Als er erkannte, dass er den König der Zulus vor sich hatte und dass dieser offenbar ein Geheimtreffen abhielt, lauschte er mit wachsendem Interesse seinen Worten.
Der König richtete sich jetzt zu seiner vollen imposanten Größe auf. »Es wird Krieg geben«, donnerte er und stieß seine Faust in den Himmel. »Der Ngqungqulu verkündet unseren Sieg, und die großen Könige unseres Volkes, Shaka Zulu und Dingane, haben im Traum zu mir gesprochen. Lasst die Armee marschieren, war ihre Botschaft. Die Weißen werden sterben. Ich werde also die Sangomas aus meinem Reich zusammenrufen, damit sie unsere Krieger unverwundbar gegen die Kugeln der Umlungus machen, und die Mädchen meines Isigodlos, meine Leibwache, werden ihre Schießübungen wieder aufnehmen!«
Andrew Sinclair schmunzelte, als er das hörte. Offenbar ahnte der König nicht, dass jetzt, in diesem Augenblick, die einflussreichsten Männer Natals seinen Sturz planten und einige Regimenter, die an der Grenze zu Transvaal die Buren in Schach hielten, bereits ihren Marschbefehl erhalten hatten. Es würde Krieg geben, darüber bestand auch für ihn kein Zweifel. Ein Krieg verhieß gute Geschäfte, und er hatte vor, davon zu profitieren. Blitzschnell stellte er eine Kalkulation an und lächelte höchst zufrieden in sich hinein, hörte er doch schon das Klingeln der Münzen, mit denen er sich die Taschen zu füllen gedachte.
Die Räte jedoch antworteten ihrem König nicht. Mit ängstlichen Mienen hielten sie ihre Augen weiter himmelwärts gerichtet. Befremdet folgte Cetshwayo ihren Blicken, und dann sah auch er es, und als er begriff, was er sah, senkte er den Kopf und wandte seinen Blick nach innen.
Vier Falken waren aus dem Nichts herabgestoßen, vier kleine Falken, und hatten den mächtigen Adler angegriffen. Immer wieder schossen sie heran, immer wieder hackten sie mit ihren scharfen Schnäbeln nach dem riesigen Vogel, und es kam der Moment, da der Adler so schwer verletzt war, dass er sich geschlagen gab und im Blau des unendlichen Himmels verschwand.
Andrew Sinclair sah ihm nach, konnte sich die plötzliche, deutliche Niedergeschlagenheit Cetshwayos aber nicht erklären. Er zuckte die Schultern. Vermutlich war das wieder so ein lächerlicher Zuluaberglaube. Nun, ihm sollte es recht sein. Je geschwächter der König in den Krieg zog, desto schneller war es vorbei, und desto reicher würde seine Beute sein.
Am Abend dieses Tages erschien eine schwarze Wolke am Himmel über Zululand, von Horizont zu Horizont reichte sie, und wer genau hinsah, entdeckte, dass es Schwalben waren. Tausende und abertausende von Schwalben, ein schier endloser Schwarm. Der Himmel über den grünen Hügeln war schwarz vor Schwalben, obwohl es noch mitten im Winter war.
Andrew Sinclair, zurückgekehrt in sein Lager, bemerkte die Vögel natürlich auch, aber er, der Europäer, erkannte es nicht als ungewöhnlich, geschweige denn als himmlischen Fingerzeig.
Das war es, was an diesem kalten Julitag geschah. Dieses geheimnisvolle Zeichen eines drohenden Unheils wurde in den Himmel geschrieben. Cetshwayo kaMpande hatte noch nie von Belsazar gehört, dem letzten König der Babylonier, und dem Menetekel an der Wand, doch die Zeichen füllten seine Seele mit Düsternis, und er wusste, dass die Tage seines Reichs, und so auch seine, gezählt waren.
So sandte er, der König der Zulus, der sein Land gemäß der Gesetze seiner Vorfahren regierte, der einen tief sitzenden Sinn für Gerechtigkeit und Ausgleich besaß, der nichts weiter wünschte, als die Bahn, die ihm das Schicksal vorgeschrieben hatte, in Frieden zu vollenden, seine Boten ins ganze Land und rief seine Krieger nach Ondini. Die Kriegstrommeln begannen zu sprechen.
Noch herrschte gespannte Ruhe wie die, kurz bevor ein Sturm losbricht, aber König Cetshwayo hörte ihn deutlich, den Donner, der hinter dem Horizont grollte, und Furcht überfiel ihn.
2
Vier Wochen zuvor und über einhundertfünfzig Meilen weiter südlich, an der grünen Küste Natals, folgte Johann Steinach einer einsamen Fußspur im Sand hinunter zum Saum der auslaufenden Wellen. Die Sonne war ein rosa Hauch über dem Horizont, das Meer schlief noch im Morgendunst. Das Wasser lief ab, und wie eine Herde urweltlicher Fabelwesen tauchte das steinerne Riff langsam aus dem Indischen Ozean. In den schattigen Teichen drifteten die Fische noch träumend dahin. Johanns Blick folgte der Spur, und er entdeckte sie, wo er es erwartet hatte. Eingehüllt in den silbrigen Gischtschleier auf ihrem Felsen, der weit draußen der Brandung trotzte. Dorthin flüchtete sie sich, wenn sie sich verloren hatte. Hier fand sie sich wieder, konnte ihre Gedanken ordnen, fand Lösungen, die ihr vorher nicht in den Sinn gekommen waren. Das tat sie schon seit zwanzig Jahren, und so lange trug der mächtige, seepockenverkrustete Sandstein ihren Namen. Catherines Felsen.
Johann krempelte seine Hosen bis zum Knie hoch, stieg über den kühlen Dünensand hinunter auf den Strand und folgte ihren Schritten. Wie sie hatte auch er nicht schlafen können, aus dem gleichen Grund, schon seit langem nicht, obwohl er tagsüber mit der beinharten Arbeit beschäftigt war, Rohre zu verlegen, um das Wasser aus dem nahen Fluss zu seiner Ananas- und Papayaplantage zu leiten. Die unbarmherzige, seit einem Jahr herrschende Trockenheit hatte selbst das grüne Natal zu einem staubigen Braun gebrannt. Ursprünglich hatte er den Fehler begangen, das Wasser durch halbierte, ausgehöhlte Baumstämme zu leiten, über die jedoch Termiten mit großem Appetit hergefallen waren und sie in kürzester Zeit in Siebe verwandelt hatten. Jetzt benutzte er Tonrohre, die eine Ziegelei bei Durban brannte. Der Eigentümer kam aus Österreich und verstand sein Handwerk. Das Problem war das Gewicht. Zwei seiner Männer waren ausgefallen. Einer hustete Blut, der andere hatte ein Rohr fallen lassen, das ihm den Fuß zerquetschte. Da es eilte, weil die Ananas von einem Händler am Kap vorbestellt waren, hatte er selbst mit angefasst.
Catherine musste das Knirschen seiner Schritte im Sand gehört haben, denn sie drehte sich zu ihm, streckte ihre Hand aus und zog ihn wortlos neben sich, dann richtete sie ihren Blick wieder auf den Horizont, wo ein tiefes Glühen den Aufgang der Sonne ankündigte.
Mit gekreuzten Beinen setzte er sich.
»Wenn Maria etwas zugestoßen ist, würde man uns das doch wissen lassen.« Es war keine Frage.
Er nickte, aber erwiderte nichts.
Sie schleuderte einen Stein, der die Wasseroberfläche wie Glas splittern ließ. »Egal, ich habe es satt, nur herumzusitzen und zu warten. Heute reite ich nach Durban, nehme morgen die Postkutsche nach Pietermaritzburg und gebe ein Telegramm auf. Das hatte ich mir schon vor ein paar Tagen vorgenommen. Eigentlich wollte ich reiten, aber in der Dunkelheit bin ich nicht gern allein unterwegs, ich müsste auf der Strecke übernachten. So geht es am schnellsten.« Johann hatte das Problem mit den Bewässerungsrohren, das verstand sie, auch dass bei dem Unternehmen jeder Tag zählte.
Er sah sie überrascht an. »Postkutsche? Soll außerordentlich unbequem sein …«
»Bin ich aus Zucker?«
»Nein, das wahrlich nicht.« Ein Lächeln huschte über seine Züge. »Aber diese Möglichkeit hatte ich gar nicht in Betracht gezogen. Bisher hatte ich noch nie jemandem etwas so dringend mitzuteilen. Die Schiffspost hat allemal genügt. Hast du durchgerechnet, wie lange es dauern wird, ehe wir Antwort bekommen?«
Mit einer Hand ihr Haar zurückhaltend, das ihr im Winterwind immer wieder in die Augen wehte, sah sie ihn an.
»Natürlich. Jede Art von Rechenspielchen habe ich betrieben, aber es kam immer dasselbe heraus. Es dauert rund eineinhalb Monate. Den ersten Tag reite ich nach Durban, am zweiten nehme ich die Postkutsche nach Pietermaritzburg, den nächsten Tag gebe ich das Telegramm auf.« Sie zählte die Tage an den Fingern ab. »Am vierten Abend sollte es dann Kapstadt erreichen und daraufhin in Papierform an Bord eines Dampfschiffs nach Madeira gebracht werden, wo das transatlantische Kabel liegt, das Afrika mit Europa verbindet. Die Reise nach Madeira dauert knapp zweieinhalb Wochen, wenn das Wetter gut ist, unbestimmte Zeit länger, wenn Stürme, Hafenstreiks oder ähnliche Schicksalsschläge dazwischenkommen. Als ehemaliger Seemann weißt du besser als ich, was die Stürme vor der Skelettküste anrichten können.« Sie streckte drei Finger hoch. »Das sind also schon mindestens drei Wochen, vorausgesetzt das Schiff hat Kapstadt sofort verlassen, und alles ist glatt gegangen, was ich, ehrlich gesagt, nicht für wahrscheinlich halte. Trotzdem, lass es uns so annehmen. Dann sollte es höchstens, alle Eventualitäten eingerechnet, noch wenige Tage dauern, bis Herr Puttfarcken in Hamburg das Telegramm in der Hand hält.«
Sie zog eine Grimasse. »Im besten Fall dauert es sechs Wochen, ehe wir überhaupt hoffen können zu erfahren, wie es unserer Kleinen geht.«
Johann konnte nicht mehr still sitzen. Er kletterte vom Felsen herunter, fischte einen seidig glatten, schwarz glänzenden Stein aus dem Teich zu seinen Füßen und warf ihn weit hinter der Brandung ins Meer. »Das ist Basaltgestein, wusstest du das? Es muss hier vor Millionen von Jahren in Form flüssiger Lava aus der Erde gequollen sein.«
Er hatte ihr das schon oft erklärt, aber sie schüttelte den Kopf. Sie wusste, dass es eine automatische Bemerkung war, die ihm half, seine Gedanken zu entwirren.
»Es gibt in Übersee eine Vorrichtung, die Telefon heißt«, sagte er endlich. »Man steht zu Hause, spricht in eine Art Trichter hinein, und zig Meilen entfernt kommt die Stimme dann wieder aus einem solchen Ding heraus.«
Auch sie hatte davon gehört. »Ich kann das zwar kaum glauben, verstehe partout nicht, wie die Stimme in den Apparat hineinkommt, durch die Luft fliegt und am anderen Ende aus einem Trichter tönt, aber Francis Court hat mir versichert, dass es funktioniert. Er hat es bereits selbst in London benutzt.« Sie ballte die Fäuste. »Und wir müssen sechs geschlagene Wochen warten! Eine Brieftaube wäre schneller. Mein Gott, ich wünschte, ich hätte Flügel, um mal eben nach Deutschland fliegen zu können!« Ihre Füße sicher in die Nischen und Mulden setzend, die Jahrtausende von Wind und Wasser in den Felsen gekerbt hatten, stieg auch sie herunter.
Wieder schleuderte er einen Stein ins Wasser. »Nimm die Gig, Cleopatra hat ein Natalgeschwür am Bein.«
So geschah es. Ziko begleitete sie. Sofort nach ihrer Ankunft reservierte Catherine für den nächsten Morgen einen Sitz in der Postkutsche, denn die hatte nur Platz für vier Passagiere und war schnell ausgebucht. Danach lenkte sie ihren Einspänner auf die Berea, den lang gezogenen Hügel, der ersten Stufe zum Hochplateau der Drakensberge, die das am Meer liegende Durban vor kalten Westwinden schützten und im Sommer für fast tropisches Klima sorgten. Hier hatten Cilla und Per Jorgensen erst vor kurzem ihr Haus gebaut. Sie würde bei ihnen übernachten, und Ziko würde mit Pferd und Wagen dort ihre Rückkehr erwarten.
Cilla Jorgensen war hocherfreut, sie zu sehen, sorgte für gutes Essen, ein frisch bezogenes Bett, munteres Geplauder, das Catherine tatsächlich für ein paar Stunden von ihren Sorgen ablenkte. Nach einem reichlichen Frühstück brachte Per Jorgensen, ein blonder, stark ergrauter Hüne mit Pranken, die aussahen, als könnten sie Baumstämme aus dem Boden reißen, sie noch vor Sonnenaufgang in seinem Zweispänner zum Abfahrtspunkt der Postkutsche. Der Morgen war frisch, die Nächte oft noch winterkalt, obwohl tagsüber die Sonne täglich höher stieg und ihre Strahlen schon von der kommenden Sommerhitze kündeten.
Die Postkutsche war ein zweirädriges Gefährt, das von sechs Pferden gezogen wurde. Nervöse Pferde, wie Catherine mit Missbehagen feststellte, während sie ihre Reisetasche einem der drei Schwarzen übergab, die die Fahrt begleiten würden. Er warf sie aufs Verdeck, kletterte auf der schmalen Leiter hinterher und zurrte sie wie das übrige Gepäck mit den Postsäcken fest. Behände hangelte er sich dann auf das Brett, das ihm und seinem Kumpanen an der Rückwand der Passagierkabine als Sitz diente. Catherine fühlte flüchtiges Mitleid mit diesen Männern. Die Bank war schmal, die Fahrt würde sehr unbequem für sie werden. Genauer gesagt, sie würden jeden Stein, jede Holprigkeit aufs Schmerzhafteste spüren. In Pietermaritzburg würden sie grün und blau am ganzen Körper sein. Der dritte Schwarze, ein muskelbepackter Zulu, stieg zum Kutscher auf den Bock.
Per half ihr über das Treppchen in den engen Innenraum der Kutsche. Die Sitzbank für die Fahrgäste stellte sich als kaum breiter heraus und war ebenfalls ungepolstert. Ihr Mitleid mit den schwarzen Beifahrern verschwand. Ein Blick zeigte ihr, dass die Fensterlöcher nicht verglast waren. Entweder war das Glas herausgefallen, oder der Postmeister erachtete das als überflüssigen Luxus. Sie war froh, dass sie über ihr wärmstes Wollkleid eine dicke, gewalkte Jacke gezogen hatte und vorsichtshalber alle Unterröcke trug, die sie besaß. Drei Stück. Ihre Mitpassagiere, zwei Männer und eine jüngere Frau, die in guter Hoffnung war, grüßten mit einem stummen Nicken. Die Männer hatten verbrannte, wettergegerbte Haut, die Frau war blass, was wohl an ihrem Zustand lag. Von der Art, wie sie den abgewetzten Beutel in ihrem Schoß umklammerte, schloss Catherine, dass er ihre gesamte Habe enthielt. Sie trug ihr braunes Haar in einem windzerzausten Zopf um den Kopf gewunden und war, wie ihre Begleiter auch, ärmlich gekleidet. Der Jüngere, der recht groß war, trug eine grüne Jacke, die offensichtlich nicht für ihn gemacht war. Sie war viel zu eng und unter dem Arm aufgerissen, seine klobigen Stiefel waren dilettantisch geflickt, die Hosen fadenscheinig.
Einwanderer, die in Pietermaritzburg Arbeit suchten, nahm Catherine an. Entweder frisch aus Übersee oder schon in Durban gescheitert. Mit einer Entschuldigung und kurzem Gruß drängte sie sich hindurch und ließ sich auf den letzten Platz fallen.
»Morgen, die Damen, Morgen, die Herren, nun woll’n wir mal …« Der blau uniformierte Kutscher stank, hatte eine dröhnende Stimme und Hände voller Schwielen. Ehe es sich Catherine versah, holte er einen zollbreiten Lederriemen hervor, führte ihn hinter der Rückenlehne durch und machte sich daran, ihn unter ihrer Brust festzuschnallen.
»Der sitzt zu fest, ich kann nicht atmen«, protestierte sie und hakte ihre Finger dahinter, versuchte vergeblich, ihn zu lockern.
Der Mann, der eben ihre Sitznachbarin auf die gleiche Weise festband, drehte sich um. »Nicht doch, Gnädigste, sonst verliere ich Sie wohlmöglich unterwegs, und das woll’n wir doch nicht, was?« Er grinste höchst belustigt, als wisse er etwas, das sie nicht wusste.
Catherine schwieg. Es war ihre erste Fahrt in einer Postkutsche, und dass sie festgebunden werden musste, konnte nichts Gutes bedeuten. Sie lehnte sich aus der Fensteröffnung und winkte Per zum Abschied zu. Er hob die Hand, wortkarg wie immer, wendete den Zweispänner auf der breiten West Street, streifte dabei um ein Haar das Postgespann. Das vorderste Pferd wieherte, tänzelte und keilte aus. Die Kutsche schwankte heftig.
»Jessasmariaundjosef!«, schrie die schwangere Frau, bäumte sich in ihrem Riemen auf und gab ein würgendes Geräusch von sich.
Der jüngere der beiden Männer langte herüber und tätschelte ihr den Arm, brummte dabei ein paar Worte, die Catherine eindeutig als einen deutschen Dialekt identifizierte. Sie war froh, dass sie der Frau nicht gegenübersaß. Sollte die sich übergeben müssen, würde das im Schoß eines der Männer landen.
Der Postillion schnallte seinen Hut unterm Kinn fest, knöpfte seine Uniformjacke bis zum Hals zu, klappte den Kragen hoch und stieg auf den Bock. »Holla, holla!«, brüllte er, ließ seine Peitsche über die Rücken der Pferde tanzen. Die machten einen Satz und jagten in einem Höllentempo die West Street hinunter. Hühner stoben gackernd beiseite, die Händler, die eben ihre Stände für den Markt aufbauten, beeilten sich, dem heranrasenden Fahrzeug Platz zu machen.
Am Rand von Durban, wo Hütten die festen Gebäude ablösten, Rudel von ausgemergelten, herrenlosen Hunden neben Schweinen und Ratten in Abfällen wühlten, kam es fast zu einem schlimmen Unfall. In halsbrecherischem Bravado lenkte der Kutscher sein Gefährt um die Kurve und sah sich unvermittelt einem Rindvieh gegenüber, das dösend in der Straße stand und ihnen blöde entgegenglotzte. Widerwillig musste Catherine anerkennen, dass der Mann ein Virtuose war, was das Handhaben von Pferden betraf. Geistesgegenwärtig gelang es ihm, durch ein geschicktes Manöver rechts an dem Tier vorbeizusteuern, die Kutsche holperte zwar mit Wucht über eine Bodenwelle, dass ihr die Zähne zusammenschlugen, schrammte aber an der Kuh vorbei. Der Kutscher schrie »He!« und »Hoho!«, und die sechs Grauen galoppierten den Hügel hinan auf die Berea.
Catherine presste ihren Rücken fest an die harte Rückenlehne, hielt sich mit einer Hand am Fensterrahmen fest, mit der anderen am Sitz. Trotz des Brustriemens wurde sie herumgeworfen wie ein Sack Kartoffeln. Sie fragte sich, wie sich die beiden bedauernswerten Zulus auf ihrem prekären Sitz halten konnten. Der Postillion brüllte, einer der Männer fluchte, die junge Frau neben ihr wimmerte und presste mit aufgerissenen Augen die Hand auf ihren geschwollenen Bauch. Ganz offensichtlich war es ihr erstes Kind.
Sie tat Catherine Leid, denn sie erinnerte sich noch daran, wie ängstlich sie selbst bei ihrer ersten Schwangerschaft gewesen war. Sie schloss die Augen und dachte an ihre Kinder. Vor Jahren hatte Mr Wickers, der Fotograf aus Durban, eine Serie von Fotos von Inqaba und seinen Bewohnern gemacht. Eins liebte sie besonders. Es zeigte die ganze Familie und hing in ihrem Schlafzimmer im Lobster Pott. In der Mitte standen Johann und sie, er hatte seinen Arm um sie gelegt, der andere umfasste seine Töchter, und ihr Arm lag um Stefans Schulter. Die Kinder waren noch klein, Viktoria vielleicht vierzehn, Stefan zwölf und Maria zehn Jahre alt. Doch es existierten zwei Fotografien dieser Szene. Die erste Aufnahme wurde nach Meinung von Mr Wickers von der kleinen Lulamani verdorben, die unverhofft durchs Bild gehuscht war. Der Fotograf hatte reflexartig den Auslöser gedrückt, Lulamani hatte sich erschrocken umgedreht, und so war sie auf dem Familienfoto verewigt worden. Etwas verwischt, ein Bein graziös vors andere gekreuzt, aus seelevollen, schwarzen Augen über ihre Schulter schauend. Eine weiße Perlenschnur lag um ihre kindlichen Hüften. Sonst trug sie nichts.
Catherines Gedanken begannen zu verschwimmen. Zwölf Jahre lag das etwa zurück. Da war unsere Welt noch in Ordnung, dachte sie. Stefan war ein unbekümmerter Junge, Viktoria und Maria fröhlich wie zwitschernde Vögelchen, und Lulamani ein süßes, zutrauliches Mädchen, das oft auf Inqaba erschien, um mit Maria zu spielen. Später, als sie immer mehr Pflichten im Umuzi ihrer Eltern übernehmen musste, waren ihre Besuche selten geworden, ihre Zutraulichkeit hatte sich in eine gewisse Zurückhaltung verwandelt.
Lulamani. Unwillkürlich seufzte sie, fing dabei den neugierigen Blick des älteren Mannes ihr gegenüber auf, der sie schon seit Fahrtbeginn auf ungezogene Art angestarrt hatte. Sie senkte den Kopf, sodass die Krempe ihres Huts ihr Gesicht verbarg, und schloss die Augen, schloss die Welt aus, verkroch sich in ihr Innerstes.
Lulamani war Nomitis und Sihayos Tochter und wie viele Kinder der Farmarbeiter mit den Steinach-Kindern aufgewachsen. Der Name Nomiti war untrennbar mit Erinnerungen an Sicelo verbunden, und die würden unweigerlich den Giftschlamm hochspülen. Mit zusammengebissenen Zähnen wollte sie sich den Bildern widersetzen, die jetzt aus dem schwarzen Nebel des Vergessens auftauchten. Doch ihre Kraft reichte nicht. Sicelo stand vor ihr und neben ihm eine hübsche, junge Zulu, die europäische Kleidung trug, komplett mit Hut und weißen Handschuhen.
»Sie wird meine neue Frau«, hatte der lange Sicelo sie mit unverhohlenem Stolz vorgestellt. »Ich nehme sie mit nach Inqaba.«
»Guten Tag, Madam, ich freue mich, Sie kennen zu lernen.« Das Mädchen deutete einen Knicks an. Ihr Englisch war perfekt, ihr Ausdruck gewählt.
Catherine hatte es die Sprache verschlagen. Es stellte sich heraus, dass König Mpande das Mädchen als Kleinkind einem Missionar geschenkt hatte, der den König von einer Krankheit heilte. Das kinderlose Missionarsehepaar nannte sie Sophia und erzog sie wie seine Tochter, ließ ihr auch die Ausbildung angedeihen, wie es sich für eine der ihren geziemte. Sicelo und sie hatten sich zum ersten Mal auf dem Markt in Durban getroffen.
Am nächsten Tag erschien Sophia, ihre Habseligkeiten balancierte sie in einem Bündel auf dem Kopf, um ihre Hüften trug sie nichts als einen Schurz, der sich auf den zweiten Blick als der Überrest ihres Stoffrocks herausstellte, und um ihre Stirn gewunden das Band aus schimmernden Holzperlen. »Ich heiße Nomiti«, verkündete sie.
Wie ein Reptil, das sich häutet, hatte das junge Mädchen mit ihrem Namen auch ihre europäische Hülle abgestreift. Wie selbstverständlich servierte Nomiti ihrem Mann Sicelo sein Essen auf den Knien und hob nie länger die Augen zu ihm als für einen flüchtigen Blick, so wie es die Sitte von einer Zulufrau einem Mann gegenüber verlangte. Nur ihr fließendes Französisch, das etwas altmodische Englisch und ihre unzweifelhaft damenhaften Manieren erinnerten an ihr früheres Leben. Sicelo und Nomiti wurden so glücklich, wie es zwei Liebende nur sein konnten, und nie hatte Catherine sich verziehen, dass ihre Unachtsamkeit dazu führte, dass der Zulu sein Leben verlor.
Noch heute träumte sie von diesem einen Augenblick, und im Traum stolperte sie nicht, fiel nicht gegen Sicelo, der verlor nicht das Gleichgewicht, sein Gegner konnte ihm den Panga nicht entreißen. Welle auf Welle rollten die Bilder über sie hinweg, und sie konnte nicht verhindern, dass auch der eine Name, den sie am meisten fürchtete, wie ätzende Säure in ihr hochstieg, der Name des Mannes, dem es um ein Haar gelungen wäre, ihr Leben und das ihrer Familie zu zerstören.
Konstantin von Bernitt.
Mit einem gewaltigen Hieb hatte Konstantin dem großen Zulu mit dessen eigenem Panga den Hals durchtrennt. Sie presste die Hände an die Schläfen. Das Abbild des sterbenden Sicelo hatte sich unauslöschlich in ihr Gedächtnis gebrannt. Nomiti verlor ihr Lachen. Ein Teil von ihr war mit Sicelo gestorben, und so hatte Catherines Fehltritt auch ihr Leben zerstört.
Das war ihre private Hölle, das Kreuz, das sie bis ans Ende ihrer Tage tragen musste. Natürlich hatte Sicelos Bruder Sihayo Nomiti als Frau übernommen, wie es Sitte bei ihrem Volk war, und Johann hatte ihnen zehn Rinder zur Hochzeit geschenkt, aber ihr war es immer so vorgekommen, als wäre das der Preis für Sicelos Leben gewesen. Zehn Rinder für einen Mann wie Sicelo.
Lulamani war das erste Kind von Sihayo und Nomiti, und während der Geburt geriet die junge Mutter in Not. Mandisa, Nomitis Schwiegermutter, die sonst jedes Kind in die Welt geholt hatte, egal wie verquer es lag, war selbst sehr krank, und so hatte Sihayo Katheni von Inqaba um Hilfe gebeten. Es war ein hartes Stück Arbeit gewesen, aber endlich hielt sie Lulamani im Arm, ein zierliches, aber kräftig brüllendes Kind, und nach den Gesetzen der Zulus war sie nun für das Mädchen verantwortlich, so wie es Lulamanis Pflicht sein würde, im Alter für sie da zu sein.
Als Catherine Lulamanis und Nomitis Leben gerettet hatte, war so eine Schuld beglichen worden, wenn auch nur ein kleiner Teil. An jenem pechschwarzen Tag, der nur aus Schmerzen und Angst bestand, als ihr erstes Kind in ihrem Bauch zu sterben drohte, als Johann nur noch um ihr Leben flehte, und sie schon auf der Schwelle zum Jenseits stand, war Mandisa gekommen, diese resolute, großherzige, unerschrockene Frau, die mehr über Kräuter und ihre Wirkungen wusste als jeder Inyanga ihres Stammes und sicherlich mehr als der Armeearzt, der damals in Durban praktizierte und eher als Viehdoktor taugte und ohnehin gut zehn Tage entfernt war.
Mandisa erschien, schob Johann energisch beiseite, und zwei Stunden später hatte Catherine ihr Kind im Arm gehalten, sie selbst war völlig ausgelaugt und so erschöpft, dass sie nicht sprechen konnte, Viktoria aber war kräftig und schrie und verlangte sofort nach ihrer Brust. Den Augenblick, als Johann an ihrem Bett kniete und sie zu dritt waren, diesen kostbarsten Augenblick ihres bisherigen Lebens, verdankte sie der tatkräftigen, weisen Zulu. Hinterher hatte die gewiefte Schwarze Johann fünf Kühe als Preis für ihre Kunst genannt, dabei ihr fettes Lachen gelacht, das hieß, dass sie genau wusste, dass der Preis eigentlich maßlos war. Aber sie hatte den Umlungu Jontani, wie Johann von den Zulus genannt wurde, völlig richtig eingeschätzt, Johann hatte sofort zugestimmt. Für das Leben seiner Frau und seines Kindes hätte er freudig alle seine Rinder hergegeben.
Catherine hatte bis zu diesem Tag ihr Versprechen an Mandisa gehalten, mit niemandem darüber zu sprechen, was in dem Zimmer damals geschehen war, auch nicht mit Johann.
Die Kutschenräder knallten auf ein Hindernis, das Gefährt machte einen Satz und schleuderte, als würde eine Riesenfaust es schütteln. Sie schlug mit dem Kopf gegen den Fensterrahmen, dass Sterne vor ihren Augen tanzten, und kehrte damit unsanft in die Gegenwart zurück. Ihr Mund war trocken, und die Zunge klebte ihr am Gaumen. Sie bückte sich, nahm die mit Filz verkleidete Wasserflasche aus ihrer Reisetasche, die sie zwischen ihren Beinen eingeklemmt hielt, entkorkte sie und trank in langen Zügen.
Ihre Gedanken sprangen von Sicelo zurück zu einem anderen Sohn dieses geheimnisvollen Kontinents, und unvermittelt glaubte sie einen Duft von Anis zu spüren, würzig, hell und untrennbar mit César verbunden, dem Griot aus Mali, dem Hüter der Geschichten seines Volkes. Er war eines Tages in ihrem Leben aufgetaucht und erzählte, dass er seine Geschichten verloren hätte. Da er glaubte, dass die beiden Fremdlinge, die kleine Catherine und ihr Vater, auf der Suche nach ihrer Farbe wären, denn sie waren schließlich weiß und nicht braun wie alle Menschen, bat er darum, sich ihnen anschließen zu dürfen.
Er fand seine Geschichten wieder, und noch heute spürte sie seine Worte, die in jede Pore ihrer Haut gedrungen waren, als sie noch ein Kind war, und sich in Anisduft verwandelt hatten. Als er an derselben mysteriösen Krankheit starb wie ihr Vater, bei lebendigem Leib von Maden aufgefressen wurde, blieben ihr dieser tröstliche Duft und das Echo seiner Geschichten. An seine Stelle war Sicelo getreten.
Catherine hielt der schwangeren Frau die Flasche hin. »Möchten Sie auch etwas trinken?«, fragte sie auf Deutsch. Ihre Stimme raschelte wie trockene Blätter.
»Nein, nein, danke«, stotterte die Frau, offensichtlich verblüfft, ihre eigene Sprache in dieser Wildnis zu hören.
Catherine bückte sich, um die Flasche wieder zu verstauen, spürte, wie das Blut in ihrer Stirn pochte.
»Sie haben da eine große Beule auf der Stirn, gnädige Frau«, flüsterte ihre Mitfahrerin.
Catherine fasste hin, spürte die Schwellung. Verstohlen untersuchte sie auch ihre Arme. Auch hier hatte sie schmerzhafte Stellen. Hätte sie geahnt, dass die Postkutschenfahrt ein derart Knochen brechendes Abenteuer war, wäre sie doch besser geritten, auch wenn das einen Tag länger gedauert hätte und sie in irgendeiner Spelunke hätte übernachten müssen.
Die sechs Gäule galoppierten durch eine Senke, das Gefährt tanzte, krachte in eine ausgewaschene Furche, und Catherine befürchtete schon, dass sie stecken bleiben würden, aber der Kutscher ließ seine Peitsche singen. Die Pferde gehorchten ängstlich wiehernd und keuchten den steilen Hügel hinauf, dass Catherine in ihren Sitz gepresst wurde.
Sie schloss wieder die Augen, und sofort erschien ihr ein neues Bild. Stefan und Lulamani auf der Veranda von Inqaba. Lulamani im elfenbeinfarbenen Brautkleid und einem spinnwebzarten Schleier, der von einem Kranz aus weißen Amatungulublüten gehalten wurde, Stefan stolz in Johanns Frack, den dieser sich anlässlich des Besuchs von Queen Victoria hatte anfertigen lassen. Die Hosen waren zwei Fingerbreit zu kurz, da Stefan einen Zoll größer war als sein Vater, aber das fiel kaum auf. Vor ihnen stand ein Priester, den Catherine vorher noch nie gesehen hatte.
»Ich will«, hörte sie die feste Stimme ihres Sohnes. Dann hatte er Lulamani den goldenen Ring an den Finger gesteckt, den er extra bei Isaac, der im früheren Leben Goldschmied gewesen war, hatte anfertigen lassen.
Später hatte ihr Mila von Gerüchten berichtet, die behaupteten, dass der Priester kein echter gewesen war, sondern ein ehemaliger Sträfling, der seine Soutane geklaut hatte. Nicht im Entferntesten war ihnen die Idee gekommen, dass der distinguiert wirkende, weißhaarige Geistliche, den Stefan auf einer seiner Wanderungen im Busch kennen gelernt hatte, keiner gewesen war. Jedenfalls bestritt Reverend Peters aus Durban auch Catherine gegenüber, je von dem Mann gehört zu haben, ja, er deutete sogar an, dass die Kirche Stefans Ehe deswegen nicht anerkannte. Catherine sprach Stefan vorsichtig darauf an und hatte ihn selten so zornig erlebt.
»Ich habe geschworen, Lulamani zu lieben und zu ehren, bis dass der Tod uns scheidet. Laut und deutlich. Gott wird mich gehört haben, ob der Pfaffe nun echt war oder nicht.«
Keiner wagte danach, in seiner Gegenwart je wieder auch nur ein Wort darüber zu verlieren.
Noch heute fragte sie sich, wie es möglich gewesen war, dass weder sie noch Johann lange Zeit nicht bemerkt hatten, was unter ihrer Nase passierte. Erst Maria öffnete ihnen eines Tages die Augen.
»Sie gehen zusammen, weißt du, so wie Mann und Frau. Ich glaube, Stefan will Lulamani heiraten. Werden ihre Kinder dann gestreift oder eins braun und eins weiß, wie bei unserem weißen Ziegenbock, der nur schwarze Weibchen hat?«
Catherine war derart vor den Kopf geschlagen, dass sie nicht antworten konnte. In der Folge beobachtete sie ihren Sohn und Lulamani heimlich, und es wurde ihr schnell klar, dass Maria Recht hatte. Die beiden waren ein Paar. Anfänglich waren sie und Johann versucht gewesen, es nicht ernst zu nehmen, schließlich war Stefan erst zwanzig und Lulamani fünf Jahre jünger, aber sehr schnell wurde offensichtlich, dass sich zwischen ihnen etwas anbahnte. Johann hatte sofort reagiert. Er schickte den vehement protestierenden Stefan noch im selben Monat auf die Farm eines Freundes, die fünfzig Meilen hinter Pietermaritzburg in Richmond lag. Um seine Ausbildung abzurunden, wie er seinem Sohn erklärte. Stefan hielt es ein halbes Jahr aus, dann stand er eines Tages auf Inqabas Hof, abgerissen, abgemagert, dunkelbraun gebrannt, aber breit lachend. Er trug keine Schuhe, und seiner entsetzten Mutter wurde klar, dass er den ganzen Weg von Richmond bis nach Inqaba zu Fuß zurückgelegt haben musste. Den ganzen Weg zu Lulamani.
»Da bin ich wieder«, hatte er gesagt. Und er blieb.
Als Stefan zweiundzwanzig Jahre alt war, sich durch Elfenbeinjagd und Handel mit den Zulus ein nettes Sümmchen gespart hatte, sprach er beim König vor, legte ihm seine Absicht dar, Lulamani zur Frau zu nehmen, untermauerte diesen Wunsch mit einem Wagen voller Geschenke, bekam die Zustimmung zu dieser Verbindung, kaufte vierzig Rinder und trieb diese zu Sihayo.
»Ich will Lulamani heiraten«, verkündete er. »Ich bezahle dir zehn Rinder mehr, als es für eine Häuptlingstochter üblich ist.«
Catherine seufzte im Rückblick. Sie musste sich eingestehen, dass Stefan sich durch Lulamani verändert hatte. Er war glücklich und zufrieden. Früher hatte ihn eine gewisse Unruhe umgetrieben, sodass sie schon befürchtet hatte, dass er eines Tages Inqaba verlassen würde. Das hätte Johann sicher das Herz gebrochen. Lulamani war mit Catherines Kindern aufgewachsen, Catherine hatte die Kleine als Erste im Arm gehalten, und das Mädchen hatte einen festen Platz in ihrem Herzen. Eigentlich wäre die junge Zulu also die perfekte Schwiegertochter.
Als Erster verbat Andrew Sinclair seiner Frau Lilly, Stefan in sein Haus einzuladen. Andere hatten es ihm gleich getan, und im Club zeigten sie Stefan die kalte Schulter. Das war deutlich. Daraufhin erwog Johann, aus dem Club auszutreten, obwohl er eines der Gründungsmitglieder war. Nur die vereinten Überredungskünste von Justus Kappenhofer und Timothy Robertson hielten ihn davon ab. Und Johann brauchte den Club. Dort war der Klatsch zu einer ausgefeilten Kunstform der Kommunikation geworden. Einem Geschäftsmann in Natal hätte man ebenso gut das Blut abschnüren können, schnitt man ihn von diesem Informationsfluss ab. So begnügte Johann sich damit, sich diejenigen, die sich an dem Boykott beteiligt hatten, einzeln vorzuknöpfen und ihnen glasklar zu machen, dass er ihr Verhalten als Kriegserklärung ansah. Er gehörte zum inneren Kreis in Durban. Keiner konnte es sich leisten, ihn zum Feind zu haben. Das wusste Johann und nutzte es, wenn auch mit traurigem Herzen.
Lulamani war ein entzückendes Geschöpf. In den eleganten, von kosmopolitischem Geist geprägten Salons von Paris könnte sie Furore machen, das musste Catherine zugeben, genauso sicher aber wusste sie, dass Stefan seine Liebste nie in die weiße Gesellschaft Durbans einführen konnte. Die war viel zu verbohrt und engstirnig, um eine Zulu in ihren Reihen zu akzeptieren. Bei der Vorstellung, was geschehen würde, wenn er Lulamani auf ein Fest in Durban mitnehmen würde, konnte Catherine sich ein bitteres Lächeln nicht verkneifen. Vermutlich würden die Durbaner Damen reihenweise in Ohnmacht fallen, aber nicht bevor sie versucht hätten, Lulamani mit Blicken und Worten zu töten. Es war nicht auszudenken, wie ihr Sohn dann reagieren würde.
Stefan wollte das alles nicht wahrhaben, wischte alle Warnungen seiner Eltern vom Tisch. »Ich lebe in Zululand, meine Frau ist eine Zulu, und damit basta.«
Er klang wie sein Großvater Louis le Roux, und genauso unbeugsam war er auch. Er schenkte Lulamani europäische Kleidung, brachte ihr Lesen bei und bat seine Mutter, mit ihr Französisch zu sprechen und die europäischen Manieren, die sie von ihrer Mutter Nomiti gelernt hatte, weiter zu polieren. Er war Catherines Sohn. Wie konnte sie ihm das abschlagen?