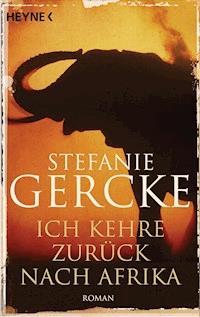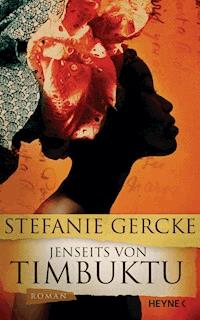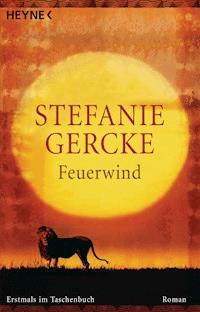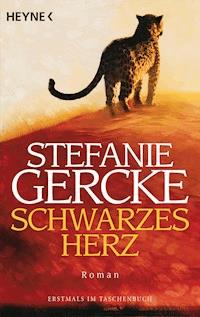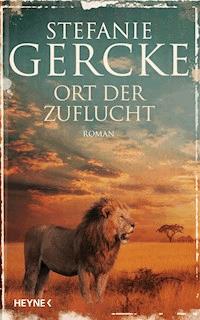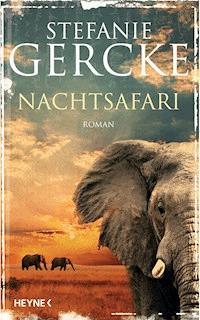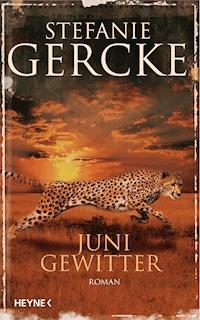
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sehnsucht, Tragik, Geheimnis, Liebe – der neue große Roman von Stefanie Gercke
Anfang der Achtziger lernt die junge Lübecker Restauratorin Alice auf romantische Weise ihren zukünftigen Mann Pierre kennen. Weil sie sich mit ihrem wohlhabenden Vater völlig überworfen hat, wandert sie mit Pierre nach Südafrika aus. Die beiden sind im Hotel- und Immobiliengewerbe erfolgreich, und die Geburt des Sohnes Christoph krönt das neue Glück. Gemeinsam überstehen sie auch die Wirren bei der Auflösung der Apartheid. Doch dann wird Pierre ermordet, und Christoph verschwindet spurlos. Aller Ho nungen beraubt, kehrt Alice nach Lübeck zurück, wo sie ein großes Familiengeheimnis erwartet. Und auch eine neue Liebe? Mit wiedererwachtem Lebensmut reist Alice noch einmal nach Südafrika und begibt sich auf die Suche nach ihrem verschollenen Sohn.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 770
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Das Buch
Anfang der Achtziger lernt die junge Lübecker Restauratorin Alice auf romantische Weise ihren zukünftigen Mann Pierre kennen. Weil sie sich mit ihrem wohlhabenden Vater völlig überworfen hat, wandert sie mit Pierre nach Südafrika aus. Die beiden sind im Hotel- und Immobiliengewerbe erfolgreich, und die Geburt des Sohnes Christoph krönt das neue Glück. Gemeinsam überstehen sie auch die Wirren bei der Auflösung der Apartheid. Doch dann wird Pierre ermordet, und Christoph verschwindet spurlos. Aller Hoffnungen beraubt, kehrt Alice nach Lübeck zurück, wo sie ein großes Familiengeheimnis erwartet. Und auch eine neue Liebe? Mit wiedererwachtem Lebensmut reist Alice noch einmal nach Südafrika und begibt sich auf die Suche nach ihrem verschollenen Sohn.
Die Autorin
Stefanie Gercke wurde auf einer Insel des Bissagos-Archipels vor Guinea-Bissau/Westafrika als erste Weiße geboren und wanderte mit 20 Jahren nach Südafrika aus. Politische Gründe zwangen sie Ende der Siebzigerjahre zur Ausreise, und erst unter der neuen Regierung Nelson Mandelas konnte sie zurückkehren. Sie liebt ihre regelmäßigen kleinen Fluchten in die südafrikanische Provinz Natal und lebt sonst mit ihrer großen Familie bei Hamburg. Zuletzt im Heyne Verlag erschienen: Nachtsafari.
STEFANIE
GERCKE
JUNIGEWITTER
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält
technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung.
Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch
unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung
oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere
in elektronischer Form, ist untersagt und kann
straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten,
so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung,
da wir uns diese nicht zu eigen machen,
sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt
der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Copyright © 2015 by Stefanie Gercke
Deutsche Erstausgabe im Wilhelm Heyne Verlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik·Design, München,
unterVerwendung der Fotos von photobar und
Galina Andrushko/Shutterstock
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN 978-3-641-12950-7
www.heyne.de
1
Alice lebte schon lange in Afrika, so lange, dass sie wie ein Geschöpf dieses Kontinents ein drohendes Unheil bereits spürte, noch bevor es ausbrach. Pierre sagte immer, dass sie Gefahren wittern könne, und im Laufe der Jahre hatten sie beide gelernt, sich darauf zu verlassen.
Aber heute versagte ihr Instinkt. Der Perlmuttschimmer am Horizont kündigte den Tag an, an dem sich ihr Leben unwiderruflich ändern sollte, und sie schlief ruhig und traumlos. Allerdings hatte es in der Zeit zuvor auch keinerlei sichtbare Hinweise gegeben. Der Himmel über Natal strahlte tiefblau, die Sonne brannte, und die Bougainvilleen in ihrem Garten prangten in leuchtendem Rot. Ein friedlicher Hochsommertag reihte sich an den anderen.
Die leichte Brise, die vom Meer hochstrich und die weißen Gardinen blähte, streichelte ihr sacht über die Haut. Sie strampelte das dünne Laken, das sie als Bettdecke benutzte, im Halbschlaf von sich und driftete noch genussvoll zwischen Träumen und Wachsein hin und her, bis sie schließlich ganz aufwachte. Schlaftrunken streckte und rekelte sie sich und schaltete automatisch das Radio ein.
»Guten Morgen, Südafrika«, schallte die unsäglich muntere Stimme des Ansagers durchs Zimmer. »Und wieder ein wunderschöner Tag in unserem wunderschönen Land!«
Mit schmerzverzogenem Gesicht fasste sich Alice an den Kopf. Vor Sonnenaufgang war sie so viel guter Laune einfach noch nicht gewachsen. Stöhnend drehte sie das Radio leiser, tastete nach rechts und berührte ein leeres Kissen, worauf ihr wieder einfiel, dass Pierre gestern überraschend nach Kapstadt geflogen war. Dort hatte er vor, sich mit dem wichtigsten Investor ihrer neuen Ferienanlage zu treffen, und die Besprechung würde sicherlich, wie das in Südafrika so üblich war, auf einem der schönsten Golfplätze stattfinden und dann in einem angesagten Restaurant fortgesetzt werden.
Abwesend rieb sich Alice mit dem Daumen über die wulstige Narbe auf ihrem Oberarm, die sie von dem Vorfall mit der Schlange vor rund vierzehn Jahren zurückbehalten hatte. Instinktiv tat sie das immer, wenn sie sich aufregte, obwohl es sie eigentlich nicht beruhigte. Dafür waren die Auswirkungen damals zu gravierend gewesen. Resolut verdrängte sie die Erinnerung. Bis zum späten Nachmittag hatte sie eine endlose Liste abzuarbeiten, ehe am Abend die Party für die Investoren steigen würde, und ausgerechnet heute, an diesem besonderen Tag, der so entscheidend war für den Rest ihres gemeinsamen Lebens, hätte sie Pierre hier gebraucht. Jetzt musste sie die letzten organisatorischen Hürden allein nehmen.
»Der hat’s gern exklusiv«, hatte Pierre gestern auf ihre Frage hin erklärt, warum dieser Mann nicht einfach zu ihrer Party kommen könne. »Immerhin will er mehrere Bungalows kaufen. Außerdem haben wir Anfragen von Dubai bis Australien, und auch die Schwalben sind wieder scharenweise auf der Suche nach einem Nistplatz.«
Schwalben nannten sie hier die Deutschen, die wie diese Vögel im europäischen Winter nach Afrika flogen und mit ihnen im April wieder nach Hause zurückkehrten.
»Wird es ausreichen?«, hatte sie gefragt.
»Na klar«, hatte Pierre im Brustton der Überzeugung geantwortet. »Wenn ich den Deal mit dem Investor durchziehen kann, sind die Kosten für das Land auf einen Schlag getilgt, und wir sind alle Sorgen los! Es kann nichts schiefgehen, Honey. Es wird wunderbar werden.« Er lachte sein mitreißendes Lachen, das so voller Lebensfreude war und vor Optimismus sprühte.
Aber dieses eine Mal verfehlte es seine Wirkung bei ihr. Mit einem inneren Beben dachte sie daran, dass sie ihr Restaurant verkauft und ihr eigenes Haus, an dem sie mit jeder Faser hing, bis unters Dach mit Hypotheken belastet hatten, um das Grundstück für die Ferienanlage anzuzahlen. Als sie den Betrag hörte, den sie noch zusätzlich aufnehmen mussten, war ihr schlecht geworden. »Die Summe ist der reine Wahnsinn, das Ganze ist viel zu groß für uns!«, protestierte sie.
»Unsinn«, versuchte Pierre ihre Einwände wegzuwischen. »Wenn wir von der Bank nur einen kleinen Betrag haben wollen, denkt ein Banker gleich, wir nagen schon am Hungertuch und sind deswegen nicht kreditwürdig. Wenn du ein Darlehen aufnimmst, muss das schon eine anständige Höhe haben. Dann ist das Interesse an deinem Wohlergehen auch deutlich ausgeprägter. Du kennst doch den alten Schnack: Von der Bank bekommst du nur einen Regenschirm, wenn die Sonne scheint.«
Bis jetzt hatte er recht behalten. Die Bank sagte ihnen die Kredite zu, vorbehaltlich der Zustimmung der drei Clan-Häuptlinge, deren Familien das Land gehörte.
Pierre und sie waren zusammen mit ihrem Anwalt und einem fröhlichen, korpulenten Zulu mit blitzendem Goldzahn, der sie als Verbindungsmann zu den Clans begleitete, ins Herz von Zululand gefahren. Die Verhandlung sollte unter dem Indababaum des Dorfes stattfinden. Nach und nach trafen die Häuptlinge mit ihren Indunas ein und – nach der Anzahl zu urteilen – alle erwachsenen Clan-Mitglieder. Es folgte ein endloses Palaver, es wurden lange, gewundene Reden geschwungen, jeder wollte angehört werden, und Alice, die sich im Hintergrund hielt, bewunderte Pierres Geduld. Sie hatte Mühe, die Augen offen zu halten. Als es schon so aussah, als wäre der Deal endlich besiegelt, vernahm sie ein zischendes Geräusch wie von einem wütenden Hornissenschwarm. Es schwoll bedrohlich an, bis es ihr in den Ohren vibrierte.
Aufs Höchste beunruhigt, flog ihr Blick über die Menge. Der Protest kam aus der Gruppe junger Hitzköpfe, die schon den ganzen Tag aufsässige Bemerkungen gemacht hatten, aber bisher immer von den Älteren beschwichtigt worden waren. Jetzt wurden die Zwischenrufe lauter und bösartiger, und die Unterhäuptlinge schafften es nicht, die Unruhestifter in den Griff zu bekommen. Schließlich erhob sich der älteste Clan-Häuptling, eine imposante Erscheinung in voller Stammestracht. Stirnband und Brustpanzer waren aus prachtvollem Leopardenfell, und von der Hüfte schwangen buschige Ginsterkatzenschwänze. Er streckte das Kinn vor und starrte mit blutunterlaufenen Augen schweigend auf die Aufrührer.
»Thula!«, donnerte er plötzlich in einer Lautstärke, dass Alice vor Schreck zusammenfuhr.
Der Hornissenschwarm verstummte sofort, und am Ende wurde Pierres Ausdauer belohnt. Nachdem die Beteiligung der Clans an den Einkünften der Ferienanlage bis ins Letzte festgelegt worden war, signalisierten die Chefs ihre Zustimmung.
Pierre wischte sich verstohlen den Schweiß von der Stirn. »Mann, die sind ja härter als eine Horde Anwälte«, flüsterte er ihr zu. »Entweder wir unterschreiben das, oder die Ferienanlage kann nicht gebaut werden. Wir haben keine Wahl. Unsere Anwälte werden die Verträge aufsetzen, und die Rechtsverdreher der Familien prüfen sie. Sobald sie das Okay geben, ist die Kuh vom Eis.«
Nach einigem Hin und Her unterschrieben die Clan-Chefs, die Banken drehten den Geldhahn auf, und die Architekten entwarfen die Pläne. Alles lief so, wie es vorgesehen war, und Alice hatte aufgeatmet. Nun hing alles davon ab, wie viele Leute die Bungalows kaufen würden, und deswegen war diese Party so ungeheuer wichtig. Schließlich sollte ihnen das Einkommen, das sie sich vom Verkauf der Ferienwohnungen und dem Betrieb der Anlage erhofften, im Alter ein komfortables Leben garantieren.
Und dieser Zeitpunkt rückte unerbittlich näher. Pierre würde dieses Jahr seinen sechzigsten Geburtstag feiern, was er geflissentlich ignorierte. Inzwischen war aus dem einst dichten Haarschopf ein sonnengebräunter, glatt rasierter Schädel geworden, die Stirn hatte sich in deutliche Querfalten gelegt, und die dunklen Augen waren von einem Kranz feiner Fältchen umgeben. Jahrelanges Tennis- und Squashspielen hatten ihm einen schlimmen Knorpelschaden im rechten Knie beschert, und wenn er ausnahmsweise zu Hause am Herd stand, meldete sich sein Rücken. Aber sein Grinsen war frech wie bei ihrer ersten Begegnung, das Funkeln in den Augen ungetrübt, und noch immer bestand er darauf, ab und zu auf den wilden Wellen des Indischen Ozeans zu surfen. Mit umgeschnalltem Kniestabilisator.
Alice war fünf Jahre jünger. Ihre Knie waren noch in Ordnung, ihr Haar, das sich in der feuchten Seeluft kräftig lockte, glänzte unverändert und ungefärbt in warmem Goldbraun. Ihr Alter war für sie nur noch eine Zahl, und sie fühlte sich fit und gesund. Meistens jedenfalls. Die kleinen Hinweise wie häufige Rückenschmerzen, die nachlassende Elastizität des Bindegewebes, das ihr deutlich machte, dass auch sie nicht mehr wirklich jung war, konnte sie noch ignorieren. Aber auch sie vermied es, viel über die Zukunft nachzudenken.
Neben ihrem Kopfkissen ertönte ein Pfiff, laut, frech und herausfordernd, so wie Männer einer schönen Frau hinterherpfiffen. Alice lächelte und setzte sich auf. Es war das Erkennungssignal, dass ihr Pierre eine Nachricht aufs Handy geschickt hatte. Bei Sonnenaufgang ging er joggen, egal, wo er war und welches Wetter herrschte, und immer wenn er unterwegs war, schickte er ihr ein paar Worte. Sie öffnete die Nachricht, und selbst nach zweiunddreißig Jahren hüpfte ihr Herz, als sie seine Liebeserklärung und das Versprechen las, dass er allerspätestens um halb vier wieder zu Hause sein werde. Seine Ansprache an die Investoren wollte er auf dem Rückflug noch einmal durchgehen. Ihr momentaner Verdruss über ihn war vergessen. Mit fliegenden Fingern tippte sie ihre Antwort, nahm ein Selfie auf – mit Kussmund –, lud es hoch und schickte beides weg.
Mit geübtem Griff deaktivierte Alice den elektronischen Alarm neben ihrem Bett, der den Zugang zu ihrem Schlafzimmer schützte, und schwang die Beine auf den Boden. Dabei achtete sie darauf, den knallrot lackierten Panikknopf nicht zu berühren, der auf beiden Seiten ihres Doppelbetts angebracht war und den Notruf in der Zentrale des eigens für ihre Straße zuständigen Sicherheitsdienstes auslösen würde. Einmal war ihr das versehentlich passiert, und wenige Minuten später waren Wachmänner mit gezogenen Waffen in ihr Haus gestürmt und hatten sie fast zu Tode erschreckt.
Schon früher, als er für den Mutterkonzern der Hotelkette, für die er eines der schönsten Hotels nördlich von Durban managte, häufig geschäftlich verreisen musste und sie mit Hausmädchen und Gärtner allein zu Hause war, hatte Pierre sie bekniet, einer Alarmanlage zuzustimmen. Sie hatte keine Angst gehabt und das als überflüssige Ausgabe angesehen, aber Pierre hatte sich große Sorgen gemacht.
Doch schon im ersten halben Jahr, nachdem sie nach Umhlanga Rocks gezogen waren, passierte es. Obwohl die Hotelleitung ihr, wie immer wenn Pierre abwesend war, einen bewaffneten Nachtwächter gestellt hatte und sie ihren Hausangestellten grundsätzlich nie sagte, wann sie allein im Haus sein werde, musste es jemand erfahren haben.
Am selben Abend betraten drei maskierte Männer das Grundstück, stachen den Nachtwächter nieder, drangen ins Haus ein und fesselten sie auf einen Küchenstuhl. Sie schlugen ihr brutal ins Gesicht. Einer der Männer setzte ihr ein Messer an den Hals und schrie sie an, wo Geld und Wertsachen aufbewahrt seien. Alice gehorchte sofort. Es wäre Selbstmord gewesen, die Befehle dieser Kerle nicht zu befolgen.
Irgendwann verschwanden die Angreifer mit reicher Beute in die Nacht und ließen sie geknebelt und fest verschnürt wie ein Paket zurück. Es gelang ihr zwar, das Tuch, das man ihr in den Mund gestopft hatte, mit der Zunge etwas zu lockern, aber Schreien war sinnlos. Es war Donnerstag, und sie war ganz allein im Haus. Das Hausmädchen und der Gärtner hatten frei, wie es für Hausangestellte in Südafrika an diesem Wochentag Tradition war. Das nächste Nachbarhaus war zu weit entfernt, und das Brandungsrauschen des Indischen Ozeans, vom kräftigen Wind übers Land getrieben, verschluckte praktisch alle Geräusche.
Erst nach Mitternacht kam ihr Hausmädchen zurück und ging singend am Küchenfenster vorbei. Alice schrie, dass sie glaubte, ihr würde der Kopf platzen. Es dauerte für sie unerträglich lange, ehe die Zulu ihre durch den Knebel gedämpften Schreie hörte und sie befreite. Alice rief die Polizei und anschließend Pierre an. Der war zutiefst besorgt, aber sie konnte ihn beruhigen. Außer Hautabschürfungen und Blutergüssen, die von den Schlägen herrührten, hatte sie keine weiteren Verletzungen erlitten.
Am nächsten Tag erschien der Gärtner nicht wieder, und die Polizei vermutete, dass er entweder selbst einer der Einbrecher gewesen war oder der Informant.
»Die verkaufen ihre Tipps an Gangster, aber so genau bekommt man das meistens nicht heraus«, erklärte ihr einer der Polizisten. »Lassen Sie sich immer Referenzen zeigen, bevor Sie jemanden einstellen.«
Alice hatte nicht darauf geantwortet. Die Referenzen des Gärtners und auch des Hausmädchens waren überzeugend gewesen. Korrektes Englisch, ohne Fehler. Also hatte sie angenommen, dass die tatsächlich von früheren Arbeitgebern stammten.
Pierre war am Abend von seiner Reise mit einem äußerst lebhaften, pechschwarzen Dobermannwelpen zurückgekehrt, der als Erstes seine nadelspitzen Zähne in ihre Waden versenkte, sich danach die Wohnzimmergardine schnappte und sie vergnügt knurrend zerfetzte. Als nächsten Zeitvertreib jagte er das kreischende Hausmädchen durchs Haus. Die Zulu kündigte auf der Stelle. Alice taufte den Welpen wie seine drei Vorgänger auf den Namen Pollux, und wie sie sollte er sich als erwachsener Hund als ein hervorragender Schutz für die Familie herausstellen.
Pierre und auch ihr Arzt sorgten sich, dass sie von dem Überfall einen seelischen Knacks davongetragen haben könnte, aber Alice schüttelte das Erlebnis mit überraschender Leichtigkeit ab. »Mir ist ja nichts passiert, und wir sind doch gut versichert«, hatte sie Pierre beruhigt.
Tough Cookie, sagte jetzt eine Stimme in ihrem Kopf.
Tita Robertson, eine ihrer besten und ältesten Freundinnen, hatte sie einmal so genannt.
»Hart im Nehmen«, hatte Pierre dazu gesagt. »Sie hat Nerven wie Drahtseile, meine Alice.«
Seine Stimme war voller Bewunderung gewesen, und das hatte ihr geschmeichelt.
Gedankenverloren öffnete sie ihren Kleiderschrank und nahm frische Unterwäsche heraus. Von wegen Tough Cookie! Wenn es bedeutete, dass sie in prekären Situationen die Nerven behielt und ihr Gesichtsausdruck nichts von dem verriet, was in ihr vorging, dann traf das größtenteils zu. Das hatte sie sich in den Jahren der Apartheid antrainiert, als der Geheimdienst hinter ihnen her gewesen war, sie auf Schritt und Tritt bespitzelt wurden und sie selbst einmal vier unbeschreiblich grauenvolle Tage im Gefängnis zugebracht hatte. Das metallene Geräusch, mit dem die Zellentür hinter ihr zugekracht war, das Gefühl des bedingungslosen Ausgeliefertseins, der totalen Hilflosigkeit, verfolgten sie bis heute.
Bevor sie sich dagegen wappnen konnte, überfiel sie ein Flashback, der genügte, dass ihr schlagartig schlecht wurde. Die Unterwäsche fiel auf den Boden, und mit vor den Mund gepresster Hand rannte sie ins Badezimmer. Übers Waschbecken gebeugt, an den Bildern von damals würgend, die ihr wie faustgroße Brocken im Hals steckten, schaufelte sie sich kaltes Wasser ins Gesicht. Den Kopf gesenkt, die Augen geschlossen, kämpfte sie gegen die Dämonen der Vergangenheit an und zwang ihr rasendes Herz zur Ruhe.
Nach ein paar Minuten war der Spuk vorüber. Sie öffnete die Flügel des schwer vergitterten Badezimmerfensters und trank die erfrischende Meeresluft in großen Schlucken, bis die schrecklichen Bilder verblassten. Sie rieb das Gesicht trocken und betrachtete sich kritisch im Spiegel. Heute Abend musste sie strahlend aussehen. Um die Augenpartie herum zeigten sich unerfreuliche Knitterfalten. Mit dem Finger fuhr sie die Konturen nach. Sie war sich sicher, dass durch den Stress der letzten Tage wieder einige dazugekommen waren. Genervt wandte sie sich ab.
Nachdem sie geduscht und Zähne geputzt hatte, warf sie ein weißes Strandhemd über und ging zurück ins Schlafzimmer. Behutsam schob sie die Gardinen vor der Terrassentür ein paar Zentimeter auseinander und blinzelte durch den Spalt hinaus. Gazefeiner Morgennebel schimmerte wie Goldgespinst über dem Indischen Ozean, der sich ruhig atmend bis in die Unendlichkeit erstreckte. Der Himmel begann rosig zu glühen, ein Strahlen erfüllte die Welt, und alle Spannung fiel von ihr ab. Dieser Augenblick verzauberte sie jeden Morgen aufs Neue. Aber heute hatte sie wenig Zeit, das Wunder des werdenden Tages zu genießen, und sie zog die Gardinen vollständig zurück, widerwillig, weil sie wusste, welcher Anblick auf sie wartete.
Massive Riegel sicherten die Tür, und die fingerdicken Streben des soliden Metallgitters, das über die gesamte Breite der Balkontür reichte, blinkten stählern im Morgenlicht. Brutal zerschnitten sie den glühenden Himmel in scharfkantige Stücke und warfen das Schattenbild des Gitters über den Boden und ihr Bett.
Die krasse südafrikanische Realität starrte ihr ins Gesicht.
Eine Gänsehaut lief ihr über den Rücken. Jeden Morgen war es das Gleiche. Erst dieses unirdisch schöne Naturschauspiel über dem Ozean, dann die pechschwarze Wirklichkeit dieses herrlichen Landes. Und jeden Morgen bereute sie es, dass sie sich dieses Haus in den Hang über dem Indischen Ozean gebaut hatten und nicht ein Apartment in einem der neuen Hochhäuser am Strand bewohnten. Mindestens im zehnten Stock oder noch höher, um wirklich sicher zu sein. Streifte sie dann jedoch durch ihren blühenden, duftenden Garten, der in der subtropischen Wärme KwaZulu-Natals in üppiger Verschwendung gedieh, wollte sie mit niemandem tauschen.
Entschlossen schüttelte Alice das unbehagliche Gefühl ab, stellte den Türalarm aus und lief hinunter in die Küche, um sich in Windeseile ihren morgendlichen Espresso zu machen. Ein Blick aus dem Panoramafenster ihres Wohnzimmers übers Meer sagte ihr, dass der Sonnenaufgang unmittelbar bevorstand. Das Licht veränderte sich jetzt schnell, und der Horizont trug schon einen Feuerkranz. Gerade noch genug Zeit, den Kaffee zu machen, entschied sie. Sie wandte sich der Maschine zu und wollte eben den Knopf drücken, als sie einen Laut vernahm. Sie zog den Finger zurück und lauschte.
Das Geräusch war so leise gewesen, dass sie es praktisch nur im Unterbewusstsein wahrgenommen hatte, und sie hätte es auch überhört, wenn es in diesem Augenblick nicht sonst so absolut still gewesen wäre. Manchmal passierte das. Der Ozean atmete ein, die Wellen fielen in sich zusammen, der Wind, der eben noch durch die Palmwedel geraschelt war, schwieg. Heute waren selbst die Affen, die sich lautstark auf dem unbebauten Nachbargrundstück gezankt hatten, unvermittelt verstummt. Und jetzt vernahm sie es wieder. Kein Schaben oder Kratzen. Die Worte allein waren schon zu laut. Es war nur ein Hauch, so als würde ein Papier vom Wind geblasen über den Fliesenboden gleiten.
Aber sie lebte in Afrika, seit vielen Jahren schon, und sie wusste es besser. Sehr langsam, Zentimeter um Zentimeter, drehte sie sich um.
Sie war kohlschwarz, armdick und stand hoch aufgerichtet und heftig züngelnd nicht einmal einen Meter von ihr entfernt. Die Haube war zu voller Größe gebläht, das gelblich weiße Band um den Hals unverwechselbar. Eine Spuckkobra. Eine Rinkhals, die noch aus zwei Meter Entfernung ihr Gift präzise in die Augen eines Angreifers sprühen konnte, und diese war ihr nahe genug, sich mit einem tödlichen Biss zu wehren.
Alice rührte keinen Muskel, ihr Herz schlug hart. Schlangen sahen schlecht, das wusste sie, und waren außerdem taub, nur imstande, mit der Zunge Duftstoffe aufzunehmen, um so ihre Beute zu finden. Alice bewegte ihre Augen – nur ihre Augen – auf der Suche nach einer Waffe, aber in ihrer unmittelbaren Umgebung fand sie nichts, was sie benutzen konnte. Also konzentrierte sie sich darauf, einen Weg zu finden, wie sie sich aus der Reichweite der Schlange zurückziehen konnte, ohne dass diese eine Gelegenheit bekam zuzuschlagen. Aber die Rinkhals fixierte sie unverwandt und schwang den Leib dabei sanft hin und her, und Alice war sich klar, dass jede Bewegung ihrerseits das Reptil zum Angriff reizen würde.
»Stillstehen!«, befahl plötzlich eine tiefe Stimme hinter ihr.
Alice zuckte zusammen, und die Rinkhalskobra reagierte sofort mit einem aggressiven Zischen. Mühsam entspannte sie ihre zitternden Muskeln. Ihr Atem ging allerdings so heftig, dass sie befürchtete, die Kobra könnte die Bewegung ihrer Brust wahrnehmen. Sie atmete sehr langsam tief ein und hielt die Luft an, um sie dann schluckweise herauszulassen. Gleichzeitig fragte sie sich, wie jemand ungesehen auf die Küchenterrasse gelangen konnte, obwohl ihr Grundstück bewacht wurde.
Ntombi, ihre Haushaltshilfe? Aber dazu war die Stimme zu männlich gewesen. Der Gärtner? Ob ein Weißer oder Schwarzer gesprochen hatte, konnte sie im Nachhinein nicht ausmachen. »Shongololo?«, rief sie ihn mit steifen Lippen.
Es kam keine Antwort. Dann krachte der nächste Brecher auf den Strand, die Affen kreischten, Pollux tobte im Hof, und sie war sich sicher, dass ihre Fantasie ihr einen Streich gespielt hatte, als eine undeutliche Bewegung ihren Blick auf die Glastür lenkte, die von der Küche auf die Terrasse führte.
Ihr eigenes Spiegelbild stand vor ihr, die aufgerichtete Schlange, und dann plötzlich entdeckte sie hinter ihrem Spiegelbild den Schemen eines Mannes. Wie er gekleidet war, konnte sie so schnell nicht erkennen, aber er trug eine blaue Baseballkappe, dessen war sie sich sicher. Unwillkürlich wendete sie den Kopf nach ihm um, worauf die Kobra blitzschnell in einem Scheinangriff zuschlug. Alice erstarrte.
»Nicht umdrehen!«, befahl der Mann mit der tiefen Stimme. »Nicht bewegen!«
Und im selben Moment flog ein silbern blitzendes Messer durchdie Luft, es gab ein merkwürdig schmatzendes Geräusch, das Messer klirrte auf die Fliesen, und der Kopf der Schlange rollte ihr vor die Füße. Der Leib der kopflosen Kobra stand noch für einen Augenblick aufrecht, aus dem Hals schoss Blut, dann wand sich das tote Reptil in Zuckungen über den Boden auf sie zu. Alice sprang zurück und wirbelte gleichzeitig herum, um zu sehen, wer der Messerwerfer war.
Wie ein Negativ stand das Bild des Mannes, das sie im Spiegel gesehen hatte, vor ihrem inneren Auge, aber außer ihr befand sich jetzt niemand mehr in der Küche. Auch die Terrasse war leer. Schwer atmend bändigte sie ihre unkontrolliert rasenden Gedanken. Schließlich hatte sie sich so weit beruhigt, dass sie imstande war, eine Gartenforke aus dem Geräteschuppen zu holen, die tote Schlange aufzuspießen und in eine Plastiktüte zu stecken. Sie verknotete die Tüte und rief anschließend Ntombi. Die Zulu erschien, sah die Blutlache auf dem Boden und blickte sie entsetzt an. »Madam!«, rief sie. »Haben Sie sich geschnitten?«
Alice erklärte ihr, was geschehen sei, und wies sie an, die Tüte mit der Schlange in den Mülleimer auf dem Hof zu werfen und dann die Fliesen gründlich zu wischen. Ntombi wich mit allen Anzeichen von Panik zurück. »Die Schlange ist tot, sie beißt nicht mehr! Sie steckt hier in dieser verknoteten Tüte.« Ntombi aber schüttelte nur den Kopf und rannte aus der Küche. Ungeduldig brachte Alice die Tüte mit der toten Kobra selbst in den Hof und rief dann Ntombi zurück. Hastig und furchtsame Blicke um sich werfend, führte die Zulu ihre Anweisung, den Boden zu wischen, schließlich aus.
Alice trat an das große Küchenfenster und schob mit zwei Fingern die Lamellen der Sonnenjalousie auseinander, automatisch darauf bedacht, dass sie von der Straße aus nicht zu sehen war, und hielt Ausschau nach dem Schlangentöter.
Blendende Morgensonne strömte herein, und es dauerte einige Augenblicke, ehe sich die tanzenden Lichtpunkte vor ihren Augen verzogen hatten und sie den Mann entdeckte, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite herumlungerte. Ihr Haus lag in einer verschlafenen, von ausladenden Flammenbäumen beschützten Villengegend, in die sich für gewöhnlich niemand verirrte, der nicht dort hingehörte. Alarmiert sah sie genauer hin.
Seiner Hautfarbe nach zu urteilen, war er Afrikaner, etwas mehr als mittelgroß und kräftig gebaut. Er trug Jeans, ein unauffälliges graues T-Shirt und eine blaue Baseballkappe, unter der sich sein kurzes, stumpf schwarzes Haar hervorkräuselte. Mehr konnte sie nicht erkennen. Sie schätzte ihn auf Ende zwanzig, obwohl ihr die Einschätzung des Alters bei Schwarzen immer schwerfiel. Meist erschienen sie ihr deutlich jünger, als sie es tatsächlich waren.
Der Mann hockte angelehnt an einem Baumstamm, kaute offensichtlich gelangweilt auf einem Grashalm, kratzte sich und blinzelte schläfrig in die Sonne. War er es, der sie vor der Kobra gerettet hatte? Und wenn ja – warum hatte er das getan? Afrikaner fürchteten sich meistens vor Schlangen. Und was hatte er überhaupt in ihrem Haus zu suchen gehabt? Sie ließ ihn nicht aus den Augen.
Auf einmal, urplötzlich, hörte der Mann zu kauen auf, und sein Blick glitt unter dem Mützenschirm blitzschnell über die Fassade ihres Hauses, vom Küchenfenster zum Vorgarten, ehe er den Kopf senkte und wieder in reptilienhafte Reglosigkeit verfiel. Er hatte keinerlei Anzeichen gezeigt, dass er sie gesehen hatte, trotzdem war sie sich dessen sicher. Ihr war sofort klar, dass dieser Mann nicht nur die Zeit totschlug. Er beobachtete ihr Haus, mit Sicherheit. Aber warum? Plante er einen Einbruch?
Erst ein paar Wochen zuvor war eine Familie in ihrer Straße von vier Gangstern überfallen worden. Die zwei kleinen Kinder hatten sie mit Klebeband umwickelt und nur die Nase frei gelassen. Das Ehepaar fesselten sie auf eine andere brutale Art. Auf dem Bauch liegend, wurde ihnen ein Strick um den Hals geschlungen und mit den angewinkelten Beine vertäut. Darauf durchwühlte die Gang das Haus, fand aber wohl nicht das, was sie erwartet hatte. Das machte sie wütend. Sie vergewaltigten die Frau vor den Augen ihres Mannes, einer nach dem anderen. Der Mann erdrosselte sich fast selbst, so sehr versuchte er frei zu kommen, um seiner Frau zu helfen. Aufgeputscht gerieten die Verbrecher offenbar in einen Blutrausch und folterten das Ehepaar, bis der Mann seinen schweren Verletzungen erlag. Danach verwüsteten sie das Haus und flüchteten in dem Mercedes des Ehepaares. Der Wagen war einen Monat später gefunden worden, ausgeschlachtet und ohne Reifen, die Täter wurden nie gefasst. Die Frau war darauf mit ihren Kindern nach Australien ausgewandert.
Seitdem hatten sich alle Nachbarn zusammengetan und einen Sicherheitsdienst beauftragt, der die Häuser vierundzwanzig Stunden am Tag überwachte. Alice fragte sich, ob diese Typen gerade einen Mittagsschlaf hielten, anstatt das zu tun, wofür sie gut bezahlt wurden. Angespannt suchte sie die Straße ab, und dann entdeckte sie einen zweiten Mann, einen großen, muskelbepackten Kerl, der, die Hände unter dem Kopf gefaltet, auf dem unbebauten Grundstück zwei Häuser weiter im Gras lag, aber nicht etwa schlief, wie deutlich an seinem Blick zu erkennen war.
Alice sah genauer hin, und plötzlich war sie sich sicher, dass sie diesen beiden Männern schon an anderen Orten begegnet war. Ihre Art, sich zu bewegen, die Kopfhaltung und ihre absolute Körperbeherrschung kamen ihr bekannt vor. Für gewöhnlich vollführten fast alle Menschen ständig unbewusste, meist ziellose Bewegungen. Nicht diese Männer, und je länger sie hinsah, desto überzeugter war sie, dass es dieselben waren, die sie in letzter Zeit beunruhigend oft – zu zweit oder auch allein – in ihrer Nähe entdeckt hatte. Eine Tatsache, die sie in ihrer Hetze, die Party vorzubereiten, offenbar nicht registriert hatte.
Aber nun beobachteten sie ohne Zweifel ihr Haus, beobachteten sie. Oder Pierre? Oder sie beide? Ein eiskaltes Gefühl packte sie im Genick. Diese Situation hatte sie schon erlebt. Déjà-vu, schon einmal gesehen, hieß das im Französischen. Einmal gesehen, viel zu oft gesehen.
Damals, Ende der Achtziger bis hin zu dem Tag, als Nelson Mandela zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas vereidigt wurde, waren sie und Pierre vom BOSS, dem Bureau of State Security, dem gefürchteten Geheimdienst Südafrikas, auf Schritt und Tritt verfolgt und beobachtet worden. Das BOSS hatte ihr Telefon abgehört, ihre Post geöffnet und ihre Bankkonten überwacht. Wochenlang hatte ein staubiges, beigefarbenes Auto mit zwei Männern keine dreißig Meter von ihrem Haus entfernt geparkt. Sie hatten sich nicht einmal Mühe gegeben, nicht entdeckt zu werden. Im Gegenteil, sie hatten sie provokativ angegrinst, wenn sie mitbekamen, dass sie zu ihnen hinüberschaute, und ihr zugewinkt, wenn sie das Haus verließ.
Bald hatte Alice sich in einer Art permanenter Hochspannung befunden, kaum noch geschlafen und die entsetzlichsten Dinge geträumt. Tagsüber hatte Pierre arbeiten müssen, und sie hatte sich gefürchtet, einerseits aus dem Haus zu gehen und andererseits allein zu bleiben. Und eines Tages hatten sie an ihre Tür gehämmert, dieselben beiden Männer, die das Haus vom Auto aus beobachtet hatten, hatten sie festgenommen und ins Gefängnis gebracht. Ihr war nicht einmal erlaubt worden, Pierre oder ihren Anwalt anzurufen. Der Schock war gewaltig gewesen und hatte ein inneres Zittern hinterlassen, das bis heute nachschwang. Jedes Mal, wenn jemand an ihre Tür klopfte, jagte ihr Puls hoch, und Angst explodierte in ihrem Magen. Bis heute. Jahrzehnte nach dem Vorfall.
Alice schlang sich schützend die Arme um den Leib. War auch der Geheimdienst der jetzigen Regierung hinter ihnen her? Fing nach all diesen Jahren alles wieder von vorn an? Nicht für eine Sekunde gab sie sich der Illusion hin, dass alle die, die damals an der Macht gewesen waren, plötzlich bei der Wende über den Rand der Welt gefallen wären. Sie wusste, dass die Apartheidgeheimdienstler im Hintergrund immer noch die Fäden zogen.
Reiß dich zusammen, befahl sie sich. Es kann nicht sein!
Wie immer, wenn sie unter Stress stand, redete sie in Gedanken mit sich selbst. Es zügelte ihre ungebremst dahingaloppierende Fantasie und verschaffte ihr Luft zum Atmen. Weder Pierre noch sie hatten sich etwas zuschulden kommen lassen, genauso wenig wie damals. Aber damals hatte in Südafrika Bürgerkrieg geherrscht, und Recht und Gesetz waren ausgehebelt gewesen. Jede ihrer Aktionen, waren sie ihr und Pierre noch so harmlos erschienen, war gegen sie ausgelegt worden. Aber heute waren die anderen an der Macht, die, die damals gegen die Apartheid und für die Freiheit gekämpft hatten, und heute nannte man das Land die Regenbogennation.
Ohne ihren Blick von den Männern zu lassen, nahm Alice ihr Mobiltelefon vom Küchentisch, zog sich ein paar Schritte vom Fenster zurück und machte Fotos. In eineinhalb Stunden war sie mit Jill, Tita und Angelica in Umhlanga Rocks im Luigi’s verabredet. Sowohl Nils Rogge, Jills Mann, als auch Neil Robertson, Titas Mann, waren ehemalige Kriegsreporter und bekannte Journalisten. Wie Mick, der Sohn der Robertsons, der Rechtsanwalt war, unterhielten beide Kontakte, die wie ein kräftiges Wurzelgeflecht in alle Bereiche der Republik reichten. Wenn ihr jemand Informationen über diese Typen besorgen konnte, dann waren sie es.
Alice schoss zwei Bilder, aber beide waren ziemlich unscharf, wie sie gleich darauf feststellte. Als sie jedoch nach draußen sah und ein weiteres Foto machen wollte, waren die Männer wie vom Erdboden verschluckt. Im flirrenden Schatten der Flammenbäume lag ihre Straße wieder leer und friedlich da. Und das versetzte sie endgültig in Alarmbereitschaft. Sie stützte sich auf dem Küchentresen ab. Es ging also tatsächlich wieder los. Oder waren es doch nur Verbrecher, die auskundschafteten, ob es bei ihnen etwas zu holen gab? Keine Profis?
Ihre Gedanken sprangen wie wild hierhin und dorthin, panisch wie Antilopen, die von Raubkatzen gejagt wurden. Überfallartig wurde ihr schwindelig. Sie fiel auf die Knie, wartete mit gesenktem Kopf, bis die schwarzen Flecken vor den Augen verschwanden, und kroch dann zum Schrank neben dem Herd, wo sie einen Muskateller zum Kochen aufbewahrte. Sie nahm einen tiefen Zug aus der Flasche. Mit dem Handrücken wischte sie sich den Mund ab. Von wegen Tough Cookie, fuhr es ihr durch den Kopf. Früher hatte sie das nicht gebraucht. Muss am Alter liegen, dachte sie. Mitte fünfzig war man seelisch offenbar nicht mehr so widerstandsfähig wie mit zwanzig oder dreißig.
Krampfhaft bemühte sie sich, nicht an Vergangenes zu denken. Zu viele Verletzungen hatte ihr das Leben zugefügt, einige waren nie richtig vernarbt, und die geringste Erschütterung ließ sie wieder aufbrechen. Dann begann die Wunde erneut zu eitern, und es dauerte oft Wochen, ehe sich wieder Schorf gebildet hatte und die Schmerzen nachließen. Sie trank noch einen Schluck, ehe sie die Flasche zurückstellte. Der Alkohol tat schnell seine Wirkung, und sie zog sich am Küchentisch wieder hoch.
Aber kaum stand sie, traf sie ein verzögerter Schock mit voller Gewalt, und sie fiel wie ein Stein in ein bodenloses Loch. Über dreißig Jahre zurück in ihr früheres Leben.
Ihr knickten die Knie ein. Sie landete auf dem Fliesenboden, rollte sich zusammen und bettete den Kopf auf die Arme. Wie konnte es so weit kommen? Was passierte gerade mit ihr? Tränen sammelten sich in ihren Augenwinkeln.
Sie war so glücklich gewesen, hatte sich so federleicht gefühlt, als sie nach ihrer Hochzeit mit Pierre in Durban gelandet war. Wie ein Schmetterling, der sich aus dem engen Kokon befreit hatte, war sie hinaus in die Wärme, ins gleißende afrikanische Licht und ihr neues Leben getreten.
2
Alice’ eigentliches Leben begann am 7. Juni 1982 während eines sintflutartigen Gewitters von apokalyptischen Ausmaßen, zu Füßen der Eros-Statue im Zentrum von London. Geboren war sie als Alice Lauritzen am 29. Juni dreiundzwanzig Jahre zuvor in Lübeck, und bisher war sie noch nie weiter als bis nach Bayern zu der Schwester ihrer Mutter gereist, wenn man von der kurzen Zugreise mit ihrer besten Freundin nach St. Tropez absah.
Ihr Abitur hatte sie mit einer mäßigen Note bestanden. Sie studierte Englisch und Kunstgeschichte und absolvierte parallel dazu eine Ausbildung als Gemälderestauratorin im Museum bei Fabrizio Fortini, einem temperamentvollen älteren Italiener.
In ihrer Freizeit streifte sie an Regentagen durch die Museen und Kunstgalerien. Schien die Sonne, fotografierte sie entweder die Lichtreflexionen auf Regenpfützen oder Pflanzen mit einer Makrolinse, die sie sich zusammengespart hatte. Die finanzielle Unterstützung, die sie von ihren Eltern bekam, reichte nur für das Nötigste.
»Ich könnte dir mehr geben, aber du musst lernen, mit Geld umzugehen«, hatte ihr Vater ihr kühl beschieden.
Um nicht immer in denselben Kleidern herumlaufen zu müssen, brachte Alice sich mithilfe der Schneiderin ihrer Mutter das Nähen bei. Abends traf sie sich mit Freunden, entweder zu Hause oder im Dr.-Jazz-Bunker an der Untertrave, und sonst gab es in ihrer großen Familie immer irgendeine Feier, zu der alle zusammenkamen und Neuigkeiten austauschten. Einige ältere Tanten hatten für Geheimnisse eine untrügliche Nase entwickelt und trabten wie Trüffelschweine zwischen ihren Verwandten umher, um alles zutage zu fördern, was andere verheimlichen wollten. Sie wurden immer fündig. Und so wurden Familienfehden am Leben erhalten, belanglose Begebenheiten aufgebauscht, gnadenlos über jeden gelästert und immer dieselben Geschichten erzählt. Hier wurde ein Schnörkel hinzugefügt und dort ein unbequemes Detail weggelassen, bis sie sich über die Jahre zu schillernden Seifenblasen aufblähten. Die Jüngeren ertränkten ihren Frust in der süßen Bowle, die es mit unerschütterlicher Regelmäßigkeit gab. Das Rezept stammte von einer der Großmütter, und niemand dachte je daran, es zu ändern.
Das Leben floss dahin wie ein träger Strom, ein Tag reihte sich an den anderen, konturlos verschwammen sie ineinander. Alice wurde, ohne dass es ihr anfänglich bewusst wurde, immer unzufriedener. Sie färbte ihr dickes, goldbraunes Haar leuchtend rot, was ihr Entsetzensschreie seitens ihrer Eltern und Getuschel in der Familie einbrachte, aber ihre Tage auch nicht interessanter machte. Darauf färbte sie ihre Mähne schwarz. Das wirkte zu ihren blaugrünen Augen zwar sehr exotisch, aber das Ergebnis war das Gleiche. Sie ließ die Farbe wieder herauswachsen, und mit jedem Zentimeter wuchs ihre Frustration.
In Lübeck, wo ihr Elternhaus in einer ruhigen Nebenstraße am östlichen Ufer der Wakenitz stand, kannte in ihren Kreisen jeder praktisch jeden. Im Vergleich zu Hamburg war die Stadt von überschaubarer Größe, und es gelang ihr nie, den scharfen Augen ihrer zahlreichen Verwandten, Freunde und Bekannten zu entkommen. Hatte sie sich mit einem neuen Freund im Schutz der Dunkelheit auf einer Parkbank geküsst, wusste es bereits am nächsten Morgen ihre Mutter und kurz darauf der Rest der Familie, die sie – und ihren neuen Freund – mit anzüglich neugierigen Blicken und Bemerkungen bedachte, was zur Folge hatte, dass der Betreffende sich meist schnell wieder zurückzog.
Alice erstickte fast an den altüberlieferten Konventionen und überholten Moralvorstellungen und lebte, so kam es ihr vor, in einem Käfig mit unsichtbaren Stäben und keiner Möglichkeit, in die Freiheit zu gelangen.
Doch an diesem einen Tag im Juni 1982 drehte sich ihr Leben um hundertachtzig Grad. Ein hingeworfener Satz ihres Vaters, der kürzlich an einem Bandscheibenvorfall operiert worden war und immer noch starke Schmerzen hatte, führte zu einem Streit, der für Stunden hin und her wogte und von Minute zu Minute immer unerträglicher wurde.
»Hoffentlich heiratest du bald«, hatte er beim Frühstück bemerkt. »Ich brauche einen Nachfolger im Geschäft.«
Diese diskriminierende Bemerkung traf sie wie ein Schlag, obwohl ihr allein die Vorstellung, ihre Tage in der Familienfirma zu verbringen, Angstschauer über den Rücken jagte. Sie explodierte und schrie ihn an, dass er antiquiert und chauvinistisch sei. Ihr Vater brüllte zurück und hob die Hand, als wollte er sie schlagen, wie er es früher so oft getan hatte. Ins Gesicht, auf den Rücken – wo immer er sie treffen konnte.
Sie sah ihm starr in die Augen. »Wag es ja nicht«, flüsterte sie und dehnte jedes Wort.
Seine Hand hing für ein paar Sekunden in der Luft, schließlich ballte er sie zur Faust und ließ den Arm sinken.
Ihre Mutter brach in Tränen aus. »Kind, Kind«, schluchzte sie händeringend. »Musst du denn immer so grässlich ehrlich sein?«
»Seit wann ist ehrlich ein Schimpfwort?«, schrie Alice und stürzte aus dem Zimmer in den Keller hinunter, obwohl sie schon immer eine unerklärliche Angst vor Kellerräumen gehabt hatte. Dort schnappte sie sich ihren kleinen, abgewetzten Koffer. Nachdem sie das Nötigste gepackt hatte, zog sie ihre neue Schlaghose und einen leichten Pullover an. Dann rannte sie fluchtartig aus dem Haus zu ihrer Bank und plünderte ihr mageres Konto. Anschließend meldete sie sich beim Museum und ihrem Lehrmeister Fortini krank und trampte zum Hamburger Flughafen. Sie war noch nie geflogen und sehr aufgeregt, als sie ziemlich schnell ein billiges Ticket nach London ergatterte. Seit Jahren hatte sie davon geträumt, einmal über die Carnaby Street zu bummeln und den Geist der Swinging Sixties zu spüren.
Das Flugzeug trug sie hinauf ins grenzenlose Blau, und Alice blickte stumm hinaus und ließ ihr bisheriges Leben hinter sich. Aufgeregt landete sie in Englands Hauptstadt und fuhr von Gatwick aus sofort mit dem Bus ins Zentrum. Aber immer noch war sie so aufgewühlt, dass alle ihre Gedanken um den Streit mit ihren Eltern kreisten.
Ziellos lief sie den ganzen Tag lang durch die Straßen des Molochs London, zum Schluss barfuß, weil sich an ihren Fersen markstückgroße Blasen gebildet hatten und ihre geschwollenen Füße nicht mehr in die Schuhe passten. Gegen Abend waren ihre Beinmuskeln vor Überanstrengung völlig verkrampft, und sie konnte kaum noch einen Schritt vor den anderen setzen. Sie humpelte auf den Piccadilly Circus, legte sich ausgehungert und müde dem geflügelten Eros zu Füßen und schloss die Augen. Allmählich entspannte sie sich, das Verkehrsrauschen entfernte sich, und sie glitt unversehens in einen leichten Schlaf.
Ein eiskalter Tropfen, der ihr auf die Nase fiel und über die Wange glitt, weckte sie auf. Sie schoss hoch. Vor ihrem Gesicht schwebte eine Hand, die eine Eiswaffel hielt. Es war eine kräftige, sonnenbraune Männerhand. Wieder tropfte flüssiges Eis auf ihr Gesicht. Empört hob sie den Kopf.
Bis dahin hatte sie den Ausdruck »Liebe auf den ersten Blick« für Unsinn gehalten. Ihrer Meinung nach war es unmöglich, sich innerhalb eines Augenblicks in einen wildfremden Menschen zu verlieben. Aber es war so. Wie ein Blitzschlag. Liebe auf den allerersten Blick. Ihr wurde heiß und kalt und schwindelig, und das Eis schmolz auf der Denkmalsstufe unbeachtet zu einem rosa Eiscremesee. Wie hypnotisiert starrte sie den Mann vor ihr an.
Eine verwaschene Jeansjacke lässig über die breiten Schultern geworfen, dunkles, dichtes Haar bis tief in den Nacken, kräftiges Kinn, unverschämtes Grinsen. Und schwarze Augen, die sie amüsiert anfunkelten. Ihr Herz stolperte. Doch als ein unterschwelliges Grollen die Luft erschütterte und sie unversehens aus der Verzauberung riss, erschien ihr das wie eine Warnung der Götter.
Finger weg, hörte sie ihre innere Stimme sagen. Der weiß, wie gut er aussieht. Der ist Marke eingebildeter Schnösel.
»Sie wirken, als könnten Sie eine Erfrischung gebrauchen«, unterbrach der Mann ihre Gedanken. »Die hier hat sich leider verflüssigt. Wie wär’s mit einem Kaffee? Und Kuchen? Ich kenne da ein nettes, kleines Café …« Er sprach Englisch mit einem Akzent, den sie nicht einordnen konnte.
Die Vision von dampfendem Kaffee und einem großen Stück Sahnetorte tanzte Alice vor Augen, und ihr Magen knurrte vernehmlich. Ihre mahnende innere Stimme wurde zu einem kläglichen Fiepen im Hintergrund. Aber sie widerstand der Versuchung. »Nein danke.« Tapfer lächelnd ignorierte sie seine hingestreckte Hand und stand auf. Sie nahm ihre Ballerinas, zog den Träger ihrer Tasche über die Schulter und machte sich daran, barfuß über die Stufen hinabzuhumpeln. Ihre Füße schmerzten höllisch, was sie aber ertrug, ohne eine Miene zu verziehen.
Der Mann verschränkte die Arme vor der Brust und blickte spöttisch auf sie hinunter. »Ich kann hören, wie Ihr Magen knurrt«, sagte er und grinste frech.
Ohne Zweifel, das tat er. Unüberhörbar. Alice spannte die Bauchmuskeln an, um dieses peinliche Geräusch zu stoppen, was aber keinerlei Wirkung zeigte. Vor Verlegenheit glühend, stolperte sie weiter. Durch eine ungeschickte Bewegung rutschte ihr die schwere Tasche von der Schulter auf die Treppe, der Inhalt kippte hinaus, sie strauchelte und wäre die letzte Stufe hinuntergefallen, hätte der Mann nicht blitzschnell zugegriffen und sie aufgefangen.
»Hoppla«, rief er. »Immer schön langsam.«
»Danke«, sagte sie mit steifen Lippen und wand sich aus seinem festen Griff, ärgerte sich dabei über sich selbst, dass sie trotz der Schrecksekunde aufmerksam registriert hatte, wie schön trocken und warm seine Hände waren. Wie angenehm sein Geruch. Und dass er keinen Ring am Ringfinger trug.
Welch blödes Klischee, verspottete sie sich. Heldin wird von Held aus großer Gefahr gerettet. Heldin sinkt Helden dankbar an die Brust, sie heiraten und leben glücklich bis an ihr Lebensende. »Ganz bestimmt nicht«, fuhr sie ihn an.
Der Mann bedachte sie im ersten Augenblick mit einem verständnislosen Blick, der aber langsam einem spöttisch funkelnden Lächeln wich, was ihr den unangenehmen Eindruck vermittelte, dass er genau wusste, was in ihr vorgegangen war. Um diesem Blick zu entgehen, schüttelte sie ihr Haar ins Gesicht, kniete sich hin, raffte ihre Habseligkeiten zusammen und stopfte sie zurück in die Tasche.
Er hockte sich neben sie und machte sich daran, ihr zu helfen. »Wie weit glauben Sie denn, dass Sie auf Ihren wehen Füßen noch laufen können?« Das freche Grinsen wurde breiter.
»Das geht Sie nichts an«, fauchte sie. »Lassen Sie das, ich mach das schon!« Hastig riss sie ihm ihren Lippenstift aus der Hand.
Er blinzelte in den Himmel. »Außerdem braut sich gerade ein Gewitter zusammen. Eins der berüchtigten Londoner Junigewitter. Sie werden ziemlich nass werden.«
Wie zur Bestätigung rollte dumpfer Donner über den schnell dunkler werdenden Himmel, Blitze zuckten, und die ersten dicken Regentropfen platschten aufs Pflaster und durchnässten im Handumdrehen ihre dünne Bluse.
»Wenn Sie nicht vorsichtig sind, könnten Sie sogar in den Fluten ertrinken!« Er lachte laut und fröhlich und zog sich das durchnässte T-Shirt über den Kopf. Sein Oberkörper war tiefbraun gebrannt und beeindruckend muskulös.
Alice zwang sich wegzusehen und räumte mit fliegenden Händen den Rest der herausgefallenen Gegenstände in die Tasche. Böiger Wind war aufgekommen und trieb den Regen in dichten Schwaden über den Platz. Ohne ein weiteres Wort rannte sie, so schnell es ihre geschundenen Füße erlaubten, durch den Wolkenbruch davon.
»War nett, Sie kennengelernt zu haben«, schrie er hinter ihr her, und sein Lachen übertönte sogar das Gewitter.
Unwillkürlich drehte sie sich um, aber er war nicht mehr zu sehen. Die Treppe zu Füßen des Eros war leer. Der scharfe Stich, der sie darauf durchzuckte, brachte ihre Gefühlswelt vollkommen durcheinander. Ihr Blick flog über die Menschenmenge, die kurz zuvor den Piccadilly Circus bevölkert hatte und jetzt vom Regen auseinandergetrieben wurde, aber sie konnte ihn nirgendwo entdecken. Sie suchte Schutz unter einem Dachüberhang und entschied, später über ihre merkwürdige Reaktion nachzudenken.
Das tat sie dann, bis auf die Haut durchnässt, irgendwo in London auf einer Parkbank, während sie dem letzten Tröpfeln des Regens lauschte. Jasmin hing in weißen Kaskaden über den Weg, und sein tropisch süßer Duft mischte sich mit dem von Heckenrosen zu einem berauschenden Bukett. Alles brachte ihre Sinne zum Singen, und dieses Gefühl verwirrte sie. Nachdenklich wanderte sie noch lange barfuß durch die lichtglänzende, pulsierende Stadt.
Planmäßig flog Alice zurück nach Hamburg und zog vorübergehend bei Manuela ein. Ihre Eltern wollte sie vorerst nicht sehen. Sie verkroch sich in das winzige Zimmer, in das Manuela ihr ein Faltbett gestellt hatte. Die Semesterferien waren zu Ende, der Universitätsalltag hatte begonnen, und sie vergrub sich in ihren Büchern, um nicht mehr an diesen Mann zu denken. Nachts lag sie wach, und morgens fühlte sie sich wie gerädert.
Es dauerte Tage, ehe ihr klar wurde, dass ihre trübe Stimmung und ihr verrücktspielender Magen unmittelbar damit zu tun hatten, dass ihr dieser Mann immer noch im Kopf herumspukte. Sie rief sich zur Ordnung, aber das nützte nichts. Er hatte sich in ihr eingenistet, seine funkelnden Augen, das herausfordernde Grinsen, die Lebensfreude, die er versprühte.
Ihre Stimmungsschwankungen fielen nicht nur ihren Freundinnen auf, sondern auch Joachim, mit dem sie seit einem Jahr zusammen war, und der reagierte heftig. Vorwurfsvoll beschuldigte er sie, einen anderen kennengelernt zu haben. Mit deutlich zur Schau getragener Seelenpein bohrte er immer wieder nach, immer wieder hackte er auf Einzelheiten herum wie ein wütender Specht. Es gab keinen großen Krach, aber es entwickelte sich ein ständig schwelender Brand, und am Ende der Woche war ihre Beziehung nur noch ein kalter Aschehaufen.
Joachim. Treu, liebevoll und sanft. Und schrecklich langweilig, auch wenn sie sich das vorher noch nie eingestanden hatte. Selten nur hatte er das Bedürfnis, etwas zu unternehmen oder andere Leute zu treffen. Ihm genügte es, mit ihr händchenhaltend auf der Couch zu sitzen und fernzusehen. Plötzlich sah sie sich mit sechzig, festgewachsen auf dieser Couch, und als einziges Fenster zur Welt den Fernseher. Sie sagte ihm, dass es zu Ende sei, und ging.
Manuela, schmal, blond und ein wenig verträumt, erklärte sie mit leicht verspannter Mundpartie für verrückt. »Sieht er denn so gut aus?«, wollte sie stirnrunzelnd wissen.
Sah er gut aus? Alice zuckte mit den Schultern. Was sollte sie ihrer Freundin sagen? Dass er umwerfend gut roch? Dass sein Grinsen unverschämt und aufregend war, seine Anziehungskraft unwiderstehlich? Dass sie sich unsterblich in einen Mann verliebt hatte, dem sie nie zuvor begegnet war? Obwohl kaum eine Chance bestand, ihn je wiederzusehen? »Schon«, sagte sie zögerlich. »Ziemlich.«
»Wie heißt er, und woher kommt er?«, setzte Manuela das Verhör unerbittlich fort.
»Keine Ahnung. Seinen Namen hat er nicht genannt. Er hat Englisch mit einem Akzent gesprochen, den ich nicht einordnen kann, und woher er kommt, weiß ich auch nicht.« Ihre Gefühle behielt sie für sich.
Aber Manuela kannte sie viel zu gut. »Ach herrje, du hast dich verknallt«, rief sie. »Jetzt hör mir mal zu! Du kennst seinen Namen nicht, du weißt nicht einmal, von welchem Kontinent er stammt, das heißt, du wirst ihn nie wiedersehen. Also vergiss ihn, das geht vorüber wie Windpocken. Kratz nicht dran, dann bleiben auch keine Narben. Sei lieb zu Joachim. So einen findest du so schnell nicht wieder.«
Alice hatte darauf nicht geantwortet, sondern am Flughafen ein Exemplar von Londons größter Tageszeitung gekauft. Die darauffolgenden Tage verbrachte sie damit, den Text für eine Suchanzeige zu formulieren. Auf englisch natürlich. Dutzende von Entwürfen riss sie aus der Schreibmaschine und warf sie in den Papierkorb, bis er überquoll.
Und dann bekam sie plötzlich Post.
Es war der Umschlag eines Briefes, den sie schon vor Wochen von ihren Eltern nachgesandt bekommen hatte und der jetzt auf geheimnisvolle Weise mit englischen Briefmarken beklebt war. Verdutzt drehte sie den Umschlag um und las den Absender.
»Pierre Diekmann, London.«
Wie betäubt sank Alice auf einen Stuhl. Der leere Umschlag war in ihrer Umhängetasche gewesen, daran erinnerte sie sich, und er konnte ihr nur herausgerutscht sein, als die ihr heruntergefallen war und der Inhalt sich über die Stufen des Denkmals verteilt hatte. Und dieser Pierre Diekmann hatte ihn einfach eingesteckt. Anders konnte er nicht an ihn gelangt sein. Unverschämt, fuhr es ihr durch den Kopf.
Es steckte lediglich ein Zettel darin, auf dem handschriftlich eine Nummer mit englischer Vorwahl geschrieben war. Sonst nichts. Kein Gruß. Keine Unterschrift. Benommen stand sie auf, ging zu Manuelas Telefon und wählte. Das Ferngespräch würde sie ihr natürlich bezahlen. Er meldete sich nach dem dritten Klingelton mit einem kurzen, markigen »Diekmann!«.
»Hier ist Alice …«, sagte sie und ärgerte sich gleich darauf, dass ihre Stimme so atemlos klang.
Zwei Tage später stand er vor ihrer Tür.
»Hallo«, sagte er und grinste dieses freche Grinsen. »Ich habe eine Stellung in Südafrika angenommen und wandere im Winter dorthin aus. Kommst du mit mir?«
Später gestand er ihr, dass er diesen Satz tagelang geübt hatte. Vor dem Spiegel. Weil er so unglaublichen Bammel vor ihrem Wiedersehen gehabt hatte und davor, dass sie ihn sofort wieder rauswerfen würde.
Ihr lief es heiß und kalt den Rücken hinunter, und bevor sie einen zusammenhängenden Gedanken fassen konnte, lächelte sie ihn an. »Ja«, hörte sie sich zu ihrer eigenen Verwirrung laut antworten.
Das Grinsen erlosch. Ungläubig starrte er sie an. »Ja? Du kommst mit mir?«
Ihr Gesicht begann zu glühen, und plötzlich war ihr klar, dass sie auf diesen Mann ihr ganzes bisheriges Leben gewartet hatte und dass sie mit ihm den Rest dieses Lebens verbringen wollte. »Ja«, sagte sie. »Natürlich.«
Und so geschah es.
Natürlich konnten sie nicht bei Manuela wohnen und mieteten deshalb für die Zeit bis zu ihrem Abflug ein winziges Einzimmerapartment. Die Wochen, die folgten, waren ein einziger Rausch der Sinne. Jede Minute verbrachten sie zusammen, konnten kaum die Hände voneinander lassen.
»Ihr benehmt euch, als würdet ihr unter einer Käseglocke leben«, bemerkte Manuela und schaute eifersüchtig drein. »Den Rest der Welt nehmt ihr anscheinend gar nicht mehr wahr.«
»Wie bitte?« Alice blickte ihre Freundin verträumt an und schmiegte sich in Pierres Arme, worauf Manuela aufgab.
»Wir könnten es ja wie meine Eltern machen«, sagte er eines Morgens nach dem Aufwachen zu ihr.
»Und was haben die gemacht?«, sagte Alice und fuhr die Konturen seines Mundes mit dem Zeigefinger nach. Sie war völlig vernarrt in diese Lippen.
Er nahm ihren Finger und küsste ihn. »Anfang der Fünfziger haben sie sich einfach ein kleines Zelt und ein gebrauchtes Motorrad gekauft, sind durch die Lande gefahren und haben von ihrer Sehnsuchtsstadt Paris geträumt …« Er unterbrach sich und ließ seine Lippen ihren nackten Arm hochwandern, machte einen Abstecher zu ihrer Brust, und dann dauerte es eine gute Weile, ehe er weitersprechen konnte. »Wir könnten über Land nach Johannesburg fahren«, nahm er den Faden wieder auf. »Was hältst du davon?« Seine Zähne blitzten.
»Mit einem kleinen Zelt?«, murmelte sie träge. »Was ist, wenn ein Elefant zu Besuch kommt?«
»Wir bitten ihn höflich herein und bieten ihm etwas zu trinken an.«
Sie lachte und zog seinen Kopf zu sich herunter. »Hm … erzähl mir mehr von deinen Eltern«, murmelte sie, als sie ihn endlich wieder freigab.
»Sie haben beide an derselben Uni Französisch studiert, sich verliebt und sich entschieden, nach ihrem Examen die deutsche Provinz hinter sich zu lassen. Sie tauschten ihr Motorrad gegen eine Ente, packten sie bis oben hin voll und zuckelten nach Paris, schlugen ihr Zelt auf dem Grundstück der kommunistischen Jugendherberge auf, weil es fast nichts kostete und weil die Herberge warme Duschen hatte. Mein Vater arbeitete als Übersetzer für Englisch, meine Mutter für Deutsch. Fortan nannten sie sich Existenzialisten, kleideten sich schwarz, rauchten Gauloises ohne Filter, tranken Unmengen von Rotwein und aßen Baguette, weil das am billigsten war. Dabei hörten sie Cool Jazz, lasen Sartre und Beauvoir und diskutierten die Nächte durch. Irgendwann zog es sie dann weiter nach Süden. Sie kratzten ihre letzten Centimes zusammen und kauften auf dem Land im Languedoc ein verfallenes Steinhäuschen, renovierten es mit eigenen Händen und bauten Gemüse an. Als ich zur Welt kam, schafften sie sich erst eine Ziege und dann eine Kuh an, um Milch für mich zu haben.«
Er verstummte und schaute mit leisem Lächeln vor sich hin.
»Leben sie noch?«, fragte sie leise und hoffte so sehr, dass es so war. Sie würde sie gern kennenlernen.
»O ja, und wie. Immer noch in Schwarz, immer noch Kette rauchend, nur schlürfen sie heute ab und zu Pastis mit Minze und essen geräucherten Lachs. Mon père ist zu Geld gekommen.«
Alice seufzte und dachte dabei an ihre Eltern, die immer korrekt gekleidet waren, nicht rauchten und sicherlich weder Cool Jazz gehört noch Simone de Beauvoir gelesen hatten. Sie nannten die Französin eine militante Frauenrechtlerin, womit sie ja eigentlich recht hatten.
ENDE DER LESEPROBE