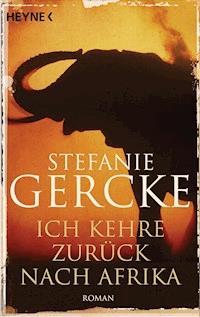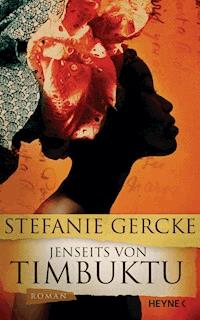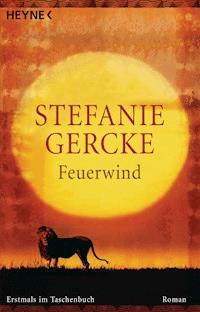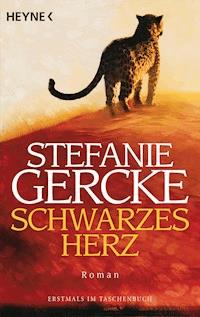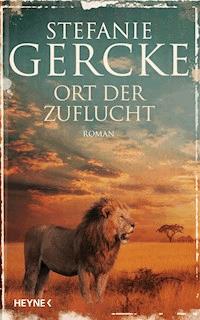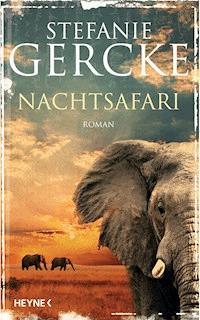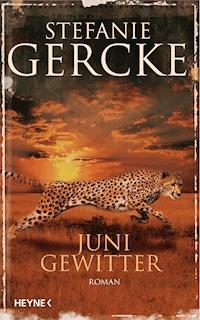6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Erdbeben der Gefühle
Die junge Farbige Benita ist erfolgreiche Investmentbankerin in London. Ein geheimnisvoller Talisman zwingt sie, sich in ihrem Geburtsland Südafrika endlich auf die Suche nach der Wahrheit zu machen. Wer hat ihre Mutter zur Zeit der politischen Verfolgung umgebracht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1121
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1
Beauty Makuba war das erste Opfer. Am Morgen des 4. Novembers fiel sie mit ausgestreckten Armen kopfüber in ein dreißig Meter tiefes Loch in ihrem Garten, das sich über Nacht aufgetan hatte, brach sich erst beide Arme, gleich darauf den Schädel und zum Schluss das Genick. Schmerzen spürte Beauty nicht. Sie war sofort tot.
An diesem Tag fanden ihre Nachbarn in dem kleinen Ort Promise, der vom Bergbau lebte, nicht weniger als sechshundert solcher Löcher in ihren Gärten. Das tiefste war so tief, dass es dem Hausbesitzer bodenlos erschien und er fürchtete, in seinem Vorgarten einen direkten Zugang zur Hölle zu haben. Das regte ihn sehr auf, aber niemand konnte ihm die Frage beantworten, woher diese Löcher wirklich kamen und wohin sie führten.
Die Minengesellschaft wandte sich an ihre Geologen. Da alles am Guy-Fawkes-Day geschah, an dem die Engländer mit Freudenfeuern und dem Abbrennen von spektakulären Feuerwerkskörpern feierten, dass besagter Guy Fawkes und seine Mitverschwörer im Jahr 1605 mit ihrem Plan scheiterten, das englische Parlament in die Luft zu jagen, unterlief dem Geologen vom Dienst, der obendrein an jenem Tag Geburtstag hatte, eine Nachlässigkeit. Er übersah einige ungewöhnliche, verhältnismäßig flache Zacken auf dem Seismographen. In seiner langatmigen Erklärung hieß es, dass es sich um einen Kaverneneinbruch handele, der ja vor Ort keine Besonderheit sei.
Die hiesigen Minen waren ins Dolomitgestein getrieben, und durch die Schächte sickerte immerfort Oberflächenwasser nach, das von der Minengesellschaft ständig abgepumpt werden musste. Langsam, aber stetig fraß das Wasser das Gestein, und es entstanden riesige Kavernen, bis irgendwann die Höhlendecke aus dem weichen Kalkgestein nicht mehr stark genug war und einbrach. Der Einbruch erzeugte ein dumpfes Grollen und einen kurzen Erdstoß. Dann war es vorüber. Die Bosse der Minengesellschaft waren beruhigt und machten sich auf, um ebenfalls ausgiebig den Festtag zu begehen.
Prudence Magubane aber hatte eine Erklärung, die den Bewohnern von Promise, die bis auf wenige Ausnahmen alle von dunkler Hautfarbe waren, mehr einleuchtete. Schon immer, so behauptete die alte Frau, der man nachsagte, dass sie in mondhellen Nächten allerlei geheimnisvolle Riten praktiziere, habe sie davor gewarnt, dass der Boden unter dem Ort durchlöchert sei wie ein Baumstamm von Termiten, weil da unten etwas lebe, das von unvorstellbarer Gefräßigkeit sei.
Viele der Anwohner glaubten ihr, kauften ihre Medizin und gossen sie in die Löcher, um das unterirdische Biest zu füttern. Das Geschäft florierte, und Prudence Magubane zog bald von ihrer Wellblechhütte in ein Haus aus Stein, und in ihrem Wohnzimmer flimmerte fortan Tag und Nacht ein Fernseher.
Aber das unterirdische Biest war unersättlich. Es lag auf der Lauer und wartete.
Am Abend des Guy-Fawkes-Day bebte die Erde erneut, ein Stollen brach ein, und zehn Minenarbeiter der King Midas Gold Mine wurden verschüttet. Unerfahrene verwechselten das Geräusch gern mit dem eines vorbeifahrenden Zuges, aber jeder, der in dieser Gegend lebte, hielt es für einen Kaverneneinbruch, jede Frau, deren Mann in den Minen arbeitete, schickte ein Stoßgebet zum Himmel und hoffte, dass es nicht den ihren getroffen hatte.
Dieses Mal jedoch war es anders. Was die Höhlen zusammenbrechen ließ, war nicht ein Kaverneneinbruch, sondern ein tektonisches Beben. Die Geologen wiesen schnellstens daraufhin, dass Derartiges in dieser Gegend außerordentlich ungewöhnlich sei und sich wohl kaum wiederholen könne.
Aber das Biest hatte die Zähne gefletscht.
Die zehn Minenarbeiter konnten nach einigen Tagen nur noch tot geborgen werden. Das Begräbnis wurde vom Fernsehen übertragen, und die Frauen warfen sich über die Särge ihrer Männer und schrien und klagten, was die Stimmbänder hergaben, damit ihre Ahnen die Toten mit offenen Armen empfingen.
Es war eine sehr würdige Zeremonie.
Linnie merkte von alledem nichts. Das Weltgeschehen interessierte sie schon lange nicht mehr. Außerdem lebte weit weg an der südöstlichen Küste des Indischen Ozeans, hatte weder je von dem Ort Promise noch von den mysteriösen Erdlöchern gehört. Sie besaß weder Radio noch Fernsehen, und die Zeitungen, die sie las, waren die, die andere Leute weggeworfen hatten, denn der Busch war ihr Heim, der Himmel ihr Dach und der warme Sand ihr Bett. Sie war zu einem Nachtwesen geworden, ein flüchtiger Schatten zwischen den Büschen, ein trockenes Rascheln im Ried, nichts mehr. Seit achtzehn Jahren war sie nichts als ein Schatten. Unsichtbar. Nicht vorhanden.
Das war gut so, denn niemals durfte einer von denen erfahren, dass es sie noch gab, durfte nicht ahnen, dass sie noch atmete. Ob sie noch lebte, war eine Frage, auf die sie die Antwort selbst nicht geben konnte. Die, die sie einst war, existierte nicht mehr, und mit jedem Tag entfernte sich ihr früheres Leben weiter von ihr. Als schaute sie durch das falsche Ende eines Fernrohrs, erkannte sie jetzt nur noch einen schwach leuchtenden Punkt, und auch der würde bald erloschen sein. Dann blieb nur noch Finsternis. Und der Hass. Denn solange nicht vollbracht war, was sie sich damals geschworen hatte, musste sie atmen. Ein und aus. Ein und aus. War es vorbei, würde sie sich fallen lassen, sich auflösen, einfach aufhören zu sein. Von ihr würde nichts bleiben, nur tanzende Stäubchen in den Sonnenstrahlen. Manchmal, wenn die Schmerzen zu schlimm wurden, wünschte sie diesen Augenblick herbei, mehr als alles andere auf der Welt. Dann stieg sie im pflaumenfarbenen Morgengrauen nackt in die Wellen, dort, wo keine Felsen unter der Oberfläche lauerten, legte sich auf den Rücken und ließ sich mit geschlossenen Augen ins Licht treiben, hoffte, dass das Meer sie mitnehmen würde in die Ewigkeit. Aber dann schwappte ihr unweigerlich eine vorwitzige Welle in den Mund, oder irgendetwas knabberte an ihrem Zeh, sie verschluckte sich, musste husten und spucken, und ihr Überlebensreflex setzte wieder ein. Sie schwamm zurück an Land.
Eine große grellbunte Heuschrecke landete auf ihrem Arm. Spüren konnte sie das nicht. Unter den wulstigen Narben, die ihren gesamten Körper überzogen, waren die Nerven weitgehend zerstört, nur stellenweise fühlte sie etwas, und dann waren es immer Schmerzen, furchtbare, spitze Schmerzen. An vielen Tagen war sie nur noch ein einziger Schmerz, und es kam ihr vor, als hätte sie nicht nur die Verbindung zu ihrem Körper verloren, sondern auch zu ihrer Seele. In ihrem Inneren war sie tot, alle menschlichen Gefühle waren gestorben.
Alle, bis auf eines. Den Hass. Lichterloh brannte er in ihr, hatte jedes andere Gefühl mit seinen Flammen verzehrt. In diesem Feuer schmiedete sie ihre Wut, schürte die Glut, verlor nie ihr Ziel aus den Augen.
Mit einer blitzschnellen Handbewegung fing sie die Heuschrecke ein und setzte sie ins Blätterwerk. Der Insektenleib war prall und weich, das konnte sie fühlen. Die Fingerspitzen ihrer rechten Hand waren unversehrt. Sie hatte sie zur Faust geballt, und deswegen waren sie verschont geblieben. Sachte strich sie über den pferdeähnlichen Kopf des Tieres, die festen Flügeldecken, zupfte die durchsichtigen, pergamentartigen Hinterflügel hervor, bis sie sich wie Fächer entfalteten. Es gab Zeiten, da hatte sie das Insekt gegessen, meist geröstet, aber auch roh, wenn sie hungrig genug war, obwohl es abstoßend bitter schmeckte. Aber jetzt hatte sie sich ihr Lager nicht weit vom Ort im Dünenwald bereitet, und wenn es ihr nicht gelang, in der Morgendämmerung einige Krebse, vielleicht einen Tintenfisch oder sogar einen Fisch zu fangen, der zur dieser frühen Tageszeit noch schlafend auf dem schattigen Grund eines Teichs im Felsenriff lag, wanderte sie abends im Schutz der Dunkelheit zu den Mülltonnen, die hinter den großen Hotels standen. Dort war der Tisch stets reich gedeckt.
Vor einigen Monaten hatten Kinder, die den dichten Buschstreifen unterhalb der Promenade erkundeten, sie in ihrem Unterschlupf aufgestöbert, und einige unerschrockene hatten sich ihr genähert, zögernd Fragen gestellt und dann ihren ehrlichen Antworten gelauscht. Sie waren zu ihren Freunden geworden und brachten ihr nun ab und zu sauberes Wasser und Essen, das sie ihrer Mutter stahlen oder mit einer kleinen Lüge abschwatzten. Nicht einer verriet sie. Eifersüchtig hüteten alle ihr Geheimnis vor den Erwachsenen, und sie belohnte die Treue der Kinder, indem sie ihnen kleine Figuren aus Lehm modellierte oder Flöten aus Bambus schnitzte, den sie nachts aus einem üppigen Garten in der Nähe des Strandes schnitt, nachdem sie den blutdurstig geifernden Wachhund mit sanften Schnalzlauten und saftigen Fleischresten aus den Mülleimern des Steakrestaurants in ein lammfrommes Hündchen verwandelt hatte.
Nach ihrem abendlichen Beutezug durch die Mülltonnen der Hotels duschte sie sich unter den Strandduschen. Seewasser und Meeresluft überzogen ihre Haut schnell mit Salzkristallen, an denen der grobe Sand so fest haftete, dass sie ihn nicht abschütteln konnte. Dann juckten die Narben so unerträglich, dass sie sich die Haut vom Leibe hätte kratzen mögen. Sie wartete immer, bis der Strand menschenleer war und auch niemand mehr über die Promenade wanderte. Bei ihrer Duschorgie beobachtet zu werden wäre ihr sehr peinlich. Erst wenn kein Sandkorn mehr an ihr klebte, der Juckreiz endlich nachließ, drehte sie den Hahn zu.
In den letzten Monaten hatte sie sehr viel Gewicht verloren, und ihre von glänzenden Wulsten durchzogene, schuppige Haut warf dicke Falten, was ihr ein reptilienhaftes Aussehen verlieh. Ein Reptil mit eingefallenen Flanken und zu großem Kopf, so sah sie sich.
Die Chamäleonfrau nannte man sie, wegen ihrer Haut und der Tatsache, dass ihr Kopf bis auf einige dünne Haarbüschel kahl war, das wusste sie wohl. Sie hatte die Kinder reden hören. Aber es machte ihr nichts aus, und nie benutzte sie ihr Aussehen, um ihnen Angst einzujagen. Kinder liebte sie. Ihr eigenes, ihr einziges, hatte sie verloren, gleichzeitig mit dem Vater, der die Liebe ihres Lebens gewesen war. Die Erinnerung an den, der den Tod ihres Mannes verursacht und sie zu dem Dasein einer lebenden Toten verdammt hatte, die Erinnerung an diesen Mann hielt ihren Hass lebendig.
Sie ballte die Fäuste, presste die Lider zusammen, zwang sich, sich diesen Mann genau vorzustellen, rief sich seine sanfte, tödliche Stimme ins Gedächtnis, suhlte sich in der Erinnerung an den Schmerz, den ihr seine manikürten Hände zugefügt hatten, konzentrierte sich auf diesen weiß glühenden Punkt in ihrem Zentrum. So lebhaft war ihre Vorstellungskraft, dass sie ihn riechen konnte, diesen abstoßenden Geruch nach männlichem Schweiß, vermischt mit Zigarrenrauch und seinem klebrig-süßlichen Rasierwasser. Sie musste sich das antun, damit sie in jener einen Sekunde, auf die sie seit vielen Jahren mit der grausamen Geduld einer hungrigen Raubkatze lauerte, dem Augenblick, in dem er vor ihr stehen würde, bereit war.
Nun war dieser Augenblick ganz nah. Einen Monat würde er in seinem Luxusapartment in Umhlanga Rocks verbringen. Aus geschäftlichen Gründen, so hatte es in einer der Zeitungen gestanden, die sie täglich aus dem Papierkorb vor dem La Spiaggia fischte in der Hoffnung, irgendwann eine Spur dieses Mannes zu finden. Beim schnellen Durchblättern war ihr Blick an dem Foto eines Mannes hängen geblieben, der mit verschränkten Armen den Betrachter kühl von oben herab musterte. Es deckte sich exakt mit dem Bild von ihm, das seit achtzehn Jahren wie mit Säure in ihre Seele geätzt war, und die Erkenntnis, wen sie vor sich hatte, hatte sie mit der Wucht eines Schmiedehammers getroffen, ihr für Minuten jegliche Kontrolle über sich selbst geraubt, allein die Erinnerung verursachte dieselbe Reaktion wie in jenem Moment. Sie zitterte, ihr Herz setzte aus, ihre Hände flogen, sie rang nach Atem, als würde ihr jemand die Kehle zudrücken. Sie hatte die Zeitung fallen lassen und war, hilflos gegen die Dämonen kämpfend, hinunter auf den schattigen Strand gestolpert, entlang den auslaufenden Wellen, bis sie irgendwann lang hingeschlagen und liegen geblieben war. Ihr Mund hatte sich mit Salzwasser gefüllt, Sand ihr die gepeinigte Haut heruntergerieben. Wie ein Stück Treibholz rollte sie in der auflaufenden Flut hin und her, bis eine Welle sie hinauf auf den trockenen Sand gespuckt hatte.
Die wilden Filmfetzen vor ihren Augen waren allmählich verblasst, und eine tödliche Ruhe hatte sich ihrer bemächtigt. Sie ging zurück zum La Spiaggia, fand die Zeitung und hatte im Licht der Straßenlampe den Artikel gelesen, der neben dem Bild abgedruckt war, und damit den süßesten Augenblick der vergangenen achtzehn Jahre erlebt. So lange hatte sie ihn gesucht, hatte sich ans Leben geklammert, hatte sich geschworen, es nicht eher zu verlassen, bis sie ihn gefunden hatte, bis er für alles auf Heller und Pfennig bezahlt hatte, und jetzt hatte sie ihn gefunden.
Er nannte sich heute anders, als er damals hieß, und es war nicht sein Gesicht, das dort abgebildet war. Offenbar hatte er seine Gesichtszüge mittels kosmetischer Operationen verändern lassen – besonders das Kinn erschien ihr kantiger –, aber seine elegante Erscheinung, die arrogante Kopfhaltung, seine Gestik verrieten ihn. Das Haar trug er so militärisch kurz wie früher, aber es war nicht mehr dunkelbraun, sondern weiß.
Wie damals verbarg er seinen durchtrainierten Körper unter feinstem Stoff, glich auch heute noch äußerlich dem, was er ursprünglich gewesen war: ein Wissenschaftler. Was nicht auf den ersten Blick ersichtlich war, was sie aber am eigenen Leib erfahren hatte, waren seine Besessenheit und die unglaubliche Kraft, die er besaß, eine Kraft und Schnelligkeit, die sie eigentlich bisher nur im Tierreich erlebt hatte. Sein Körper schien nur aus Muskeln zu bestehen. Er war nicht groß, unter eins achtzig sicherlich, so schätzte sie ihn, obwohl er größer wirkte.
Unter seinem neuen Namen war er heute offenbar ein prominenter Geschäftsmann, nicht verheiratet, darauf würde sie wetten. Seine Zuneigung galt Jungen mit glatter Haut und knospenden Körpern, das hatte sie beobachtet, damals.
Die Bilder jagten ihr einen Schauer über ihre zerstörte Haut, lösten dabei einen starken Juckreiz aus. Sie beherrschte sich und kratzte sich nicht, weil die Wunden, die sie sich dann selbst zufügte, in dem feuchtwarmen Seeklima leicht vereiterten und oft für Monate nicht heilten. Zwar kannte sie sich gut aus, wusste welche Pflanzen in den Dünen, zu Brei zerdrückt, aseptisch wirkten und die Heilung förderten, aber seit einiger Zeit konnte sie nicht mehr ignorieren, welches Risiko diese Infektionen für sie darstellten.
Die Anzeichen waren nur zu deutlich. Lange hatte sie geglaubt, sie wäre noch einmal davongekommen, nachdem die Bande von zugekifften Tsotsies sie in ihrem Versteck am Strand vor Durbans Goldener Meile aufgestöbert hatte. Durch die Verkrüppelungen und die straff spannenden Narben konnte sie sich nur mit großer Mühe und nur sehr langsam fortbewegen. Sie entkam ihnen nicht. Einer nach dem anderen hatten sie sich auf sie gestürzt, wieder und immer wieder.
Es war eine dunkle, mondlose Nacht gewesen, kurz vor der Wintersonnenwende, und keiner hatte ihr Äußeres richtig wahrgenommen. Erst als die Kerle von ihr abgelassen und sie halb bewusstlos vor Schock und Schmerzen liegen lassen hatten, hatte einer von ihnen ein Feuer angezündet – um sich zu wärmen oder Heroin zu kochen, das konnte sie nicht sagen –, und erst dann bemerkten ihre Peiniger ihr Aussehen.
»Es ist ein Tier, es ist … das Chamäleon«, schrie einer, und alle stoben entsetzt davon.
Das Chamäleon war der Todesbote der Zulus, und sie hatte trotz ihres Zustandes ein grimmiges Gefühl von Gerechtigkeit verspürt, weil sie wusste, dass selbst bei den Zulus, die schon im Bauch der Stadt geboren worden waren, der Glaube an die Mythologie ihres Volkes tief verwurzelt war. Diese Männer würden wissen, dass sie dem Tod geweiht waren, und egal, wie sie starben, in ihrem letzten Augenblick würden sie das Wesen vor sich haben, das Schuppen trug und aussah wie ein großes Reptil und doch eine Menschenfrau war. Ihre verbleibende Zeit auf Erden würde keine angenehme werden, dessen war sie sich sicher. Es war ein schwacher Trost, und er hielt nicht lange an.
Obwohl sie wusste, dass antiretrovirale Medikamente, die, kurz nach der Infektion verabreicht, den Ausbruch der Krankheit verhindern oder zumindest verzögern konnten, in Südafrika illegal waren, hatte sie sich voll verzweifelter Wut zum nächsten Krankenhaus geschleppt. Weinend hatte sie die junge indische Ärztin in der Notaufnahme um das rettende Medikament angefleht. Aber vergeblich, sie wurde abgewiesen. Rasend vor Angst, hatte sie geschrien, war den Gang entlanggekrochen und hatte an Türen gehämmert, bis zwei Krankenpfleger sie einfingen.
»Stell dich nicht so an«, hatte einer der beiden geknurrt und sie – durch Einweghandschuhe geschützt – gepackt und vor die Tür gesetzt. Sie nahm es ihnen nicht übel. In einem Land, wo alle sechsundzwanzig Sekunden eine Frau vergewaltigt wurde, war ihr Schicksal ein alltägliches. Nur in den müden Augen der Ärztin hatte sie tiefstes Mitleid gesehen.
An diesem Morgen war sie versucht gewesen, einfach ins Meer zu gehen und weit hinauszuschwimmen, bis sie die Kraft verließ, es keinen Weg mehr zurückgab und sie in die stille, weiche Tiefe sinken würde, immer weiter, bis das Licht über ihr sich verdunkelte, die Stille tiefer wurde und endlich nichts mehr da war als Frieden. Keine Schmerzen, keine Sehnsüchte. Nichts mehr. Stundenlang hatte sie am Saum der Wellen gestanden und hinaus ins sturmgepeitschte wintergraue Meer gestarrt. Doch dann hatte sie ein streunender Hund angefallen, und ein paar Halbwüchsige bewarfen sie mit Steinen und verhöhnten sie mit üblen Namen. Da war die Wut zurückgekommen, und sie wusste, dass sie nie aufgeben würde, bis er die Rechnung in Gänze beglichen hatte.
Am nächsten Tag hatte sie sich von Kopf bis Fuß verhüllt, sich einen Platz im Sammeltaxi geleistet und war die fünfzehn Kilometer nach Umhlanga Rocks gefahren. Seitdem lebte sie dort. Die Hotels hier waren die teuersten in KwaZulu-Natal, und das, was aus ihren Küchen im Abfall landete, hätte manche Familie gesund und reichhaltig ernährt. Ihr boten die Abfälle vielfältige Abwechslung. Sie war sorgfältig in ihrer Auswahl, ernährte sich gesund, ging morgens in der Stunde vor Aufgang der Sonne, die ihr Freund geworden war, lange am Strand entlang, um sich fit zu halten und den Ausbruch der Krankheit hinauszuzögern. Außerdem tat die feuchte, mineralienhaltige Luft ihrer geschundenen Haut gut, bewahrte sie der feine Gischtschleier vor dem Austrocknen, sodass die Narben nicht so spannten.
Das war jetzt vier Jahre her. Für den Test hatte sie kein Geld, und lange Zeit hatte sie sich an die Hoffnung geklammert, dass das Schicksal ihr dieses eine Mal gnädig gestimmt war, aber letztlich hatte sie nach und nach die verräterischen Zeichen bemerkt. Husten, der nicht aufhören wollte, Wunden, die nicht mehr heilten, und eines Morgens, im ersten Licht der aufgehenden Sonne, hatte sie es entdeckt. Wie eine bösartige schwarze Kröte wuchs es aus ihrer Haut, ein schreckliches, tödliches Mal. Das erste Kaposi-Geschwür. Es war der Anfang vom Ende, das wusste sie von den vielen, die so gestorben waren, und daher wusste sie auch, dass der Weg dorthin durchs Fegefeuer führte.
Eine beißende, alles verschlingende Angst packte sie, der sie nichts entgegenzusetzen hatte als ihre Wut. Eine Art innere Raserei, die sie gelegentlich dazu trieb, im Mondlicht mit ihrem Messer auf Rattenjagd zu gehen. Der entsetzte Aufschrei der Touristen, die am nächsten Morgen die fein säuberlich aufgereihten Rattenkadaver auf der Promenade entdeckten, entlockte ihr in ihrem Buschversteck nur ein höhnisches Lachen. Manchmal fing sie Schlangen, von denen es in dem verfilzten Busch genügend gab, und legte sie neben die Ratten. Dann wurden die Schreie schriller und ihr Lachen über diese dummen Leute, die vergaßen, dass das hier Afrika war, lauter.
Noch heute musste sie über die Reaktion auf die Mamba schmunzeln. Es war eine grüne Mamba gewesen, die zwischen den Häusern lebte und sich unvorsichtigerweise ihrem Schlafbereich näherte. Sie hatte das Reptil, das gut und gerne seine zwei Meter lang war, erschlagen, mit einem Stock die Kiefer des hundeschnauzenähnlichen Kopfes aufgedrückt und eine Ratte mit dem Kopf voran hineingestopft. Das Geschrei der Touristen hatte einen Menschenauflauf verursacht. Aber natürlich ließen diese kleinen Eskapaden ihre Angst nur für ein paar Stunden in den Hintergrund treten.
Ihre Körperkraft verfiel allmählich, die Schmerzanfälle wurden länger und intensiver, aber mit eiserner Entschlossenheit ging sie dagegen an. Sie musste durchhalten, bis sie ihn zur Strecke gebracht hatte. In Augenblicken, wo Groll und Verzweiflung mit ihr durchgingen, träumte sie davon, ihn mit einem Messer zu bearbeiten und Feuer einzusetzen, wie er das mit ihr getan hatte, aber das würde zu schnell gehen. Er sollte eine öffentliche Verhandlung bekommen, vor einem ordentlichen Gericht. Sie wollte, dass die ganze Welt erfuhr, was er getan hatte; sie wollte, dass er im schwarzen Pfuhl eines südafrikanischen Gefängnisses sein Leben lang dafür büßen musste. Das wollte sie. Aber vorher würde sie ihm eine Spritze mit ihrem Blut in den Leib jagen. Wie sie sollte auch er spüren, wie sich das Gift in den Adern ausbreitete, sollte er die Kaposikröten kennenlernen. Wie sie sollte er sich am Ende den Tod herbeiwünschen. Die Spritze, die sie vor Monaten am Strand gefunden hatte, lag versteckt an ihrem Schlafplatz. Sie beschloss, sie von nun an immer bei sich zu tragen.
Die Sonne war schon eine halbe Stunde zuvor hinter den Hügeln versunken, die Wolken über dem Meer glühten in ihrem feurigen Widerschein, und die Fledermäuse kamen aus ihren Verstecken. Sie wartete noch, bis sich die Schatten vertieften, das Licht allmählich dem Indigo der Nacht wich, und machte sich auf den Weg. Sie musste dringend duschen, außerdem hatte sie Hunger. Die Lichtkegel der Straßenlaternen meidend, bewegte sie sich am Rand der Dünenvegetation unterhalb der Promenade. Lautlos, unsichtbar. Nichts als ein Schatten. Die laut schwatzenden Leute, die zu einem der Restaurants unterwegs waren, ahnten nichts von ihr.
Begegnete sie doch einmal anderen Menschen, vertraute sie darauf, dass diese vermieden, sie anzusehen, denn die meisten konnten ihren Anblick nicht aushalten, wandten sich nach dem ersten Blick verstört ab und hasteten vorbei. Auch das machte sie unsichtbar. Nur die streunenden Hunde nahmen sie wahr, beschnupperten sie, leckten ihr manchmal die Hand, drängten sich mit struppigem Fell gegen sie, hungerten nach Zuwendung, wie auch sie es tat. Deswegen ließ sie diese Annäherung zu. Es war die einzige Berührung von lebenden Wesen, die einzige kreatürliche Wärme, die ihr widerfuhr, und sie genoss diese Augenblicke.
Auch heute Abend wuselte einer der verflohten Vierbeiner über den Weg zu ihr hinunter und fuhr schwanzwedelnd mit der Zunge über ihre bloßen Beine. Sie tätschelte ihn abwesend. Es war heute windig, wie so oft in der ersten Novemberwoche, wenn das erfrischende Frühlingswetter vom nahenden Sommer verdrängt wurde, und kaum einer würde beim La Spiaggia draußen sitzen und essen. Als sie sich dem Restaurant näherte, sah sie ihre Annahme bestätigt. Die Terrasse, die weit über den Strand ragte, lag verlassen im sterbenden Licht des Tages da, nur zwei Ratten huschten quiekend an der Stützmauer entlang, auf der Suche nach Nahrung, wie auch sie es war.
Ungestört duschte sie lange und ausgiebig. Am Tag zuvor hatte sie eine halb volle Flasche Shampoo am Strand gefunden. Sie schäumte sich von oben bis unten mit dem nach Pfirsich duftenden Shampoo ein, freute sich über den ungewohnten Genuss, ihre Haut mit dem sahnigen Schaum zu reinigen. Anschließend rieb sie sich mit dem Olivenöl ein, das ihr eines der Kinder aus der Küche seiner Mutter besorgt hatte. Zum Schluss streifte sie ihren Umhang über.
Später würde sie nackt im Mondlicht nach Hause spazieren, langsam, jeder mühsame Schritt doch ein Hochgenuss, denn jegliches Stück Stoff, war er noch so weich, verursachte ihr Qual. Schnurrend vor Wohligkeit, schlich sie sich hinter das Restaurant, um sich ihr Abendessen zusammenzustellen. Es roch nach Pizza, und sie freute sich darauf.
Unter dem Küchenfenster, neben der Tonne, in die die Kellner das auf den Tellern übrig gebliebene Essen warfen, stapelten sich wie immer Zeitungen. Ein kurzer Blick ließ sie erkennen, dass sie uninteressant für sie waren, uralt; zumindest die oberste, die Sun aus England, die Touristen gern kauften, war drei Monate alt. Sie wollte sich schon abwenden, als ihr Blick an einem Bild auf der ersten Seite hängen blieb. Als sie genauer hinsah, glaubte sie, einer Halluzination aufzusitzen. Mit bebenden Händen zog sie die Zeitung zu sich heran, konnte die Bildunterschrift und den Text nicht erkennen, denn auch ihre Augen wurden allmählich schwächer. Doch durchs Küchenfenster fiel ein Lichtschein, und sie vergaß ihre Furcht, gesehen zu werden, trat aus dem Schatten und hielt die Zeitung dicht vors Gesicht, bis sie die Buchstaben entziffern konnte.
Mit jagendem Herzen las sie den Artikel, kämpfte sich von Wort zu Wort, und mit jedem Wort wurden die Bilder, die aus ihrer Erinnerung hervorgezerrt wurden, schrecklicher. Aber sie zwang sich, den Artikel bis zum Ende zu lesen.
Als sie alles gelesen hatte, las sie es noch einmal, starrte zum Schluss minutenlang auf das Foto, dann faltete sie die Zeitung sorgfältig zusammen und schleppte sich hinunter zum Strand, watete durch die flachen Teiche, die Zeitung hoch über ihren Kopf haltend, bis sie den hohen Felsen erreichte, der weit draußen der Brandung trotzte. Sie kroch hinauf und schaute über das im fahlen Mondlicht schimmernde Meer zurück in ihre Vergangenheit, ihre Augen blind vor ungeweinten Tränen. Was sie sah, erschütterte sie bis in die Grundfesten ihres Seins, brach die Verkrustung so weit auf, dass sie endlich weinen konnte.
Viel später humpelte sie im Mondlicht am Rand der Wellen entlang zu ihrem Versteck unter den breiten Blättern der vielstämmigen Wilden Banane, ließ sich stöhnend auf die Knie nieder, kroch hinein und zog den Müllsack, den sie zwischen die Stämme geklemmt hatte, heraus und knotete ihn auf. Alles, was sie an materiellen Dingen auf dieser Welt besaß, passte in diesen einen Sack.
Mit den Fingerspitzen tastete sie durch ihre Habseligkeiten, erfühlte ihren Kamm, zwei Bücher, ein Medikamentenröhrchen und das Messer, das in einer Holzscheide steckte. Schließlich zog sie ein kleines Kästchen aus blondem Holz heraus. Es war nicht groß, passte gut in ihre Hand. Sie selbst hatte das Kästchen angefertigt, voller Liebe, voller Sehnsucht, denn es sollte ihren größten Schatz beherbergen. Mit dem Zeigefinger strich sie über die feinen Schnitzereien und folgte den gewundenen Linien. Sehen konnte sie hier nichts, es war zu dunkel, aber sie brauchte kein Licht, um zu wissen, was die Schnitzereien bedeuteten.
Drei Initialen, fest miteinander verschlungen. Drei Namen.
Mit ihren versteiften Fingern drückte sie den Deckel hoch und nahm den kleinen Gegenstand heraus, der auf einem Wattebett ruhte. Glatt und glänzend lag er auf ihrer Handfläche, noch warm von der Tageshitze.
Tief unter der Ascheschicht ihrer abgestorbenen Empfindungen glühte ein Funke auf. Ein winziges Fünkchen Leben, ein kleines, flackerndes Flämmchen.
In derselben Woche, vor der südöstlichen Küste Afrikas, mehr als fünftausend Kilometer unter dem Boden des Indischen Ozeans im brodelnden Feuerkern der Erde, führten komplizierte physikalische Vorgänge Anfang November 2006 dazu, dass flüssiges Magma an der Grenzschicht des äußeren Kerns eine glühende Blase bildete. Sie dehnte sich aus, stieg auf wie eine Ölblase im Wasser, presste immer stärker gegen die Erdkruste, bis diese den ungeheuren Kräften nachgab und aufriss. Das Magma erstarrte in dem viel kühleren Meer, aber unaufhörlich strömte geschmolzene Gesteinsmasse nach, erkaltete, und der so entstandene Lavakeil drückte mit stetig wachsender Kraft den unterseeischen Spalt im Meeresboden immer weiter auseinander. Die ozeanische Platte vor der Ostküste Afrikas verschob sich Zentimeter um Zentimeter.
Der Druck auf die Ränder der leichteren kontinentalen Platte wuchs sprunghaft, die Spannung wurde enorm. Die hoch empfindlichen Instrumente in den seismografischen Instituten begannen heftig auszuschlagen, und dringende Erdbebenwarnungen für den Südosten Afrikas wurden an die großen Nachrichtenzentren ausgegeben.
Diese wandten sich in einer Sondersendung an ihre Experten. Jene Wissenschaftler, die natürlich eine Möglichkeit witterten, einmal im Rampenlicht zu stehen, relativierten die Warnungen mit weitschweifigen Aussagen und wiesen darauf hin, dass ein größeres Erdbeben im südlichen Teil Ostafrikas sehr unwahrscheinlich sei. Der Große Afrikanische Grabenbruch, so sagten sie, ein über viertausend Kilometer langer Riss in der Erdkruste, erstrecke sich in Nordsüdrichtung vom Libanon nach Mosambik. Dort trete Vulkanismus auf, der hin und wieder zu Beben führe; er verlaufe weiter nördlich, die Epizentren lägen meist tief unter dem Tanganjikasee und würden das Gebiet südlich von Maputo kaum beeinträchtigen.
Das natürlich beruhigte die Menschen, die dort lebten. Sie gingen ihrem Tagwerk wie gewöhnlich nach, und die Nachrichtensender schickten ihre Experten zurück in die Anonymität und beschäftigten sich wieder mit den Attentaten in Bagdad und der Vogelgrippe, von der man annahm, dass sie in China zum ersten Mal vom Menschen zum Menschen übertragen worden war.
In der Nacht zum 14. November entluden sich schließlich die aufgestauten Kräfte in einem Beben von einem Ausmaß, wie es im Osten Afrikas noch nie beobachtet worden war. Es erreichte 8,1 auf der Richterskala. Die Schockwelle lief, begleitet von einem Donnern wie von mehreren heranrasenden D-Zügen, die Küste Ostafrikas hinunter, zerstörte fast jedes Gebäude, das sich in seinem Weg befand, und tötete viele tausend Menschen. Die Geologen nannten es ein Phänomen, die Medien eine Katastrophe. Die Experten wurden erneut vorgeführt und stotterten sich ihre Erklärungen vor der Kamera zurecht.
Die, die von dem Beben betroffen waren, glaubten voller Furcht, dass es Gottes Strafe sei, und es sollte ein perfektes Beispiel von Ursache und Wirkung werden, denn es löste ein Ereignis aus, das von niemandem vorhergesehen worden war, weil jeder es für völlig außerhalb jeder Wahrscheinlichkeit gehalten hatte.
Der noch nicht vollendete Bau eines himmelstürmenden Hochhauses von vierzig Stockwerken namens Zulu Sunrise an der Küste des Indischen Ozeans von KwaZulu-Natal trug einen Riss im Fundament davon, den allerdings niemand bemerkte, weil das Epizentrum des Bebens rund zweitausend Kilometer entfernt lag und der Erdstoß so kurz gewesen war, so tief in der Nacht passiert war, dass keinem der Ingenieure in den Sinn kam, ihr kostbares Bauwerk auf Schäden zu überprüfen.
Nun aber hatte sich das unterirdische Biest, vor dem Prudence Magubane immer gewarnt hatte, aufgebäumt.
Und in derselben Nacht geschah noch etwas.
Tief im Herzen von Zululand verschob das Beben die Erde so massiv, dass der Lauf eines Flusses, des Umiyane, verändert wurde. Der Umiyane war ein Wanderer, neigte zu häufigen Überschwemmungen, die ihn immer neue Nebenarme bilden ließen, trocknete in Dürreperioden jedoch zu einem Rinnsal ein, worauf die Nebenarme versandeten und Dorfbewohner, die ihr Wasser zuvor aus dem nahen Fluss schöpfen konnten, nun gezwungen waren, oft über einen Kilometer zu laufen, ehe sie das Wasser wieder fanden. Jetzt wurde der Umiyane, der ohnehin durch die sehr ergiebigen Frühlingsregen zu einem reißenden Strom angeschwollen war, durch die Erdstöße aus seinem Bett gekippt, seine Flutwelle überschwemmte die Uferregion auf einer Breite von einem halben Kilometer, riss ein ganzes Dorf und seine Bewohner mit sich, verschlang alles, was ihm in die Quere kam, bis er schließlich am Fuß einer Hügelkette eine breite, von dornigem Buschwerk, Wilden Bananen und Ilala-Palmen überwucherte Senke fand, die sich meilenweit durch die hügelige Landschaft zog. Diese Rinne war sein eigenes Bett gewesen, das er vor mehr als sechzig Jahren verlassen hatte. Mit schäumenden Kaskaden stürzte er sich bereitwillig hinein.
Die Gewalt seiner Wassermassen wurde gebündelt, er wühlte den Boden auf, spülte Felsen frei und verschob Tonnen von Sand, während er es sich in seinem neuen Bett bequem machte. Dabei geriet ein ungewöhnlicher Stein ans Tageslicht, der die Strahlen der Sonne einfing und sie vielfach gebrochen in sprühenden Regenbogenfarben zurückwarf. Seit er 1573 vergraben worden war, hatte er hier in der Erde geruht.
Einmal hatte er der Familie der Dona Elena de Vila Flor gehört, einem jungen Mädchen aus Portugal, die als Einzige ihrer aristokratischen Familie den Untergang des Schiffes ihres Vaters und die anschließende, von grauenvollen Vorkommnissen begleitete Odyssee vom Umzinkulu-Fluss im Süden durch das von wilden Tieren und kriegerischen Menschen bevölkerte Land zur Delagoa Bay in Mosambik überstand. Ihre Mutter und ihre beiden Brüder starben unter unvorstellbaren Qualen, ihr Vater wurde daraufhin wahnsinnig und verschwand im Busch. Zurück blieb Dona Elena samt zwei Ledersäcken mit Geschmeide und Goldmünzen. Der Familienschatz der de Vila Flors.
Die kleine Elena, goldhaarig und zart, aber von einer inneren Widerstandskraft, die das Ergebnis von Vererbung durch viele Generationen und strikter Erziehung war, blieb allein zurück und irrte orientierungslos durch die Wildnis. Sie war dem Tod nahe, als die Söhne einer am Flussufer lebenden Nguni-Familie sie fanden. Nachdem der mutigste es wagte, ihre weiße Haut zu berühren, und herausfand, dass sie sich nicht kalt und tot anfühlte, sondern warm und weich wie seine, und er sich weder verbrannte, noch dass ihm sonst etwas Schreckliches durch diese Berührung widerfuhr, gaben sie ihr zu trinken und trugen sie in das Umuzi ihres Clans. Dort bereitete ihre Mutter für den Gast nahrhafte Mahlzeiten aus Amasi, geronnener Kuhmilch, und zerquetschten Maiskörnern und flößte der geschwächten Weißen frisch gebrautes Hirsebier ein. Später fütterte sie das Mädchen mit Mopani-Raupen, die dafür bekannt waren, dass sie große Kraft verliehen.
Dona Elena war jung und kam schnell wieder zu Kräften und lebte noch viele Jahrzehnte allein als Weiße unter den schwarzen Menschen, hochverehrt, nicht nur wegen ihrer leuchtenden Erscheinung, sondern auch wegen ihres Wissens um die Kunst des Heilens und vieler anderer Dinge, die in ihrem zivilisierten Heimatland Stand der Wissenschaft waren und die sie mit ihren Brüdern von ihren Hauslehrern gelernt hatte, Dinge, die jetzt ihren schwarzen Rettern dazu verhalfen, allen anderen Clans überlegen zu sein.
Den Schatz ließ Dona Elena herbeischaffen, um ihn am Ufer des Umiyane zu vergraben. In dem Leben, das sie jetzt führte, war er wertlos.
Die wenigen, die von der Mannschaft ihres Schiffes übrig geblieben waren, glaubten sie tot, durchstöberten für Wochen voller Gier die gesamte Gegend nach dem Gold, hätten sicherlich Dona Elena Leid angetan, nur um zu erfahren, was sie mit dem Schatz gemacht hatte, hätten sie geahnt, dass sie noch am Leben war. Die zwei Sklaven, die Monate später, zu Skeletten abgemagert, als Einzige Lourenço Marques erreichten, berichteten nur, dass Dom de Vila Flor vor seinem Tod die Säcke mit Gold und Schmuck wohl irgendwo versteckt hatte.
»Weit südlich von hier, in der Nähe eines Sees, irgendwo entlang der Küste.« So wurde ihre Antwort überliefert.
Was heute längst in Vergessenheit geraten war, was nicht einmal mehr die Alten wussten, was nur noch ein fernes Echo der Zeit war, als die Geschichte ihres Volkes wie ein Schatz vom Vater zum Sohn vererbt wurde, war der Name des Umiyane, den er in diesen Zeiten trug. Die Nguni-Familien, die vor mehr als vierhundert Jahren an seinen idyllischen Ufern lebten, hatten ihm diesen gegeben. Das Wasser der Goldenen Frau.
Jetzt lag der Stein dort in der afrikanischen Sonne und funkelte und schimmerte. Ein Hammerkopfvogel schnappte nach ihm, konnte ihn aber nicht aus dem Flussgrund lösen. Die Kette, an der er hing, hatte sich in etwas verhakt, das tief im Sand vergraben lag. Aufgebracht krächzend strich der Vogel davon.
Der Mann, der eben vor sein Haus getreten war, beachtete den Vogel nicht. Er war beunruhigt, denn der Erdstoß hatte ihn in der Nacht geweckt. Lautlos durch die Zähne pfeifend, untersuchte er die Hauswände auf Risse, fand aber zu seiner Erleichterung keine. Kurz nachdem er aus dem Gefängnis geflohen war, war er mit seiner Familie und Freunden in das Haus, dessen Eigentümer als verschollen galten, eingezogen. Ein Haus war schließlich dazu da, dass Menschen darin lebten, und seine Familie brauchte ein Haus. Stirnrunzelnd blickte er übers Land, vermisste das stete Rauschen des Flusses. Zu seinem Entzücken entdeckte er, dass der Umiyane sich so weit zurückgezogen hatte, dass sein Grundstück sich fast verdoppelt hatte. Er breitete die Arme aus und hielt sein Gesicht in die Sonne. Ein Mann konnte nie genug Land besitzen; die Gefängniszelle hatte er mit vierunddreißig anderen Männern teilen müssen.
Unwillkürlich fasste er sich an die Schulter. Selbst nach fast zwei Jahren war die Schusswunde nicht so verheilt, wie er es erhofft hatte, trotz der Kräuter, mit denen seine Frau sie behandelt hatte. Die Hände in die Taschen seiner löcherigen Hosen vergraben, ging er zurück ins Haus. Als er es betrat, entdeckte er eine Schlange unter dem zerschlissenen Rieddach. Er zog seine Pistole aus dem Hosenbund, erschoss das Reptil, trug es am Schwanz nach draußen und legte es gut sichtbar auf den Weg. Es hieß, dass die Artgenossen dann das Haus meiden würden.
Zufrieden genehmigte er sich einen tiefen Schluck aus der Flasche, die er kürzlich bei einem kleinen nächtlichen Einkaufstrip durch die Häuser der weiteren Umgebung hatte mitgehen lassen.
Von dem schimmernden Stein am Rand des Flussbetts ahnte er nichts.
2
Im fernen London verursachte das Erdbeben nur zackige Ausschläge der Seismografen im Geologischen Institut und wurde in den allgemeinen Nachrichten von BBC World nach den Überschwemmungen in Pakistan mit zwei Sätzen erwähnt. Mosambik und das angrenzende Zululand waren zu weit entfernt, nicht nur in Meilen. Soweit es die meisten Londoner und ihre Landsleute betraf, hätte die Gegend ebenso gut auf dem Mond liegen können, so wenig berührte es sie, was dort passierte. Die Ölpreise waren in nie geahnte Höhen gestiegen, Victoria B. gab bekannt, sich nun doch von David trennen zu wollen, und Prinz William schien entschlossen zu sein, die hübsche Kate zu heiraten. Das war es, was die Leute interessierte.
Der Oktober war im Süden Englands mit einem Feuerwerk von blutroten Sonnenuntergängen und goldenem Blätterregen verloschen, die letzten Zugvögel waren längst über den südlichen Horizont verschwunden, und die Brunftschreie der Rothirsche verhallten in den Wäldern. Der November stürmte mit frühem Frost und schweren Wolken heran, heulte um Londons Häuserecken herum, riss die Blätter von den Bäumen und peitschte eiskalte Regenschauer gegen die Fenster. Die Londoner schimpften mit vergnügter Hingabe über ihr Wetter, spannten die Regenschirme auf und gingen von kühlenden Sommergetränken zu Glühwein und Whisky über.
Benita Forrester umklammerte ihren Schirm mit erstarrten Fingern. Sie hastete gerade von der Tiefgarage zur Bank, als sie auf einmal wie angewurzelt stehen blieb. Passanten rempelten sie an, eine Schirmspitze bohrte sich ihr in die Seite, und die Bugwelle eines vorbeifahrenden Autos schwappte ihr über die Füße. Sie merkte es nicht einmal. Die Vision, die unvermittelt vor ihr aufgeblitzt war, hielt sie im Bann. Das Bild einer lichtüberschütteten Landschaft, von sonnenflirrendem Gras, von niedrigen Palmen mit tropfenförmigen Webervogelnestern, die wie schwere Früchte von den Blätterspitzen hingen, und eines unendlich weiten, gleißenden Himmels.
Es gehörte zu einer anderen Zeit, zu ihrem anderen Leben, das heute nur noch ein schwaches Schimmern war, ein flüchtiger Duft. Eine ferne Melodie tanzte in ihrem Kopf, Wärme streichelte sie, staubiger, süßer Grasduft kitzelte ihre Nase, und für den Bruchteil einer Sekunde bekam die innere Mauer, hinter der sie vor achtzehn Jahren alles vergraben hatte, einen Riss, und diese entsetzliche Sehnsucht raste wie ein Feuerstoß durch ihren Körper. Benita rannte weiter, immer schneller, spürte dankbar, dass die eisigen Nadelstiche des Regens das Feuer abkühlten und die Bilder allmählich im Nebel verschwinden ließen. Sie stemmte sich gegen den treibenden Regen und hielt die durchweichte Papiertüte mit ihrem Frühstück an die Brust gepresst.
Wie jeden Morgen war sie erst nach dem letzten Läuten ihres Weckers aufgewacht und nach einer hastigen Dusche ohne einen Bissen aus dem Haus gehetzt. Ihr Gesicht machte sie sich im trüben Licht der Untergrundbahn zurecht, war froh, dass ihre natürliche Hautfarbe dafür sorgte, dass sie nicht so bleich und elend wirkte wie ihre winterweißen Mitmenschen.
Da es ihr häufiger passierte, dass sie den Wecker überhörte, war es ihr längst zur Routine geworden, sich Muffins und Cappuccino im Plastikbecher in der Nähe der Bank an einer Imbissbude zu kaufen, die einem glutäugigen Italiener mit großer Nase gehörte, der sie seit Jahren hoffnungslos anhimmelte.
Während er den Cappuccino in einen Plastikbecher laufen ließ, ihn aufschäumte und die frischesten Muffins für sie einpackte, verschlang er sie mit den Augen und träumte, eines Tages diesen herrlichen, großzügigen Mund auf seinem fühlen zu dürfen.
»Ciao, bella«, rief er ihr nach, wenn sie sich wieder ins morgendliche Gewühl stürzte, und schickte ihr einen heißen Kuss hinterher.
Nichts von diesen verborgenen Leidenschaften ahnend, vertilgte Benita Cappuccino und Muffins meist gleich hier an einem der Stehtische, die der Budenbesitzer für seine Kunden aufgestellt hatte. War sie wie heute zu spät dran, verschlang sie ihre Muffins auf dem Weg zur Bank. Da es jedoch wie aus Kübeln schüttete, entschied sie, an ihrem Arbeitsplatz zu frühstücken. Dabei würde sie sich schon einen ersten Überblick über die internationalen Märkte verschaffen können.
Mit einem Satz sprang sie über die große Pfütze, die sich vor dem Eingang zur Bank gebildet hatte, schloss ihren Schirm in einem Tropfenregen und ließ sich im Strom ihrer Kollegen durch die Drehtür ins warme Innere des Gebäudes spülen und weiter in den voll gepackten Aufzug, in dem es nach nasser Wolle roch und wo ein Stimmengewirr herrschte, dass ihr die Ohren zu platzen drohten. Im sechsten Stockwerk entfloh sie dem Gedränge und strebte ihrem Büro zu.
»He, Benita, wir feiern am Samstag eine Party. Champagner in Strömen, Kaviar kiloweise. Das Übliche also. Kommst du?«
Sie drehte sich nach dem Sprecher um, erkannte einen der Geier, einen der Händler, die in einem großen Saal mit Dutzenden anderen Händlern vor dem Computer saßen und die Börsenkurse belauerten wie hungrige Geier ihre Beute, was ihnen ebenjenen Spitznamen eingebracht hatte. Dieser Geier hieß Jeremy, lebte mit zwei der anderen Geier aus Bequemlichkeitsgründen in der sogenannten Geier-WG zusammen und war seit ihrem ersten Arbeitstag in der Bank hinter ihr her. Die Partys der drei waren legendär. Jede Menge Alkohol, Kokain, Kaviar, Fingerfood aus dem besten Sushi-Restaurant; sexuell frustrierte Kerle, deren zeitfressender Job ihnen keine Gelegenheit für elementare menschliche Bedürfnisse ließ, und Schwärme von auf Hochglanz lackierten, ebenso frustrierten Bankerinnen, deren biologische Uhr so laut tickte, dass man kaum eines ihrer Worte verstehen konnte.
Benita erinnerte sich nur zu gut an den Morgen nach der letzten Party von Jeremy. Die rasenden Kopfschmerzen und die würgende Übelkeit waren die eine Sache gewesen, die Tatsache jedoch, dass sie sich kaum mehr an den Abend erinnern konnte, jagte ihr geradezu flammende Scham ins Gesicht. Die Vorstellung, auch nur für kurze Zeit die Kontrolle über sich abgegeben zu haben, entsetzte sie. Nach einigen schlaflosen Nächten zwang sie sich, Jeremy zu fragen, was während dieser verlorenen Zeit so alles passiert sei.
»Nichts.« Er grinste. »Du warst blau. Wie du das mit dem einen Caipirinha geschafft hast, an dem du den ganzen Abend genuckelt hast, ist mir allerdings ein Rätsel.«
Sie war überzeugt, dass ihr jemand etwas in den Drink getan hatte. Danach hielt sie sich von den Partys der Geier fern.
»Um acht Uhr bei uns. Ich schick dir ein Taxi«, drängte Jeremy jetzt.
»Keine Zeit«, flötete sie und entwischte ihm.
Fünf Minuten später summten ihre drei Computer, und lange Zahlenkolonnen bauten sich auf. Die Bildschirme nicht aus den Augen lassend, entledigte sie sich ihrer durchnässten Stiefel und stieg in ihre hochhackigen Pumps. Dann setzte sie sich an den Schreibtisch und begab sich in ihre virtuelle Welt der internationalen Kapitalmärkte, in der sie sicher war und sich zu Hause fühlte. Konzentriert registrierte sie die Veränderungen, während sie abwesend an einem Muffin knabberte.
Henry Barber war ebenfalls spät dran und stürzte aus dem Aufzug seines Apartmentgebäudes hinaus auf die Straße, wo er prompt auf dem schmierigen Blätterteppich des schlecht gefegten Bürgersteiges ausrutschte. Er stieß einen lauten Fluch aus und fing den Sturz reflexartig mit dem rechten Arm ab, der mit hörbarem Knacks an mehreren Stellen brach. Eine Stunde später fand er sich im Krankenhaus wieder, wo ihm ein mürrisch dreinschauender Arzt erklärte, dass der Arm operiert werden müsse, und zwar noch heute. Stetig vor sich hin schimpfend, einerseits aus Frustration, andererseits weil der Arm höllisch schmerzte, wählte Henry die Durchwahlnummer von Miranda Bell im Vorzimmer von Sir Roderick Ashburton, dem Vorsitzenden der Privatbank, dessen leitender Angestellter er war, und meldete sich für zwei Tage krank. Anschließend rief er Benita an, deren direkter Vorgesetzter und Liebhaber er war.
»Für zwei Tage bin ich weg vom Fenster«, knurrte er. »Aber ich werde von zu Hause aus arbeiten. Bring mir bitte den Stapel Vorgänge vorbei, die in meiner obersten Schreibtischschublade liegen, und am besten gleich die Whiskyflasche aus der untersten dazu – es tut wirklich höllisch weh.« Er stöhnte auf, weil die Krankenschwester bereits den Zugang zu seiner Vene legte. »Und hol mich hier raus!«
Er glaubte die Worte zu schreien, aber sie erreichten Benita nur als raues, schwächer werdendes Flüstern, als das Beruhigungsmittel zur Vorbereitung der Operation ihn wie eine heiße Welle durchflutete.
»Sprich lauter, ich versteh dich nicht«, sagte Benita.
Ein höhnisches Schnauben kam durch die Leitung, und eine barsche weibliche Kommandostimme, die sie unangenehm an ihre Mathematiklehrerin erinnerte, teilte ihr mit, dass Mr Barber für die nächsten Tage nirgendwohin gehen werde; es handele sich um einen komplizierten Bruch, und vor dem morgigen Tag brauche sie gar nicht vorbeizukommen. Dann tönte nur noch das Besetztzeichen in ihr Ohr.
Unmittelbar darauf rief Miranda Bell an und teilte ihr mit, dass Sir Roderick Ashburton sie zu sehen wünsche. »Sofort. Er hat schlechte Laune.«
Benita verzog das Gesicht. Sie stopfte sich schnell den letzten Rosinenmuffin in den Mund, zog den Deckel vom Plastikbecher ab und spülte das klebrige Gebäck mit dem längst erkalteten Cappuccino hinunter. Ihrem Chef mit leerem Magen gegenüberzutreten war nicht ratsam. Er brachte es fertig, sie auf der Stelle in den entferntesten Zipfel Schottlands oder sogar auf den Kontinent zu schicken, um einen Klienten der Bank zu besuchen, und dann war es wahrscheinlich, dass sie den ganzen Tag nichts zwischen die Zähne bekam.
Sie warf den leeren Becher in den Papierkorb und fuhr sich mit beiden Händen durchs Haar, um die Lockenpracht aufzulockern. Nach einem prüfenden Blick in den Spiegel frischte sie ihren Lippenstift auf und malte den Lidstrich nach. Auf dem Weg aus der Tür zog sie die Jacke ihres olivfarbenen Tweedkostüms über und stand Minuten später im Vorzimmer des Vorstandsvorsitzenden. Miranda Bell, blond, schlank, energisch und wie immer in einem perfekt sitzenden dunklen Kostüm, bedeutete ihr mit einer Handbewegung, zu warten. Benita setzte sich, schlug die Beine übereinander und versuchte zum wiederholten Mal das Alter der Frau hinter dem Schreibtisch einzuschätzen. Irgendwo um die fünfzig vermutete sie. Die eiserne Miranda, wie sie hinter ihrem Rücken genannt wurde, war die rechte Hand Roderick Ashburtons und die graue Eminenz der Bank. Schon zu Zeiten seines Vaters hatte sie die Bank mit eiserner Hand regiert, ihrem angebeteten Chef den Rücken freigehalten, und als dieser gestorben war, hatte sie ihre Loyalität auf den ältesten Sohn, Gerald, übertragen, der seinem Vater als Vorstandsvorsitzender der Familienbank gefolgt war. Seit der Gründung der Bank war diese Stellung grundsätzlich von einem direkten Abkommen des Gründers ausgefüllt worden, dafür sorgte die Tatsache, dass immer noch mehr als siebzig Prozent der Anteile von der unmittelbaren Familie gehalten wurden, in diesem Fall von Isabel Ashburton und ihren Söhnen Gerald und Roderick. Der Rest verteilte sich auf die weitere Verwandtschaft.
Unter Geralds Führung lief die Bank wie ein geöltes Uhrwerk, blühte und gedieh, bis er bei der letzten Fastnet-Segelregatta im Sturm vom unkontrolliert herumschwingenden Baum seiner Jacht an der Schläfe getroffen und bei dem anschließenden Sturz so schwer verletzt wurde, dass er voraussichtlich erst in einigen Monaten seinen Platz wieder würde einnehmen können.
Seitdem saß Roderick Ashburton auf dem überdimensionalen Chefsessel, und es war wohlbekannt, dass er es kaum erwarten konnte, ihn wieder zu räumen. Er konnte nicht verbergen, dass er Büroarbeit hasste und das trockene Finanzgeschäft verabscheute, aber es wurde gemunkelt, dass er neuerdings das Geld, das am Anfang eines jeden Jahres automatisch auf sein Konto überwiesen wurde, tatsächlich brauchte.
Vermutlich wusste nur Miranda Bell, wozu er das Geld verwendete, so wie sie alles wusste, was vor sich ging, aber es war sicherlich leichter, einen der großen Panzerschränke im Tresorkeller aufzubrechen, als ihr eine Information zu entlocken. Benita versuchte gar nicht erst, von ihr zu erfahren, was so brandeilig war, dass es nicht warten konnte, bis Henry wieder verfügbar war.
Ein grünes Licht blinkte diskret auf der Telefonanlage auf, und die eiserne Miranda stand mit einem Rascheln ihres eleganten Kostüms auf und öffnete die schwere Tür zu dem hallenartigen Büro ihres Chefs. »Miss Forrester, Sir Roderick.«
Roderick Ashburton, der hinter einem monströsen, mit Schnitzereien überladenen Schreibtisch saß, schaute nur kurz hoch, als sie den riesigen Raum mit schnellen Schritten durchquerte.
»Ah, Benita, guten Morgen. Setz dich.« Er deutete auf einen unbequem wirkenden Stuhl vor dem Schreibtisch. »Ist dein Pass in Ordnung? Wie lange ist er noch gültig?« Kein Lächeln, kühle Stimme, nichts als unverbindliche Höflichkeit im Blick.
Das Desinteresse, das er an den Tag legte, machte Benita so wütend, dass sie ihn mit Freuden erwürgt hätte, gleichzeitig musste sie aber zähneknirschend zugeben, dass ihre gekränkte Eitelkeit diesen Impuls hervorrief. Also beherrschte sie ihre Mimik und setzte sich. Die hohe Stuhllehne zwang ihr eine kerzengerade Haltung auf.
»Ja, und sechs Jahre«, beantwortete sie seine Fragen, bemüht, sich seinem geschäftsmäßigen Ton anzupassen.
Den Kopf leicht zurückgelegt, um ihren inneren Abstand zu verdeutlichen, musterte sie ihn. Obwohl er äußerst korrekt in konservatives Dunkelgrau mit Weste und blütenweißen Manschetten gekleidet war, wirkte seine athletische Gestalt in dem altmodischen Raum, dessen getäfelte Wände jahrhundertelange Tradition atmeten, fehl am Platz. Die Porträts vorangegangener Ashburtons, die an den Wänden hinter dem großen Schreibtisch aus rötlichem Kirschholz hingen, zeigten durchweg Männer in fortgeschrittenem Alter, die fett waren – mit aufgeschwemmten Zügen, die von einem zu ausschweifenden Leben, zu wenig frischer Luft und der Gier nach immer mehr gezeichnet waren.
Diese Gier konnte sie in dem klar geschnittenen Gesicht des jetzigen Vorstandsvorsitzenden nicht entdecken. Eine gewisse Härte war zwar da, aber keine Gier. Seine Bewegungen waren energiegeladen und voll kontrollierter Kraft, die nicht nur auf Muskeln beruhte, sondern, wie sie nur zu gut wusste, ihre Wurzeln in Ungeduld und Frustration hatte, als müsste er ständig seinen Bewegungsdrang unterdrücken. Es war der einzige Hinweis darauf, dass sich unter dem korrekten Anzug, hinter dem kühlen, geschäftsmäßigen Gehabe ein völlig anderer Mensch versteckte.
Das hatte sie selbst erlebt, und sie hatte sich weiß Gott bemüht, diese Erfahrung ein für alle Mal aus dem Gedächtnis zu löschen, aber da sie für Roderick Ashburton arbeitete und ihn fast täglich sah, hatte sie keine Chance. Auch jetzt stieg ihr zu ihrem Verdruss das verräterische Blut in den Kopf, musste sie wieder daran denken, wie sie sich benommen hatte, obwohl sie doch jeden Tag in der Zeitung lesen konnte, dass Roderick Ashburton ein Jäger von Frauen war, ein rücksichtsloser Raubritter von internationalem Ruf. Seine Beute waren die Schönsten der Schönen, die Berühmtesten, die Blondesten und mit Vorliebe die, die als unnahbar galten oder die Frauen anderer Männer waren. Erschien er auf einer Party, im Schlepptau immer eine Gruppe junger Männer, die sich die »Jungen Wilden« nannten und ihm folgten wie Pilotfische einem Hai, war seine Wirkung die jenes ewig hungrigen Raubfisches, der mitten in einen Schwarm Sardinen stieß.
Gerüchte umschwirrten ihn wie Fliegen verdorbenes Fleisch. Es hieß, dass er an seinen vier Bettpfosten für jede Eroberung eine Kerbe anbringe, und bereits den dritten Satz Pfosten benötige. Heute noch krümmte sie sich innerlich vor Scham, dass sie noch vor einem Jahr wild entschlossen gewesen war, nicht nur eine dieser Kerben zu werden, koste es, was es wolle, sondern vor allen Dingen, die letzte zu sein.
Ein Naturereignis hatte ihn ihr Adoptivvater Adrian einmal genannt, aber ein höchst unerfreuliches.
»Ich hoffe, du fällst nicht auch auf ihn herein«, hatte der ehemalige General streng hinzugefügt.
Sie hatte spöttisch gelacht. »Roderick Ashburton? Auf diesen Playboy? Ganz bestimmt nicht. Außerdem entspreche ich wohl nicht seinem Beuteschema.«
Nur wenige Monate nach dieser Unterhaltung hatte es sie getroffen. Völlig unvorbereitet. Dabei kannte sie ihn schon seit Jahren, als es passierte. Die Forresters und die Ashburtons waren Nachbarn, und man traf sich gelegentlich auf Partys oder bei irgendwelchen Sportveranstaltungen und redete sich mit dem Vornamen an. Aber Roderick Ashburton, der einige Jahre älter war als sie und gesellschaftlich Welten entfernt, gehörte an den äußersten Rand ihres Lebens. Meist erfuhr sie von seinen Eskapaden durch die Klatschpresse, in der er regelmäßig auftauchte. Sein Leben fand auf der Überholspur statt. Sein Wagemut war legendär und grenzte ihrer Ansicht nach an Todessehnsucht. Ständig forderte er den Teufel heraus, fuhr zu schnell, tauchte zu tief, kletterte zu hoch, und immer hatte er eine Frau im Arm, schwüle, sinnliche Frauen, mit lüsternem Schmollmund und geldgierigen kalten Augen. Er sah blendend aus, ohne Zweifel, um die eins neunzig groß, hellblaue Augen unter dichtem dunklem Haar und ein Freibeuterlächeln, das den Frauen die Knie weich werden ließ. Die Verachtung jedoch, die er dem Leben im Allgemeinen und den meisten Menschen entgegenbrachte, stieß Benita ab.
Bis zu jenem Spätsommerabend in London vor einem Jahr, als sich die ungewöhnliche Hitze in einem Gewitter entlud, das selbst im stärksten Mann die Urangst vor dem Zorn der Götter erweckte. Innerhalb von Minuten war der Tag zur Nacht geworden, der Himmel öffnete sich, und ein Wolkenbruch ging hernieder, der ihr kleines Auto in den herunterstürzenden Fluten jämmerlich verrecken ließ.
Eine Regenbö schlug gegen das Fenster, und ihr Blick glitt ab. Sie schaute in den grauen November hinaus, zurück zu jenem Abend.
Sie war ausgestiegen, um ein Taxi zu suchen, und fand sich in einer Gespensterwelt wieder. Von violetten Stroboskopblitzen wie festgenagelt, blind vom peitschenden Regen, der so dicht war, dass sie meinte, Wasser zu atmen, stand sie mitten auf dem Picadilly Circus unter der goldenen Eros-Statue und fluchte wie ein Bauarbeiter. Nirgendwo war ein Taxi zu sehen, nur gelegentlich huschte trübes Scheinwerferlicht geisterhaft an ihr vorbei und verschwand im silbrigen Grau. Sie schrie und winkte, aber keiner schien sie zu sehen.
Nach einer Ewigkeit rutschte ein flacher Sportwagen an ihr vorbei, der eine Bugwelle vor sich her schob, die ihr bis zur Brust spritzte. Wütend schleuderte sie ihm ein unflätiges Schimpfwort hinterher, da leuchteten die Bremslichter wider Erwarten auf, und der Wagen setzte zurück. Die Tür flog auf, ein Mann lehnte sich heraus und inspizierte sie schweigend.
»Pass doch auf, du Idiot!«, schrie sie ihm entgegen, wischte sich mit beiden Händen ihr nasses Haar aus den Augen, um erkennen zu können, ob der Mann vertrauenswürdig aussah, ob sie wegrennen oder Schutz bei ihm suchen sollte.
»Wasserleichen fluchen nicht, daher schließe ich messerscharf, dass du noch nicht ertrunken bist und es sich lohnt, dich zu retten. Vielleicht bekomme ich ja den Viktoria-Orden dafür.«
Die gedehnte Sprechweise, das Freibeutergrinsen und die unverschämten blauen Augen waren unverkennbar gewesen. Vor Erleichterung hatte sie einen Jauchzer ausgestoßen.
»Roderick! Dem Himmel sei Dank!« Ohne auf seine Einladung zu warten, sprang sie mit einem Satz in den Wagen und schlug die Tür zu. Sein nasser Pullover lag zerknüllt auf dem Boden zu ihren Füßen. Sie schob den Pulloverklumpen beiseite und wandte sich ihm zu. Das schwarze T-Shirt klebte ihm am Oberkörper, und sie konnte nicht umhin zu registrieren, dass sich seine Muskeln höchst aufregend darunter abzeichneten. Die Jeans hatte er aufgekrempelt, weil er bis zu den Knien nass war. Schuhe und Strümpfe hatte er ausgezogen und fuhr barfuß.
Aufatmend lehnte sie sich im cremefarbenen Ledersitz zurück und lächelte ihn fröhlich an. »Du bist ein Held! Das war Rettung in höchster Not. Dir gebührt mindestens der Viktoria-Orden. Ich werde eine Eingabe bei der Queen machen. Hast du vielleicht ein Handtuch an Bord?«
Statt ihr eine Antwort zu geben, betrachtete er mit grimmigem Ausdruck die Pfütze, die sich sofort um ihre Füße gebildet hatte, und den sich rasch verbreitenden nassen Fleck auf den hellen Polstern. Mit einer unbeherrschten Geste schleuderte er seine tropfenden Haare aus den Augen.
»Steig doch ein, liebe Benita, es ist mir eine Freude, mir von dir die Polster ruinieren und mein Auto unter Wasser setzen zu lassen«, knurrte er sie an. Keine Spur von Freundlichkeit milderte den schneidenden Sarkasmus seiner Worte.
Der Ton stachelte sie sofort auf. So konnte er mit den Frauen sprechen, mit denen er gewöhnlich herumzog, aber nicht mit ihr.
»Was ist das für ein lausiges Auto, das nicht einmal ein bisschen Regen vertragen kann? Außerdem hast du deinen Sitz doch auch schon ruiniert.« Kratzbürstig deutete sie auf die Nässe, die sich um seine eigene Sitzfläche ausbreitete.
Er funkelte sie an. »Was ich mit meinem Wagen anstelle, geht dich nichts an, und wenn ich ihn gegen die Wand setze! Von meinen Gästen erwarte ich, dass sie ihn pfleglich behandeln, und du bist nicht einmal ein Gast!«, brüllte er. »Dich nehme ich doch nur aus purer Barmherzigkeit mit! Ich könnte dich hier auch ertrinken lassen!«
»Wo hätte ich mich denn hinsetzen sollen?«, schrie sie zurück. »Auf den Boden? Dir zu Füßen? Das würde dir wohl so passen, du dämlicher Macho! Halt sofort an und lass mich aussteigen! Auf der Stelle!«
Unvermittelt schlug seine Stimmung um. Er schenkte ihr sein breitestes Piratengrinsen und ließ die Zentralverriegelung einschnappen. »Dafür wirst du mir büßen, meine Liebe, ich werde dich entführen und mir eine angemessene Strafe ausdenken.« Dann trat er aufs Gas, und der Porsche schoss vorwärts. Die Motorhaube verschwand fast unter der aufspritzenden Bugwelle.
Es half nichts, dass sie schrie und tobte und ihn mit sehr undamenhaften Namen belegte, er lachte nur lauter und fuhr noch schneller, ließ den schweren Wagen halsbrecherisch um die Kurven schleudern.
Doch plötzlich überkam es sie. In einer Aufwallung von blinder Wut packte sie das Steuer und verriss es. Reaktionsschnell griff Roderick Ashburton sofort nach, konnte aber nicht verhindern, dass der Wagen auf den überfluteten Straßen ins Schleudern geriet, gegen den Kantstein knallte, zurücksprang und quer über die Straße in den entgegenkommenden Verkehr katapultiert wurde. Haarscharf verfehlten sie einen Pkw und schleuderten unaufhaltsam auf einen Fernlaster zu, dessen Fahrer in Panik auf der Hupe lehnte. Wie ein urweltlicher Brunstschrei hallte ihr Dröhnen durch die Dunkelheit, mischte sich mit dem Kreischen von Metall, Rodericks groben Flüchen und ihren Schreien.
Roderick Ashburtons Erfahrungen als Rennfahrer hatte ihnen am Ende das Leben gerettet. Automatisch riss er das Steuer herum, nutzte das Schleudermoment seines schweren Sportwagens und setzte ihn mit der Fahrerseite an eine Hausmauer. Das rote Metall zog eine Leuchtspur von sprühenden Funken, ehe der Wagen mit ohrenzerfetzendem Kreischen langsam zum Stehen kam. Donner krachte, Blitze zuckten durch die gespenstische Regenwelt und erleuchteten das Wageninnere. Langsam erwachte Benita aus ihrer Schreckensstarre und sah zu ihm hinüber. Das Herz hämmerte gegen ihre Rippen.
Roderick Ashburtons Hand zitterte, als er den Motor abschaltete. Er umklammerte das Steuerrad, als müsste er sich festhalten. Sein Kopf war auf die Brust gefallen. Für ein paar Sekunden saß er nur da und atmete tief ein und aus.
Endlich hob er den Kopf und wandte sich ihr zu. Ein Blitz erhellte sein von mörderischem Zorn verzerrtes Gesicht. Unwillkürlich fuhr sie zurück und drückte sich in die äußerste Ecke des Sitzes, war in dieser Sekunde überzeugt, dass er sie schlagen würde. Sie war sich voll bewusst, dass das, was sie getan hatte, nicht zu entschuldigen war. Ihr dummer Anfall von Jähzorn hätte sie beide das Leben kosten können.
»Es … es tut mir leid«, flüsterte sie und berührte ihn mit den Fingerspitzen am Arm.
Die Geste schien ihn noch mehr aufzubringen. Er schüttelte ihre Hand ab. »Bist du völlig verrückt geworden? Oder lebensmüde?« , schrie er sie an. »Ist dir klar, dass wir beide fast draufgegangen wären? Wenn du dich umbringen willst, mach das gefälligst woanders, und verschone mich dabei!« Er lehnte sich abrupt über sie und stieß die Beifahrertür auf. »Raus!«
Sie rührte sich nicht. »Es tut mir verdammt noch mal leid, hörst du?«, zischte sie. »Ich werde den Schaden bezahlen.«
Vor Zorn sprühend, hatte er sie angestarrt. »Na, willst du nicht anfangen zu heulen, um mich weichzuklopfen, oder über die blutige Beule an deinem Kopf lamentieren?« Er zeigte seine Zähne in einem sarkastischen Grinsen. »Willst du dich mir nicht an den Hals werfen und versprechen, alles zu tun, um es wieder gutzumachen? Na, komm schon, so machen das doch alle!«
Jetzt geriet sie wieder in Rage. »Aber nicht ich! Ich denke gar nicht daran, ich bin doch nicht eins von deinen Flittchen«, schrie sie. »Ich steh für das gerade, was ich getan habe. Schick mir die Rechnung, Sir Roderick Mistkerl Ashburton.«
Damit wollte sie aussteigen, aber seine Hand schoss vor und packte sie am Arm.
Für eine Minute starrte er sie an, wortlos, unter gesenkten Brauen, das Gesicht hart, wie aus Granit gemeißelt. Dann beugte er sich vor und hob die andere Hand.
Sie versteifte den Rücken in Erwartung eines Schlages, hatte sich aber so weit in die Ecke gepresst, dass sie nicht mehr zurückweichen konnte. Zu ihrer Verwirrung legte er die Hand sanft an ihre Wange.
Es geschah in diesem Augenblick. Seine Berührung wirkte wie ein elektrischer Schlag, und unvermittelt hatte sie das unwirkliche Gefühl zu fallen, ganz langsam, wie in Zeitlupe, war drauf und dran, in diesen hellen Augen zu ertrinken. Er sagte etwas, was sie nicht verstand, lächelte nicht dabei, sondern hielt sie nur mit diesem unglaublich intensiven Blick fest.
Draußen zerschnitt ein greller Blitz die Schwärze der Nacht, Donner krachte, das Ende der Welt schien gekommen zu sein. Die Hitze seiner Haut brannte auf ihrer, machte sie willenlos, sie hob die Arme und lieferte sich dieser Hitze aus, seinen Händen, seinem Mund, hörte ein raues, kehliges Stöhnen, wusste nicht, ob es seines war oder ihres.