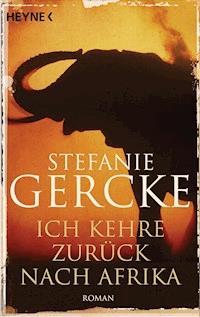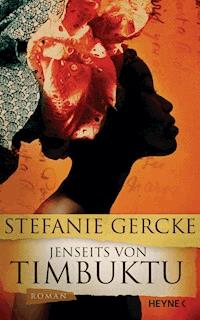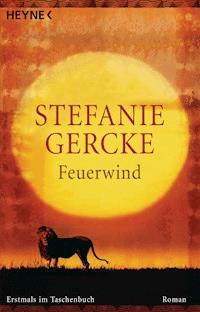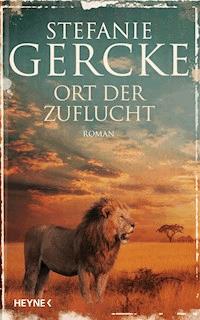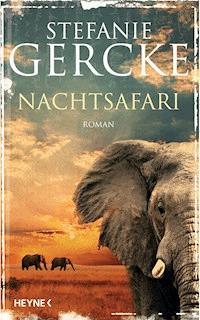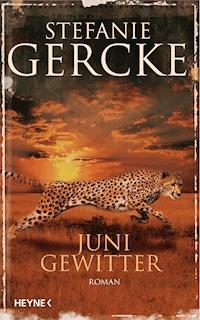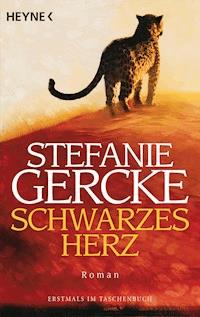
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der neue große Afrika-Roman von Stefanie Gercke
Die kritische TV-Journalistin Lisa Darling gilt in Südafrika als das »Gewissen der Nation«. Ihre Welt droht zusammenzubrechen, als der Verdacht aufkommt, dass ihr Vater zur Zeit der Apartheid bei der Geheimpolizei war. Lisa, die ihren Vater über alles liebt, will die Wahrheit herausfinden... und macht eine grausame Entdeckung.
Das moderne Südafrika und die Schatten der Vergangenheit: ein epischer Afrika-Roman, wie ihn nur Stefanie Gercke so authentisch schreiben kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1100
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1
Israel Mabaso war glücklich. Er raste mit seinem Motorrad über die gewundene Küstenstraße am Fuß des Tafelbergmassivs. Der Himmel leuchtete wie aus blauem Kristall, das Meer schimmerte, und Kapstadts Silhouette flimmerte im Licht der aufgehenden Sonne. Israel hatte die Straße für sich allein und gab Vollgas. Neunzig ungezügelte Pferdestärken röhrten auf, die Tachonadel schnellte auf 150 Stundenkilometer. Überschäumend vor Lebensfreude, schrie er sein Glück in den starken Südoststurm, der über Nacht aufgekommen war – jener Sturm, den die Kapstädter den Kap-Doktor nannten.
Tief über den Lenker geduckt, nahm Israel eine scharfe S-Kurve, verlagerte dabei mit Schwung sein Gewicht nach rechts, wobei sich die schwere Maschine gefährlich schräg legte, so dass zwischen seinen jeansbehosten Beinen und der Straßenoberfläche nur wenige Zentimeter Luft blieben. Israel besaß das Motorrad erst seit zwei Tagen und hatte zuvor auch noch nie auf einem gesessen. Als ihm der Kap-Doktor jetzt jählings eine tückische Orkanbö in die Seite schleuderte, verlor er die Kontrolle. Der Metallkoloss bockte unter seinen Händen, kam ins Schlingern, kippte um und begrub dabei sein rechtes Bein unter sich. Unrettbar festgeklemmt, schlitterte Israel über den Asphalt. Metall kreischte, Funken sprühten, der Motor heulte, und Sekunden später krachte die Maschine in die Felswand, die die Straße begrenzte.
Der linke Handgriff des Lenkers bohrte sich durch die viel zu dünne Lederjacke tief in Israels Brust, brach ihm etliche Rippen und drückte sie nach innen, wo sie mehrere große Blutgefäße zerrissen. Der Motorengeräusch stoppte abrupt, nur das Ticken der überhitzten Maschine war noch zu hören. Israel lag als blutiges Bündel eingeklemmt zwischen der Felswand und dem zerfetzten Metall und gab keinen Laut mehr von sich.
Aber Israel Mabaso starb nicht. Jedenfalls nicht gleich, nicht hier auf der Straße. Er schaffte es, lange genug am Leben zu bleiben, um auf seinem Weg in die Hölle eine Lawine von Ereignissen loszutreten, die ihre Opfer so gierig verschlang wie ein Löwe seine Beute.
Nachdem er Israel zur Strecke gebracht hatte, fegte der Kap-Doktor durch die Vororte der Stadt, wo er Lisa Darling erfasste, die eben aus der Haustür trat, bereit, auch mit ihr seinen Schabernack zu treiben. Sie allerdings verlor nicht die Balance, sondern lachte und breitete ihre Arme aus, nutzte den Schwung und wirbelte in einer Pirouette über den schmalen Gehweg. Sekundenlang hatte sie das berauschende Gefühl, fliegen zu können, dass der Sturm sie mit sich tragen würde, hinauf in die funkelnde Freiheit des Himmels. Für Lisa Darling gehörte der Kap-Doktor zu Kapstadt wie der Nebel zu London.
Begonnen hatte alles etwa zwei Wochen zuvor in den Brüllenden Vierzigern, den sturmgepeitschten subantarktischen Breiten, wo die eisigen Wasser des Südatlantiks auf die wärmeren des Indischen Ozeans prallten. Dort war das Zuhause des Kap-Doktors. Meist vergnügte er sich damit, um die Felsspitzen der kargen Inseln zu fegen, die wie Fliegenkot die Landkarte sprenkelten, die Wellenkämme zu weißem Schaum zu schlagen und das Gefi eder der Pinguine zu zerzausen.
In den im Hochsommer vorherrschenden Wetterverhältnissen seiner Heimat jedoch gelang es ihm in regelmäßigen Abständen, sich zu einem Sturm aufzublähen. Gierig verschlang er dann die Energie, die sich aus dem Temperaturunterschied zwischen den zwei Ozeanen ergab, wuchs, wurde stärker und immer ungestümer, bis ihn der Übermut packte und er sich auf den Weg nach Norden zum Südzipfel Afrikas machte, um dort als Kap-Doktor sein Unwesen zu treiben. In der »Mother-City« Südafrikas angekommen, heulte er durch die Häuserschluchten, fuhr bis in die kleinsten Ecken und trug den Schmutz fort ins Meer, bis die Luft wieder kristallklar war.
Heutzutage war es der stinkende Smog, den er wegblies, früher beseitigte er den Pesthauch, der aus den mit Fäkalien verseuchten Straßen aufstieg und Krankheit und Tod verbreitete, und das brachte ihm seinen Namen ein.
Im Januar 2009 waren die Verhältnisse über der Île de la Possession, die ungefähr dreitausendfünfhundert Kilometer südsüdöstlich des Kaps der Guten Hoffnung im frostigen Süden des Indischen Ozeans wie ein Trutzturm aus den Wellen ragte, ideal. Noch allerdings war der Kap-Doktor nur ein harmloser Wind, noch ging seine Stimme in dem brüllenden Chaos unter, das im Elefanten-Teich herrschte, wie Wissenschaftler die seichte Meerwasserlagune nannten, die sich im Laufe der Jahrtausende zwischen den schroffen Klippen an der nördlichen Küste der Insel gebildet hatte.
Hunderttausende von Pinguinen schnatterten aufgeregt durcheinander, Möwen flatterten in kreischenden weißen Wolken über der Insel, See-Elefantenbullen trieben röhrend ihren Harem zusammen. Die Paarungszeit lag hinter ihnen, und sie waren ausgehungert und übellaunig. Der Alpha-Bulle – der Sultan, dessen Harem fünfundzwanzig Kühe und fast die doppelte Anzahl glänzend schwarzer Jungtiere umfasste – maß über sechs Meter. Vor der Paarungszeit hatte er noch dreieinhalb Tonnen gewogen. Jetzt waren seine sonst so prachtvoll glänzenden Speckfalten verschwunden. Die Flanken waren eingefallen und das Fell mit einer rostig braunen Kruste seiner Exkremente überzogen. Während er bei seinen Kühen emsig für Nachwuchs sorgte, hatte er es nicht gewagt, sie auch nur für einen einzigen Tauchgang im Meer den jüngeren Bullen, die ihm ständig brüllend den Anspruch auf den Thron streitig machten, preiszugeben. Seit Beginn der Saison hatte er deshalb nichts mehr gefressen und auch keine Gelegenheit gehabt, sein Fell im Wasser zu säubern.
Jetzt endlich, nach getaner Arbeit, robbte er müde ins eisige Meer, tauchte ab in die klaren Tiefen und machte sich hungrig auf die Suche nach Fischschwärmen und Tintenfi schen.
Über den Wellen aber brodelte die Wetterküche. Der Wind schwoll zu einem ausgewachsenen Sturm an und drehte nach Nordwest, wobei sein Hunger immer größer wurde, seine Gewalt sich mit jeder Meile steigerte, bis er seine zerstörerische Stärke erreicht hatte. Der Kap-Doktor war geboren.
Der erschöpfte Sultan, der gerade ein paar saftige Tintenfische verschlungen hatte und sich treiben ließ, spürte davon nichts, auch nicht, dass sich die Strömung stetig verstärkte und er mit unwiderstehlicher Kraft zu den südlichen Küsten des dunklen Kontinents mitgerissen wurde.
Seine verhängnisvolle Reise ins ferne Kapstadt hatte begonnen.
Zwei Wochen später näherte sich der Kap-Doktor der Küste. Im Sturmschritt überquerte er den Agulhasstrom und saugte sich über den warmen Gewässern der False Bay mit Feuchtigkeit voll. Über der Millionenstadt am Kap herrschte an diesem Februartag das gefürchtete Inversionsklima. Die Rauchschwaden der Holzfeuer, die von den Slums von Khayelitsha herüberdrifteten, die Abgasfahne der nahe gelegenen Raffinerie und die bläulichen Wolken von Auspuffgasen der Autoschlange, die sich durch die Innenstadt wälzte, vereinigten sich zu einem übelriechenden Smog, der unter der mörderischen Hitzeglocke in den Häuserschluchten gefangen lag.
Energiegeladen marschierte der Kap-Doktor an der Ostflanke des Tafelbergs hoch und spuckte die weiße Wolke aus, die sich als das berühmte Tischtuch über das Plateau legte. Derart erleichtert, pumpte er sich zu einem ernsthaften Sturm auf, fegte um den Devil’s Peak herum, wühlte das Meer auf, schlug die Wellenkronen zu weißer, schaumiger Gischt und trieb sie wie Schneeschleier über die schwarze Wasseroberfläche, ehe er sich über die Hang-Klippen hinab auf Kapstadt stürzte und mit urgewaltiger Kraft durch die Straßenschluchten brandete, wo er im Nu den klebrigen braunen Schleier, der die Stadt zu ersticken drohte, zerriss. In seiner Raserei warf er Bäume um, verwüstete Gärten, kippte Busse auf die Seite, deckte Dächer ab – und schleuderte Israel Mabaso mit seinem Motorrad in die Felswand.
Während der Sturm wie ein betrunkener Schläger durch die Straßen randalierte, zurrten und nagelten die Einwohner eilig alles fest, was davonzufliegen drohte. Diejenigen, deren Häuser am Strand standen, sicherten obendrein ihre Terrassen mit Sandsäcken. Wie immer ertrugen die Kapstäder das Ganze mit gelassener Heiterkeit. Sie wussten, dass der Kap-Doktor die Stadt blitzsauber fegen würde, ehe er seiner Spielchen müde wurde und irgendwann gelangweilt über den südlichen Horizont in die endlosen Weiten des Ozeans verschwand.
In seinem Sog erreichte auch der Sultan die südliche Spitze des Kaps. Bald kitzelte ein Geruch seine Nüstern, den er erst wenige Male zuvor gerochen hatte, trotzdem wusste er instinktiv, dass hinter dem Horizont eine immense Landmasse lag. Trockene Erde, von der Sommersonne aufgeheizt. Er sog die Luft tief in sein groteskes Riechorgan, spürte, dass es Zeit für ihn war, an Land zu gehen. Die Dreckkruste auf seinem Fell war im Wasser aufgeweicht, und schon lösten sich ganze Haarbüschel. Seit Tagen juckte ihn seine vernarbte Haut unerträglich. Die Mauser hatte begonnen, und für die nächsten Wochen brauchte er einen ruhigen Platz. Mit kräftigen Schwanzschlägen steuerte der Sultan auf die Küste zu.
Israel Mabaso ahnte natürlich nichts davon. Allerdings wäre er beruhigt gewesen, hätte er gewusst, dass der Kap-Doktor, der für sein Sterben verantwortlich war, jetzt eine Kettenreaktion ausgelöst hatte, die dafür sorgen würde, dass sein letzter Wunsch, nicht allein zur Hölle zu fahren, erfüllt werden würde.
Auch Lisa Darling erhielt keine Warnung, nicht den kleinsten Hinweis, dass der bizarre Vorgang, durch den ihr Leben für immer aus den Fugen geraten würde, soeben begonnen hatte.
Im Krankenhaus in der Innenstadt wachte Israel Mabaso von seinem eigenen Gestank auf und wurde sich mit brutaler Klarheit bewusst, dass sein Ende nahe war. Würde es nicht so höllisch wehtun, wann immer die Wirkung der Betäubungsmittel nachließ, hätte er vielleicht darüber gelacht, dass er – nach dem Leben, das er geführt hatte – ausgerechnet in einem Krankenhausbett starb. Durch Verletzungen, die er bei einem banalen Motorradunfall erlitten hatte.
Wie lächerlich und stillos das doch war. Keine Kugel aus dem Hinterhalt, kein Messerstich hatte ihn getroffen, nicht einmal die Sexseuche hatte er sich eingefangen. Er hatte immer angenommen, dass er mit einem Trommelwirbel und einer Verbeugung abtreten würde, ein spöttisches »so long« auf den Lippen. Aber jetzt verfaulte er bei lebendigem Leib und verwandelte sich in ein stinkendes Stück Aas. Was genau ihm den Brustkorb zerfetzt hatte, hatte ihm niemand erklärt, auch nicht, warum das Loch immer größer wurde. Im Grunde kümmerte es ihn nicht mehr. Meist trieb er auf den warmen Wellen eines Morphiumrauschs dahin, was ihm gelegentlich ein amüsiertes Kichern entlockte. Früher hatte er für einen solch herrlichen Rausch viel zahlen müssen. Nun aber genügte ein Druck auf die Klingel, und Schwester Paulina erschien mit der magischen Spritze in der Hand. Er stöhnte leise. In der Mitte seines Körpers brannte ein Höllenfeuer, und das Atmen fiel ihm immer schwerer. Automatisch tastete er nach der Klingel, doch nach kurzem Zögern ließ er seine Hand zurückfallen.
Seit er in einem klaren Augenblick den Doktor, der versucht hatte, ihn wieder zusammenzuflicken, erkannt hatte, beherrschte ihn nur ein einziger Gedanke: Er wollte das, was er in seinem Gedächtnis bisher an der tiefsten Stelle vergraben hatte, nicht mit hinübernehmen. Er wollte es loswerden. Es drückte ihm die Luft ab. Im übertragenen Sinn, denn noch hing er am Beatmungsgerät und konnte nicht sprechen. Bis er diesen verdammten Schlauch los war, musste er sich gedulden. Abgesehen davon, hätte er – wenn er wirklich ehrlich gegen sich selbst war – gerne Gesellschaft auf seinem Weg zur Hölle. Die Vorstellung, dass die anderen ihr Dasein unbehelligt und in bequemem Wohlstand genossen, das mit seinem Dahinscheiden obendrein noch deutlich sorgloser werden würde, wurmte ihn. Er gönnte es ihnen nicht, so einfach war das. Wenn er daran dachte, wie sie ihn behandelt hatten, fing der Monitor, der seinen Herzschlag überwachte, hektisch an zu piepen. Im Grunde war er ihnen nicht mehr wert gewesen als eine Fußmatte, über die man täglich hinwegtrampelte.
Ganz praktisch, oft unentbehrlich, aber eben doch etwas, an dem man sich die Füße abtrat.
Die Kraft, seinen Vorfahren eine Ziege als Opfer darzubringen, damit sie ihm erlaubten, sich zu ihnen zu gesellen, und nicht dazu verdammten, ruhelos bis in alle Ewigkeit durch die Hügel seines Heimatlandes zu geistern, hatte er nicht mehr. Aber das, was er dem Doktor mitzuteilen hatte, war besser als eine gewöhnliche Ziege. Seine Ahnen würden ihn mit offenen Armen empfangen, dessen war er sich sicher. Ziemlich, zumindest.
Mühsam wandte er den Kopf zum Fenster. Der Himmel, vom Rahmen in ein säuberliches Viereck geschnitten, flimmerte im Sonnengefunkel, eine Möwe wurde vom Sturm wie ein Papierfetzen durch sein Blickfeld gewirbelt, wurde immer kleiner, bis sie schließlich im schimmernden Blau verschwand. Israel spürte, dass seine Seele sich von seinem zerbrochenen Körper befreien wollte, spürte den Wind der Freiheit, der die Möwe davongetragen hatte. Ein Schluchzen stieg ihm in die Kehle, aber es blieb im Beatmungsschlauch hängen. Bittere Tränen rannen ihm den Hals hinab ins Kissen, das schon vollkommen schweißdurchtränkt war. Seine Poren sonderten unglaubliche Mengen Flüssigkeit ab. Die Klimaanlage war wieder einmal ausgefallen, und die Februarhitze strömte ungehindert durch die weit geöffneten Fenster. Wie eine schwere Decke lastete sie auf den Kranken, die mit Israel in dem Sechsbettzimmer dem Tod entgegendämmerten.
Obwohl draußen blendende Helligkeit herrschte, kam es Israel so vor, als würde das Licht allmählich schwächer werden. Angestrengt starrte er in das gleißende Himmelsviereck, als ob er das Licht festhalten wollte, während seine Gedanken ziellos durch sein vergangenes Leben wanderten. Das Abbild der strengen Schwestern der Missionsstation, wo er seine ersten Schuljahre verbracht hatte, schwamm aus den trüben Tiefen seiner Erinnerung an die Oberfläche, gleichzeitig hörte er den dünnen Rohrstock durch die Luft zischen, mit dem die Nonnen mit großem Eifer danach trachteten, ihm seinen Glauben an die Macht der Ahnen auszutreiben. Oft hatten Striemen ein blutiges Gitter auf sein Hinterteil gezeichnet, oft hatte er für Tage nicht sitzen können. Auch auf seinen Handflächen bildeten sich im Laufe der Jahre dort, wo der Rohrstock sich tief ins Fleisch gebissen hatte, lange, wulstige Narben.
Plötzlich stieg ihm der Geruch von Kernseife in die Nase, jener an Gestank grenzende Geruch, der seine Jahre auf der Mission durchdrungen hatte. Die Brustwunde brannte, er knurrte vor Schmerz, das helle Viereck verdunkelte sich, und die Bilder lösten sich in Nebel auf.
Als er wieder klarer denken konnte, beschloss er, Schwester Paulina zu bitten, für ihn eine Kerze in der Kirche an der Ecke anzuzünden. Vielleicht war er jetzt doch zu weit von seinen Vorfahren entfernt, als dass sie ihn hören konnten. So genau wusste er das nicht. Die Missionsschwestern hatten ihm eingebläut, dass ihr Gott überall sei und alles sehe. Die Vorstellung hatte ihn früher in seinen Albträumen verfolgt, später hatte er darüber gelacht. Aber vielleicht stimmte das ja tatsächlich. Schaden konnte die Kerze auf jeden Fall nicht.
Ermattet vom Denken, schloss Israel Mabaso die Augen und fiel in einen unruhigen Schlaf.
Als Lisa Darling an diesem flirrenden Hochsommertag aus der Tür ihres Apartmenthauses auf die Straße trat, war sie bester Stimmung. Die Hitze, die auf der Stadt lastete, machte ihr nichts aus. Ihr blaues Kleid – ein kniekurzes, ärmelloses Nichts aus hauchdünnem Flatterstoff – war bestens für das Kapstädter Sommerwetter geeignet. Im Sturm, der von den sonnenheißen Hängen des Tafelbergs herunterfuhr, wirbelte sie übermütig über den schmalen Bürgersteig. Der Tag versprach perfekt zu werden. Schon zeigte der Smog, der ihre Sicht trübte, fransige Löcher im Schwefelgelb. Der Himmel darüber glühte in sattem Kobaltblau, Bougainvilleen leuchteten vor weißen Häuserwänden, und Brigitte Tshayimpi würde heute nicht im Studio sein und sie schikanieren können.
Lisa sah sich um. Ihr Auto stand fünfzig Meter weiter auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die Tiefgarage des Apartmenthauses war bei einem Unwetter überflutet worden und sollte erst in einigen Tagen wieder zur Benutzung frei gegeben werden. Während sie auf eine Möglichkeit wartete, durch den Strom von Autos, der sich über die Beachroad wälzte, zu ihrem Fahrzeug zu gelangen, begaben sich ihre Gedanken auf Höhenflug.
Das Beste an diesem perfekten Tag war, dass sie sich beruflich dem Gipfel näherte. Schon schimmerte er durch die Wolken. Die Reportage, die sie in einigen Tagen in Khayelitsha drehen würde, hatte sie wie immer akribisch vorbereitet. Es war eine engagierte Dokumentation über junge schwarze Unternehmerinnen und deren schwierigen Weg zum Erfolg, über die Probleme, die sie in der afrikanischen Männerwelt meistern mussten. Die Frauen hatten sie tief beeindruckt. Ihr Kampf für gleiche Chancen, um Achtung und Erfolg, unterschied sich durch nichts von dem gnadenlosen Überlebenskampf im Dschungel. Das war das Thema ihres Films.
Sie war angekommen, ganz ohne Zweifel. Endlich hatte sie den Sprung von der einfachen Reporterin, die in jeder wachen Minute den Polizeifunk abhörte, um ja keinen Unfall, kein brennendes Haus zu verpassen, zur Autorin von aufsehenerregenden Reportagen geschafft.
Nachdem sie vor wenigen Monaten einen prestigeträchtigen Preis gewonnen hatte, war Lisa Darling auf dem besten Weg, der Markenname für engagierte, bestens recherchierte politische Dokumentationen zu werden. Seitdem bewegte sich etwas in der obersten Etage des Senders. Gestern war ihr endlich der Sendeplatz unmittelbar nach den Abendnachrichten zugesichert worden. Zwar noch inoffiziell, wie ihre Kontaktfrau in diesem exklusiven Club ihr zuflüsterte, aber die offizielle Bekanntgabe würde wohl in den nächsten Tagen folgen. Für Brigitte Tshayimpi, die ihr von den neuen Herren des Senders vor ein paar Monaten als Studioleiterin direkt vor die Nase gesetzt worden war und die seither mit allen Mitteln versuchte, sie aus dem Studio zu mobben, bedeutete das einen Tritt in ihr bemerkenswertes Hinterteil.
Geschieht ihr recht, dachte Lisa. Bob Wilson, ihr bisheriger Boss, war mit Leib und Seele ein leidenschaftlicher Journalist gewesen. Im Zuge des Black Empowerment – der erklärten Politik der Regierung, sämtliche Schlüsselstellungen in allen Bereichen mit Schwarzen zu besetzen – hatte er seinen Posten an Brigitte Tshayimpi abgeben müssen. Sie war schwarz, eine Frau und hatte sich im Freiheitskampf als eine der profiliertesten Aktivistinnen hervorgetan – im heutigen Südafrika die beste Qualifikation für eine Position auf höchster Ebene. Häufig landeten auf diese Weise Leute an der Spitze großer Unternehmen, die von der Materie nicht die geringste Ahnung hatten.
Bob Wilson war mit seiner Familie desillusioniert nach Australien ausgewandert, wodurch Lisa ihren Mentor und einflussreichen Freund verlor, was sie schnell zu spüren bekam. Zum Beispiel hatte Miss Tshayimpi einen Doktortitel in Tourismus und wurde fuchsteufelswild, vergaß man, sie damit anzureden. Lisa hatte das mehrmals vergessen, worauf die Studioleiterin subtile Rache nahm.
Es hatte damit angefangen, dass sie aus ihrem Büro, das zwar nicht groß war, aber eine Traumaussicht auf Kapstadt und das Meer bot, in ein Kabuff auf der Rückseite des Gebäudes umziehen musste. Als einzige Tageslichtquelle diente hier ein verdrecktes, schmales Fenster zum Hinterhof. Vorübergehend, nur für ein paar Tage, während ihr Büro renoviert werde, hieß es, keine Veranlassung für sie, ihre persönlichen Sachen auszupacken und sich häuslich einzurichten. Aber aus Tagen wurden Wochen, und als dann immer wieder Unterlagen verschwanden, ihre Anfragen und Aufträge nicht oder nur verzögert ausgeführt wurden, hatte Lisa endlich kapiert, dass Brigitte Tshayimpi es auf sie abgesehen hatte.
Das würde sich nun aber in Kürze drastisch ändern. Triumph floss schon wie süßer Honig durch ihre Adern, aber noch war sie vorsichtig. Ihre Reportage Verlorene Seelen über die verschwundenen Opfer der Apartheid lag bereits wieder ein Jahr zurück, der zweite Teil war noch nicht ganz fertig, und nach dem kürzlichen Fiasko mit ihrer Dokumentation über Muthi-Morde, die die Tshayimpi als imageschädigend für Südafrika gekippt hatte, hatte sie dieses Erfolgserlebnis dringend nötig.
Tief in Gedanken, trat sie unvorsichtig ein paar Meter auf die Fahrbahn, als am unteren Ende der Straße gleichzeitig eine Ampel umsprang. Wie eine Herde durchgehender Büffel donnerten die Fahrzeuge auf sie zu. Ein Lieferwagen streifte sie fast, und während sie dem Fahrer wütend Beleidigungen nachrief, sprang ihr Blick frustriert über ihre Umgebung. Dabei fiel ihr ein Wahlplakat mit dem Abbild des Präsidentschaftskandidaten des ANC, Tom Zulu, auf. Der Anblick ließ sie sofort an einen weiteren Bericht denken, an dem sie in letzter Zeit mit Hochdruck gearbeitet hatte, einen über die Wahlkampfmoral der Parteien.
Sie war stolz darauf, dass es ihr gelungen war, kompromisslos herauszuarbeiten, mit welchen demagogischen Finessen die Parteifürsten ihre Anhänger aufhetzten, die sich infolgedessen seit Monaten mit den gegnerischen Sympathisanten immer wieder blutige Kämpfe lieferten. Es hatte mehrere Tote gegeben, und sie vertrat die Meinung, dass besonders der charismatische Tom Zulu, der mit seinen siebenundsechzig Jahren mit unglaublicher Vitalität und Kraft seine Zuhörer mitriss, gefährlich war für das Land. Brandgefährlich.
Der Machtkampf, der zwischen seinen Anhängern und denen des Präsidenten tobte, eskalierte täglich und war so bösartig geworden, dass es den ANC gespalten hatte. Abtrünnige hatten eine neue Partei gegründet.
Das Wort Bruderkrieg stand wie eine drohende Wolke hinter dem Horizont.
Lisa musterte das Plakat. Tom Zulu war ein Bulle von einem Mann, strahlte eine düstere, unwiderstehliche Stärke aus. Auf allen Versammlungen tanzte er auf der Bühne und stimmte irgendwann »Ushimi Wami« an, seine alte Kriegshymne aus den Zeiten seines Kampfes gegen den Apartheidstaat. »Ushimi Wami« – »bring mir meine Maschine«. Alle Welt, auch seine Genossen, interpretierte es so, dass er nach seinem Maschinengewehr rief. Dann schwang er im Rhythmus des Gesanges mit, beide Fäuste erhoben, ein Leuchten auf dem runden Gesicht, röhrte seine Parolen und brachte die Menge zum Kochen.
Ein teuflischer Verführer der Massen. So beschrieb sie ihn.
Der Wahlkampf brodelte Woche für Woche stärker hoch und war mittlerweile schon derart überhitzt, dass jeden Augenblick eine größere Explosion stattfinden konnte. Die Gewaltausbrüche hatten ihr eine derartige Angst eingejagt, dass sie zum ersten Mal für einen kurzen schwachen Augenblick erwogen hatte auszuwandern. Sowohl ein englischer als auch ein australischer Sender hatten ihr Angebote gemacht, die höchst verlockend waren. Sie hatte sich vorgestellt, wie ihr Leben wohl aussah, wenn nicht unausweichlich mit jeder Nacht auch die Angst kam, diese Urangst, die einen flackernden Rand von Panik trug und die jeder weiße Bürger dieses Landes mit der Muttermilch eingesogen hatte. Diese unkontrollierbare Angst, die schon längst die Schutzbarriere des Bewusstseins überwunden hatte und immer mehr ans Tageslicht drängte.
Sie hatte sich vorgestellt, wie es wäre, wenn nicht vor jedem Fenster schwere Gitter den Himmel in kleine Stückchen schneiden würden. Wie das Leben aussehen würde, in dem sich niemand hinter hohen Mauern und elektrischen Zäunen zu verschanzen brauchte. Es war ihr nicht wirklich gelungen. Wie alle Südafrikaner hatte sie sich zu sehr an die Beschränkungen, die die extreme Kriminalität des Landes notwendig machte, gewöhnt.
Aber letztlich war es ihr Stolz gewesen, der nicht zugelassen hatte, dass sie sich davonmachte. Gelbbäuchige Feiglinge, so nannten die, die blieben, trotzig jene, die das Land verließen, und feige war sie noch nie gewesen.
Ihre Analyse über diese erschreckende Gewaltbereitschaft war so gut wie fertiggestellt. Die würde sie sofort nachschieben, sobald die Reportage über die Unternehmerinnen von Khayelitsha im Abendprogramm gelaufen war. Im Schneideraum würde sie allerdings noch einige Kanten abschleifen müssen, ehe sie das Ergebnis im Sender präsentierte, sonst würde die Tshayimpi gleich wieder ihre Krallen hineinschlagen und ihr Werk mit dem gleichen Vergnügen auseinanderreißen wie eine spielende Katze ein Wollknäuel. Diese Frau zu unterschätzen, konnte sie sich nicht erlauben.
Aber abgesehen davon war der Bericht ein Knaller, dessen war sie sich sicher. Ihre überschwängliche Laune kehrte zurück.
»Primetime«, sang sie und hüpfte ein paar Schritte wie ein übermütiges Kind, fühlte sich leicht wie eine Feder und ein wenig albern, so als hätte sie Champagner auf nüchternen Magen getrunken.
Selbst Brigitte Tshayimpi würde ihr bald nichts mehr anhaben können. In Zukunft würde die ihre Finger von ihr lassen und ihre giftige Zunge im Zaum halten müssen. Gute Einschaltquoten waren die beste Garantie dafür.
»Primetime«, trällerte sie noch einmal. »Primetime, primetime, primetime …«
Als Sahnehäubchen auf diesen Traumtag hatte Brian, der Mann, den sie in zwei Monaten zu heiraten vorhatte, eben angerufen und sie zum Essen ins Jardine eingeladen. Es war das erste Mal, dass Brian sie in ein Restaurant dieser Preisklasse ausführte. Vor dem Essen hatten sie vor, mit Freunden dem Mondaufgang vom Lion’s Head aus zuzusehen. Es versprach eine klare Vollmondnacht zu werden, und der Blick über die Zwölf Apostel bei Mondlicht war einfach unvergleichbar. Und unglaublich romantisch.
Und nach dem Essen dann Dessert in Brians neuem Apartment. Ihre Nervenenden prickelten, und eine wohlige Trägheit machte ihre Glieder schwer. Brian. Intelligent und zielstrebig. Tennisgestählte Muskeln, dunkelbraunes Haar, jungenhaftes Grinsen, warme, geschickte Hände. Etwas leichtsinnig vielleicht, aber aufregend.
Ihre Freundin Hillary, die ihn als »absolutes Heiratsmaterial« einstufte, hatte sie und Brian einmal zum Abendessen eingeladen. »Damit du Appetit aufs Familienleben bekommst.«
In ihrem sonnendurchfluteten Haus mit großem Garten, inmitten des kreativen Chaos, das drei kleine Kinder, zwei Hausangestellte, zwei Hunde und drei Katzen anrichten konnten, führte sie mit ihrem Mann offenbar ein restlos glückliches Leben. Während des Abendessens hatte Lisa sich dabei erwischt, dass sie Hillary beneidete, was sie selbst am meisten überraschte, denn sie hatte sich nach der Scheidung von Scott für immer immun gegen die Sirenenklänge von Familienleben und Mutterschaft gehalten.
Unbewusst leckte sie sich über die Lippen. Den heutigen Tag würde sie sich nicht verderben lassen, auch nicht von dieser Hexe Tshayimpi. Schon gar nicht von dieser Hexe! Wieder ballte sich ein heißer Knoten aus Wut und Frustration in ihrem Magen, aber das Klingeln ihres Handys lenkte sie von diesem unerfreulichen Thema ab. Energisch schob sie jeden weiteren Gedanken an ihre Studioleiterin beiseite und nahm das Telefon aus der Umhängetasche. Die Nummer auf dem Display war die ihres Kameramannes. Sie nahm den Anruf an.
»Andy, was gibt’s?«
Andy Willems war ein schmaler, sanfter Mann, dessen Vorfahren von den weißen Siedlern als Sklaven aus Malaysia nach Südafrika gebracht worden waren. In ihm mischten sich alle Bevölkerungsgruppen dieses Landes. Sogar ein Koi-San gehörte zu seinen Ahnen, wie seine hohen Wangenknochen bezeugten. Er war ein absoluter Künstler hinter der Kamera, aber sensibel und in sich gekehrt, ziemlich depressiv, wie so viele Kap-Farbige. Brigitte Tshayimpi hatte auch ihn auf dem Kieker, und einer kampfgewohnten ANC-Frau wie ihr war er nicht gewachsen. Seitdem sank er täglich tiefer in ein seelisches schwarzes Loch.
Lisa seufzte. Andy war eigentlich viel zu zartbesaitet für das Mediengeschäft. »Worum geht’s?«
Andys leise Stimme träufelte aus dem Hörer. Wie immer holte er weit aus, um sich auf großen Umwegen dem zu nähern, was er eigentlich sagen wollte. Sie lauschte ungeduldig. Ihre Gedanken zerfaserten. Unkonzentriert schweifte ihr Blick über die Straße hinüber zum Strand vom Mouille Point, verfolgte die Kapriolen einer Möwe, die einem Obdachlosen, der im Schatten einer windzerzausten Palme am Strandweg sein Zuhause aufgeschlagen hatte, das Brot zu stehlen versuchte. Auf einmal drang das, was Andy stockend berichtete, in ihr Bewusstsein. Er redete über Brigitte Tshayimpi. Sie erstarrte.
»Sie will was?«, schrie sie auf. »Diese verdammte …!« In letzter Sekunde verschluckte sie ein saftiges Schimpfwort. »Das kommt gar nicht infrage! Ich brauche dich, das weißt du! Du bist mein Kameramann. Wir arbeiten doch schon seit Jahren zusammen! Mit wem sollst du denn ihrer Meinung nach drehen? Nein, sag’s gar nicht erst. Ich will es nicht wissen. Du drehst für mich. Basta!«
Aber Andy redete einfach weiter. Langsam und zögernd stolperte er von Wort zu Wort, redete um den heißen Brei herum, ließ seine Sätze unfertig in der Luft hängen. Mit steinernem Schweigen hörte sie ihm zu, wusste aus Erfahrung, dass er, dadurch verunsichert, über kurz oder lang mit der Wahrheit herausplatzen würde. Sie behielt Recht.
»Ich soll mit Linda drehen«, quiekte er.
Lisas Laune kippte augenblicklich. »Linda! Vergiss es«, fauchte sie. »Sag der Tshayimpi das!«
Gequält stotterte Andy seinen Protest. In diesem Augenblick klopfte ein anderer Anrufer an, und sie unterbrach ihren Kameramann. »Ich muss Schluss machen. Die Tshayimpi soll einen anderen für den Dreh einteilen. Du machst meine Reportage, verstanden? Sag’s ihr, und zwar gleich!«
Ein Jaulen drang aus dem Hörer. Lisa verdrehte gereizt die Augen himmelwärts. Oft genug hatte sie erlebt, dass Andy Willems in Gegenwart von Brigitte Tshayimpi in hilflose Schreckensstarre verfiel, nicht anders als das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange. Ihr würde wohl doch nichts anderes übrigbleiben, als selbst mit der Studioleiterin zu reden, eine Aussicht, die ihr augenblicklich den Tag zu verhageln drohte. Sie knirschte mit den Zähnen.
»Okay, okay, ich sag’s ihr selbst … Nein, du brauchst dich nicht darum zu kümmern. Bye.«
»Totsiens«, verabschiedete sich Andy erleichtert.
Missgelaunt legte Lisa auf. Ein Blick zeigte ihr, dass der andere Anrufer ihr Vater war. Nach kurzem Zögern drückte sie ihn weg. Im Moment war sie einfach zu aufgebracht, um mit ihm reden zu können. Er würde sofort merken, dass etwas nicht stimmte, und gnadenlos nachbohren, würde sie gekonnt mit Worten vor sich hertreiben, ihr jeden Ausweg verstellen, bis sie in der Falle saß und ihm alles erzählte, vor allen Dingen auch Sachen, über die sie mit ihm auf keinen Fall diskutieren wollte. Sie hatte gelernt, diese Fähigkeit von ihm als ein verstörendes Überbleibsel seines Berufes zu hassen.
Bis vor sieben Jahren war er bei der Polizei gewesen. Als Kind, auch später noch als Jugendliche, hatte sie sich kaum Gedanken gemacht, was er dort tat. Erst während ihres Studiums war ihr immer klarer geworden, dass er politisch noch in der Schwarzen Zeit verwurzelt war, wie sie die Zeit der Apartheid in ihren Reportagen immer nannte. Ihr Bild von ihrem Vater, der Lichtgestalt, dem festen Anker ihrer Kindheit, geriet immer mehr ins Wanken, je älter sie wurde.
Während ihres Jurastudiums, Anfang der neunziger Jahre, brach das Apartheidregime zusammen, und nachdem Nelson Mandela 1994 als Staatspräsident vereidigt wurde, gelangten täglich neue Verbrechen ans Tageslicht. In den Zeitungen und im Fernsehen war von unvorstellbaren Grausamkeiten die Rede, die die Polizei verübt habe. Ihr wurde übel davon, sie konnte nichts essen, lag nächtelang wach. Bald schob sich für sie über den Ausdruck »Polizei« die Bezeichnung »mein Vater«, ohne dass sie sich dagegen zu wehren vermochte. Als sie es nicht mehr ertragen konnte, hatte sie endlich den Mut gefunden, ihn zur Rede zu stellen.
Der Streit hatte auf Lalisa stattgefunden. Kühl berechnend hatte sie einen Tag gewählt, an dem ihre Mutter nicht im Haus war. Sie war entschlossen gewesen, am Ende des Tages zu wissen, welche Stellung dieser Mann, der ihr Vater war, im Polizeidienst wirklich bekleidet hatte, und vor allen Dingen, welch ein Mensch er heute war. Dass es einen Streit geben würde, hielt sie für unausweichlich. Aber sie musste ihm die Wahrheit entlocken, um endlich inneren Frieden zu finden.
Zu dieser Zeit arbeitete sie bereits als Reporterin, und wie für ein wichtiges Interview bereitete sie sich sorgfältig vor, durchforstete alle Archive, deren sie habhaft werden konnte. Das Internet befand sich erst in den Kinderschuhen, und Suchmaschinen wie Google gab es noch nicht, weshalb sie hauptsächlich auf die Zeitungsarchive angewiesen war. Wenigstens bestanden die aus Mikrofilmen und nicht aus Stapeln von staubigem Papier.
Aber sie fand nichts außer einem verschwommenen Foto, das ihn in voller Uniform im Hintergrund irgendeiner Festivität zeigte. Der Eindruck, dass er nicht sehr wichtig gewesen sein konnte, verstärkte sich, was sie auf gewisse Weise beruhigte.
Wie vorausgesehen, entwickelte sich das Gespräch mit ihrem Vater innerhalb von Minuten zu einem Duell. So wie er es bei ihr sonst tat, jagte sie nun ihn mit Worten, versperrte ihm jeden Ausweg, stocherte in seinem Innersten herum, bis er explodierte. Nach dem kurzen, lauten Wortwechsel schwieg er plötzlich und starrte sie mit versteinertem Gesicht an. Sie hielt es für einen seiner Polizeitricks und schwieg ebenfalls. Ihre Blicke verkrallten sich ineinander. Schließlich gab er als Erster nach und brach das Schweigen. Er wirkte gefasst.
»Damals habe ich das System nicht hinterfragt«, begann er mit ruhiger Stimme, sein Blick offen und aufrichtig. »Ich diente dem Staat, war wie du Jurist, arbeitete in der Verwaltung bei der Polizei, nicht im aktiven Dienst.« Sein Ton setzte hier ein Ausrufezeichen. »Die Entwicklung war schleichend, jeden Tag wurde mein Urteilsvermögen ein wenig mehr getrübt, und als sich die Apartheid in ihrer ganzen Hässlichkeit entfaltete, konnte ich das nicht mehr erkennen. So war es.«
Und da hatte er wieder vor ihr gestanden. Ihr Vater. An diesen Augenblick würde sie sich immer erinnern. Das kantige, vertrauenerweckende Gesicht, sein Lächeln, das gleichermaßen verwegen wie siegessicher wirkte, die blitzenden blauen Augen. Sein Geständnis riss die Barriere nieder, die sie um ihre Gefühle zu ihm errichtet hatte. Es übertraf alles, was sie erwartet hatte.
Unwillkürlich schossen ihr jetzt wie damals die Tränen in die Augen. Sie blinzelte sie weg. Den Rest dieses Tages hatten sie geredet, ihr Vater und sie. Über alles, auch darüber, wie froh er war, eine Laufbahn im aktiven Dienst abgelehnt zu haben.
»Mein Arbeitsplatz in der Logistik war zwar wenig aufregend, um nicht zu sagen langweilig, aber wenigstens konnte ich ruhig schlafen. Aber natürlich sind wir im Rückblick alle schuldig gewesen«, hatte er hinzugesetzt, reuevoll und offensichtlich betroffen von der Erinnerung.
In einer spontanen Gefühlsaufwallung war sie ihm um den Hals gefallen. Sie glaubte ihm. Er hatte keinen Grund mehr, etwas zu verbergen. Im Gegenteil. In ihr kroch die unbehagliche Vorstellung hoch, wie sie wohl selbst geworden wäre, wäre sie in der Schwarzen Zeit aufgewachsen. Diese Erkenntnis half ihr, ihn und seine Generation zumindest ansatzweise zu verstehen. Er hatte inmitten jener Gesellschaft gelebt und war den Vorurteilen von klein auf ausgesetzt gewesen. Warum er den Polizeidienst gewählt hatte, war ihr nicht klargeworden. Es war ihr auch nicht mehr wichtig. Jetzt hatte er ihr gezeigt, dass er fähig war, seine Rolle kritisch zu sehen. Das war ihr genug. Sie hatte den Vater wiedergewonnen, der er einst für die kleine Lisa gewesen war. Groß, stark, beschützend und immer ehrlich zu ihr, und es hatte sie seelisch völlig aus der Bahn geworfen, wie sehr sie das alles aufwühlte.
Später hatte sie erkannt, dass dieser Streit ihre Berufswahl bestimmt hatte. Als Anwältin oder Richterin wäre sie auf die Fälle beschränkt gewesen, die zufällig auf ihrem Tisch landeten, hätte sie nur in sehr kleinem Rahmen dafür sorgen können, dass den Opfern Gerechtigkeit widerfuhr.
Als Journalistin dagegen konnte sie der Welt vor Augen führen, wie es in ihrem Land gewesen war, konnte sie den Opfern Gehör verschaffen, konnte dafür sorgen, dass sie nicht vergessen wurden. Sie konnte aber auch zeigen, was daraus geworden war, konnte zeigen, welche Kraft in den Menschen dieses herrlichen Landes steckte und welcher Wille zur Wahrheit und zur Veränderung.
Sie hatte nicht lange auf den ersten Erfolg zu warten brauchen. Bei der Erinnerung an jenen wunderbaren Moment, als ihr erstes Honorar für einen Bericht ins Haus flatterte, musste sie unwillkürlich lächeln. Es hatte süßer geschmeckt als Manna vom Himmel. Eine Kopie des Schecks hing noch immer gerahmt an ihrer Schlafzimmerwand.
Ein Windstoß fuhr ihr durchs Haar, und eine hellblonde Haarsträhne kitzelte sie an der Nase. Sie nieste und kehrte in die Gegenwart zurück. Das Rauschen des Verkehrs mischte sich mit dem Wellenschlag des Atlantiks. Die hartnäckige Möwe hatte es geschafft, den Obdachlosen, eine bizarre Erscheinung mit grellbunter Rastamütze und einem knöchellangen Hemd aus Sackleinen, zu überlisten, und flog mit dem Brot im Schnabel davon. Der Mann sprang mit rudernden Armen empört umher und erinnerte sie damit an die Abbildung von Rumpelstilzchen in einem uralten Kinderbuch ihrer Mutter.
Prompt überfiel sie das dringende Bedürfnis, mit ihr zu sprechen. In einem Monat würde sie ihren sechzigsten Geburtstag begehen, und nach anfänglichen Versuchen, die deprimierende Wahrheit zu ignorieren, hatte sie sich dann doch dazu durchgerungen, dieser Zahl mit einer üppigen Party die Stirn zu bieten. Impulsiv wählte Lisa die Mobil-Nummer ihrer Mutter.
Melly meldete sich fast sofort. »Lisa, mein Schatz. Das muss Gedankenübertragung sein. Ich wollte dich gerade anrufen. Stell dir nur vor, was passiert ist!« Aufgeregt sprudelten die Wörter aus dem Hörer. »Im Gästehaus ist mir aus der Wohnzimmerlampe Wasser entgegengelaufen. Wie ein Sturzbach! Ich war so verdattert, dass ich eine ganze Zeit gebraucht habe, um mir bewusst zu machen, dass Wasser und Elektrizität nicht gut zusammenpassen. Natürlich habe ich dann sofort die Sicherungen ausgeschaltet und deinen Vater geholt. Als der endlich festgestellt hat, dass im Dach ein Rohr gebrochen ist, war er klitschnass – und sehr schlechter Laune. Kein Wunder, wir haben nämlich schätzungsweise dreitausend Liter im Gebäude. Es stinkt widerlich, der Fußboden ist aufgequollen, schwarzer Schimmelrasen wuchert über die Wände und Decken, die Möbel sind tropfnass und von allen möglichen Viechern bewohnt. In einem hat sich bereits ein quakender Frosch breitgemacht, stell dir das nur vor!«
Melly rang hörbar nach Atem.
»Wir werden alles wegwerfen müssen, und dein Vater überlegt sogar, das Haus einfach abzureißen und ein neues bauen zu lassen. Aber das schaffen wir natürlich nicht bis zur Geburtstagsfeier«, jammerte sie.
Lisa krümmte sich vor Lachen. »Frag doch Jill, ob du auf Inqaba feiern kannst. Ihr habt doch eine ziemlich gute Verbindung zueinander«, schlug sie vor, nachdem sie sich erholt hatte. Jill Rogge, ihre ziemlich entfernte Cousine, besaß die Farm Inqaba, eine der schönsten Gästefarmen KwaZulu-Natals und gleichzeitig eine der ältesten Farmen überhaupt in Zululand. »Ihr Koch ist klasse, und du hättest überhaupt keine Arbeit.«
»Mein Kind, das ist eine blendende Idee. Warum bin ich nicht gleich darauf gekommen«, seufzte ihre Mutter erleichtert.
»Ich habe auch Neuigkeiten.« Schnell erzählte Lisa ihr von dem neuen Sendeplatz. »Es ist zwar noch nicht ganz offiziell, aber das ist nur noch eine Formsache, denke ich. Daran kann auch die Tshayimpi nichts mehr ändern!«
»Lisa, das ist ja absolut phänomenal! Gratuliere … ich bin so stolz auf dich! Welches Outfit hast du vor der Kamera getragen?«
Lisa lachte auf. »Schlicht, aber todschick. Einen Hosenanzug, naturfarbenes Leinen mit genügend Kunststoffanteil, dass er nicht so grässlich zerknittert wirkt.«
Vor ihr tat sich eine Lücke im Verkehr auf. Leichtfüßig schlängelte sie sich zur anderen Straßenseite hindurch. Dann schlenderte sie über den geteerten Weg am schmalen Strand entlang, während sie sich weiter mit ihrer Mutter angeregt über die neueste Mode, Durbaner Klatsch und die ständigen Stromausfälle unterhielt.
Bei diesem Thema seufzte Melly dramatisch. »Ohne Generator ist man ja verloren. Bill hat gerade einen zweiten gekauft, falls der erste ausfällt und sein kostbarer Wein zu warm wird.«
Lisa kicherte. »Na, das wäre natürlich eine wirkliche Katastrophe.«
Ihr Vater hatte den großen Raum neben der Küche, der eigentlich als Billardzimmer geplant gewesen war, in einen kühlen Weinkeller verwandelt, wo Hunderte von Weinflaschen in exakt der richtigen Temperatur gelagert wurden. Gute Bordeaux leicht über 16 Grad, leichte Weißweine und Champagner bei 8 Grad, Sherry und Portweine bei 10 Grad. Auch seine beachtliche Sammlung von Hochprozentern wie Whisky, Gin oder Wodka bewahrte er hier auf. Im afrikanischen Hochsommer stieg der Stromverbrauch der Farm zwar ins Astronomische, aber das interessierte Bill Darling nicht im Geringsten.
»Du kannst dir das Theater nicht vorstellen, wenn sich einer seiner Rotweine in der Sommerhitze beim Dekantieren zu schnell erwärmt. Er treibt mich mit Eismanschetten und Tauchthermometern zum Wahnsinn …« Melly schnaubte spöttisch. »Als Nächstes wird er ein Extrazimmer nur zum Trinken seines Weins bauen.«
»Papa wäre das zuzutrauen.« Lachend verabschiedete Lisa sich. Ihre gute Laune war wieder restlos hergestellt. Ein Blick auf die Armbanduhr sagte ihr allerdings, dass sie sich sputen musste, ins Studio zu gelangen. Mit schlechtem Gewissen lief sie eilig zu ihrem Wagen.
Der Wind hatte aufgefrischt und spielte mit ihrem hellblonden Haar. Ihr blaues Kleid flatterte. Eine Bö griff unter den federleichten Rock, wirbelte ihn zu einem Kelch hoch und entblößte ihre eleganten langen Beine. Sekundenlang verwandelte sich Lisa Darling in eine schimmernd blaue, langstielige Blüte mit goldener Krone. Übermütig tanzte sie über den Strandweg hinauf zu ihrem Auto, schloss es auf, warf ihre Tasche auf den Beifahrersitz und fädelte sich kurz darauf in den morgendlichen Verkehr ein. Es würde ein guter Tag werden. Vielleicht sogar einer, den sie im Kalender anstreichen würde.
Abends, als die drückende Smogdecke aus der Stadt vertrieben war, ruhte sich der Kap-Doktor aus und schwächte sich vorübergehend zu einem kräftigen Wind ab. Es war heiß, und die Luft funkelte. Die Kapstädter atmeten tief durch, räumten auf und machten sich mit fröhlicher Energie auf die Partytour durch Kapstadts In-Lokale. Für das Essen im Jardine schlüpfte Lisa Darling in ein kniefreies Hängerkleid in leuchtenden Grüntönen, das sie sich gekauft hatte, weil die Restaurants im Zuge der Stromsparmaßnahmen ihre Klimaanlagen deutlich wärmer einstellten, wenn nicht gar ganz abschalteten.
Sie schloss die Wohnungstür ab und stieg in den Lift. Zwar hatte es heute keine offizielle Entscheidung über den Sendeplatz gegeben, aber sonst war der Tag, den sie hauptsächlich im Schneideraum verbracht hatte, gut verlaufen. Nun lag ein herrlicher Abend vor ihr.
2
Am nächsten Morgen strahlte die Sonne aus dem porzellanblauen Himmel, die Luft war wie Champagner, der Kap-Doktor noch friedlicher Laune, und an der Victoria & Albert Waterfront schoben sich breite Touristenströme durchs edle Einkaufszentrum. Die Menschen waren bestens aufgelegt, das Geld saß locker, die großen Jachten wagten sich bereits zu einer Vergnügungstour aus dem sicheren Hafen, und die schwarze Rauchdecke, die oft über Khayelitsha lag, konnte man nicht einmal riechen. Nichts trübte den schönen Morgen.
Einem Menschen jedoch hatte der Kap-Doktor keine Erleichterung gebracht. Israel Mabaso schnappte rasselnd nach Luft. Das Fenster des Sechsbettzimmers war weit geöffnet, aber die dumpfe Hitze im Raum wich nur langsam. Trotzdem fror er, obwohl er von innen glühte, außerdem fühlte er seine Beine nicht mehr. Die Taubheit kroch stetig höher, und er wünschte, sie würde die obere Hälfte seines Körpers schnell erreichen. Der Schmerz, der in seiner Brust brannte, schoss ihm im Takt seines flatternden Herzens wie flüssiges Feuer in die kleinsten Nervenverästelungen. Er bestand nur noch aus diesem Schmerz. Irgendwann während der letzten Stunden hatte sich die Gewissheit, dass er gerade Glied für Glied starb, immer nachdrücklicher in sein Bewusstsein gedrängt. Er fand nicht mehr die Kraft, sich dagegen aufzulehnen.
Eine Weile lag er so da, driftete immer wieder in die Bewusstlosigkeit ab, bemühte sich in seinen lichten Augenblicken, einen Gedanken festzuhalten, der ab und zu durch den dichten Nebel in seinem Hirn geisterte. Aber das erwies sich als unmöglich, so als wollte er eine vorbeischießende Schwalbe einfangen. Er sank tiefer zurück in die weiche, warme Dunkelheit.
In letzter Sekunde, ehe die dunkle Welle für immer über ihm zusammenschlug, schickte der Kap-Doktor ihm wie zum Abschied einen letzten Windstoß, der die offen stehende Tür seines Zimmers zuschlug. Der Knall fuhr ihm in die Knochen und stieß ihn zurück ins Leben, für eine kurze Zeitspanne jedenfalls.
Er hörte Schwester Paulina auf dem Gang mit den Metalltabletts klappern, die im Krankenhaus verwendet wurden. Das Geräusch verriet ihm, dass es früher Morgen sein musste, denn um diese Zeit teilte die Schwester die Medikamentenrationen ihrer Patienten ein. Jetzt brach das Klappern abrupt ab, und die Tür wurde wieder aufgestoßen.
»Alles in Ordnung?«, fragte eine weibliche Stimme.
»Nein, absolut nicht. Ich sterbe«, wollte Israel rufen, bekam aber nur ein schwaches Gurgeln heraus. Verzweifelt schnappte er nach Luft. Schon wurde es wieder dunkel um ihn, als er hörte, wie die Schwester mit einem Fußtritt den Hebel der Tür feststellte und sich energische Schritte seinem Bett näherten. Gleich darauf fühlte er eine warme Hand auf seiner Schulter.
Seine Lider flatterten, und nach ein paar angestrengten Atemzügen gelang es ihm, die Augen noch einmal zu öffnen. Das Gesicht einer älteren Frau in Schwesterntracht schwebte wie ein lächelnder brauner Mond über ihm. Sein Blick klammerte sich an ihr fest.
»Israel, können Sie mich hören?« Die Hand schüttelte ihn sanft.
Es tat weh. »Wa…«, machte er und versuchte, sich die rissigen Lippen zu lecken.
»Wasser?«, fragte die Krankenschwester.
Israel grunzte zustimmend.
Schwester Paulina stützte ihm den Kopf, ergriff die Schnabeltasse, die auf seinem Nachttisch stand, und hob sie an seine Lippen. Das meiste lief ihm aus den Mundwinkeln heraus, aber es belebte ihn so weit, dass er die Kraft fand, ein paar zusammenhängende Worte herauszupressen.
Der teilnehmende Ausdruck auf dem braunen Mondgesicht verwandelte sich unvermittelt in blankes Entsetzen.
»Mord?«, wisperte die Schwester schockiert.
»Versprechen Sie es, Schwester Paulina?«, krächzte Israel eindringlich und brachte es fertig, den Kopf anzuheben. »Sie müssen alles … aufschreiben. Sofort, damit Sie nichts vergessen … und es dann dem Doktor sagen …« Seine Stimme verlor sich in unverständlichem Röcheln.
»Versprochen«, fl üsterte sie, »… aber wo ist das Tal, und wer liegt …?«
»Krokodil«, sagte Israel Mabaso, laut und klar. Dann fiel er zurück in die Kissen, die Taubheit erreichte seine Brust, die Welle rauschte heran und schlug über ihm zusammen. Alle Gedanken machten sich auf leisen Schwingen davon.
Israel lächelte. Er hatte keine Schmerzen mehr.
Die Schwester, die dem Tod schon unzählige Male ins Gesicht geblickt hatte und sofort erkannte, dass der Mann vor ihr aus dem Leben gegangen war, suchte mit geübten Fingern den Puls an seinem Hals, fand ihn nicht mehr, horchte an seinem Herzen, vernahm aber nur Stille und drückte ihm dann sanft die Augen zu. Anschließend zog sie ihm das Laken über das Gesicht und schob eine Trennwand um das Bett, um den übrigen Patienten den Anblick zu ersparen. Dabei wiederholte sie in Gedanken unablässig, was Israel Mabaso ihr anvertraut hatte. Hastig verließ sie das Zimmer.
Draußen auf dem Gang fischte sie einen Bleistift aus der Tasche ihrer Schwesternuniform, notierte einige Stichworte auf der Rückseite einer Medikamentenschachtel und steckte sie ein. Der Doktor würde erst in rund zwei Stunden seinen Dienst antreten, und sie befürchtete, dass sie sonst irgendeine der grausigen Einzelheiten vergessen könnte.
Das, was ihr Israel Mabaso auf seinem Sterbebett anvertraut hatte, beschäftigte sie so sehr, dass sie die Oberschwester um eine Pause bat und ihre erste Zigarette seit Jahren rauchte. Aber auch die konnte ihre tiefe Unruhe nicht vertreiben.
Sie erwischte den Doktor gerade, als er mit ausgreifenden Schritten an ihr vorbei zum Operationstrakt eilte, um sich für die Transplantation vorzubereiten. Schüchtern berührte sie ihn am Arm.
Etwas unwirsch schaute er auf sie hinunter. »Was ist, Schwester? Ich bin im Stau aufgehalten worden und habe es verdammt eilig. Mein Patient liegt schon in der Narkose.«
»Es betrifft Israel Mabaso …«
»Gibt es Schwierigkeiten mit der Medikation? Geben Sie ihm Morphium, sooft er es braucht. Mehr können wir für ihn nicht mehr tun«, unterbrach er sie. Seine Konzentration war schon auf seinen Patienten gerichtet.
Es würde seine vierte Herztransplantation sein. Die anderen beiden hatte der Professor noch selbst durchgeführt, aber immer wieder zwang ihn die Arthrose in seinen Händen, Jüngeren das Operieren zu überlassen. Was der Professor sicherlich als Schicksalsschlag empfand, war für ihn ein Glücksfall. In den anderen Krankenhäusern würde er für die nächsten Jahre allenfalls Blinddärme und Gallen entfernen. Die prestigeträchtigen Transplantationen behielten die Professoren als saftige Brocken für sich.
Die Aussichten auf Erfolg bei diesem Fall waren gut. Der Spender war bei seinem Unfalltod erst zwanzig Jahre alt gewesen. Der Empfänger, ein durchtrainierter Mann, der nach einer besonders schweren Virusgrippe eine Herzbeutelentzündung bekommen hatte und innerhalb kürzester Zeit an die Spitze der Empfängerliste geklettert war, würde zwei Tage nach der Transplantation seinen vierzigsten Geburtstag feiern. Voraussichtlich jedenfalls. Er zumindest würde alles dafür tun, um ihm das zu ermöglichen.
»Nein, es gibt keine Schwierigkeiten mit der Medikation, das heißt nicht mehr …« Die Schwester war ins Stottern geraten, fing sich aber wieder. »Israel ist vor zwei Stunden verstorben, aber vorher hat er mir noch etwas anvertraut, und er hat mich schwören lassen, dass ich es nur Ihnen persönlich mitteilen soll.«
Ungeduldig wandte der Arzt sich zum Gehen. »Begleiten Sie mich zum OP, dabei können Sie es mir erzählen, obwohl ich Israel Mabaso nur als Patienten hier kenne. Kannte. Vorher habe ich ihn noch nie gesehen, und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der richtige Adressat bin.«
»Doch, doch«, keuchte die Schwester, während sie ihm hinterherhastete. »Ich soll Ihnen sagen, dass die drei ermordet wurden und unter dem Isivivani vergraben sind … Er murmelte dann noch etwas von einem Tal und einer Kuh, aber das habe ich eigentlich nicht verstanden. Er ist immer wieder vom Englischen in seine Sprache abgerutscht.« Sie benötigte ein paar tiefe Atemzüge, ehe sie weiterreden konnte. »Isivivani – das ist doch so ein Steinhaufen, nicht wahr? Wunschsteine oder so, hab ich mal gelesen. Jeder, der vorbeigeht, legt einen Stein auf den Haufen … Warum, weiß ich allerdings nicht.« Angestrengt runzelte sie die Stirn. »Wo der Haufen sein soll, hat er nicht mehr sagen können … und auch nicht, wer die Ermordeten sind, die da begraben liegen.«
Erst jetzt verstand der Doktor, was sie gesagt hatte, und blieb so abrupt stehen, als wäre er gegen eine Wand gelaufen. »Sagen Sie das noch einmal«, flüsterte er heiser.
Schwester Paulina wiederholte die Sätze. »Das ist, soweit ich mich erinnere, ziemlich wortgetreu das, was Israel gesagt hat … Ist Ihnen nicht gut?«, setzte sie mit besorgter Stimme hinzu.
Der Doktor spürte, wie ihm bei ihren Worten alles Blut aus dem Gesicht wich. Er war nicht imstande, ihr zu antworten, sondern hob nur abwehrend die Hände.
Schwester Paulina sah ihn eindringlich an. »Wissen Sie, was er meint? Ich habe ihn noch gefragt, wo genau das ist und wer da wen ermordet hat und wo die Opfer begraben sein sollen, aber er hat es nicht mehr geschafft … Es ging dann sehr schnell … Zum Schluss hat er noch was von einem Krokodil gesagt …«
Der Doktor fuhr zusammen und starrte an ihr vorbei auf einen Punkt im Nichts, und was er sah, war grauenvoll. Seine Muskeln verkrampften sich, er atmete heftig. Als Schwester Paulina mit allen Anzeichen von Furcht vor ihm zurückscheute, wurde ihm bewusst, welchen Eindruck er ihr vermitteln musste. Er kam mit einem Ruck zu sich.
»Es tut mir leid, ich hätte damit warten sollen …«, stammelte die Schwester und legte ihm impulsiv die Hand auf den Arm. »Ich habe ja nicht geahnt, dass die Nachricht Ihnen so nahegehen würde … Die Operation … sie ist hoch kompliziert …«
Der Doktor zwang sich zu einem beruhigenden Lächeln. »Es ist gut, Schwester, machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin fit, und meine Hände sind ruhig. Sehen Sie …« Zur Demonstration streckte er die Hände mit gespreizten Fingern von sich.
Es waren schöne Hände, vertrauenswürdige Hände, muskulös und sehnig mit langen, empfindsamen Chirurgenfingern, und zittern taten sie absolut nicht.
Das stellte offenbar auch die Schwester fest, denn sie schaute jetzt etwas beruhigter drein und gab ihn frei.
»Es war richtig, dass Sie es mir jetzt gesagt haben«, fuhr der Doktor fort. »Ich habe sehr lange darauf gewartet, und es bedeutet mir ungeheuer viel.« Ein abwesender Ausdruck trat in seine dunklen Augen. »Sie können gar nicht ermessen, wie viel es mir bedeutet«, sagte er leise.
Inzwischen waren sie im Bereich vor den Operationssälen angekommen, und der Chirurg drückte auf den Türöffner. »Danke noch einmal. Schreiben Sie alles auf, und legen Sie den Zettel bitte auf meinen Schreibtisch. Mein Team wartet, ich muss mich beeilen, sonst hüpft uns der Patient vom Tisch«, sagte er lächelnd und sah ihr nach, wie sie sich mit allen Anzeichen von Erleichterung in Richtung seines Zimmers entfernte. Dann fiel die schwere Tür zu den Operationssälen schmatzend hinter ihm zu, und er verbannte rigoros alle Gedanken an Israel Mabaso und das, was der ihm hatte ausrichten lassen. Die nächsten Stunden erforderten seine vollste Konzentration.
Erst als draußen schon die Dämmerung übers Meer zog, lockerte sich die angespannte Atmosphäre im Operationssaal merklich. Die Transplantation war ohne Schwierigkeiten verlaufen, und das neue Herz schlug kräftig und regelmäßig in der Brust seines Patienten. Als der Chirurg gerade die letzten Stiche setzte, flackerten auf einmal alle Lichter, und für Sekunden erstarrte das Operationsteam. Dann sprang das große Notstromaggregat an, und Erleichterung rauschte wie eine Welle durch den Saal. Der Chirurg beendete seine Arbeit zügig. Danach wurde der Patient auf die Intensivstation gebracht.
Der Doktor streifte Handschuhe und Gesichtsmaske ab, dankte dabei dem glücklichen Umstand, der ihn an diese Klinik geführt hatte, die zu Crosscare, einer der renommiertesten privaten Krankenhausketten Südafrikas, gehörte und wo es eine Notstromversorgung gab, die auch noch reibungslos funktionierte. Sonst hätte die Transplantation in einer Katastrophe enden können. Er presste beide Hände ins Kreuz, bog den Rücken durch und dehnte sich, dass die Knochen knackten. Nach der stundenlangen Operation in vornübergebeugter Haltung fühlte er sich zwar wie gerädert, war aber trotzdem in Hochstimmung. Er beschloss, Vivi heute zu einem späten Dinner bei Kerzenlicht ins Mount Nelson einzuladen. Er hatte es sich weiß Gott verdient, eine kleine Party zu veranstalten. Außerdem war er das auch Vivi schuldig, die bisher mit lächelnder Geduld seine Überstunden ertrug und sich selten beklagte, wenn er zu müde war, um irgendetwas anderes zu machen, als sich ins Bett fallen zu lassen und sofort einzuschlafen. Keine seiner bisherigen Freundinnen hatte das länger als ein paar Monate mitgemacht. Aber noch hielt Vivi durch. Sie hatte sich den Abend ebenso verdient.
Fröhlich vor sich hin pfeifend, duschte er in dem winzigen Badezimmer, das zu seinem Büro gehörte, zog sich dann von Kopf bis Fuß frisch an und ging zu seinem Schreibtisch, um Autoschlüssel und Mobiltelefon zu holen. Dabei fiel sein Blick auf den Zettel, den Schwester Paulina dort hingelegt hatte. Erst jetzt erinnerte er sich wieder an die Botschaft, die ihm Israel Mabaso mit seinem letzten Atemzug geschickt hatte.
Wie ein Stein stürzte er aus seinen gedanklichen Höhenflügen ab in die raue Wirklichkeit, fiel auf seinen Drehsessel und zog den Zettel heran. »Die Drei«, stand da, »Mord« und »Isivivani«. Leise sprach er die Worte aus, wiederholte sie immer wieder. Etwas in ihm weigerte sich, wirklich zu akzeptieren, was das alles bedeutete.
Schon hatte er die Hand in die Hosentasche gesteckt und sein Mobiltelefon ergriffen, da zögerte er. Über die Jahre waren seine Nachforschungen immer ohne Ergebnis geblieben. Bevor er seine gesamte Familie in Aufruhr versetzte, musste er sich vergewissern, wer Israel Mabaso im Leben gewesen war, ob er dessen Behauptung Glauben schenken konnte oder ob es wieder einmal eine falsche Fährte war, die sich im Nichts verlor. Er wählte eine interne Nummer und wartete ungeduldig.
Die Stationsschwester meldete sich, und nach einem kurzen Gespräch hatte er die genauen Personalien des Verstorbenen. Jetzt würde er Vincent anrufen, von dem er wusste, dass er oft bis in die Nacht an seinem Computer saß, und auch, dass auf dessen Festplatte Informationen verborgen waren, für die gewisse Leute töten würden. Er tippte die Nummer ein.
Kurz darauf dröhnte Vincents Stimme durch den Hörer. »Hallo, Jackoboy, ich grüße dich.«
Der Doktor zog ein Gesicht, als hätte er auf eine Zitrone gebissen. Sein Name war Jackson, genannt wurde er Jack, aber im Laufe der Zeit hatte er sich daran gewöhnt, von einigen Witzbolden Jacko genannt zu werden, die Variante Jackoboy allerdings hasste er aus tiefstem Herzen. Trotzdem ließ er sich jetzt nichts anmerken. Immerhin wollte er etwas von Vincent.
»Wie geht’s? Was machen die Kinderchen?«, setzte Vincent in abwesendem Ton hinzu.
»Ich hab keins … zumindest soweit mir bekannt ist«, erwiderte der Doktor trocken. »Eine Ehefrau habe ich auch nicht. Für private Daten hast du offenbar nur einen geringen Speicherplatz in deinem Hirn …«
Vincent kicherte zustimmend. Für ein paar Minuten tauschten sie Familienneuigkeiten aus, und nachdem der Doktor geduldig eine Beschreibung von Vincents neuester Freundin hatte über sich ergehen lassen, erklärte er ihm, was er von ihm wollte.
»Israel Mabaso«, sagte er und buchstabierte den Nachnamen. »Beeil dich ein bisschen. Wenn ich heute wieder so spät nach Hause komme, massakriert mich meine Freundin, oder, viel schlimmer, sie verlässt mich.«
»Hör mal, das dauert so lange, wie es dauert. Mein Computer ist eine Primadonna. Sie heißt Maria Callas und will hofiert werden.« Ein fröhliches Glucksen kam durch die Leitung.
»Vielleicht erinnerst du dich daran, dass meine Freundin Vivian heißt und noch wesentlich anspruchsvoller ist als eine einfache Operndiva.« Der Doktor grinste.
Für einige Zeit war nichts als das gedämpfte Staccatogeräusch der Anschläge zu hören, während die Finger seines Freundes über die Computertasten flogen. Nur mühsam seine Ungeduld bezähmend, drehte Jack seinen Sessel zum Fenster. Die Elektrizität war inzwischen zurückgekommen, und draußen blinkten die Lichter in den Zimmern der anderen Krankenhaustrakte. Im trüben Schein der einzelnen Straßenlaterne, die vor seinem Gebäude noch funktionierte, sah er, dass die Blätterwedel der Dattelpalme am Weg noch heftig hin und her schlugen. Noch hatte sich der Wind nicht völlig gelegt, aber er registrierte dankbar, dass der Sturm seine Schuldigkeit getan hatte. Die Dreckwolke, die sonst ständig über der Stadt hing, seine Lunge strapazierte und nachts den Blick auf die Sterne verdeckte, war verschwunden. Er stellte das Telefon auf Lautsprecher, stand auf und öffnete das Fenster. Ein Schwall salzig-würziger Luft strömte herein, und er atmete tief durch. Unter ihm gingen schwatzend ein paar Krankenschwestern vorbei, draußen auf dem Gang quietschten Gummisohlen auf dem Linoleum, und aus der Ferne näherte sich eine Ambulanz mit heulenden Sirenen. Arbeit sicherlich, aber heute nicht mehr für ihn. Aufseufzend warf er sich wieder in seinen Schreibtischsessel und nahm den Hörer hoch. »Wird’s was, Vincent?«
»Bingo!«, hörte er in diesem Augenblick seinen Freund rufen. Unwillkürlich setzte er sich auf. »Du hast tatsächlich etwas gefunden?«
»Oh, Bingo, Bingo!«, schnurrte es als Antwort aus dem Hörer. »Welch ein erstaunlicher Schweinehund unser Israel doch im Leben war. Weißt du, mit wem er Tango getanzt hat?«
Der Doktor musste schmunzeln. Vincent liebte amerikanische Gangsterfilme aus den vierziger Jahren und benutzte Ausdrücke daraus, die so altmodisch waren, dass sie kaum jemand verstand. »Na, rück schon damit heraus!«
Sein Freund gluckste aufgeregt. »Mit dem Vice-Colonel«, rief er triumphierend. »Mister Trevor Scheißkerl Pryce höchstpersönlich!«
Der Vice-Colonel! Der Chirurg zuckte unwillkürlich zusammen. Der Mann war vor Jahrzehnten aus England eingewandert, hatte bald die südafrikanische Staatsangehörigkeit angenommen und war in den Achtzigern bei der Staatssicherheit gelandet. Seinen Namen verdankte er der Tatsache, dass er einen Schraubstock – im Englischen Vice genannt – einsetzte, wenn er seine Opfer zu umfassenden Aussagen bewegen wollte. Erst vor zwei Jahren war er endlich unter falschem Namen gefasst worden und nach den präzisen Aussagen einer jungen Frau, die als Kind Zeugin gewesen war, wie er ihre Mutter gefoltert hatte, und die ihm selbst in letzter Sekunde verletzt entkommen war, zu einer mehrfach lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt worden. Der Fall hatte monatelang die Fernsehnachrichten und Schlagzeilen der Zeitungen beherrscht.
Und sein Patient Israel Mabaso war ein Handlanger des Vice-Colonel gewesen! Sein Puls beschleunigte sich. Was hatte er mit dem Verschwinden der drei zu tun? Würde seine Familie endlich Gewissheit über ihr Schicksal bekommen? Er musste an seine Mutter denken, die gestorben war, ohne zu erfahren, was mit ihren beiden ältesten Söhnen geschehen war, und an seinen Vater, der außer seinen Söhnen auch noch seinen Bruder verloren hatte.
»Dann hat Mabaso tatsächlich genau gewusst, wovon er redete«, sagte er leise.
»Allerdings«, bestätigte Vincent. »Genauestens.«
»Bist du dir ganz sicher?«
»Also, Jacko, hör mal …«
»Ist ja gut, entschuldige, dass ich deine Kompetenz infrage gestellt habe. Aber ich muss wirklich sicher sein, bevor … bevor … nun, bevor ich die Pferde scheumache. Bevor ich meinen Vater anrufe. Er ist auch nicht mehr so belastbar wie früher. Dieser Mabaso war also bei der Polizei? Steht da noch Genaueres?«
»Er hat alles das für den Vice-Colonel erledigt, womit der sich die Hände nicht beschmutzen wollte, wenn du weißt, was ich meine. Müllabfuhr, sozusagen. Für andere wohl auch. Und einmal ist er nur knapp dem Schicksal entgangen, von den Bewohnern im Township als Polizeispitzel mit dem Halsband hingerichtet zu werden.«
»Oh.« Dem Arzt stellten sich die Nackenhaare auf. Hinrichtung mit dem »Halsband« bedeutete, dass dem Opfer bei lebendigem Leib ein mit Benzin gefüllter Autoreifen um den Oberkörper gelegt und dann angezündet wurde. In den achtziger und den frühen neunziger Jahren wurden Dutzende, die vermeintlich Polizeispitzel oder der Hexerei verdächtig waren, auf diese Weise getötet. Neuerdings waren auch einige Vergewaltiger mit dieser Methode von den aufgebrachten Verwandten des Opfers, denen die Polizei zu langsam arbeitete, ins Jenseits befördert worden. »Wieso ist er nicht von der Truth Commission erfasst worden?«
»Er ist untergetaucht und hat seinen Namen und Wohnort vermutlich wesentlich öfter gewechselt als sein Hemd. Wie so viele. Wobei ich glaube, dass er Hilfe vom Vice-Colonel hatte, der ein starkes Interesse daran gehabt haben dürfte, dass Israel Mabaso die Klappe hält. Jetzt, wo sie den Colonel eingebuchtet und den Schlüssel zu seiner Zelle weggeworfen haben, kann es ihm ja wohl egal sein. Leider gibt es bei uns die Todesstrafe nicht mehr«, bemerkte Vincent mit deutlichem Bedauern. »Woran ist Mabaso denn gestorben? Hat ihm jemand ein Messer zwischen die Rippen gejagt? Ich kann mir vorstellen, dass es außer dem Vice-Colonel noch ein paar Dutzend Leute gibt, die das gerne getan hätten.«
»Er hatte einen Motorradunfall.«
»Hoffentlich hat er was davon gehabt …«
»Hat er«, erwiderte der Doktor, der seine Brüder und seinen Onkel sehr geliebt hatte. »Aber sag jetzt nichts weiter. Er war ein Mensch, und ich bin Arzt.«
»Ach, ich bekomme gelegentlich archaische Anwandlungen, wenn dieser Dreck aus der Vergangenheit wieder hochgespült wird. Was wirst du jetzt tun?«
»Das muss ich jetzt erst einmal verdauen. Aber ich lasse es dich wissen, sobald ich mich entschieden habe. Vorerst vielen Dank für alles. Pass auf dich auf, hörst du. Werde nicht leichtsinnig.«
Der letzte Satz war sehr ernst gemeint. Der Inhalt von Vincents Festplatten war hochbrisant, und schon mehr als einmal hatte es Anschläge auf ihn gegeben.
»O Jackoboy, das tue ich, das kann ich dir versichern. Seit dem letzten Mal habe ich alle Festplatten gespiegelt und nach Übersee geschafft, wo sie an einem bombensicheren Ort liegen.« Vincent prustete. »Das ist wörtlich zu nehmen. Falls mir etwas passiert, wird der Inhalt veröffentlicht, und das habe ich überall verbreitet.« Wieder lachte er vergnügt. »Du wirst es nicht glauben, aber die erstaunlichsten Leute sind jetzt sehr um mein Wohlergehen bemüht.«