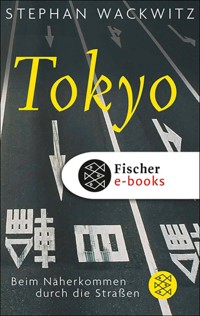9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Fifth Avenue im Herzen New Yorks ist die Hauptstraße des 20. Jahrhunderts. Schnurgerade geht ihr Lauf durch die Kulturgeschichte der Moderne. Einige der berühmtesten Museen der Welt liegen an ihr und epochale Bauwerke wie das Empire State Building. Stephan Wackwitz folgt ihr von einem unscheinbaren Verkehrskreisel in Harlem bis in die Künstlerwelten von Greenwich Village. Er trifft die mächtigen Kuratoren des Metropolitan Museum, erhält Zugang zu den Wohnungen der Superreichen am Central Park und beschreibt die exaltierten Bewohnerinnen von Midtown Manhattan. Und zeichnet in einzigartig persönlicher Weise das Bild eines von Erinnerungen, Träumen, Sehnsüchten und Visionen unaufhörlich belebten Weltboulevards.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Stephan Wackwitz
Fifth Avenue
Spaziergänge durch das letzte Jahrhundert
Über dieses Buch
Die Fifth Avenue im Herzen New Yorks ist die Hauptstraße des 20. Jahrhunderts. Schnurgerade geht ihr Lauf durch die Kulturgeschichte der Moderne. Einige der berühmtesten Museen der Welt liegen an ihr und epochale Bauwerke wie das Empire State Building. Stephan Wackwitz folgt ihr von einem unscheinbaren Verkehrskreisel in Harlem bis in die Künstlerwelten von Greenwich Village. Er trifft die mächtigen Kuratoren des Metropolitan Museum, erhält Zugang zu den Wohnungen der Superreichen am Central Park und beschreibt die exaltierten Bewohnerinnen von Midtown Manhattan. Und zeichnet in einzigartig persönlicher Weise das Bild eines von Erinnerungen, Träumen, Sehnsüchten und Visionen unaufhörlich belebten Weltboulevards.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Coverabbildung: Michael Kenna, Morning Traffic, Midtown, New York, New York, USA, 2000
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2010
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400806-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Musik
Eine höhere Form des Landlebens
Die Verklärung des Gewöhnlichen
Große Kunst
Ein neuer Untergang des Amerikanischen Imperiums
Einige berühmte Ansichten der Fifth Avenue
Nach Jackson Pollock
Musik
Die Fifth Avenue entspringt (denn wir erzählen in Richtung des Verkehrsflusses von der berühmten New Yorker Einbahnstraße) am nordöstlichen Stadtrand von Harlem. An einem strahlenden Samstagnachmittag im März 2008 habe ich mich in die unansehnliche, vage heruntergekommene Stadtlandschaft am Harlem River verirrt, wo der Weltboulevard seinen Ausgang nimmt. Das Flussufer riecht nach Wasser und Verwesung. Eine Brücke aus Stahlträgern führt in die Bronx hinüber. Lagerhäuser und backsteinerne Sozialwohnungen nehmen quadratkilometerweit kein Ende. Der Highway, der die Insel Manhattan einfasst, wütet hinter einer Absperrung vorüber. Er folgt dem Verlauf des Harlem River von Nord nach Südost zum East River. Eine ihrer ästhetischen Absichten nicht ganz gewisse Stadtplanung hat das Dreieck, das durch die Begegnung von diagonalem Flussverlauf und rechtwinkligem Straßengitter zustande gekommen ist, auf der Mitte der Straßenkreuzung in Gestalt eines kaum vorgartengroßen Verkehrsinselparks wiederholt. Drei kleine Bäume. Zwei unbequeme Bänke. Pflegeleichtes Bodengehölz. Vom unablässig wehenden Wind der Flusslandschaft hergetragene Plastiktüten haben sich in ihm verfangen. Zigarettenkippen. Werbeprospekte, wie man sie in Hauseingängen findet und irgendwo wegwirft, vergilben im Rinnstein. Und inmitten der Vernachlässigung steht und glänzt im kalten Frühlingssonnenlicht ein drei Meter hoher Obelisk aus dunkelgrauem Granit.
Einen Moment lang ist er ein Zitat aus den Anfangsszenen von Stanley Kubricks »2001 – Odyssee im Weltraum«. Wenn man sich nicht entschließen will, den wie vom Himmel in diese denkbar unpassende Gegend gefallenen Stein auf eine schwer greifbare Weise unheimlich zu finden, ist er entschieden rührend in seinem rudimentären und schmutzigen Miniaturpark – und deswegen wie alles Rührende auch ein bisschen lächerlich. Obelisken sind seit dem frühen 19. Jahrhundert die schwersten, die geheimnisvollsten, die ultimativ dramatischen Zeichen repräsentativer Städtebaukunst gewesen. 1836 wurde der Obelisk von Luxor auf der Place de la Concorde in Paris aufgestellt. Nicht lang zuvor war die riesige Freifläche zwischen Stadt und Palast nach der Revolution benannt gewesen und hatte die Guillotine beherbergt. Die von undeutbaren Bildern bedeckte Steinsäule aus dem fremden Land war dort aufgerichtet als nicht zu entzifferndes und deshalb auf alles Erdenkliche verweisendes Zeichen eines wiederhergestellten Zusammenhangs der Stadt, des Landes, der Lebenden und der Toten (die Ägypter symbolisierten in diesen seltsamen, eleganten und unübersehbaren Stelen, wie man vermutet, die Strahlen des Göttlichen, das in ihnen auf die Erde trifft). Seitdem ließ sich jedes Beaux-Arts-Stadtbild des 19. Jahrhunderts angelegen sein, einen wirklich aus Ägypten herangeschafften oder vor Ort selbst behauenen Obelisken an denjenigen Plätzen, Embankments und Promenaden aufzustellen, wo es besonders mysteriös, bedeutungsreich und romantisch zugehen und den Spaziergänger anmuten sollte.
Allerdings hat der Obelisk am Ursprung der Fifth Avenue nichts von der Größe, der Verwittertheit, der Authentizität zum Beispiel des sogenannten »Obelisken von Heliopolis«, der ein paar Kilometer südlich von hier zwischen Metropolitan Museum und Central Park steht (der New Yorker Industriefürst William H. Vanderbilt hat ihn im späteren 19. Jahrhundert aus Ägypten hierher transportieren lassen). Doch sind auch die goldenen Inschriften des kleinen Monuments in Harlem fast hieroglyphenhaft geheimnisvoll, und ihr Sinn wäre nicht zu enträtseln, wenn nicht eine grünweiße Erklärungstafel der Stadtverwaltung einen ins Bild setzen würde. Die französischen Ortsnamen nämlich, die kryptischen Datumsangaben, das Symbol der drohend aufgerollten, zum Vorschnellen bereiten Schlange und die zugleich umständliche wie lakonische Truppenbezeichnung »369th Infantry Regiment (15th Regiment NYG) (Colored)«, erfährt man, verweisen auf eine Einheit der US-Nationalgarde. Als regulärer Truppenteil der vierten Armee der französischen Republik hat das hier geehrte 369. Infanterieregiment nach 1917 gegen das Deutsche Kaiserreich gekämpft (und gegen meinen Großvater, dachte ich sofort, der als Offizier damals in Flandern stand). Allein bei der Befreiung des Fleckens Sechault in den Ardennen fiel ein Drittel der Einheit. Die Überlebenden des Kriegs wurden nach ihrer Rückkehr mit einer Parade geehrt, die vom Washington Square aus die gesamte Fifth Avenue stadtauswärts nach Harlem entlanggeführt hat – bis zu dem seltsamen Platz, auf dem wir jetzt stehen und in der Märzsonne blinzelnd uns einen Reim auf die goldenen Inschriften des kleinen grauen Obelisken zu machen versuchen.
Die »Harlem Hellfighters«, wie das »369th Infantry Regiment (15th Regiment NYG) (Colored)« der New Yorker Nationalgarde sich irgendwann selbst getauft hat und von seinen weißen Kameraden bald immer respektvoller genannt werden sollte, ist eine rein afroamerikanische Einheit gewesen (in der American Army herrschte zur Zeit des Ersten Weltkriegs noch race segregation). Nach dem Eintritt der USA in den Krieg im April 1917 wurden die »Hellfighters« in die Armee übernommen. In South Carolina trainierte man sie unter dem rassistischen Hohngelächter der Einheimischen als eine Art Exotikum auf Gefechtsbedingungen. Und am Neujahrstag des Jahres 1918 schließlich betrat mit dem »369th Infantry Regiment« ein Gepäckträger und Mietpage aus Albany im Staat New York den in schon vier entsetzlichen Jahren umkämpften Kontinent Europa: Henry Lincoln Johnson. Diesem Mann wird unsere Erzählung jetzt eine Weile lang folgen, bis seine Gestalt sich wieder in den Atmosphären, Erinnerungen und Geistererscheinungen verflüchtigen wird, die in dem kleinen vernachlässigten Verkehrsinselpark am Ursprung der Fifth Avenue umgehen.
Man weiß im Grunde nicht viel von Henry Lincoln Johnson. Er war 1897 irgendwo im Süden zur Welt gekommen, noch vor der Übersiedlung der Familie nach New York State. Sein zweiter Vorname lässt darauf schließen, dass seine Eltern gehofft haben, mit ihrem Kind der Erinnerung an die Sklaverei, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch schwer auf den amerikanischen Südstaaten gelastet hat, in erfolgversprechendere Gegenden zu entfliehen. Aber es war dann doch nur ein professioneller Lastenträger aus Henry Lincoln geworden, der sich in Albany am Bahnhof bereithielt, um gegen Entgelt Golfausrüstungen, Hutschachteln, Seekisten und Koffer in Autos zu verladen oder auf Hotelzimmer zu schleppen. Auch seine Karriere in Nationalgarde und Armee war lange Zeit unspektakulär verlaufen. Bis am 14. Mai 1918 Private Johnson im Niemandsland zwischen den Fronten des Argonner Walds einen verwundeten Kameraden zu seiner Einheit zurückbegleitete und in einen Spähtrupp von dreißig bis vierzig deutschen Soldaten hineinlief, die das Feuer eröffneten. Johnson wurde in dem sich nun entfaltenden Schusswechsel verwundet. Er scheint einen Moment in Ohnmacht gefallen und für tot liegengelassen worden zu sein, während die Deutschen seinen Kameraden in die Gefangenschaft davonführten.
Nun passierte Folgendes: Henry Lincoln Johnson erlangte nach kurzer Zeit das Bewusstsein wieder und sah sich ohne seinen Schutzbefohlenen allein im Schlamm des Argonner Waldes liegen. Er stand trotz seiner schweren Verwundung irgendwie auf, nahm – offenbar vollkommen high von Wut und Adrenalin – sein noch geladenes Gewehr an sich, setzte dem deutschen Spähtrupp, seine Waffe leerschießend, nach und warf sich, ausgerüstet mit nichts als seinen Fäusten und dem sogenannten »Bolomesser«, einer unterarmlangen Machete, auf den Feind, dessen Verblüffung in einen entscheidenden taktischen Vorteil umwandelnd. Der sich rücksichtslos in die völlig aus dem Konzept gebrachten deutschen Pioniere hineinkämpfende (dabei, wie gesagt: selbst schwer verwundete) Henry Lincoln Johnson ließ eine beispiellose Schneise der Vernichtung hinter sich. Der Entfesselte tötete vier deutsche Soldaten, verwundete um die zwanzig, schlug die übrigen in die Flucht, kümmerte sich eine Nacht lang um seinen Kameraden und wurde erst im Morgengrauen von seinen scheu staunenden Kameraden entsetzt.
Die Nachricht vom Amoklauf des Gepäckträgers aus dem amerikanischen Albany verbreitete sich mit der Geschwindigkeit eines Steppenbrands bei Freund und Feind. Henry Lincoln Johnson wurde im französischen Heeresbericht erwähnt und erhielt das »Croix de la guerre«. Das 369. Infanterieregiment sollte wenig später auch als Einheit diesen Orden erhalten und wurde weithin berühmt als eine der tapfersten Truppen des großen Krieges. Der Mann jedoch, der in einem einzigen, nie mehr zu vergessenden Lebensmoment eine generationenalte Wut auf den weißen Mann im Rahmen des militärisch Zulässigen und Erwünschten in sich befreit und eine gar nicht mehr übersehbare Schuld der Weißen an deutsche Soldaten zurückgezahlt hatte, wurde wie so viele Veteranen aus dem ersten großen Krieg des 20. Jahrhunderts nicht mehr heimisch in der Welt. Militärische Heldenstücke wie das von Henry Lincoln Johnson am 14. Mai 1918 vollbrachte sind vielleicht nur zu erklären durch die Annahme eines in vielen (vielleicht allen) Menschen bereitliegenden Dispositivs der Tötungslust. In bestimmten Extremsituationen von Angst und Wut entlädt es sich (das ist die eine Möglichkeit) verbrecherisch. Oder eben, wenn Krieg ist, in einem Rahmen, der zur Verleihung von Orden führt.
»Drei Minuten vor dem Angriff winkte mir Vinke mit einer gefüllten Feldflasche. Ich tat einen tiefen Zug. Es war, als ob ich Wasser hinabstürzte. Nun fehlte noch die Offensivzigarre. Dreimal löschte der Luftdruck das Streichholz aus. Der große Augenblick war gekommen. Die Feuerwalze rollte auf die ersten Gräben zu. Wir traten an.« So hat Ernst Jünger die Seelenzustände »in Stahlgewittern« beschrieben. Sie herrschten von 1914 bis 1918 auf beiden Seiten des Frontensystems im Westen. Das nordfranzösische und flandrische Erdreich war in jenen Jahren unterminiert, als seien dort Maulwürfe am Werk, die in einem Albtraum oder Horrorfilm zu Raubtieren mutiert waren. Von Zeit zu Zeit brachen sie hervor ans Licht und stürmten voll Mordlust nach vorn. »Im Vorgehen erfasste uns ein berserkerhafter Grimm. Der übermächtige Wunsch zu töten beflügelte meine Schritte. Die Wut entpresste mir bittere Tränen. Der ungeheure Vernichtungswille, der über der Walstatt lastete, verdichtete sich in den Gehirnen und tauchte sie in rote Nebel ein. Wir riefen uns schluchzend und stammelnd abgerissene Sätze zu, und ein unbeteiligter Zuschauer hätte vielleicht glauben können, dass wir von einem Übermaß an Glück ergriffen seien.«
Wie Hochverrat ist Massenmord eine Frage des Datums. Johnson könnte (sich so den Fall zurechtzulegen und ihn in seinen geheimen Implikationen weiterzuspinnen, kommt man bei längerem Nachdenken nicht umhin) in einem umnebelten Zustand des Außersichseins gesteuert gewesen sein von der nicht mehr zu kontrollierenden Wutlust darauf, weiße Männer umzubringen. Es war eine Urszene, eine extreme, im Körper Henry Lincoln Johnsons aufgespeicherte, aus fernen Zeittiefen an ihn überlieferte Möglichkeit, die an jenem Maitag im Jahr 1918 plötzlich überwältigende Realität wurde. Wer aber derlei einmal erlebt hat, aus dem wird kein guter Gepäckträger mehr. An der Siegesparade seiner Einheit die Fifth Avenue stadtauswärts hat Henry Lincoln Johnson noch in der ersten Reihe teilgenommen. Ich betrachte im Internet das vergilbte Foto eines schüchtern dreinblickenden, kleingewachsenen schwarzen Mannes unter dem französischen Helm. Man fährt ihn stehend in einem offenen Auto wie einen Präsidenten oder sonst eine Zelebrität. Und er hält, so ungeschickt und verlegen wie manche Geistererscheinungen, einen Blumenstrauß in der Hand.
Aber mit seiner Frau (die sich vor ihrem Mann insgeheim jetzt gegraust haben mag) wurde es nach seiner Rückkehr aus Frankreich nie mehr wie zuvor. Seine vielen Kriegsverwundungen machten es ihm unmöglich, weiter in seinem Beruf zu arbeiten. Der von Dünkel und Rassenangst verblendeten US-Armeeführung ist das von Private Johnson in Frankreich angerichtete Massaker (das als Heldentat anzuerkennen sie freilich nicht umhin konnte) offenbar tief unheimlich gewesen. Sie verweigerte ihm angemessene soziale Unterstützung ebenso wie eine militärische Auszeichnung. Erst knapp über dreißig Jahre alt starb Henry Lincoln Johnson 1929 im Veteranenkrankenhaus von Albany am Alkohol und an den Folgen seiner Verwundungen (mein Großvater, der im selben Jahr geboren ist wie Private Johnson und im gleichen Krieg gekämpft hat wie er, stand – hochdekoriert – damals einer deutschen Auslandsgemeinde im polnischen Oberschlesien vor und würde noch fünfzig Jahre, bis 1979 leben; eine andere Geschichte, die anderswo erzählt worden ist). Henry Lincoln Johnson aber wurde erst von Präsident Bill Clinton 1996 posthum das »Purple Heart« verliehen. Und eine Veteraneninitiative, die in Albany schon die Errichtung eines Denkmals für ihren berühmten Kameraden und die Umbenennung einer Ringstraße in »Henry Johnson Boulevard« durchgesetzt hat, lässt sich derzeit die Höherstufung dieses Ordens zur höchsten amerikanischen Tapferkeitsauszeichnung, der »Medal of Honor«, angelegen sein.
Die Geschichte Johnsons ist eine Art Mikroskop oder Fernglas. Man kann mit ihm die Tage und Nächte, die Träume und Ängste, die Wut und die Einsamkeit der kein Ende nehmenden Mordmonate des Ersten Weltkrieges betrachten – Erlebnisse, von denen dann oft schon die übernächste Generation (»Opa erzählt wieder vom Krieg«) nichts mehr wissen will. Die Geschichte der Kunst ist weniger pointillistisch, skandalös und unterirdisch überliefert als die der körperlichen Tapferkeit und militärischen Tötungsathletik. Die Eroberer und Wegbereiter, die Schurken und Versager, die Hochstapler, die Berühmten und die Verkannten im kulturellen Geisterreich sind Thema einer episch ausschwingenden, vielfältig zusammenhängenden, gut ausgearbeiteten und oft wiederholten Erzählung, die sich jeder gern vergegenwärtigt. Verblüffenderweise aber hat auch zu ihr das »369th Infantry Regiment (15th Regiment NYG) (Colored)« ein entscheidendes Kapitel beigetragen. In den nun folgenden Wochen erfuhr ich es schrittweise, staunend und immer mehr erfüllt von so etwas wie Ehrfurcht, auf Spaziergängen und über Recherchen in Bibliotheken oder im Internet, nachdem ich den Faden an jenem kalt strahlenden Märznachmittag des Jahres 2008 in Harlem einmal aufgenommen hatte.
Um es kurz zu machen: Die Regimentskapelle der »Harlem Hellfighters« war eine der berühmtesten und einflussreichsten Jazzformationen der Musikgeschichte. Die »369th Infantry Regiments Band« hat ihre Kameraden aufgeheitert und getröstet durch damals hochberühmte Nummern wie »On Patrol in No-Man’s Land«. Einerseits. Andererseits und sozusagen nebenher aber hat diese Regimentskapelle nichts Geringeres geleistet als die Einführung des Jazz in Frankreich und überhaupt in Europa. Ihr Bandleader, der Pianist James Reese Europe, ist als Musiker und Kulturpolitiker eine zentrale Figur des »Ragtime«, jener synkopierten und harmonisch grellgefärbten Marschmusik, aus der erst in den zwanziger Jahren entstanden ist, was wir heute Jazz nennen. Vor dem Ersten Weltkrieg freilich war Ragtime noch nicht die Vorgeschichte von irgendetwas, sondern eine von mehreren Avantgarden schwarzer Kultur, die sich in New Orleans, Chicago und Harlem etablierte und den Kampf um ihre gesellschaftliche Legitimation aufnahm.
Wie Henry Lincoln Johnson kam James Reese Europe aus dem Süden, aus Alabama. Schon seine Eltern waren Musiker. Und bei dem Kompositionswettbewerb, der dem musikalischen Wunderkind zum ersten Mal so etwas wie Ruhm eintrug, bekam er nur deshalb den zweiten und nicht den ersten Preis, weil den seine kleine Schwester gewann. Mit 22 begann er in New York für die wichtigsten Bandleader seiner Zeit zu spielen. Die Künstlerlegende behauptet, der siebenjährige George Gershwin habe auf dem Bordstein des Harlemer Lokals gesessen, wo Europe’s Musik durch offene Türen zu ihm herausdrang. Fest steht jedenfalls, dass James Reese Europe, dessen Ruf sich in der Musikwelt nun schnell verbreitete, sein Prestige als Künstler in die Gründung einer kulturpolitisch bahnbrechenden und bis heute vorbildlichen Musikerkooperative einbrachte. Der »Clef Club«, dessen Immobilie in Midtown, an der West 53rd Street, bald zum Zentrum des Jazz in New York wurde, ist eine Kombination von Künstlergewerkschaft, Lokal, Konzertagentur und Musikklub gewesen. Ein visionäres Monument der Selbstorganisation einer Berufsgruppe, die in der öffentlichen Wertschätzung damals noch knapp über Schuhputzern, Clowns und Gangstern rangierte. Und der höhere Organisationsgrad zahlte sich aus. Zunächst in einem neuen Selbstbewusstsein der New Yorker Jazzmusiker, aber dann auch sehr schnell in verbesserten Arbeitsbedingungen und intensiver Kommunikation über Musik, über Auftrittsmöglichkeiten, Personalien und den neuesten Klatsch. Der Arbeiterbewegung analog und parallel zu deren Erfolgen kam es schon vor dem Weltkrieg zu einer gewerkschaftsartigen Beheimatung und Einbürgerung des musikalischen Jazz-Prekariats in der entstehenden schwarzen middle class. Die in der Folge zum Träger der sich in solchen Initiativen bereits ankündigenden »Harlem Renaissance« der zwanziger Jahre werden sollte.
Die »Harlem Renaissance« ist die erste und der Musterfall einer Reihe von Arrivierungsbewegungen gewesen, aus denen die Kulturgeschichte New Yorks im letzten Jahrhundert besteht. Neuformatierungen (Verklärungen) des Marginalen und Verachteten waren seit Beginn des Jahrhunderts das wichtigste Funktionsprinzip der künstlerischen Moderne in Europa. Spätestens seit Duchamps Aufenthalt von 1915 bis 1919 war New York ihr transatlantischer Stützpunkt. Das endgültige modernistische Zentrum, Erbin des Pariser Montmartre, ist die Stadt erst nach dem Zweiten Weltkrieg geworden und dann das ganze letzte Jahrhundert hindurch geblieben. Die Kulturbewegung New Yorks verlief dabei von den verachteten Rändern im Norden und Süden in die Kunsttempel von Midtown. Eine unablässig sich drehende Sittenkomödie der sozialen und kulturellen Neuinterpretation war die letzten hundert Jahre hier in Gang. Eine allseitige Umdeutungsmaschinerie zwischen oben und unten. Ein permanent tagendes Jüngstes Berufungsgericht, das im kulturellen Feld die Polpositionen verschob und vertauschte. Zwei Förderbänder der Kulturbewegung beschäftigten sich das ganze 20. Jahrhundert lang unablässig damit, Kunstwerke, Stile, Toleranzen, Paradigmen die Fifth Avenue hinauf- und hinunterzuschaffen, von Harlem im Norden und vom Greenwich Village im Süden zur etablierten Mitte der Stadt: ins MoMA, in die Carnegie Hall, ins Whitney Museum of American Art, ins Lincoln Center und ins Metropolitan Museum.
Illegitime Unterschichtenkulturen wie Jazz oder folk music fanden sich in New York mit oft spektakulärer Geschwindigkeit auf dem kulturellen Olymp wieder und Bilder von Suppendosen im ersten Museum des Landes. Unten war hier so plötzlich oben wie nirgendwo sonst auf der Welt und zugleich so sichtbar und sensationell oben wie sonst nirgendwo. Was in ungeheizten Ateliers downtown unter allgemeinem Kopfschütteln entstanden war, hing über Nacht (ein halbes Jahr später) uptown im Metropolitan Museum. Das kulturelle high/low-Mobile, das sich im soziokulturellen Oben/Unten-Schema der New Yorker Avenuen spiegelt, ist Erbe und Spielform des Klassenkampfs zwischen Bourgeoisie und Proletariat gewesen. Bis ins 20. Jahrhundert hinein hatte der soziale Urkonflikt des 19ten die architektonische Gestalt der Stadt geprägt – bis in die Lage und Beschaffenheit des letzten Pflastersteins. Heute dagegen (und schon seit langem) werden Immobilienpreise, Ansehensgewinne, das image von Häusern, Menschen, Vierteln in New York anhand kultureller Unterscheidungen bestimmt. So kann man die Geschichte New Yorks im 20. Jahrhundert schreiben als die Verwandlung des Klassenkampfs in Kulturkämpfe. Oder als die Ablösung der Massaker, Schlachten, Orden und Triumphe des Kriegs durch die Siege, Niederlagen, Karrieren und Untergänge, die im Reich der Kunst vorkommen und möglich sind. Als die Geschichte, um es mit zwei Namen zu sagen, der beiden Regimentskameraden Henry Lincoln Johnson und James Reese Europe.
Schon vor dem Krieg, am 2. Mai 1912 war das Ragtime-Orchester des Clef-Club unter der Leitung von James Reese Europe zum ersten Mal in der Carnegie Hall in Midtown aufgetreten. Eine Band aus Harlem im vornehmsten Konzertsaal der Bourgeoisie – das war 1912 eine kalkulierte Provokation, ein spektakulärer Akt des Muts, eine Offenheit auf Seiten des Carnegie-Managements, die in europäischen Kultureinrichtungen damals undenkbar gewesen wäre. Und eine Gelegenheit, der sich James Reese Europe mit seinen musikalischen Mitstreitern nun in einer so aufregenden und überzeugenden Weise gewachsen zeigte, dass der Ragtime-Tabubruch bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs und zur Einschiffung der Band nach Frankreich noch zweimal wiederholt werden sollte. James Reese Europe aber fiel nach der Rückkehr aus dem Krieg (den er unversehrt überstanden hatte) auf der Amerika-Tournee seiner Band dem Wutausbruch eines Perkussionisten zum Opfer, der in der Konzertpause aus einem längst vergessenen Grund mit dem Messer auf seinen Chef einstach und ihm die Halsschlagader durchtrennte. In der Geschichte seiner Musik hat es James Reese Europe nicht zu größerem Ruhm gebracht als zu dem eines Wegbereiters. Und es ist ein ironischer Akzent seines Lebenslaufs, dass ihm (der auf kulturellen Feldern ungleich Bleibenderes geleistet hat als auf denen des Kriegs) im Gegensatz zu seinem (tatsächlich bis zur Unheimlichkeit tapferen) Kameraden Henry Lincoln Johnson die militärische Ehre einer Bestattung auf dem Heldenfriedhof in Arlington zuteil wurde.
Es herrschte dann schon ein geradezu mediterran festlicher und überschwänglicher Frühling in New York, als ich im April 2008 an Wochenenden die Gewohnheit annahm, von der 96sten Straße ins puertorikanische East Harlem hinaufzuwandern und am Jefferson Park vorbei zur 125sten Straße. An dieser Ost-West-Magistrale, der repräsentativen Hauptstraße von Harlem, liegt nicht nur das musikgeschichtlich legendäre Apollo-Theater oder das Büro Bill Clintons, sondern auch das National Black Theatre und, an der Kreuzung zur Lenox-Avenue (die hier Malcolm X Boulevard heißt), die Lenox Lounge, ein erst 1999 wiederhergestelltes und der Ruinierung entrissenes innenarchitektonisches Ensemble der vierziger Jahre, in dem Miles Davis und John Coltrane gespielt, James Baldwin und eben Malcolm X sich amüsiert haben. In einer der kunstledernen Sitzbuchten kann man dort am Fenster einen Kaffee trinken, auf den Boulevard hinaussehen und den Erinnerungen nachsinnen, die einen aus dem langen Spiegel hinter der Bar anfliegen. Die Täfelung aus gelben und braunen Hölzern ist vollständig erhalten, allerlei Intarsien aus Glas und goldenen Mosaiksteinchen sind liebevoll restauriert. Ein alter Mann saß jedesmal, wenn ich dort war, gleich am Eingang. Er trug einen eleganten hellen Anzug, altmodisch spitze Schuhe, einen braunen Fedora-Hut und wirkte vage zuständig oder zumindest, als habe er hier immer schon gesessen. Manchmal sah er in einer eigenartig verkrampften Haltung (die er hätte vermeiden können, wenn er nur einen oder zwei Plätze weiter in den Raum hineingerückt wäre) zu dem ununterbrochen laufenden Fernseher über ihm empor, und manchmal unterhielt er sich mit einer der jungen Frauen, die sich hinter der Theke langweilten (zu dieser Tageszeit kommt fast niemand in die Lenox Lounge).
Der hintere Konzertraum ist von der Bar getrennt durch Glasscheiben, in die elegant geschwungene Art-Deco-Ornamente geätzt sind. Auch wenn abends dort sehr ernstzunehmende Jazzmusiker für Touristen und für die Leute aus der Nachbarschaft spielen, ist es nicht wirklich überfüllt. Es war ein Abend im März 2008. Wir waren zum ersten Mal hergekommen. Gegen zwölf bestellte die japanische Reisegruppe, die die drei Tische im Hintergrund mit Beschlag belegt hatte, das Taxi zum Hotel. Der Saxophonist (und Bandleader), sein durch nichts aus der Ruhe zu bringender Klavierspieler und ein auf seinem Sitz jeden Moment in neue Explosionen ausbrechender Drummer waren unter der Hand durch ein halbes Dutzend Musiker verstärkt worden, die entspannt und ohne dass es weiter aufgefallen wäre, den Verlauf des Abends über hereingeschneit waren mit ihren Kästen und Gerätschaften. Eine kleine Pause trat ein. Als es gegen halb eins wieder losging, hatte sich die Stimmung im Hinterzimmer der Lenox Lounge radikal verändert. Plötzlich machten die Musiker keine Späße mehr. Der Touristenjazz war vorbei. In wechselnder Besetzung nahmen die Band und ihre Gäste einander und uns Übriggebliebene noch zwei Stunden lang mit auf einen Höhenflug, wie er selbstvergessener auch zu den Zeiten nicht gewesen sein kann, als »Birth of the Cool« frisch in den Plattenläden war. Wir hatten die Lenox Lounge zwei Jazzmusikern aus Deutschland gezeigt, die zum Staunen und zur anerkennenden Begeisterung der alteingesessenen Harlemer später auch noch eingestiegen waren. Gegen drei verabschiedeten wir uns von unseren Begleitern. Wir sahen einander an, als seien wir gerade aus einem Traum über die frühen fünfziger Jahre in die Wirklichkeit zurückgestolpert. Als wir vor der neugotischen Sandsteinkirche der Lenox Avenue ein Taxi anhielten, war das nächtliche Harlem plötzlich wieder eine Stadt des frühen letzten Jahrhunderts. Die eleganteste, erstaunlichste, träumerischste Metropole der modernen Welt.
Unterdessen liegt, wenn ich samstagnachmittags in Harlem spazieren gehe, schon ein grüner Schleier von Knospen und frisch aufgewachsenem Gras über den Nachbarschaftsgärten der Ruinengrundstücke. Sie beschwören die Atmosphäre des Hausbesetzer-Kreuzbergs der frühen achtziger Jahre herauf. Die ehemals so eleganten, von neobarockem Ornamentschmuck überwucherten townhouses der Vor- und Zwischenkriegszeit haben merkwürdig gebauchte Erker, die man nirgends sonst in New York sieht. Vor 1990 wurden viele von ihren Besitzern angezündet, weil die Versicherungssummen höher waren als jede hier zu erzielende Mieteinnahme. Harlem hat damals ganze Straßenzüge weit ausgesehen wie nach einem Bombenangriff. Noch heute sind viele Grundstücke leer oder beherbergen bloß eine von Schlingpflanzen überzogene Ruine. Fenster sind mit Brettern vernagelt. Bunt und sexy angezogene Menschen flanieren auf der 125sten Straße. Romanautoren bieten selbstverlegte Bücher feil. An jeder Ecke gibt es karibisch eingelegte Krabben oder auf Campinggrills gelegte Fleischspieße mit Fladenbrot. Man kann illegal kopierte CDs und DVDs kaufen. Räucherstäbchen glimmen. Naturparfüms stehen in Hunderten von Flaschen auf Tapeziertischen.
Das Sortiment der auf dem Bürgersteig allgegenwärtigen Buch- und Broschürenhändler ist von einer Seltsamkeit, die für Gegenden ideologisch anspruchsvoller gentrification offenbar überall auf der Welt charakteristisch ist. Ich fühle mich erinnert an das Angebot im Kreuzberg meiner Jungmännerjahre. Nicht allerdings die Klassiker des Anarchismus, des Bombenbaus, des politisierten Liebeslebens und des Marxismus-Leninismus werden auf der 125th Street feilgeboten wie damals auf Festen in besetzten Häusern der Waldemarstraße oder auf dem Mehringdamm. Stattdessen zum Beispiel ausführlich-schwülstige Erörterungen über die »spirituelle Essenz der schwarzen Frau« (was immer das sein mag). Oder historische Romane über berühmte Abessinierkönige des Mittelalters. Die Aufsätze W. E. B. Du Bois’ über The Souls of Black Folk. Bunte Schaubilder und charts verzeichnen und systematisieren afrikanische Herrschergestalten, schwarze Erfinder und Politiker (ein halbes Jahr später wird das Konterfei Barack Obamas allgegenwärtig sein). Dicke Broschüren reißen historischen Verschwörungen, Templergreueln und Illuminatenorden die Maske vom Gesicht. Unangenehm berührt einen der manifest antisemitische Dreh vieler dieser Publikationen.
Die fünfzehnstöckige Harlemer Stadtverwaltung, ein Bau der frühen siebziger Jahre, könnte auch in Polen, in Weißrussland, in Rumänien oder Indien stehen. Seine Fensterfront sieht den Boulevard entlang nach Süden Richtung Central Park. Hinter verdreckten Jalousien vertrocknen Zimmerpalmen. Der klobige, gleichsam populistisch einschüchternde Beton- und Glasbau ist benannt nach Adam Clayton Powell Jr., einem Harlemer Politiker und Geistlichen, von dem ich noch nie etwas gehört hatte. Jedoch werden einem seine Lebensbewandtnisse und Verdienste auf dem Sockel eines ebenfalls sehr realsozialistisch aussehenden Bronzedenkmals ausführlich erläutert. Es zeigt Adam Clayton Powell Jr., wie er hochdynamisch irgendwie aufwärtsstrebt und der Zukunft entgegenschreitet. Auf dem Platz davor spielt die Band eines Stadtteilfests so mitreißenden Rhythm ’n’ Blues, dass ich mich zusammennehmen muss, um mich den vor der Bühne entfesselt Tanzenden nicht anzuschließen. Denn ich muss weiter. Alte Männer mit jamaikanischen Haarbeuteln rauchen vor schäferhundgroßen, furchterregend wummernden schwarzen boom boxes. Im Marcus Garvey Park (der den Verlauf der Fifth Avenue mit seinen Felsenabhängen, Bäumen und Ausblicken unterbricht) schreien, klettern und laufen Kinder durcheinander. Vor der Einzäunung bemühen sich ambulante Fahrradreparaturwerkstätten fachmännisch und liebevoll um die Fahrzeuge der Nachbarschaft.
Aber nicht nur die Erinnerung an das Kreuzberg der achtziger Jahre wandelt den Spaziergänger in diesen Straßen an. Auch ein Heimweh nach den aus langen historischen Albträumen erwachten Städten Polens, Ungarns oder der Slowakei in den späten neunzigern wird in mir lebendig und findet zugleich etwas, woran meine Nostalgie sich halten und worüber ich nachdenken kann. Denn die sich aus niedergedrückten Verhältnissen der Hoffnungslosigkeit, des Terrors und der Gleichgültigkeit herausarbeitende Marktwirtschaft, scheint es, sieht sich überall auf der Welt ähnlich. Eine Atmosphäre und Formgesinnung gleichsam handgemachter Improvisation ist Kennzeichen einer embryonalen Mittelklasse, eine gewisse ungelenke Lebendigkeit, eine oft das Närrische streifende Originalität, aus der dann die entscheidenden und bleibenden Innovationen hervorgehen (das Benjamin-Franklin-Syndrom). Bei einem meiner Besuche in Harlem zum Beispiel gab es an der Kreuzung der 125sten Straße mit der Fifth Avenue noch ein Café, in dem man zugleich auch Kosmetik kaufen konnte. Man sah die Runde der von ihrer Idee unwiderleglich begeisterten entrepreneurs geradezu vor sich, denen es irgendwann einmal als die ultimative Geschäftsidee eingeleuchtet haben muss, dass die jungen Frauen Harlems hier nach dem Kauf eines Lidschattens eine Schokolade trinken oder sich bei Kaffee mit Kuchen zwischen Parfüms entscheiden würden.
Aber es macht auch nichts, dass das alles dann offenbar nicht geklappt hat. Schon bei meinem nächsten Besuch waren Handwerker einer (vermutlich auch gerade erst kürzlich gegründeten) Firma für Innenausbau in dem großen Raum beschäftigt, als ich über einem Milchkaffee mein Buch auspacken wollte. Mit dem Kosmetikcafé war es schon wieder aus. Eine neue Geschäftsidee bereitete ihren Einzug vor. Diese Straßen haben jede Woche einen neuen Gedanken. Manche werden ihren Findern zumindest soviel einbringen, dass sie mit wieder neuen Ideen weitermachen können. Denn der Mittelstand hat sich nie und nirgends anders entwickelt als in jener Stimmungsmelange aus Begeisterung, fixen Ideen, Bastelei, Schäbigkeit, kindlichem Stolz auf sich selbst und einer (immer auch sehr rührenden) Selbstüberschätzung. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts habe ich diese Mischung aus Atmosphären, Plänen, Projekten, Erfolgen, Träumen und Niederlagen in Krakau oder Katowice kennengelernt, auf Spaziergängen durch ganz ähnliche Viertel und Straßen. Jetzt kann ich mir diese Gegend an Aprilwochenenden in Harlem (so weit von zu Hause) wieder erwandern. Vielleicht ist sie, denke ich einen Moment lang träumerisch vor mich hin, die weltweit definitive Stadtlandschaft unserer Zeit.
Eines der Bücher, die ich am vorletzten Wochenende in der Filiale der New York Public Library am Marcus Garvey Park ausgeliehen hatte, war eine als Schullektüre (mit kurzen Einführungen, Erschließungsfragen, Arbeitsaufträgen und so weiter) edierte Anthologie der afroamerikanischen Literatur. Und so las ich (wie sich später herausstellte, am letzten Wochenende, das dem Kosmetikcafé beschieden war) an der Kreuzung der Fifth Avenue mit der 125ten Straße, zwei Häuser stadtaufwärts vom Black National Theatre entfernt, zum Beispiel das intellektuell-moralisch hochdifferenzierte und literarisch erstaunliche Geständnis des Sklaven Nat Turner, der 1831 mit seinen Genossen als ein amerikanischer Spartakus die Familie seines Besitzers und Peinigers sowie sechzig weitere Weiße erschlagen hatte. Wochenlang hielt er sich danach in den Wäldern Virginias verborgen, bis er schließlich verraten, verurteilt und gehängt wurde. Ich las die alte, vielleicht noch aus Afrika stammende Geschichte von dem in die amerikanische Sklaverei geratenen Zauberer, der in der höchsten Kollektivnot seiner Brüder und Schwestern dann schließlich das magische Wort ausspricht, das Menschen zu fliegen befähigt. Worauf die geschundenen Sklaven sich von den heißen Baumwollfeldern in die Luft erheben und wie der fliegende Robert des Kinderbuchs hoch am Himmel fernhin über den Ozean dahinziehen, als flögen sie nach Haus (eine Geschichte, die ich schon früher nicht lesen und auch jetzt nicht nacherzählen kann, ohne dass mir Tränen in die Augen steigen). Und ich las »Of our Spiritual Strivings« von W. E. B. Du Bois, dem intellektuellen Vater der »Harlem Renaissance«. Als Zeitgenosse der Südstaatenrestauration hatte er erlebt, dass die juristische Freiheit nicht zur politischen Teilhabe am amerikanischen Traum geführt hat und es Formen der Ungerechtigkeit gibt, die verheerender in innere Landschaften eingreifen, als die Befreier aus dem Norden je hätten verstehen können (wenn es sie interessiert hätte).
Der große, leidenschaftliche, an der Predigt des europäischen Protestantismus geschulte Stil ergriff mich, wie einen die Unabhängigkeit des Geistes angesichts der Dummheit und Ungerechtigkeit des Lebens ergreift. Und in Du Bois’ Schilderung einer (zeitweiligen) Abkehr der Schwarzen vom politischen Machtroman erkannte ich die welthistorische Ausweichbewegung wieder, die kluge Reformer angesichts unüberwindlicher Unterdrückung schon oft und erfolgreich vollzogen haben. Die Gallier, Spanier und Illyrer nach ihrer Niederlage und Eingliederung ins Römische Reich zum Beispiel. Die Schotten nach der endgültigen Unterwerfung ihres Landes durch den englischen Süden. Das deutsche Bürgertum im Zeitalter der Französischen Revolution. Die Polen nach dem Scheitern der großen Aufstände des 19. Jahrhunderts. Die europäische Arbeiterbewegung vor dem Ersten Weltkrieg. Wie seltsam, dachte ich, dass mein Herz, als ich jung war, immer bei den Revolutionären und ihrem schönen Scheitern gewesen ist – und heute meine gut reaction ohne Zögern auf Seiten der pragmatischen Reformer. Als »Helden des Rückzugs« (wie Hans Magnus Enzensberger Michail Gorbatschow genannt hat) lassen sie in einer Art entschlossener Resignation die ihnen nicht erreichbare (noch nicht erreichbare) politische Selbstbestimmung zunächst fahren und wenden sich einem vielleicht radikaleren Projekt zu. Sie nehmen jetzt die Arbeit daran auf, die Unterdrücker auf ihren eigenen Exzellenzfeldern zu übertreffen, auf dem der Kultur zum Beispiel oder dem des wirtschaftlichen Erfolgs. Sie fordern zunächst nicht mehr die Macht (die werden sie später bekommen). Aber dafür schon jetzt die gleichberechtigte Teilhabe an Idealen, die auch die feindliche Suprematie, wenn sie sich nicht selbst widersprechen will, nur verstehen kann als prinzipiell für jeden gültig. Romanitas