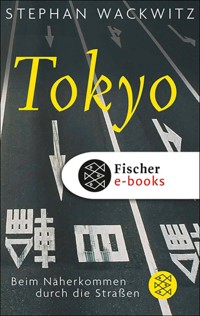
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit wachem Blick für die sinnlichen Details und einem Ohr für das Echo des Vergangenen durchstreift Stephan Wackwitz eine der faszinierendsten Städte der Welt. Fern davon, Östliches gegen Westliches auszuspielen, verdichten sich seine feinen Beobachtungen zu poetischen Bildern, die die Irritation des Blicks als ein Abenteuer des Verstehens erzählen – ein Flaneur in der Tradition der großen Essayisten der 30er Jahre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Stephan Wackwitz
Tokyo
Beim Näherkommen durch die Straßen
Über dieses Buch
Keine andere Weltstadt wirkt auf den frisch eingeflogenen Europäer auf den ersten Blick so vertraut und nach dem zweiten Blick so verwirrend wie Tokyo. Wie alle Metropolen besteht auch Tokyo aus kleineren Einheiten, die zur Megalopolis zusammengewachsen sind. Einerseits modernste, glitzernde Architektur und eine perfekt funktionierende Infrastruktur, andererseits – nur ein paar Minuten Fußweg entfernt – traditionelle Holzhäuser, die nicht einmal an die Kanalisation angeschlossen sind.Stephan Wackwitz durchstreifte drei Jahre lang dieses Amalgam aus Futurismus und Feudalismus, der Stadt von morgen und dem Landleben von gestern, mit wachem Blick für die sinnlichen Details und einem hellen Ohr für die Echos des Vergangenen. Fern davon, Östliches gegen Westliches auszuspielen, knüpfen seine Erinnerungsbilder und »theoretischen Träumereien« an die Tradition der großen Essayisten des 20. Jahrhunderts an.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Stephan Wackwitz, geboren 1952 in Stuttgart, studierte Germanistik und Geschichte in München und Stuttgart. Er arbeitet heute für das Goethe-Institut in New York, nach Stationen in Frankfurt am Main, Neu Delhi, Tokio, München, Krakau und Bratislava. Neben zahlreichen Aufsätzen erschienen von ihm die Romane »Die Wahrheit über Sancho Pansa« und »Walkers Gleichung«, zuletzt »Ein unsichtbares Land«, »Neue Menschen«, »Osterweiterung« und »Fifth Avenue. Spaziergänge durch das letzte Jahrhundert«.
Impressum
© 1994 Ammann Verlag & Co., ZürichAlle Rechte vorbehalten:S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am MainCovergestaltung: hißmann, heilmann, hamburgCoverabbildung: © Peter EisingDieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400801-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
La sphere de la notion est pareille au fond de la mer. Elle s’enrichit, elle s’exhausse des stratifications dues au mouvement même de la pensée, et dans ses bancs elle englobe des trésors, des navires, des squelettes, tous les désirs égarés, les volontés étrangères. Le bizarre chemin suivi par ce médaillon que donna dans la nuit une main blanche, d’une boutique éclatante dans un paysage de brume et de musique jusqu’à ce sediment blond où il voisine avec une méduse et les agrès vaincus de quelque anonyme Armada. La notion est aussi le naufrage de la loi, elle est ce qui la déconcerte. Elle m’échappe où je l’atteins. J’ai peine à m’élever au particulier. Je m’avance dans le particulier. Je m’y perds. Le signe de cette perte est toute la véritable connaissance, tout ce qui m’est échu de la véritable connaissance.
Louis Aragon, »Le Paysan de Paris«
Erinnerungen an die Zeit der Weltherrschaft
Nachts gehe ich mit meiner Frau in Tokyo spazieren. Ich versuche mir zu merken, was ich gesehen habe.
Gestern waren es die Böschungsmauern der schmalen Alleen, die durch den Aoyama-Zentralfriedhof von Tokyo führen. Gräber waren mit gusseisernen Zäunen eingegrenzt. Durch die Bäume war in der Ferne ein Horizont aus Leuchtreklamen sichtbar. Von einer Brücke aus ging der Blick in ein Tal. Die Dunkelheit war angefüllt mit sich ruckartig bewegenden Bremslichtern zwischen Holzhütten.
Ein Geschäftshaus aus Beton und Edelstahl ein paar Straßen weiter war tonnenrund. Im gekrümmten Schaufenster schienen Deckenlampen auf das honigfarbene Fußbodenholz. In ihrem weich abgegrenzten Schein lagen Kostüme und Pullover bereit, als seien sie schon lange in Gebrauch und würden von Butlern gepflegt. Als wohne hier ihr Besitzer.
Wir kamen auf eine Hauptstraße. Der Beton schien sich zu bewegen unter den Leuchtbildern, die über ihn hin zuckten und krabbelten. Ein vertikales Labyrinth stand zu beiden Seiten der Straße. Fahles rosagelbes Licht herrschte. Warmer Wind riss an den Kostümen der Frauen. An einem fünfzig Meter hohen marmorweißen Hausblock wirkten Balkons wie in eine Ecke hineingeschnitten. Sie führten aufs Verkehrsgetobe hinaus. Auf dem Dach war aus weißen und eisblauen Neonröhren eine stilisierte Stadt über der Stadt aufgestellt, deren zehn Meter hohes System sich, einmal in der weißen, dann in der blauen Version, jeweils einige Momente lang aufbaute und wieder erlosch. In einer Holzhütte daneben gab es einen altmodischen Frisiersalon. Die Stadt war ein in seinen Varianten untergegangener Text.
Die Schönheit europäischer Städte seit der Renaissance offenbart sich von privilegierten Zentralpunkten aus. In manchen gemalten Stadtlandschaften jener Zeit liegt eine Leere über den Straßen, Durchblicken, Palästen und Alleen, als seien sie vor der Erschaffung des Menschen gesehen. Der Beschauer wird im Linienkorridor der Zentralperspektive zum Alleinherrscher. Hinter seinem Kopf ist das Auge Gottes erschienen. Die Welt besteht aus leeren, baumbestandenen Straßen, deren Parallelen weit von hier, vielleicht in der Zukunft, in einen Punkt zusammenlaufen werden.
Von diesem Punkt, als liege er wirklich im Unendlichen, geht eine utopische Strahlung aus. Um dieser Strahlung willen spielen die weit ins Land hineinlaufenden Straßen-, Baumreihen- und Gebäudeachsen in der europäischen Stadtplanung eine so große Rolle, die Rolle des Absoluten. Diese Achsen, von denen jeder Machthaber eine angelegt haben will (Hitlers Berliner Nord-Süd-Achse, die Ischtarstraße in Babylon), symbolisieren, dass die Welt durchschaubar ist und dass sie beherrscht werden kann. Auf ihnen zieht die Macht in die Welt, aber auch der Sinn vom Himmel ins Irdische ein. In Tokyo, das war unser Eindruck von Anfang an, haben Macht und Sinn einen anderen Weg gefunden.
Als wir erst ein paar Tage hier waren, konnten wir nachts nicht schlafen, bekamen Hunger, zogen uns an und verließen das Haus. Der warme Nachtwind blies. In den Bäumen eines kleinen Parks stand das Grillengeschrei als Schallmauer. Getränkeautomaten leuchteten vor Holzhäusern in schmalen Seitenstraßen, die so dunkel waren, als lägen sie in einem Dorf. Wir tranken im Gehen schwachrosa gefärbte Pfirsichlimonade aus einer Dose. Arbeiter mit weißen Handschuhen und rotleuchtenden Signalstäben sperrten eine Lichtinsel am Straßenrand ab, wo im Schein starker Lampen gebaggert wurde. Die Stadt war ein Song von Prince, in dem die wie jeweils gesondert poliert wirkenden Details wunderschön waren, während Stimme, Melodie, Ausdruck nur parodistisch auftraten.
In einer kleinen Garküche am sechsspurigen Aoyama Dori-Boulevard (er wurde hier von zwei leeren Fußgängerbrücken auf Stahlstelzen gekreuzt) aßen wir eine Schale Nudelsuppe. Es war halb drei Uhr nachts. Auf unserem Rückweg stießen wir auf den Eingang zu einer Allee. Sie ging schnurgerade und übergangslos von der Stadtautobahn ab. Die Kronen von Ginkgobäumen bildeten einen Laubengang, in dem der Nachtwind rauschte. In den zentrumslosen Straßen kam es mir, übermüdet und von dem eben bestandenen Ess-Abenteuer aufgekratzt, vor, als habe sich die gepflegte Baumparallele (Natur und Planung waren als Zivilisation ineinander aufgegangen) inmitten eines dichten Waldes eröffnet, wo sie unvermittelt begann und im Nichts endete. Das Grillengekreisch war ein kompakter Dauerton.
Am nächsten Tag (es war ein Samstag) kehrten wir dorthin zurück. Uniformierte Schulmädchen saßen im Schatten und aßen ihre Vesperbrote. Hinter Hecken wurde in der Mittagssonne Tennis gespielt. Im Fluchtpunkt der Allee war jetzt ein Kuppelgebäude erschienen, das hinter Fontäne, Wasserbecken und Fahnenstange einen der Stadt fremden Gedanken formulierte. Wir betraten die Formen einer Zentralitätsrhetorik, die andernorts in Tokyo nicht zu vernehmen ist. Ihr Hauptargument, jener Kuppelbau, sah beim Näherkommen aus wie eine Befestigung, in der sich Tote verteidigen. Der Portalturm mit den drei Rundbögen war so hoch, dass die Kuppel nicht mehr sichtbar war, als wir schließlich vor der Sandsteinfreitreppe standen und die Köpfe in den Nacken legten. Zwei fensterlose Flügel erstreckten sich zuseiten des Zentralbaus, geschmückt mit Ornamenten in monumentalisierendem Art deco, putzig und überdimensioniert zugleich, als seien es Riesinnenbroschen aus den zwanziger Jahren oder an der Mauer festgebackene Versteinerungen zehn Meter großer Schaben.
Die »Meiji Memorial Picture Gallery«, in deren düsterem Kuppelgebäude wir nun verschwanden (in einem hölzernen Häuschen in der Vorhalle verbeugte sich die Kartenverkäuferin, eine ältere Frau, im Sitzen vor uns) ist eine Art Kultstätte (»Museum« wäre nicht treffend) für Historiengemälde aus der Geschichte des ersten Meiji-Kaisers, unter dessen Herrschaft entschlossene Politiker mit einer strategisch geplanten Reformanstrengung innerhalb weniger Jahrzehnte in Japan die Moderne eingeführt haben.
Hirobumi Ito, Vorsitzender des Geheimen Staatsrates und einer der wichtigen Reformintellektuellen der Meiji-Zeit, sagte 1888 auf der Eröffnungssitzung der Beratungen über den Reichsverfassungsentwurf: »In Europa findet sich in diesem Jahrhundert kein Land mehr, das kein konstitutionelles Regierungssystem hätte. Aber dieses System hat sich im Laufe der geschichtlichen Entwicklung herausgebildet, und seine Wurzeln liegen in allen Fällen in der fernen Vergangenheit. In unserem Lande ist es dagegen eine völlig neue Erscheinung. Deshalb müssen wir vor der Abfassung der Verfassung zunächst nach der Achse unseres Landes fragen und festlegen, was diese Achse bilden soll. Wenn man ohne eine solche Achse die Politik dem willkürlichen Räsonnement des Volkes überlässt, verliert das Regieren seine Ordnung und der Staat geht in der Folge zugrunde. Das Einzige, was in unserem Lande eine Achse bilden kann, ist das Kaiserhaus. Wir haben deshalb in diesem Verfassungsentwurf diesem Punkt ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet und uns bemüht, die monarchische Gewalt zu respektieren und möglichst wenig einzuschränken.«
Wir standen dann unter der Kuppel, die wir aus der Entfernung gesehen hatten. Die zwanzig Meter hohe und zehn Meter weite Säule aus Nichts war am Ansatz der Einwölbung mit großen blinden Rundornamenten gesäumt, von denen Marmordraperien herunterhingen. Sie ruhte auf einem spiegelglatt polierten Marmorfußboden, der mit Seilen abgesperrt war. Durch schwere Messingtüren sah man das Grün der Sportfelder. Die Fontäne rauschte. Jogger kreuzten das Blickfeld. Zuseiten der Fahne sprengten zwei Phantasietiere, Pferde mit Drachenköpfen, im Anfangssprung erstarrt, in die Symmetriegegenden hinaus. Kein Besucher außer uns war zu sehen, Der höchste Wert »Zentralität«, den die japanischen Verfassungsväter aus Europa importiert und in dieser Kuppel hatten darstellen lassen, war erkennbar nichts anderes als die Leere.
Nach rechts wies ein Holzschild mit der weißen Aufschrift: »Japanese style pictures«. Die Wände des gewölbten Raums, über dessen Parkett wir jetzt in die Geschichte des ersten Meiji-Kaisers hineinschritten, waren bedeckt von Monumentalgemälden im Stil traditioneller japanischer Goldgrundmalerei. Aufgrund der Fensterlosigkeit des Gebäudes war es, als sähe man durch die Bilder hinaus ins Land. Sehr weit in der Ferne, aber immer deutlich sichtbar, stand, saß, ritt oder schritt auf jedem der Tenno, umgeben von einem Streifen undurchdringlicher Leere. Der Kaiser war auf den Bildern so zentral und so allein wie der rote Punkt im weißen Feld der japanischen Staatsflagge. Sein dickes Gesicht mit den schweren Lippen sah wichtig und traurig aus. Auf jedem der Gemälde war etwas an sich äußerst Belangloses dargestellt (ein Spaziergang im kaiserlichen Park, eine Betriebsbesichtigung, das Verlesen eines Edikts, die Eröffnung einer Staatsratssitzung), das jedoch durch die Anwesenheit des Herrschers und durch die Anwesenheit jener Geisterluft um ihn in unabsehbare Bedeutungsbereiche gerückt wurde.
Die Gestaltung der Leere schien die eigentliche Aufgabe der Gemälde. Auf einem der eindrücklichsten saß der uncharismatische, nur durch den leeren Raum distinguierte Mann schreibend inmitten eines komplizierten Gewirks blühender Kirschzweige, flankiert von sich verbeugenden Dienern. Ein Blumenstrauß in einer graugrünen Vase stand neben ihm. Möwenartige Vögel flogen im Vordergrund, und aufgespritztes Blattgold leuchtete durch die weißen Blüten. Der ausgesparte Raum um die Hauptfigur war schmal, aber so bestimmt hingesetzt, dass er zum Zentrum des Bildes geworden war. In dem hohen Bildersaal glitzerte das Parkett. Unsere Schritte hallten.
Wir durchquerten, wieder von einem Holzschild mit weißer Aufschrift geleitet, noch einmal das Zentralfoyer und besahen im gegenüberliegenden Flügel die Bilder im westlichen Stil, gemalt zu Beginn der zwanziger Jahre in vorsichtigen, sorgfältigen und geschickten Stilkopien des Naturalismus, des Impressionismus, der Neuen Sachlichkeit. In diesem Flügel war der Krieg in den Vordergrund getreten. Hirobumi Ito sprach sich auf einem der Gemälde für den Angriff auf das Zarenreich aus. Der Tenno nahm nach dem Sieg eine Flottenparade ab. Die japanische Kriegsfahne wehte im Wind. Aus der roten Sonne waren Strahlen gedrungen und über den Saum des Stoffs hinaus bis an den Horizont gefahren; die Einsamkeit war vorerst vorbei.
Hinter der leeren Halle, dem Eingang mit dem Kartenhäuschen gegenüber, lag ein zweites, kleineres Foyer, durch dessen Fenster zusätzliches Licht in den Zentralraum fiel. In diesem Annex standen, wie in einem altmodischen Naturkundemuseum, zwei schrankartige Schaukästen aus dunklem, poliertem Holz und unregelmäßigem, mit ovalen Bläschen durchzogenem Glas. Im rechten Kasten stand das Skelett eines Pferdes. Im linken war ihm, mit dem Kopf zum Schädel des Skeletts, das offensichtlich gleiche Pferd in ausgestopftem Zustand zugeordnet. Es war klein und muskulös, wirkte ein bisschen mongolisch struppig und sah aus seinen Glasaugen aufmerksam, gutwillig und irgendwie diensteifrig drein, als lausche es auf ein Kommando, das bald von irgendwoher erfolgen müsse. Neben ihm, auf dem schön gemaserten, sorgfältig gebohnerten Holzboden, war ein Hygrometer aufgestellt. Wir lasen die erläuternde Tafel, den Sog der großen Halle im Rücken: Dieses Pferd sei für den Kaiser ausgesucht worden (wir erinnerten uns daran, dass das Aussuchen des Herrscherpferdes in taoistischen Lehrparabeln eine der Leistungen ist, an denen sich die Wesensschau des Erleuchteten besonders verblüffend bewährt), es habe einen neuen Namen erhalten, dem Kaiser sechzehn Jahre lang bei hundertdreißig Gelegenheiten gedient, »and was much favoured by His Majesty«. Dann sei es gestorben und schließlich in Erfüllung eines Wunsches des Herrschers, der es auch nach seinem Tod immer in seiner Nähe habe wissen wollen, hier aufgestellt worden, »so that his distinguished service be long remembered by the public«.
Betäubt von der Hitze, dem Sonnenlicht und der Poesie des Arrangements hinter uns standen wir dann wieder auf der Freitreppe und sahen auf die Sportplätze vor uns hinaus. Rechts stand die Beton- und Stangenmasse des Nationalen Baseballstadions. In den Rhododendronbäumen um das Fontänenbecken kreischten die Zikaden so laut und geisterhaft, als käme ihr Ton aus den Granitornamenten der Totenburgfassade.
Am Montag nach dem Besuch des Kaiserbildermuseums waren wir wieder in den windigen, heißen Nachtstraßen unterwegs. Den Tag über, im Dienst, hatten mich Phantasien über Reiterstandbilder heimgesucht, manchmal solche in der Manier der Stadtkarikaturen Saul Steinbergs (vor einem Ornamentberg von Bahnhofsgebäude, auf einem schiefen, horizontweiten Platz, stand ein Tuschepferd im Aufbäumen, auf seinem Rücken eine Art Garibaldi, der mit dem Degen in die Zukunft wies). Ein andermal stellte ich mir ein Reiterdenkmal vor, das bei zweitem Hinsehen aus einem wirklichen Pferd und einem lebendigen Herrscher bestehen würde, die plötzlich ihren Sockel verließen und die Allee stadtauswärts sprengten, die Komplexität der Welt unter dem Geschlechtsteil des Königs auf den Körper eines gezähmten starken Tiers reduziert, dem Fluchtpunkt der Achsenstraße zu, dem Nichts und den Barbaren entgegen.
Stille Nebenstraßen an diesem Abend: Ihre unvorhersehbaren Windungen folgten den Formen der verschwundenen Landschaft. Der Mond schien. Hinter Mauern standen die alten japanischen Häuser. Wir traten auf eine elegante Geschäftsstraße, in eine Gegend voller leuchtender Einzelheiten hinaus. Alle Schönheit ging von ihnen aus, nicht von einem zur Integration, zur Phänomenhierarchisierung, zur Fluchtpunktmarkierung berufenen Zentralzeichen. Eine ganze Wand in einem schwarz ausgeschlagenen Laden nahmen Lidschattentiegelchen in allen denkbaren Farben ein. Im Vordergrund standen Schminkpinsel in großen Gläsern. Auf der Schwelle begegneten sich Frauen mit gleichgültigem Gesichtsausdruck.
Einem Betonbau war eine Renaissancefassade aus unregelmäßigem Backsteinmauerwerk vorgeblendet, in dem romanische Bögen, Statuen, Fayenceteller, Inschriftenfragmente steckten. Ein Dutzend kleiner und großer Kirchturmuhren, von denen jede eine andere Zeit anzeigte, war über die Fassadenfläche verteilt. Ein alter Teddybär saß hinter Glas auf einer Flickendecke. Eine Frau in einem sehr kurzen schwarzen Kleid ging, ihren Freund anlachend, vorbei. Die Stadt war ein zusammenstürzendes Kartenhaus, auf dessen wirbelnden Blättern einzelne Werte und Zeichen, ohne Halt in einem Spiel, sekundenlang erkennbar waren. Die Straße war mit langsam vorrückenden Autos dicht angefüllt. Gott näherte sich nicht über die große Achse. Es herrschte eine Stimmung von Abdankung, Resignation, Verlassenheit, Vorahnung.
In einem großen Hinterhof in Omotesando (zwei Polizisten standen vor der ehemaligen Lieferanteneinfahrt) war eine verkleinerte Version des Münchner »Haus der Kunst« aus Gips und Plastik aufgebaut. Die Mauern des Fabrikhofs waren mit Plastikplanen überspannt, auf die Botticellis »Primavera«, der Kopf des Wagenlenkers von Delphi, der Apollo von Belvedere, historische Sportlerfotografien, abstrakte Muster stark vergrößert und buntglänzend verstreut waren. Lampen strahlten auf die Bilder und hoben sie aus der Nacht heraus.
Auf Schrifttafeln war eine »Erklärung für die Öffentlichkeit« auf Japanisch und Englisch aufgestellt. Hier seien ursprünglich Dekorationen angebracht gewesen, die auf die Olympischen Spiele 1936 in Berlin Bezug genommen hätten. Es sei dies aber, wie der Geschäftsleitung nach öffentlichen Protesten schnell klargeworden sei, eine Geschmacklosigkeit gewesen und deshalb sofort beseitigt worden. Jedenfalls habe man nur im Sinn gehabt, den Sport sowie seine völkerverbindende Wirkung zur Geltung zu bringen und mit dem hier ausgeschenkten Bier (»Suntory Malt’s«) zu assoziieren. Man entschuldige sich für das offenbar entstandene Missverständnis und hoffe, das Publikum werde die neue, nun eindeutig nur noch sport- und nicht mehr faschismusverherrlichende Dekoration zu schätzen wissen und dem mit ihr beworbenen Bier (»Suntory Malt’s«) weiterhin die Treue halten. Es sei wirklich nicht so gemeint gewesen. Undsoweiter. Zwei Mädchen im Dress von »Inter Mailand« und ein Junge im Anzug empfingen uns am hohen Flügelportal mit einladendem Gestenspiel.
Im sporthallengroßen, mit den Fahnen verschiedener Länder verhängten Innenraum liefen in allen Ecken auf Fernsehmonitoren und auf einer Leinwand über der Bar Sportaufzeichnungen zu Vivaldis »Vier Jahreszeiten«. Einmal wurde das Licht gedämpft, die Barockmusik spielte lauter und schwarzweiße Filmdokumente von der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 1964 in Tokyo erschienen. Das Mädchen, das uns bediente (ich hatte mir ein großes, sportliches »Suntory Malt’s« bestellt) trug gleichfalls ein Fußballtrikot, betrachtete meine Frau aus den Augenwinkeln und flirtete mit ihrem Kollegen. Die Pauken und Trompeten der Händel-Suiten, das »Möge-der-bessere-gewinnen«-Leistungspathos in den Gesichtern der siegreich jubelnden oder ernst an den Start gehenden Sportler auf der Leinwand, das Völkerfreundschaftsgefuchtel mit der olympischen Fackel auf den Bildschirmen, die Fahnen an der Decke mühten sich, im ideologiefreien Raum der Straßen und Interieurs von Tokyo schwere Zeichen zu errichten, die sich dem Sog des Nichts im Namen von »Suntory Malt’s« entgegenstemmen sollten. Auf einem Mäuerchen am Ausgang, neben den beiden Polizisten und umringt von ein paar Jungs, saß ein sehr schönes Mädchen in den im Herbst 1990 hier üblichen Hotpants, bis über die Knie hochgezogenen schwarzen Wollstrümpfen und Doc-Martens-Schuhen. Sie hatte kurze schwarze Haare, hörte einem ihrer Kumpels zu und sah aufmerksam und eifrig in den Verkehr der Durchgangsstraße vor ihr hinaus.
Wir wanderten über die nächtlichen Straßen von Tokyo nach Hause. Auf dem Weg tauchte in einer meinem Bewusstsein vorgelagerten Gegend ein szenisches Vorstellungsfragment auf, als seien hier irgendwo herrenlose Zügel zu ergreifen, als könne man doch so nicht leben, aber es ist zu spät.
Zwei oder drei Wochen später kamen wir nachts dort wieder vorbei. Das Scheinwerferlicht, die Polizisten, Fußballdressträgerinnen, Glanzbildtransparente waren verschwunden. Im Innenhof sah es aus wie nach einem Luftangriff. Die Trümmer der »Suntory Malt’s«-Ruhmeshalle, Gips, Plastik, Pappe und kantige Blechverstrebungen, die dem Ganzen Halt gegeben hatten, lagen und ragten auf einem haushohen Berg durcheinander; ein Bagger stand in der Dunkelheit daneben. Auf einer Seite waren die Stühle des vernichteten Etablissements mit einer Planierraupe ineinandergeschoben. Wir versuchten, einen herauszuziehen, aber er war völlig mit den anderen verkeilt.
Wir schauten uns auf dem leeren, plötzlich sehr großen Areal um. Wo die imperatorische Gebäudekarikatur gestanden hatte, lagerte jetzt das Nichts als eine Art Tier. Über der Dächerlinie um den Platz stand die stilisierte Stadt über der Stadt aus weißen und blauen Neonröhren, die sich, einmal in der weißen, dann in der blauen Version eingeschaltet, jeweils einige Momente lang aufbaute und wieder erlosch.
Windiger Tag vor Ankunft der Barbaren
In diesen Tagen, in Tokyo ist es Herbst geworden, meine ich in manchen poetisch-apokalyptischen Momenten spüren zu können, wie wenig uns noch von der Ankunft der Barbaren trennt. Eine morgens sonnenbeschienene Mauer neben der Österreichischen Botschaft zum Beispiel, an der entlang ich eine gebogene Hügelstraße zur Arbeit hinunterlaufe, Gräser in den Ritzen zwischen den Steinen, der kalte Wind und der klare, horizontale Sonnenschein werden mir, wider besseres Wissen, zu Botschaften von außerhalb der Weltstadt – als ob es so etwas gäbe. Vom Autobus aus gesehen: die Gesichter der an der Ampel wartenden, plötzlich bei Grün aus ihren Träumereien erwachenden und nach einer Schrecksekunde über den breiten Zebrastreifen loslaufenden Sekretärinnen und Aktentaschenmänner. Die haushohen gabelförmigen Stahlbetonstützen, auf denen die Highways darüber hinweggeführt sind, erinnern mich an zyklopische Grenzbefestigungen, hinter denen das offene Indianerland beginnen würde.
Um bei Ankunft der Barbaren nicht ganz unvorbereitet zu sein, habe ich die Gewohnheit angenommen, jeden Morgen im Bus eine englisch-lateinische Ausgabe der »Ammiani Marcellini rerum gestarum libri qui supersunt« zu lesen, das Geschichtswerk eines oströmischen Generals aus dem vierten Jahrhundert nach Christus, der sich mit Hunnen, Alemannen, Goten, Thrakern jenseits der Grenzbefestigungen und mit perversen, sadistischen Nullen von Oberbefehlshabern auf der eigenen Seite herumzuschlagen hatte. Ich habe die Aktentasche zwischen meine Füße vor den Sitz gestellt. In den Händen halte ich einen Band der in rotgewachstes Leinen gebundenen Ausgabe von John C. Rolfe (University of Pennsylvania), verlegt 1939 bei Heinemann in London und bei der Harvard University Press in Cambridge, Mass. –, eine Ausgabe, die mir mein Vater zum Abschied geschenkt hat, bevor ich nach Tokyo ging. Die kleine Windmühle mit den Initialen W. und H. für William Heinemann auf dem blassrot gerahmten Vorsatzblatt. Der Erwerbsvermerk meines Vaters, mit schwarzer Tinte, von 1954. Damals war ich zwei Jahre alt.
Beim Lesen blättere ich träumend, wenn der Bus in einem Stau oder an einer Ampel in Roppongi wartet, zurück auf das Foto einer in Barletta, Süditalien, gefundenen Kolossalstatue des Kaisers Valentinianus, eines fetten Mannes im Brustpanzer, der die Weltkugel in der Linken hält und die Rechte zu einer imperatorischen Geste erhoben hat. Seine Augen sind sehr groß und unter den halbkreisförmigen Brauen starr aufgerissen, als sähen sie auf etwas sich weit entfernt abspielendes Entsetzliches. Seine Haare sind zu einer Röllchenponyfrisur um die niedrige Stirn gebürstet, und zuseiten des kleinen Mundes hat der Kaiser tiefe, misanthropische Kerben (Valentinian ließ einen seiner hohen Staatsfunktionäre nach dem anderen wegen der geringsten Lappalien lebendig verbrennen).





























