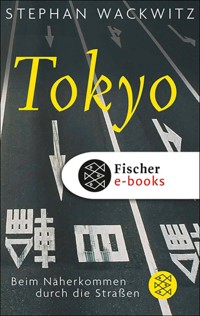9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Fünf Jahre hat Stephan Wackwitz in Georgien gelebt und auch seine Nachbarländer Armenien und Aserbaidschan bereist. Es sind uralte Kulturländer am östlichsten Rand Europas und zugleich höchst lebendige Staaten, die sich seit ihrer Loslösung von der Sowjetunion in den frühen 90er Jahren auf einem abenteuerlichen und kurvenreichen Weg in die Moderne befinden. Stephan Wackwitz erlebte in Georgien dramatische politische Machtwechsel und den permanenten Kampf um Demokratie und Menschenrechte. Er beobachtete, wie ein immenser Bauboom das Gesicht der Städte für immer veränderte. Vor allem aber spürte er mit großer Sensibilität den besonderen Atmosphären im Herzen des eurasischen Kontinents nach, wo sich nicht nur Westen, Osten und Süden, sondern auch alle Zeiten magisch zu mischen scheinen. »eines der klügsten und schönsten Bücher, die ich im letzten Jahrzehnt über den Kaukasus gelesen habe.« Olga Grjasnowa, Die Welt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Stephan Wackwitz
Die vergessene Mitte der Welt
Unterwegs zwischen Tiflis, Baku, Eriwan
Über dieses Buch
Fünf Jahre hat Stephan Wackwitz in Georgien gelebt und auch seine Nachbarländer Armenien und Aserbaidschan bereist. Es sind uralte Kulturländer am östlichsten Rand Europas und zugleich höchst lebendige Staaten, die sich seit ihrer Loslösung von der Sowjetunion in den frühen 90er Jahren auf einem abenteuerlichen und kurvenreichen Weg in die Moderne befinden. Stephan Wackwitz erlebte in Georgien dramatische politische Machtwechsel und den permanenten Kampf um Demokratie und Menschenrechte. Er beobachtete, wie ein immenser Bauboom das Gesicht der Städte für immer veränderte. Vor allem aber spürte er mit großer Sensibilität den besonderen Atmosphären im Herzen des eurasischen Kontinents nach, wo sich nicht nur Westen, Osten und Süden, sondern auch alle Zeiten magisch zu mischen scheinen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Coverabbildung: Giorgi Chakhava
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403017-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
8½
Eine vergessene Mitte der Welt
Baku
Ein Klub aus dem neunzehnten Jahrhundert
Universal Pictures
Prophetische Bushaltestellen
Architektonische Tragikomödien
Zwei unerhörte Begebenheiten
Der rote Ballon
Nachbemerkung des Autors
Eine prekäre Moderne
Die Treppen von Tiflis
Traumstadt
Wir geben nicht auf
Nachleben
Medeas Geschichte
8½
Ein Samstagmorgen in Tiflis, Oktober 2011. Die offene Tür meines Schlafzimmers führt auf eine für mich und meine Zwecke viel zu große Veranda, wo Palmen und Gartenstühle verstauben. Eine Katze aus der Nachbarschaft hat sich in der Nacht auf das Plastikdach verirrt (fällt mir jetzt ein) und in meine Träume undeutlich hineingelärmt. Der Himmel ist jetzt schon so blau wie seit Wochen tagein, tagaus von morgens bis abends. Herbstliche Frühsonne liegt auf den Höhenzügen über Tiflis. In Baseballschlagweite von meinem Bett entfernt steigt ein Hügel auf die gut doppelte Höhe des achtstöckigen Apartmenthauses, in dessen oberster Etage ich seit drei Wochen mich einrichte und zurechtfinde. Der Hang ist überwachsen mit Architektur, die so selbstgebastelt aussieht, wie sie ist. Denn hier verwirklicht sich der Bauherr meist eigenhändig. Zwischen Gärten, Bäumen, Treppen, Gassen, Rohren, Zäunen, Hecken und Sträuchern stehen Hütten (und sogar ganze Villen) in verschiedenen Do-it-yourself-Baustadien, nach schwer nachvollziehbaren Kriterien da und dort hingesetzt, erweitert und aufgestockt. Seit dem frühen Morgen wird repariert, gebessert und gehämmert. Baugerüste sind allgegenwärtig. Aus Blech zusammengelötete Schornsteine rauchen. Zementmischer sind in Betrieb, Kreissägen. Schuppenartiges zeigt sich, unfertige Häuserskelette aus Stahlbeton, Bauruinen. Hähne krähen, Hunde schlagen an.
Autos bewegen sich auf Geröllstraßen aufwärts. Romantisch verschlampte Backsteinhäuser in der soliden Bauweise der dreißiger Jahre liegen, vom allgemeinen Um- und Ausbau noch unberührt, als Relikte sowjetischer Vorzeit in verwachsenen Gärten. Gleich daneben ragt der gleichsam keinen Spaß mehr verstehende Postmodernismus einer zeitgenössischen Bauwirtschaft: renommierende Solitäre, die mit pistazienfarbenem, gelbem oder hellrosa Verputz, mit auffallenden Gauben, Panoramafenstern und perfekten Ziegeldächern demonstrieren, dass man hier mit der Zeit geht und ihre Zeichen zu deuten weiß. Das sind die Eigenheime und Wohlstandsmonumente einer noch nicht lang arrivierten Tifliser upper middle class. Veranden öffnen sich in spektakulären Höhen. Dort oben muss der Blick unvergleichlich sein in das kilometerbreite, löwenfarbene Trockenstromtal, an dessen Ausgang Tiflis liegt.
Ein weißer Schmetterling flattert von einer kompliziert verzweigten Fernsehantenne ab, fliegt schaukelnd vor einer feuerrot überwachsenen Hauswand aufwärts und verliert sich nach oben aus meinem Gesichtsfeld. Wäsche trocknet und regt sich im leichten Wind. Ein eisernes Geländer und die Silhouette einer bergab gehenden Frau zeichnen sich vor einer hellen Wand ab, sie trägt ihre Handtasche in der Armbeuge. Geländer, Frauensilhouette und Handtasche sehen von hier unten aus wie eine Tuschzeichnung von Saul Steinberg. Taubenschwärme kreisen. Eine Elster schwingt sich von einem Dachfirst in die Tiefe, gleitet wieder aufwärts, landet in den Zweigen eines Walnussbaums, dessen letzte Blätter gelb in der Sonne leuchten, reckt ihre langen Schwanzfedern kurz in die Höhe und putzt in ihrem Gefieder herum. Eine orthodoxe Kapelle steht zwischen Pinien am Hang. In der Ferne hinter ihr erstrecken sich sizilianisch kahle Höhenzüge, nur mit Nadelbäumen, Macchia und Hochspannungsmasten bestanden und durchzogen von Schluchten – fast schon ernsthafte Berge.
Elektrooberleitungen an grauen Betonpfosten führen hinauf zum Hügelkamm. In jeder noch so schmalen Lücke und noch nicht bebauten Ecke stehen herbstlich sich färbende Pappeln, Kastanien und Obstbäume. Veranden sind mit rotem Weinlaub und blauschwarzen Trauben überwachsen. Die schon fast blätterlosen Zweige der Kaki-Bäume sind so schwer mit ihren orangefarbenen Früchten beladen, dass man sich nicht denken kann, wer so viele Kakis jemals abernten und essen mag; und es erntet sie offenbar auch niemand ab. Palmen, Yuccas. Oleanderbüsche. Topfpflanzen. Zypressen verbreiten als haushohe schwarzgrüne Spindeln ihre schwer greifbare gravitas und scheinen etwas zu bedeuten. Das Schicksal vielleicht oder den Tod, geht es einem durch den Sinn; oder auch einfach nur das irgendwie Mittelmeerische. Im lappigen Blattwerk niedrig verzweigter Feigenbäume hängen die süßen, graublauen Früchte als Tropfen oder Säckchen. Und im gefiederten Laub der Granatapfelbüsche leuchten die dunkelrot bauchigen Kugeln, die man bei uns nur in großstädtischen Feinkostläden sieht. Hier wachsen sie wild. Man hält die Farbflecken der Feigen und der Granatäpfel im letzten Grün für Blüten, wenn man flüchtig aus dem Fenster sieht.
An einem Samstag vor vier oder fünf Wochen (ich wohnte noch im Hotel) bin ich eingestiegen in eine weiter östlich gelegene Sektion des langgestreckten Hügels, den ich von meinen Fenstern aus sehe. Eine Staffel aus grobem Beton schien zunächst nur zu privaten Grundstücken und Häusern zu führen. Vor deren Eingängen es dann aber mit überraschenden Biegungen doch weiterging, immer tiefer gleichsam ins Innere dieses seit vielen Generationen intensiv und kleinteilig bewohnten und bewirtschafteten Bergrückens. Unter Bäumen lagen winzige Gärten im Schatten. Dann wieder der weite Ausblick auf die Stadt und das Steppenland in der Ferne, bis zum schon ganz schneebedeckten Hochgebirge am äußersten Horizont. Katzen kreuzten meinen Weg oder lagerten auf niedrigen Mauern. Autos waren in schmalen Sträßchen geparkt – man konnte sich nicht vorstellen, wie sie jemals wieder zurückfinden würden in den Verkehrsstrom der Großstadt. Ich kam nach zehnminütigem Steigen auf einer ebenen Höhenstraße an und sah zurück auf das Stadtpanorama. Eine russische Kirche, sehr weiß und reich an Fensterbögen und Zwiebeltürmen, stand zwischen Bäumen über dem Abhang. Und auf der gegenüberliegenden Straßenseite begann das Geröll-, Dornbusch- und Pinienland, das die Stadt auf steilen Höhenzügen rings umgibt.
Ich wollte zum Fernsehturm. Es war eine denkbar verkehrte Idee. Der Fernsehturm von Tiflis, den man von so gut wie überallher in dieser Stadtlandschaft am Horizont stehen sieht, ist eine der grazilsten und abenteuerlichsten Konstruktionen, die dieses Architekturgenre im letzten Jahrhundert (als es von Stuttgart bis Duschanbe Weltläufigkeit und Fortschritt symbolisierte) hervorgebracht hat. Der rotweiß lackierte Zentralpfeiler trägt in Höhe des Goldenen Schnitts den runden Turmkorb mit dem Antennengestänge darüber; zwei dünnere Pfeiler zweigen unter ihm ab, und auf mittlerer Höhe schwebt eine Plattform für meteorologische Forschungen. Nachts ist der Turm, als sei das seine eigentliche Funktion, unaufhörlich belebt durch computergesteuerte Lichtspiele unzähliger LCD-Leuchten, mit denen er ganz übersponnen ist. Lichtfontänen und -ejakulationen schießen in die Höhe, spiralige Umdrehungen jagen sich, dann wieder begibt sich allgemeines Flimmern. Es sind stumme Schauspiele der Energieverschwendung am nächtlichen Stadthimmel, in schneller und bei näherem Hinsehen entschieden hysterisch wirkender Folge. In den frühen Morgenstunden flackern dann, als sei der Turm von seinen nächtlichen Exzessen erschöpft, nur noch ein paar der Leuchtdioden ratlos vor sich hin. Ein Taxifahrer erzählte neulich, während wir spätabends unter der phantasmagorisch überinstrumentierten Weihnachtsbeleuchtung des Rustaweli-Boulevards dahinfuhren, in der Schewardnadse-Zeit sei die Hauptstadt nachts bedeckt gewesen von allgemeiner Finsternis, in der die verschiedensten Gefahren umgingen. Neben dem Fernsehturm und seiner monumentalen Stromverausgabung ist auch ein Riesenrad farbig beleuchtet und belebt; am Tag dreht es sich fast unmerklich langsam durch den wolkenlosen Himmel.
Dort also wollte ich hin. Und ich war ahnungslos genug, es auf einem irgendwie direkten Weg durch die Macchia versuchen zu wollen. Turm und Riesenrad schienen über mir ja ganz nah, und tückischerweise ging es zu Beginn auch auf sehr befestigten und soliden Betontreppen gemächlich und sicher aufwärts. Ein Kinderspiel. Junge Liebespaare saßen knutschend auf den zahlreichen Absätzen und Aussichtsplattformen meines bequemen Anstiegs, lösten sich schuldbewusst voneinander, wenn sie mich kommen sahen, und blickten verlegen vor sich hin, wenn ich an ihnen vorbeiging (als hätte ich, nur weil erwachsen, ihnen irgendetwas zu verbieten). Ich machte mir auch noch überhaupt keine Sorgen, als das solide Treppenbauwerk nach enttäuschend kurzer Erstreckung – es kann nicht viel länger als einen halben Kilometer in den Hang hineingeführt haben – sich abrupt in einen unbefestigten Pfad verwandelte, der aber weiterhin recht geplant oder zumindest viel begangen wirkte und in kluger Streckenführung und zum Teil fast ebenerdig durch die mit Kiefern, Dornbüschen und verdorrten Gräsern wechselhaft bewachsene Landschaft führte.
Die Aussicht war sensationell – muss man das erwähnen? Sie ist es ja überall auf den Bergen um Tiflis. Wenn ich nach zwanzig Minuten Aufstieg immer öfter stehen blieb, dann beileibe nicht nur, weil ich inzwischen immer kurzatmiger geworden war. Sondern vor allem, um das eine oder andere Wahrzeichen von Tiflis im Tal zu identifizieren und mich am Wiedererkennen der Stadtlandschaft von hier oben zu erfreuen. Auch kam mir beruhigenderweise ein Trupp schweißüberströmter junger Männer in Sportkleidung entgegen, die lachend und freundlich grüßend offensichtlich von irgendeinem Ertüchtigungsausflug zurückkehrten (hatten sie da oben irgendwo gejoggt, um Himmels willen?). Und ich gab mich in der nächsten halben Stunde (während der mir dann allerdings überhaupt gar niemand mehr begegnete) allerlei kulturhistorischen Erwägungen über Pfade wie denjenigen hin, auf dem ich mittlerweile nun schon fast besorgniserregend lange aufwärts stieg, ohne dass ich dem Fernsehturm und dem Riesenrad näher gekommen zu sein schien. Im Gegenteil. Das Ziel meiner Wanderung war, wie ich nun feststellen musste, hinter einer Schlucht, die ich inzwischen offenbar irgendwie durchstiegen hatte, vollkommen verschwunden, während ich mich ein gutes Stück nach Westen versetzt fand.
An diesem Punkt meines Ausflugs hatte die Selbsttäuschung längst begonnen, mir allerlei einzureden und vorzuflüstern. Uraltes Hirten- und Fernwandererwissen, dachte ich im Steigen und Keuchen bescheidwisserisch vor mich hin, sei in diesen der Landschaft unverlierbar eingesenkten Saumpfaden aufbewahrt. Historische Erfahrungen mit der sichersten Wegführung zum Beispiel, vorbei an jenen quadratkilometerweiten Geröllfeldern, die ich nun schon seit Minuten, jedes Mal, wenn Bäume und Büsche den Blick auf sie freigaben, argwöhnisch in Augenschein nahm und mich fragte, was eigentlich passieren würde, wenn ich dort irgendwie ins Rutschen käme. Generationen von Wanderern, gab ich meiner keimenden Panik zu bedenken, haben gewusst und mit ihren Fußstapfen, Ziegenherden, Austrampelungen, mit allerlei Steinhaufen, geknickten Zweigen und anderen subliminalen Zeichengebungen der Landschaft eingeprägt, wie ihre Nachfolger (deren bislang letzter ich nun war) sicher am Rand der Felskante vorbeikämen, die sich jetzt rechts von meinem immer noch deutlich sichtbaren trail auftat.
Und dann war der Pfad plötzlich verschwunden. Was ich seit einiger Zeit vielleicht nur noch dafür gehalten hatte, hörte einfach auf. Es war auf einer kleinen Lichtung im Gehölz. Und es war nicht mehr zu unterscheiden, ob die Öffnung aus ihr heraus durch Menschen entstanden war oder vielleicht einfach nur eine Öffnung von der Art war, wie sie zwischen Bäumen und Büschen in Dreiteufelsnamen nun einmal vorkommt. Ich trat in diese, wie sich zeigte, tatsächlich nicht mehr im Entferntesten menschengemachte Lücke, und unpassierbare Wildnis aus Zweigen, Dornen und Geröll war das Einzige, was dort begann. Ein Gefühl des Gefangenseins. Zum ersten Mal an diesem Nachmittag wurde es mir doch ernsthaft sehr unbehaglich.
In der Entstehungsgeschichte schlechter Ideen gibt es einen Punkt, an dem man solche mit gutem Recht auftauchende Angst nicht wahrhaben will und sie von sich wegdrückt in einer Mischung aus Trotz und Unverletzlichkeitsgefühl. Und aus der Unlust heraus, nach so großen Fortschritten im Abwegigen die ganze weite Strecke, zurechtgestutzt und ernüchtert, wieder zurückgehen zu müssen. Der Fels auf den Hügeln rings um Tiflis ist von einer bröckeligen, bergsteigerisch tief unzuverlässigen Konsistenz und jederzeit geneigt, sich in bergab stürzendes Geröll zu verwandeln. In der nun folgenden halben Stunde (muss ich mir seither immer wieder sagen, wenn die Erinnerung an mein unbelehrtes weiteres Vordringen am Hang unter dem Fernsehturm von Tiflis mich überfällt) bin ich mehr als einmal in wirklicher Gefahr gewesen. Zurück konnte ich schon nach fünfzig Metern ungebahnten Anstiegs überhaupt nicht mehr. Ich hätte jetzt nicht mehr stoppen können, wenn ich einmal ins Rutschen gekommen wäre. Und dass ich beim Hinuntersteigen ins Rutschen kommen würde, erschien mir, wenn ich auch nur einen Augenblick talwärts sah, eigentlich unvermeidlich. So zog ich mich stattdessen an Grasbüscheln, Wurzeln und Zweigen den Berg hinauf. Einige besonders halsbrecherische Minuten und Weglosigkeiten durchkroch ich auf allen vieren. In das Panorama unter mir zu schauen vermied ich geflissentlich. Eidechsen verschwanden in Felsspalten. Es war sehr heiß und still. Manchmal rauschte ein Bach. Steine rollten und fielen hinter mir in die Tiefe.
Ich will es kurz machen: es ist mir erspart geblieben, an einem der zahlreichen Felsabbrüche umkehren zu müssen, die ich später aus sicherer Entfernung schaudernd beäugt habe. Keiner der Grasbüschel und Wurzelstöcke, an denen ich mich hochzog, hat nachgegeben. Nach zwanzig Minuten verzweifelten Emporkriechens und -kletterns, während ich an möglichst gar nichts zu denken und Meter für Meter nur noch vor mich hinzusehen versuchte, kam ich plötzlich in einen Pinienwald, der wieder von regelrechten Wegen durchzogen war und wo allerlei Sportgerüste und Übungsanweisungen auf Holztafeln vor sich hinmoderten und -rosteten. Und nicht lang danach stand ich aufatmend vor einem Zaun, der ebenerdig am Betriebsgelände des Fernsehturms entlangführte und dann plötzlich eine Lücke aufwies, durch die ich in den Volkspark von Mtatsminda trat.
Unter den vielen erstaunlichen Stadtlandschaften von Tiflis ist dieses Freizeit- und Vergnügungsgelände hoch über der Stadt eine der seltsamsten. Man muss sich einen offensichtlich in den fünfziger Jahren angelegten Höhenpark von der Art des Stuttgarter Killesberggeländes vorstellen (breite Flaniertreppen, Aussichtsplattformen, Beete, Rasenflächen; eine Art offener Ballsaal mit hohen Säulen in der romantischen Baugesinnung des sozialistischen Realismus steht am Abbruch des Bergrückens ins Tal). Ein Park, der dann aber in den Achtzigern oder Neunzigern grundlegend überarbeitet worden ist durch fest installierte Rummelplatzbauten. Das schon erwähnte Riesenrad gehört zu ihnen, aber auch allerlei Karussells, Schießbuden, Geisterbahnen, Wasserrutschen. Es gibt ein Restaurant in der Formgebung der mittelalterlichen Tifliser Altstadt, vor dem Rüstungen, Hellebarden und Kettenhemden in Wind und Regen rasseln und rosten. Es gibt Freiluftdiskos, Bistros und Grillplätze. Ein fast vollkommen gläsern-durchsichtiger Hochzeitspavillon ist das Ziel zahlreicher sehr elegant und sexy angezogener Familiengesellschaften, die sich um die vorschriftsmäßig weißgebauschte Braut und ihr seltsam unzugehörig wirkendes Opfer gruppieren. Ein »American Diner« stellt mit seiner aus großen verglasten Schwarzweißfotos bestehenden Fassade eine Art Erinnerungstempel für Elvis und Priscilla Presley dar.
Es ist dabei durchaus nicht überfüllt im Mtatsminda-Park, auch jetzt am Samstagnachmittag nicht. Daran vielleicht liegt es, dass die Popmusik aus den Lautsprechern, die hier überall aufgehängt sind (auch auf ganz unbetretenen und nur von Herbstlaub und Kiefernnadeln bedeckten Parkwegen), so poetisch wirkt. Und zugleich so absurd. Das war an jenem Frühnachmittag nach meinem überstandenen Aufstieg der Moment, in dem ich nach langem Grübeln und Ahnen herausbekommen hatte, woran eigentlich mich die Atmosphären dieser Stadt und ihrer Umgebung so intensiv wie schwer definierbar erinnerten. Denn das Absurde in freundlich-produktiver Koexistenz mit dem Poetischen ist ja die Atmosphäre und Formgesinnung der Filme Federico Fellinis in den frühen sechziger Jahren gewesen. Zu einer Zeit also, als Italien in der gleichen Weise zwischen Mittelalter und Moderne gestanden hat wie Georgien heute. Ja, dachte ich, das war es. Es waren die Sonne, die Zypressen, die ordinären oder madonnenhaften Frauen in Fellinis »8½«, die mir hier in Tiflis wieder erschienen, die Nächte und Leuchtreklamen, die Treppen, Terrassen, Ruinen und Brunnen in »La Dolce Vita«. Schönheitskult und Schafherden. Ausladende Cabriolets mit elaborierten Heckflossen. Anita Ekberg und komplizierte Blitzlichtkameras. Offene Autos, Sonnenbrillen. Durch Kopftücher vor dem Fahrtwind elegant geschützte Hochfrisuren. Es war der trocken poetische Weltskeptizismus der Drehbücher Ennio Flaianos, die unberatene Sehnsucht und die dunkle Hornbrille Marcello Mastroiannis in römischen Nachtgassen. Die vernachlässigt unter panischer Mittagssonne daliegenden Betonsiedlungen des trostlosen Umlands. Es war mir plötzlich klar. Das gleiche spätsommerlich trockene Gras weht auf den Hügeln und vorstädtischen Baustellen von Tiflis und in den poetisch schwarzweißen Filmen Federico Fellinis.
Ein andermal dann, wieder im Mtatsminda-Park, im nunc stans meiner Oktobersamstagnachmittage des Jahres 2011 in Tiflis. Schaschlikdüfte liegen über einer Terrasse, wo sich herbstlicher Laubschatten und die mild wärmende Sonne verstricken und gelbe Plastikmöbel der Biermarke Natakhtari zur Rast einladen. Katzen schnüren unter Pinien, Hunde dösen. Gut gekleidete junge Familien ergehen sich samstagnachmittäglich gelangweilt. Ich nehme mein Buch aus dem Rucksack und gebe ein Natakhtari vom Fass, eine Portion georgisches Tonofenbrot und einen Salat bei der jungen Frau in Auftrag, die freundlich an meinen Plastiktisch getreten ist (sie kennt mich schon und lacht gutmütig darüber, dass ich schon wieder hier bin, wer weiß, was sie sich denkt). Vor mir, gerahmt von Pinienzweigen, liegt undeutlich die große, verwirrende, lebendige und vollkommen improvisiert wirkende Stadt.
Das Riesenrad dreht sich so langsam, dass seine Bewegung nur bei bewusstem Hinsehen erkennbar ist. Ein Karussell mit grell orangefarbenen Gondeln an langen Hebeln steht unbemannt und unbewegt. Es könnte jetzt kreischende Passagiere riesenspinnenhaft auf und ab schwenken. Aber das Karussell ist offenbar längst stillgelegt. Man hat den Eindruck, dass es überhaupt nie in Betrieb war. Eine Anmutung poetischer Verlassenheit liegt über dem Ensemble. Bringen die kindergeburtstagsbunt glänzenden Bonbonfarben der Angstlustmaschine sie hervor oder ist es die schwungvolle Diskomusik aus den Lautsprechern? Ein geschlossenes Kartenhäuschen ist ungelenk bemalt mit einem schwimmenden Schwan zwischen Rohrkolben, einem geflügelten Herzen und einem nicht bestimmbaren, aber irgendwie weiblich anmutenden Kuschelwesen, das sich auf einer Schaukel wiegt. Ist es ein Bunny? Ein Hamster? Eine undeutliche Bilderinnerung jedenfalls von weit her, an galante Gemälde des Rokoko vielleicht.
Es ist Mitte der Siebziger gewesen, dass ich mit meiner Freundin und anderen Stuttgarter Studienkollegen die Angewohnheit entwickelte, in einem der klapprigen Gebrauchtwagen, die wir während unserer Studienzeit fuhren (ich besaß damals fast ein halbes Dutzend weißer VW-Käfer nacheinander), in den Semesterferien über die nahen Alpenpässe nach Italien zu fahren. Obwohl es heute kaum mehr zu glauben ist, Italien war ein billiges Reiseland damals. Ich brachte meistens ein Gutteil meiner studentisch knapp bemessenen Reisekasse wieder nach Hause. Und dazu Eindrücke von Landschaften, Museen, Campingplätzen, Restaurants und stimmungsaufhellenden Wetterlagen, von denen ich dann ein ganzes Semester lang zehrte, bevor ich mit Zelt, VW-Käfer, einem Sortiment von Büchern und Notizheften dann irgendwann wieder aufbrach nach Florenz, Mailand oder Bologna. Auch politisch ist Italien damals ein Traumland für mich gewesen. Hammer und Sichel, rote Fahnen, KPI-Plakate an jeder Straßenecke bedeuteten (das haben sich damals auch politisch Klügere als ich eingeredet) nicht das graue Elend, das an unserer östlichen Landesgrenze mit Asbestbeton und Stacheldraht begann, sondern einen westlichen, intellektuell und ästhetisch anziehenden Kommunismus, einen eleganten sogar, wenn man Berlinguer neben Honecker auf internationalen Parteikonferenzen stehen sah oder sich klarmachte, dass Luigi Nono, Hans-Werner Henze und viele andere Künstler, Schauspieler und Schriftsteller dort im südlichen Wunderland Mitglied der Kommunistischen Partei waren.
Beim Betrachten der Filme Fellinis aus den sechziger Jahren (es ist in meinen ersten Tifliser Wochen dann zu einer veritablen Obsession geworden) scheint mir, nachdem so viel Lebenszeit vergangen ist, jetzt deutlicher zu werden, worauf unsere Italiensehnsucht damals mit uns hinauswollte. Die Geschichte, die ich mir hier in Tiflis über meine siebziger Jahre erzähle, ist inspiriert von so unterschiedlichen Büchern wie Heinz Schlaffers »Kurze Geschichte der deutschen Literatur«, Tommaso di Ciaulas Siebziger-Jahre-Klassiker »Der Fabrikaffe und die Bäume«, Jürgen Habermas’ Bände über »Nachmetaphysisches Denken«, Greil Marcus’ »The old, weird America« und Horkheimers und Adornos »Dialektik der Aufklärung«. All diese Autoren sind überzeugt, der Prozess weltgeschichtlicher Rationalisierung, den wir mit dem Wort »Moderne« bezeichnen, sei ästhetisch, biographisch-lebensgeschichtlich und politisch-utopisch nie so fruchtbar gewesen wie zu den Zeiten, als er noch nicht vollständig gesiegt hatte. Solange die vormodernen Traditionsbestände noch mächtig waren oder sind. An den Rändern jenes repressiv Überkommenen, dumm Unhinterfragten, ehrwürdig oder dämonisch Immer-schon-Dagewesenen. An dieser weltgeschichtlichen Nahtstelle verwandelt Modernisierung Dumpfheit in Poesie. Gezähmter Terror wird als suspense in ästhetische Dienste genommen. Idiotie des Landlebens wird als poetische Unschuld zum Gegenstand nostalgischer Sehnsucht. Die kämpfende Modernisierung ist ästhetisch, politisch, moralisch interessanter als die siegreiche Moderne.
Das war, glaubte ich in meinen ersten georgischen Wochen zu verstehen, das geheime Motiv meiner Italiensehnsucht in den siebziger Jahren. Wie auch der tiefere Grund für die toskanischen Immobilienkäufe und das habituelle Zum-Italiener-Rennen der arrivierten Studentenführer in Frankfurt, die in den Achtzigern als »Toskanafraktion« bekannt wurden. Mit diesen Ferien, Landnahmen, Investitionen und Restaurantbesuchen, dachte ich in meinem ersten Tifliser Herbst, suchten und suchen wir Bürger der vollständig ausdifferenzierten Moderne deren heroisch-romantische Vorstufe. Die Fortschritte des Menschengeschlechts, das wusste der deutschbaltische Demokrat Carl Gustav Jochmann schon im Vormärz, sind die Rückschritte der Poesie. Und dabei ist mir, seit ich hierhergekommen bin, als hätten wir mit Georgien ein nicht weniger mediterranes Land als Italien vergessen. Den antiken Gebildeten war das Königreich Kolchis auf dem Gebiet des heutigen Georgien eine gegenwärtige Realität, so wenig aus dem bewohnten Erdkreis wegzudenken wie Delphi oder Korinth. Und noch in der Schlussphase des Ersten Weltkriegs operierten bayerische Bataillone östlich des Schwarzen Meers und verteidigten die territoriale Integrität des zukünftigen Georgien gegen das Osmanische Reich. Wir haben die halbe Welt vergessen seit 1918.
Währenddessen hat im Südkaukasus der mediterrane Kulturkreis seit Jahrtausenden das Persische im Süden berührt und das Skythische im Norden (denn auch die Ukraine gehört ja zu diesen vergessenen Rändern der Mittelmeerwelt). In Reiseführern liest man beiläufig, diese oder jene Burg sei von einem General Alexanders des Großen auf dem Weg nach Indien und Persien zerstört worden. Oder (Jahrhunderte später) erobert von Alexanders Bewunderer Pompeius dem Großen. Alanen, Hunnen, Goten und Perser waren hier, Kiptschaken, Osseten, Seldschuken. Dschingis Khan, Tamerlan und das russische Zarenreich terrorisierten und beherrschten den Südkaukasus. Den Berg Kasbeg, an den Zeus der griechischen Mythologie zufolge Prometheus schmiedete, kann ich an schönen Tagen aus dem Bürofenster sehen. Und gegenüber der mittelalterlichen Hauptstadt Mzcheta mit der Kathedrale aus dem zehnten Jahrhundert liegt – kaum bemerkt von irgendjemandem und erreichbar nur über einen fast unsichtbar von der Landstraße abzweigenden Saumpfad, auf den ein verblasstes Schild hinweist – eine ausgedehnte antike Königsresidenz namens Armasisziche, in der es nicht nur einen Tempel der vorchristlichen Religion dieses Landes gibt (über die man so gut wie nichts weiß), sondern auch eine elaborierte Badeanlage, das Geschenk eines römischen Kaisers für die befreundeten Herrscher des kaukasischen Iberien. Vespasians Baumeister entwarfen die Befestigungsanlagen von Armasisziche. Am Ortsausgang von Mzcheta tauchen im Sommer, bei niedrigem Wasserstand, die steinernen Pfeiler einer Brücke auf, die Pompeius bauen ließ. Kolchis war unter Nero eine römische Provinz. Das von Mzcheta aus beherrschte Iberien aber gehörte – wie Judäa unter König Herodes, wie Kappadokien in Kleinasien, wie das benachbarte Armenien und das afrikanische Mauretanien – zu einem strategischen Glacis befreundet-abhängiger Klientelstaaten rings um das Römerreich. Solange die dort herrschenden Könige der römischen Reichspolitik nicht irgendwie in die Quere kamen (wie Jugurtha im nordafrikanischen Numidien oder Mithridates in Kleinasien, die dann Opfer bedeutender Feldzüge wurden und in die lateinische Geschichtsschreibung eingingen), war das Verhältnis respektvoll distanziert, bestimmt von Handel, gelegentlicher Heerfolge und römischem Kultureinfluss. Der Ibererkönig Parsman II. und sein Gefolge wurden in Rom von Trajan empfangen. Was wir heute Georgien nennen, war jahrhundertelang ein selbstverständlicher und selbstbewusster Teil der griechischen und römischen Welt.
Dazu das oft bis weit in den Dezember hinein herrschende südliche Licht (es ist das gleiche, das in Latium oder Montenegro landeinwärts über den bergigen Landschaften liegt), das seltsam Frühlingshafte auch der kälteren Tage hier, die Küche, die eine Balance zwischen dem Italienischen und dem Persisch-Indischen hält (Gemüse, Brot, über Holzfeuern gegrilltes Fleisch; und dazu die scharfen Soßen des Orients). Die bärtigen Popen, die schwarzgekleideten alten Frauen mit ihren Kopftüchern, die sanft verschlossene Schönheit der jungen (sie scheinen, wenn man sie näher kennenlernt, in Theodor Storms Novellen am treffendsten beschrieben). Der unendliche Detailreichtum der Siedlungen am Hang über Tiflis (die älteste Stadt, verstehe ich hier, ist in unserer kollektiven Erinnerung als Labyrinth aufbewahrt). Das schwer Auszurechnende (fast möchte man hinschreiben: nicht Auszudenkende) der in Tiflis möglichen Stadtspaziergänge. Straßen, denen man zunächst ins noch ganz Unbekannte, nie Gesehene oder Geahnte zu folgen glaubt. Das sich dann aber herausstellt als eine Stadtgegend in einer Entfernung von nicht mehr als hundert Metern von einer längst bekannten. Die Basare. Die persische Architektur der Karawansereien, der Oper, der Kunsthochschule aus dem neunzehnten Jahrhundert und der ins Unterirdische führenden Mineralbäder. Die prächtige, selbstbewusst an einer Hauptstraße gelegene Synagoge der Altstadt. Georgien ist vielleicht das einzige Land der Welt, in dem es nie einen nennenswerten Antisemitismus gegeben hat. Die Ruinen eines zoroastrischen Feuertempels aus dem sechsten Jahrhundert stehen an einer steilen, gepflasterten Straße am Hang unterhalb der persisch-mongolischen Festung. Die Souterrains von Läden und Werkstätten leuchten auf meinen Heimwegen in der Dunkelheit. Das handgemalte Ladenschild eines Schusters zeigt den ungelenken Schattenriss eines hochhackigen Damenschuhs. Auf den fast schon wieder von der Natur zurückeroberten, halsbrecherisch unberechenbaren Trottoirs muss man mit vielen Umwegen gehen, springen und manchmal beinah klettern (ein Wald- oder Felsengefühl mitten in der großen Stadt). Die oberitalienische Anmutung der kolchischen Tiefebene, in die ich auf dem Weg nach Kutaissi an einem Spätherbsttag aus dem schon schneebedeckten Gebirge hineinfuhr, rief Erinnerungen an Vicenza im Winter in mir auf. Die kompakten Wände des großen und des kleinen Kaukasus in der Ferne öffneten sich langsam zum Meer hin. Die Tomaten in den allgegenwärtigen Auslagen am Straßenrand in Tiflis schmecken wie bei uns nur die im eigenen Garten gezogenen.
Der Dichter Peter Handke hat in den Neunzigern des letzten Jahrhunderts einen großen Skandal ausgelöst durch eine ungeschickte – und irgendwie auch ungut politisierte – Bekundung idealisierender Liebe zu einem anderen, lange Zeit auch so gut wie vergessenen Mittelmeerland, zu Jugoslawien. Es ist ihm in seiner Kindheit als ein, wie er irgendwo schreibt, »großes« Land erschienen. Slowenien war die Heimat seiner Mutter, und Jugoslawien spielte schon in früheren seiner Arbeiten die Rolle eines von der Vormoderne noch gestreiften Sehnsuchtslands. Abgesehen von der (ja durchaus diskussionswürdigen) Ansicht Handkes, dass die entsetzlichen Ereignisse in dem sich auflösenden Staatenbund erheblich kompliziertere und vielfältigere Ursachen gehabt haben als die politische Verworfenheit der serbischen Führung, scheinen mir Handkes damals dann von Monat zu Monat immer fahriger und schriller werdende Polemiken (eigentlich war es eine Art publizistisches Um-sich-Schlagen) heute, aus der zeitlichen Entfernung und vom Kaukasus aus betrachtet, nur vordergründig politisch. Man erinnert sich an den Reiseessay der »Süddeutschen Zeitung«, mit dem der Radau seinerzeit losging, heute auch nur noch anhand eines poetischen und ein bisschen skurrilen Adjektivs, schön und zugleich von zart unfreiwilliger Komik wie so vieles bei Handke. Ich jedenfalls kann nicht behaupten, dass ich von diesem langen Artikel etwas anderes noch im Kopf hätte als jene inzwischen berühmt-berüchtigte Formulierung von den »andersgelben Nudelnestern« auf dem Markt von Belgrad. Und irgendwie erinnere ich mich auch an eine ebenfalls seltsam eindrückliche, aber weniger im Formulierungsdetail memorierbare Beschreibung improvisierter Tankstellen am serbischen Straßenrand, die den Treibstoff angeblich als dickflüssigen »Bodenschatz« verkauften. Vom politischen Handke dieser Monate ist heute nichts mehr übrig als zwei stilistische Auffälligkeiten. Er ist fünfzehn Jahre später nur doch »Der mit den andersgelben Nudelnestern«.
Schon 1991, in einem der ersten Abschnitte seines »Abschied des Träumers vom Neunten Land«, ist von einer Evokationskraft der slowenischen Gegenstände die Rede, die von denen der »Westwelt« und vor allem in Deutschland grundlegend verschieden aussähen und sich anfühlten. Im Westen sei das zu Herzen Sprechende der Dinge verlorengegangen. Und Handke erwähnt bei seinem Lobpreis der slowenischen Gegenständlichkeit Hugo von Hofmannsthals »Briefe des Zurückgekehrten« von 1907, eine erfundene Korrespondenz aus dem gedanklichen Umfeld des »Chandos-Briefs«. Jener »Zurückgekehrte« bei Hofmannsthal ist ein deutscher Geschäftsmann, der achtzehn Jahre im Ausland gelebt hat, in den USA und in Südamerika, in Ostasien und in London. Und wenn ihm bei seinen Reisen und Auslandsaufenthalten ein eindrücklicher Moment oder Mensch, ein Blick, ein Gegenstand, ein Glas Wasser an einem heißen Tag eine Art Epiphanieerlebnis bereitete, dann dachte er an Deutschland, das ihm in der Fremde als das Land erschien, wo solche epiphanischen Momente sozusagen an der Tagesordnung gewesen waren. Inzwischen aber, im Jahr 1901, scheinen dem Zurückgekehrten die deutschen Dinge krank. »Zuweilen kam es des Morgens, in diesen deutschen Hotelzimmern, vor, dass mir der Krug und das Waschbecken – oder eine Ecke des Zimmers mit dem Tisch und dem Kleiderständer – so nicht-wirklich vorkamen, trotz ihrer unbeschreiblichen Gewöhnlichkeit so ganz und gar nicht wirklich, gewissermaßen gespenstisch, und zugleich provisorisch, wartend sozusagen vorläufig die Stelle des wirklichen Kruges, die Stelle des wirklichen mit Wasser gefüllten Waschbeckens einnehmend.« Auch die deutschen Menschen haben verloren, was sie einmal hatten und was den Zurückgekehrten auf seinen Wanderungen im Gesicht von »alten Chinesen« an Deutschland erinnerte oder im »Blick eines der unglaublich schönen Mädchen (…), wie sie auf den einsamen Gehöften der Gauchos aufwachsen«. Die Abwesenheit des Zurückgekehrten war in die Jahrzehnte nach Bismarcks Reichsgründung gefallen, in die Zeit von Gründerboom und Gründerkrach. Hofmannsthals Figur hat den Beginn der autokratischen und militaristischen Regierungszeit Wilhelms des Zweiten nicht mitbekommen und nicht die Jahrzehnte der kolonialistischen Sehnsüchte und Erwerbungen Deutschlands. In den achtzehn Jahren seiner Abwesenheit war das Deutsche Reich zu einem der modernsten und wirtschaftlich erfolgreichsten Länder der Welt geworden und politisch zur Vormacht Europas. Der Zurückgekehrte hatte auf seinen Reisen die Modernisierung Deutschlands verpasst.
Auch Handke ist, von jahrelangen Weltreisen kommend, 1991 nach Deutschland und Österreich zurückgekehrt. Und er fühlte sich dort, erzählt er in seinem »Abschied des Träumers vom Neunten Land«, neunzig Jahre nach Hofmannsthals »Briefen« so fremd wie deren erdichteter Autor. Auch Handke spürt die Entfremdung zwischen sich und den heimischen Verhältnissen an einer Gespensterhaftigkeit der deutschen Dinge. Erst hinter der Ostgrenze Kärntens, in Jugoslawien, gewann ihm die Objektwelt wieder Kontur, Seele und Bedeutung: »Wie gegenständlich aber wurden dafür mir durch die Jahre, gleich beim wiederholten Überschreiten der Grenze, die Dinge in Slowenien: Sie entzogen sich nicht – wie das meiste inzwischen nicht bloß in Deutschland, sondern überall in der Westwelt –, sie gingen einem zur Hand. Ein Flussübergang ließ sich spüren als Brücke; eine Wasserfläche wurde zum See, der Gehende fühlte sich immer wieder von einem Hügelzug, einer Häuserreihe, einem Obstgarten begleitet, der Innehaltende dann von etwas ebenso Leibhaftigem umgeben, wobei das Gemeinsame dieser Dinge die gewisse herzhafte Unscheinbarkeit gewesen ist, eine Allerwelthaftigkeit: eben das Wirkliche, welches wie wohl nichts sonst jenes Zuhause-Gefühl des ›Das ist es, jetzt bin ich endlich hier!‹ ermöglicht.«
Was Hofmannsthals Zurückgekehrter an den Dingen im wilhelminischen Deutschland vermisst, beschreibt Handke als in Slowenien gegenwärtige Erfahrung. Er wird es in den Jahren nach seinem ersten »jugoslawischen« Aufsatz, aus dem diese Sätze stammen, unglücklich politisieren. Und was in der Moderne, bei Hofmannsthal und Handke als anachronistischer spleen erscheint, hat Hegel in der »Ästhetik« als das Welt- und Dingverhältnis der antiken Lebenswelt, als das Gegenstandsgefühl im »epischen allgemeinen Weltzustand« charakterisiert. Handke schildert im »Abschied des Träumers« die slowenischen Gegenstände ganz so, wie sie, Hegel zufolge, im Epos vorkommen. »Was der Mensch zum äußeren Leben gebraucht, Haus und Hof, Gezelt, Sessel, Bett, Schwert und Lanze, das Schiff, mit dem er das Meer durchfurcht, der Wagen, der ihn zum Kampf führt, Sieden und Braten, Schlachten, Speisen und Trinken: es darf ihm nichts von allem diesen nur ein totes Mittel geworden sein, sondern er muss sich noch mit ganzem Sinn und Selbst darin lebendig fühlen und dadurch dem an sich Äußerlichen durch den engen Zusammenhang mit dem menschlichen Individuum ein selber menschlich beseeltes individuelles Gepräge geben. Unser heutiges Maschinen- und Fabrikenwesen mit den Produkten, die aus demselben hervorgehen, sowie überhaupt unsere Art, unsere äußeren Lebensbedürfnisse zu befriedigen, würde nach dieser Seite hin ganz ebenso als die moderne Staatsorganisation dem Lebenshintergrunde unangemessen sein, welchen das ursprüngliche Epos erheischt.« Thema des antiken Epos aber ist der Krieg. Und man kann sich bei der Lektüre Hofmannsthals und Handkes tatsächlich nicht von einer Art politischer Mulmigkeit freimachen. Könnten Sehnsüchte und Empfindungen, wie sie der »Zurückgekehrte« und der Slowenienreisende Peter Handke beschreiben (fragt man sich dann mit einer gewissen Bangigkeit), vielleicht Vorboten oder »Begleitgefühle« von Kriegen sein?
Auch finde ich es auf den zweiten Blick ein bisschen verunsichernd, dass mir in diesen ersten Wochen in Tiflis eine Bemerkung meines akademischen Lehrers Heinz Schlaffer einfällt, der – es muss 1977 gewesen sein – in einer Stuttgarter Vorlesung über die Theorie des Romans die ungeklärten und bürokratisch-juristisch noch nicht festgelegten Weltverhältnisse des Western als Illustration des allgemeinen epischen Weltzustands in Hegels »Ästhetik« anführte. Würde das bedeuten, dass meine derzeitige Georgienbegeisterung eine Art John-Wayne-Gefühl ist, ein Rückfall in die Zeit, als ich nicht genug bekommen konnte von Filmen wie »Il Grande Silenzio« und anderen Italo-Western? Und zu weiterem Misstrauen mir selbst und meinen Gefühlen gegenüber gab mir dann wenig später der Dokumentarfilm »Der Fall Chodorkowski« von Cyril Tuschi Anlass, den ich eines Abends mit von Einstellung zu Einstellung steigender Aufregung anschaute. Ist denn nicht, sage ich mir seither, die auch im Bösen (Putin) oder im Irrwischhaften (Saakaschwili) offensichtliche Faszination und irgendwie auch Größe der osteuropäischen Politiker darauf zurückzuführen, dass sie Produkte der gleichen Gesetzlosigkeit sind, die von der Bronzezeit bis zu »High Noon« Helden notwendig macht und hervorbringt? Die live im russischen Fernsehen übertragene Pressekonferenz geht mir nicht mehr aus dem Sinn, auf der Chodorkowski dem russischen Premier seinen politischen Fehdehandschuh hinwarf, worauf der unmittelbar (»wie aus der Pistole geschossen«) das Todesurteil für Chodorkowskis Yukos-Konzern sprach – beziehungsweise mit unnachahmlich sanfter Tücke in die Form eines nachdenklich, fast schüchtern vorgebrachten Diskussionsbeitrags kleidete. So ähnlich, denke ich seither oft, könnten im Senat des ersten vorchristlichen Jahrhunderts Sullas oder Cäsars Wortmeldungen Reiche vernichtet und Leben zerstört haben. An Putins Diktion und Körpersprache scheint – gerade weil er eigentlich so bescheiden und scheinbar vernünftig spricht – ablesbar, für ein wie viel größeres Land er steht als beispielsweise die deutsche Kanzlerin oder der französische Präsident. Size does matter – auch in der politischen Ästhetik. Und Chodorkowski ist als Kapitalist einer faszinierenden Tragik fähig, die an heroische Zeiten der amerikanischen robber barons erinnert. Von Josef Ackermann erwartet derlei niemand. Bedeutet das alles, dass mir mit meinen kaukasischen Glücksgefühlen ein autoritärer Rappel unterläuft?
Ich gehe wieder auf den Höhen über Tiflis spazieren. Es ist fast schon Winter, der milde Winter der mediterranen Welt. Manchmal bleibt schon etwas von dem Schnee liegen, der am Morgen fällt, und meistens schaffen es die wenigen Heizkörper nicht recht, die Innentemperatur meiner Wohnung auf behagliche Grade zu erwärmen. Ich habe einen Weg entdeckt, auf dem ich von meiner Wohnung aus über Treppen und Stege (die wahrscheinlich einmal Weinbergpfade gewesen sind) direkt zum »Schildkrötensee« wandern kann, einem kleinen Berggewässer, das mit Tretbooten, Uferrestaurants, einer Promenade, einem nahen Freilichtmuseum und allerlei Fitnessgeräten ein weiteres Tifliser Naherholungsgebiet vorstellt. Im Aufwärtssteigen denke ich wieder einmal darüber nach, wie seltsam es ist, dass ich trotz einer Liebe zur amerikanischen Kultur, die ich mir lebenslang erarbeitet und in so vielen Ländern erprobt hatte, dann zu Beginn des Jahrhunderts trotzdem nicht gern in den USA gelebt habe. Ich grüble herum an gewissen stark Handke-artigen Gefühlen, die mir bei meiner Rückkehr nach Europa und besonders in Osteuropa zugestoßen sind, schon in der letzten Phase meines amerikanischen Aufenthalts, als ich zum Beispiel für eine Woche geschäftlich ins ukrainische Kiew kam. Oder dann, als ich in der Zeit zwischen New York und Tiflis ein paar Urlaubstage in Krakau verbrachte. Das sehnsuchtsvolle, halb melancholische Auferstehungsgefühl, das mich auf diesen Reisen überkam, war keine angelesene Erfahrung, ich bin mir sicher. Es passierte wirklich. Es war eine Art Wiederaufblühen. Ein Wiedervertrautwerden mit den Elementen dieser so viel raueren Stadtlandschaften und ihrer tatsächlich »herzhaften Unscheinbarkeit«. Die rissigen und reparaturbedürftigen Straßen und Bürgersteige. Die Dorfluft im Zentrum von Kiew. Die Blicke der Männer und Frauen, die mittelalterlichen Mauern, die staubigen Parkwege, die altmodischen Kioske mit den billigen Zigaretten, die man hier in jedem Restaurant rauchen darf (was allerdings schon nach ein paar Monaten USA seltsam ungehörig anmutet und eigentlich kaum mehr auszuhalten ist). Und schließlich angekommen in dem kaukasischen Sehnsuchtsland Georgien, von dem ich so lang schon geträumt hatte, nahmen mich Freunde an einem sonnigen Herbstsamstag mit zu einem jungen Winzer in Kachetien im Osten des Landes.
Kachetien, ein Fürstentum des Königreichs Iberien, das sich in der Merowingerzeit wieder seine Unabhängigkeit vom arabischen Emirat Tiflis erkämpft hatte, ist das berühmteste Weinanbaugebiet des Landes – und man sucht unmittelbar nach dem Hinschreiben dieses Wortes nach einer poetischeren und weniger EU-bürokratischen Bezeichnung (also nach einer Handke-Vokabel) für das weite Tal des mäandernden Bergflusses Alasani, an dessen sanft, fast unmerklich in die Ebene hinuntergleitenden Hängen sich Weinfelder erstrecken. In der Ferne stand als eine dunkelbraune, in der Gipfelzone schon schneebedeckte Riesenwand der Kaukasus. Er ist ein erdgeschichtlich viel jüngeres Gebirge als die von Flüssen und Gletschern schon zerklüfteten und von Tälern auf ihrer ganzen Länge durchzogenen Alpen. Die Alpen imponieren (beim Anflug auf München zum Beispiel) als eine Kette von einzelnen, gut unterscheidbaren Gipfeln. Der Gebirgszug dagegen, der das Alasanibecken nach Norden hin abschließt, steht dort als titanisch kompaktes Kontinuum aus fast gleichhohen, kaum auseinanderzuhaltenden Dreieinhalbtausendern. Wir hatten an jenem Nachmittag in dem schuppenartigen Anwesen eingesprochen, wo unser Freund heute mit seiner Mutter dabei war, die Umwandlung des frisch geernteten Traubensafts in Rotwein zu überwachen.
Weinbau wird in Georgien noch ganz so betrieben wie in der Antike (die das Weinmachen, nach allem was man weiß, aus dem Südkaukasus importiert hat). Fast jede georgische Familie hat eigene Weinberge und ist stolz darauf, selbstgemachten Wein anzubieten oder zu verschenken. Die Verwandlung des Traubensafts vollzieht sich hier in großen Tonamphoren, die in den Boden eingegraben sind (und dessen Mineral- und Aromastoffe der Wein deshalb bei seinem Reifungsprozess aufnimmt). Tondeckel sind lose auf die Öffnungen gelegt, dazwischengebettete Feigenblätter sorgen für Luftaustausch. Mit einem langen Zweig rührte und wälzte der Freund an jenem Nachmittag die knallrote, in voller Gärung befindliche Mischung aus Saft, Maische und Traubenkernen in jedem der mannshohen unterirdischen Tongefäße vorsichtig um, als wir den kaum garagengroßen Raum betraten. Seine Mutter stellte dann auf der offenen Terrasse des baufälligen, über und über mit Weinranken bewachsenen Hauses georgisches Brot, Tomaten, Gurken und einen Laib schneeweißen, sehr salzigen Kuhkäses, wozu wir ein Glas aus der vorjährigen Ernte im Stehen oder auf allerlei Kisten oder Holzstößen hockend tranken (das Bäuerliche in Verbindung mit dem Hochkultivierten). Und in dem alten japanischen Jeep des Hausherrn fuhren wir anschließend durch diesige Herbstsonne zu dem Feld hinaus, wo dieser Wein vor einem Jahr gewachsen war.
Späte, sehr süße Trauben hingen an fast schon trockenen Reben zwischen den letzten Blättern, der erwähnte Wind wehte, das Gebirge thronte jenseits des afrikanisch ausgedörrten Tals, und allerlei Erhard-Kästner-Gefühle und Formulierungen à la »Göttersitz«, »Prometheus«, »gewaltig«, »unbegreiflich«, »Epiphanie der Unmittelbarkeit« und so weiter stellten sich ein in meinem inneren Monolog. Mir schien plötzlich ganz klar und einleuchtend, dass in dem Wein, den wir vorher getrunken hatten (und von dem ich offenbar sogar ein bisschen zu viel abbekommen hatte), ja tatsächlich, chemischer Analyse durchaus zugänglich, all die natürlichen Gegebenheiten dieses Landstrichs gegenwärtig seien (»Von realer Gegenwart«, der Titel eines kulturkonservativen ästhetisch-geschichtsphilosophischen Pamphlets George Steiners, rauschte mir dann leider unwillkürlich-unvermeidlich durch die Birne). Und zugleich, schien mir, sei die Vergangenheit des Weinmachens von der Jungsteinzeit bis heute darin zu schmecken gewesen. Erde und Himmel, musste ich (von mir selbst gerührt und zugleich ärgerlich) denken. Regen und Sonne. Vergangene und gegenwärtige Mühe. Arbeit und Ekstase. Das alles zusammen, dachte ich, ist der Wein. »So kann ich die Dinge erst hier wieder sehen.« Und stehenden Fußes erwarb ich nach der Rückkehr zu Winzer und Mutter, Terrasse, Schuppen und Amphorengarage eine 12er-Kiste des hiesigen Rotweins zu einem, wie man mir zu Hause wohlmeinend eröffnete, stark überhöhten Preis.
Womit ich peinlicherweise endgültig bei dem Umstand angekommen wäre, der mir vielleicht am unheimlichsten ist an der antiamerikanischen (und eigentlich, denke ich zu meinem geheimen Grauen oft, ja eigentlich vollends antimodernen) Gestimmtheit, mit der meine Georgienbegeisterung in diesen Wochen verbunden ist. Ich überlasse mich dieser prekären Geistesverfassung gleichsam experimentell und zu dem Zweck, herauszufinden, was eigentlich in mir vorgeht, obwohl mich diese Gedanken zugleich ekeln und manchmal geradezu ängstigen. Besonders unheimlich ist mir eine fatale, erst jüngst beim Herumlesen entdeckte Nähe meines neuesten – und diesmal, wie es scheint, modernekritischen – Essayistenspleens zu gewissen Motiven, die Martin Heidegger 1950 in seinem Vortrag »Das Ding« vor der Bayerischen Akademie der Künste entwickelt hat. Dem großen Philosophen sind da nicht nur so bezaubernde dadaistische Kabinettstückchen gelungen wie zum Beispiel »Aus dem Spiegel-Spiel des Gerings des Ringen ereignet sich das Dingen des Dinges«. Sondern er formulierte 1950 in der Münchner Residenz auch Gedanken und Ahnungen, die meiner »12-Flaschen-überteuerter-Rotwein-Epiphanie« auf dem spätherbstlich abgeernteten Weinberg im georgischen Kacheti unheimlicherweise sehr nahe kommen. Zum Beispiel: »Dingend verweilt das Ding die einigen Vier, Erde und Himmel, die Göttlichen und die Sterblichen, in der Einfalt ihres aus sich her einigen Gevierts.« Hilfe, ich werde bescheuert!, denke ich, indem ich das bei Heidegger Gelesene mit meinen zweifelhaften inneren Erlebnissen vergleiche – und zugleich genieße ich mein schwer erklärliches postamerikanisch-kaukasisches Glücklichsein dankbar und in vollen Zügen. Was, zum Teufel, ist das?
Nun, vermutlich ist es, finde ich nach einigem Weiterdenken, zumindest kein Anzeichen dafür, dass bald ein Krieg kommt oder ich mich auf meine alten Tage zum kulturellen Faschisten entwickelt habe. Es sind vermutlich nicht einmal die Spätfolgen eines unsymptomatisch verlaufenen kleinen Schlaganfalls. Sondern Motive konservativer Mentalitäten, die uns Moderne, wenn wir lang genug einer Überdosis Moderne ausgesetzt waren, mit gleichsam medizinisch prognostizierbarer Zwangsläufigkeit befallen. Eine Art Moderne-Kater. An einer sehr komischen Stelle seiner »Ästhetik« deckt der (als Humorist überhaupt unterschätzte) Georg Wilhelm Friedrich Hegel die unvermeidliche Verlogenheit der idyllischen Gattung auf (die Idylle gehört als eine Art friedlich-unpolitische Schwundstufe ebenfalls in den heroischen Weltzustand). Hegel beschreibt die idyllische Erfahrung als ein Empfindungsgemisch, wie es mich ganz ähnlich auf meinem kachetischen Weinberg angesichts von Kaukasus, Reben, Wind und Erde anwandelte. »Die idyllischen Zustände unserer heutigen Gegenwart haben wieder das Mangelhafte, dass diese Einfachheit, das Häusliche und Ländliche in Empfindung der Liebe oder der Wohlbehäglichkeit eines guten Kaffees im Freien usf., gleichfalls von geringfügigem Interesse sind, indem von allen weiteren Zusammenhängen mit tieferen Verflechtungen in gehaltreiche Zwecke und Verhältnisse bei diesem Landpfarrerleben usf. nur abstrahiert wird.« Indem Hegel den Kaffee, ein Produkt kolonialer Globalisierung, in die Idylle einmontiert, hat er sie komisch gesprengt. Denn wo Kaffee getrunken wird, kann man sich logischerweise nicht wie im epischen Weltzustand »mit ganzem Sinn und Selbst darin lebendig fühlen und dadurch dem an sich Äußerlichen durch den engen Zusammenhang mit dem menschlichen Individuum ein selber menschlich beseeltes individuelles Gepräge geben«. Denn man war ja noch nie, wo der Kaffee wächst, und weiß kaum, wo er herkommt (die Leerstelle des Kaffees in Hegels Idylle hatte in meinen kachetischen Hochherzigkeiten der japanische Jeep des Hausherrn inne).