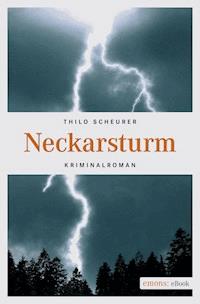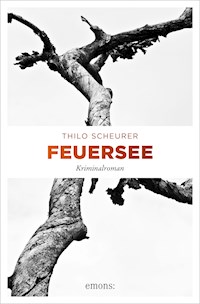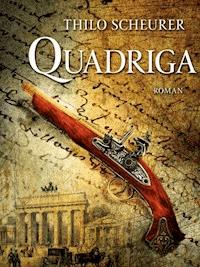Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cold Case Stuttgart
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Cold Case aus Stuttgart. Im Sommer 2011 verschwindet die siebzehnjährige Jasmin auf ihrem Schulweg spurlos. Tage später wird ihre Kleidung mit Blutspuren und Einstichen übersät entdeckt. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Ohne dass ihre Leiche je gefunden wurde, liegen die Akten Jahre später beim Stuttgarter LKA-Dezernat "Tote ohne Mörder". Oberkommissar Sebastian Franck ermittelt verdeckt in Jasmins ehemaliger Schule – und gerät damit in höchste Gefahr ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 446
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thilo Scheurer, Jahrgang 1964, lebt und schreibt in einer Kleinstadt am Rande des Schwarzwalds. Er ist Mitinhaber eines kleinen Softwareunternehmens. Aus seiner Feder stammen mehrere Abenteuer- und Kriminalromane. Der Autor ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2017 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: age fotostock/Lookphotos
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, Tobias Doetsch
Lektorat: Lothar Strüh
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-272-4
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Agentur Editio Dialog,
Dr. Michael Wenzel (www.editio-dialog.com).
Nichts ist so schön,
dass es unter gewissen Bedingungen
nicht hässlich sein kann.
Oscar Wilde
Prolog
Bilder zucken durch meinen Kopf. Viel zu schnell, als dass ich sie zusammenfügen kann: Das gleißende Licht der Sonne, Stromleitungen vor blauem Himmel, kunterbunte Häuserwände, eine alte Zeitung weht über den Asphalt.
»Hier liegt jemand«, hallt eine weibliche Stimme in meinem Kopf. Von wem redet die Frau?
Graue Wolkenschleier ziehen über die Sonne. Ihr Licht verblasst zusehends.
Jemand drückt mir einen Plastikbeutel ins Gesicht. Frischer Geruch wie auf einem Waldspaziergang vertreibt den Gestank nach Müll und Katzenpisse.
Die blasse Sonnenscheibe löst sich hinter den Wolken auf. Licht und Schatten vermischen sich zu einem fahlen Gelb.
Plötzlich friere ich.
Eine Hand hebt meinen Arm an, drückt darauf herum. Neben meinem Ohr setzt ein rhythmisches Piepen ein.
Warum nur ist es so verdammt kalt?
Jemand zupft an meinen Lidern, leuchtet mir direkt in die Augen. Die Helligkeit schmerzt, als ob ein Tausend-Watt-Strahler sich in meine Netzhaut brennt. »Keine Pupillenreaktion.«
Das Piepen verlangsamt sich.
»Beatmung fortsetzen.«
Die Zeit scheint zu kriechen. Irgendwo bellt ein Hund. Dann verstummt auch der. Drückende Ruhe. Frieden.
Ein schriller Warnton durchbricht die Stille.
»Kammerflimmern!« Die Stimme der Frau wirkt mit einem Mal angespannt. »Adrenalin null Komma fünf Milligramm.«
Was sich da im nächsten Moment in meinen Oberschenkel bohrt, fühlt sich an wie ein Spieß.
»Laden.« Hektische Hände reißen an meiner Kleidung.
Ein anderer elektrischer Ton, eine Art Fiepen, ertönt und schwillt weiter an. Eisige Metallflächen landen auf meinem nackten Oberkörper.
»Fertig«, ruft eine jüngere, männliche Stimme.
Ein Knall wie von einer Detonation zerreißt die Luft. Der Schmerz, der einen Sekundenbruchteil später durch meinen Körper schießt, ist unbeschreiblich. Das rhythmische Piepen tobt los, als stünde eine Höllenmaschine neben meinem Ohr.
»Auf die Trage«, befiehlt die Frau.
Zwei Hände packen mich an den Beinen, zwei andere unter den Achseln. »Eins, zwei, los«, ruft die männliche Stimme.
Kurz schwebt mein Körper in der Luft, wird hin und her gezerrt. Ich versuche, die Augen zu öffnen, doch es flackern nur einzelne Lichtpunkte in der Dunkelheit.
Autotüren klappern, eine Sirene heult auf. Die Lichtpunkte verblassen und verschwinden dann ganz wie in einem schwarzen Loch, das alles aufsaugt.
1
Er hätte Nein sagen sollen – einfach nur Nein. Sebastian Franck bereute es schon den ganzen Tag, dass er sich von Franziska, seiner Arbeitskollegin, zu Cems Auftritt hatte überreden lassen. Rocktube – wenn ein Veranstaltungsort schon so hieß, konnte es sich nur um eine verrauchte Kneipe mit Dutzenden schwitzender und womöglich alkoholisierter Menschen handeln. Eine schwer zu ertragende Vorstellung. Und das alles nur, weil dieser kostümierte Kasper, der Elvis Presley imitierte, auch ein Arbeitskollege im Dezernat war. Ein Teamkollege. Andererseits, wenn er nicht mitginge, würde Franziska mit ihrem Wacken Open Air keine Ruhe geben. Tausende Menschen, die sich bei Wind und Wetter im Schlamm suhlten. Ekelhaft. Da stellten ein paar Stunden seichter Rock ’n’ Roll im Trockenen das kleinere Übel dar. Vielleicht würde er danach endlich eine Zeit lang Ruhe vor Black und Heavy Metal haben.
Sebastian betrachtete sein Spiegelbild. Etwas zu kurz war der Haarschnitt geworden. Schon jetzt mit Mitte dreißig deuteten sich Geheimratsecken an und drängten allmählich die blonden Haare an der Stirn zurück. Und wenn er an seinen Vater Arthur dachte, würde es wohl nicht dabei bleiben. Mit fünfzig hatte der bereits eine Halbglatze. Eigentlich konnte er ganz zufrieden sein mit seiner Figur. Diesen Abend jedoch nicht mit seiner Kleidung: beige Stoffhose, blau gestreiftes Hemd. Franziska hatte am Nachmittag noch gesagt, dass er sich bei Cems Auftritt ruhig etwas lockerer geben konnte. Und mit »etwas lockerer« meinte sie vermutlich keinen Anzug und keine Krawatte.
Das hatte er schon mal erfüllt, wenn auch ungern. Er konnte sich nicht daran erinnern, wann er zuletzt so nachlässig gekleidet zu einer Veranstaltung aus dem Haus gegangen war. Vermutlich auf einer dieser Studentenpartys vor einigen Jahren. Mit Grausen dachte er daran, wie seine Kommilitonen damals unter dem Einfluss von Alkohol regelmäßig nicht nur ihren Anstand, sondern später auch alle Hemmungen verloren hatten. Nach dem dritten Mal hatte er die Nase voll und blieb den beinahe täglichen Partys einfach fern. Auch wenn ihm das bald den Ruf eines Langweilers einbrachte.
Er sah in den Vergrößerungsspiegel, hob den Kopf und rieb sich ein paarmal über das Kinn. Trotz der morgendlichen Rasur zeigten sich bereits wieder die ersten Bartstoppeln. Sebastian griff nach der Dose Rasierschaum und sprühte sich etwas davon auf die Handfläche. Doch statt sich damit einzuseifen, betrachtete er die walnussgroße Portion. Sollte er sich überhaupt rasieren? Ein Bartschatten passte bestimmt ebenfalls in die Kategorie »etwas lockerer«. Er stellte den Rasierschaum zurück und wusch die Hand ab.
Sebastian hob das Kinn weiter an, legte den Kopf schief. Aber die beiden Haare, die aus der Nase ragten, mussten weg – »etwas lockerer« hin oder her. Er tastete nach dem Nasenhaartrimmer, schaltete das Gerät ein und bearbeitete damit beide Nasenlöcher, bis der Scherkopf kein Geräusch mehr von sich gab. Er legte den Trimmer zurück und griff nach der Pinzette. Wenn er schon dabei war, so konnte er sich gleich noch ein paar längere Haare in den Augenbrauen zupfen. Er trug noch etwas Gesichtscreme auf, spannte und lockerte dabei einige Male seine Kiefer- und Wangenmuskeln.
Er sah auf seine Armbanduhr. In achtzehn Minuten würde Franziska ihn abholen. Nicht, dass er nicht auch seinen eigenen Wagen nehmen könnte, aber sie hatte gemeint, dass es keine gute Idee wäre, mit dem Mercedes SL Roadster in dieser Gegend zu parken. Dort gäbe es immer wieder Beschädigungen an derart teuren Autos. Und außerdem hatte sie ihm versprochen, die Musik während der Fahrt mit der Pink Lady, wie sie ihren alten Fiat Panda nannte, leise zu drehen.
Drüben im Wohnzimmer schaltete Sebastian den CD-Spieler an, und der schwermütige zweite Satz aus Schuberts Klaviersonate Nummer einundzwanzig erklang. Eigentlich die falsche Musik, um sich auf anspruchslosen Rock ’n’ Roll vorzubereiten. Etwas kraftvollere Klänge schienen ihm dazu eher geeignet. Er nahm die Fernbedienung zur Hand und drückte so lange auf eine der Tasten, bis der mächtige und harte erste Satz aus Beethovens Symphonie Nummer neun aus den Lautsprechern drang.
Zufrieden mit seiner Wahl rückte Sebastian den weißen Lederhocker vor die Fensterfront, setzte sich im Schneidersitz darauf und sah nach draußen. Besonders um diese Uhrzeit, wenn sich allmählich die Schatten der Nacht über die Stuttgarter Talstadt legten, war der Ausblick von hier oben phänomenal. Ohne Zweifel das Hauptargument für den Kauf des Penthouse.
Das Ende des ersten Satzes von Beethovens Neunter rückte näher. Die Lautstärke steigerte sich von piano über forte zu fortissimo. Wo blieb eigentlich Franziska? Sie wollte ihn um acht Uhr abholen, und bei achtzehn Minuten, die dieser erste Satz dauerte, war sie schon über der Zeit.
Mit dem Einsetzen der Streicher zu Beginn des zweiten Satzes erklang dann tatsächlich die Türklingel. Sebastian sprang auf, nahm den Hörer der Gegensprechanlage ab, und Franziskas Gesicht erschien im Bildschirm.
»Sie sind vier Minuten und«, Sebastian schaute auf seine Armbanduhr, »zwanzig Sekunden zu spät.«
»Ich weiß, Chef«, kam Franziskas Stimme durch den Hörer. »Aber die Parkplatzsituation in Ihrer Straße ist echt verdammt angespannt.«
»Dann komme ich am besten gleich runter«, gab Sebastian zurück und wollte schon auflegen.
»Nein. Bitte, Chef. Ich muss mal kurz.«
»Was müssen Sie mal kurz?«
»Für kleine Mädchen.«
»Für kleine Mädchen? … Ach so.« Er drückte auf den Türöffner. »Ganz nach oben, Penthouse.«
Sebastian öffnete die Tür und wartete auf der Schwelle, bis Franziskas zierliche Gestalt auf dem Flur erschein. Ihr Gesicht unter den pechschwarzen Haaren wirkte im Halbdunkel weiß wie Papier. Trotz der hellgrünen Strähne an der Seite.
»Hier.« Er winkte ihr zu.
Franziska beschleunigte ihren Schritt. Im Gegensatz zu ihrer Gewohnheit, weit geschnittene Cargohosen mit möglichst vielen Taschen zu tragen, hatte sie sich diesmal für eine eng anliegende schwarze Hose aus glänzendem Leder entschieden. Das oft martialisch wirkende Oberteil, wahlweise mit Totenkopf, buntem Phantasiemonster oder dem blutroten Namen einer Metal-Band, war einem ärmellosen Netzhemd über einem weißen T-Shirt gewichen. Lediglich von der Vielzahl Ketten und Riemen um Hals und Handgelenke hatte sie sich offenbar nicht trennen können.
»Wo ist Ihre Toilette?«, fragte sie, noch bevor sie die Wohnung betreten hatte.
Sebastian deutete hinter sich. »Die erste Tür links.«
Franziska lächelte dankbar, ließ dabei ihr Zahnpiercing aufblitzen und drängte sich ohne ein weiteres Wort an ihm vorbei. Einen Moment später war sie hinter der Tür zur Gästetoilette verschwunden.
Jetzt fehlten nur noch die Schuhe. Aber besaß er überhaupt ein passendes Paar zu dieser beigen Stoffhose? Er ließ seinen Blick über das Schuhregal streifen: Stiefeletten halb hoch oder ganz hoch sowie Halbschuhe reihten sich aneinander. Alle in Schwarz. Er entschied sich für eines der älteren Paare, das er eigentlich schon hatte entsorgen wollen. Man konnte ja nie wissen, wie sie nach einem Abend im Rocktube aussahen. Bestimmt nahm dort niemand Rücksicht auf handgenähte italienische Schnürschuhe aus Kalbsleder.
Kaum hatte er die Schuhe angezogen, hörte er die Toilettenspülung, dann das Wasser aus dem Wasserhahn und schließlich das Türschloss. Im nächsten Moment stand Franziska im Flur und strich ihr Shirt glatt.
»Die war doch heute Morgen noch orange.« Sebastian deutete auf ihre grüne Haarsträhne.
»Mir war für den Abend eher nach Grün.« Franziska musterte ihn, machte jedoch keine Anstalten, weiterzugehen.
»Und das geht so einfach?«
»Das sind Extensions. Und die kann ich wechseln, wie Sie Ihre Krawatten.« Noch immer beäugte sie ihn.
»Was ist? Was schauen Sie mich so an?«, fragte Sebastian.
»Haben Sie keine Jeans oder so?«
»Jeans?« Er glaubte, sich verhört zu haben.
»Ja, Jeans. Das sind diese Hosen aus grober Baumwolle, meist in unterschiedlichen Blautönen und manchmal auch etwas verwaschen.«
»Ich weiß, was Jeans sind.«
»Und, haben Sie welche?«
Sebastian zuckte mit den Schultern. »Vielleicht … ja.«
»Dann ziehen Sie die am besten an. Mit dieser beigen Hose fallen Sie nur auf.«
Sebastian schaute an sich hinunter. Warum sollte er mit einer beigen Stoffhose auffallen? Sie hatte doch gesagt, dass er sich »etwas lockerer« geben sollte. Und nachlässigere Kleidung besaß er nicht.
»Sieht ein bisschen … spießig aus.«
Er sah wieder auf. »Spießig?«
»Ja, spießig.« Franziska lächelte.
»Dazu bleibt keine Zeit. Wir kommen sowieso schon zu spät.«
»Höchstens eine Viertelstunde. Und so was fängt eh nie pünktlich an.«
»Warum geben die zwanzig Uhr dreißig als Beginn an, wenn sie von vornherein wissen, dass sie später anfangen?«
»Das ist halt so.« Franziska nickte ihm auffordernd zu. »Machen Sie schon, ich warte hier. Vielleicht finden Sie ja noch ein anderes Hemd, weiß oder so. Hauptsache einfarbig. Und am besten lassen Sie es gleich aus der Hose hängen.«
Sebastian seufzte. Warum zum Teufel hatte er sich nur auf diesen Abend eingelassen?
Im Schlafzimmer durchkämmte er seinen Kleiderschrank, fand jedoch keine blaue, sondern nur eine schwarze Jeans. Das musste reichen. Er zog sie über und stand zwei Minuten später mit einem dunkelroten Hemd über der Hose wieder im Flur.
Franziska hatte sich in der Zwischenzeit über das Aquarium gebeugt. »Süß, die Kleinen. Was sind das für Fische?«
»Guppys.«
»Nie gehört.«
»Der Name geht auf Robert John Lechmere Guppy zurück. Er hat sie 1866 auf Trinidad entdeckt und mehrere Exemplare dem Britischen Museum zugesandt.«
»Aus der Karibik? Krass! Haben die Namen?«
»Nein.«
»Und wie erkennen Sie sie dann?«
»Ich hab sie nummeriert.«
»Nummeriert? Bestimmt der Größe nach.« Franziska hielt ihren Kopf näher an die Glasscheibe. Eine ihrer Halsketten klimperte. »Und der Große da ist wohl die Nummer eins.«
»Nein, die Fünf. Sie sind aufsteigend nummeriert. Der Kleinste hat die Eins.«
»Ah.« Franziska richtete sich wieder auf und musterte ihn von oben bis unten.
»Und?« Sebastian nahm ein kariertes Sakko von der Garderobe und wollte es überziehen.
»Besser. Nur die Jacke, die geht gar nicht. Lassen Sie die einfach hier. Der Regen hat eh aufgehört.«
Unten angekommen sah Sebastian im ersten Augenblick nur den Streifenwagen, dessen eingeschaltetes Signallicht sich in der regennassen Straße spiegelte. Dann erkannte er direkt davor Franziskas alten Fiat Panda an den pinkfarbenen Felgen.
»Scheiße«, hörte er sie hinter sich ausrufen.
»Haben Sie etwa auf der Straße in zweiter Reihe geparkt?«, raunte Sebastian.
»Wie gesagt, die Parkplatzsituation hier ist verdammt angespannt. Aber ich hab den Warnblinker angeschaltet.«
»Parken in zweiter Reihe ist nach Paragraf 12 Absatz 4 StVZO generell unzulässig. Auch mit Warnblinker. In Ihrem Fall liegt sogar eine missbräuchliche Benutzung der Warnblinkanlage vor.«
»Sie klingen schon wie ein Verkehrspolizist. Der eine, der gerade eine Halterfeststellung macht, wird wohl gleich so was Ähnliches zu mir sagen.«
»Lassen Sie mich mal«, sagte Sebastian und steuerte auf den jungen Streifenpolizisten mit dem Funksprechgerät zu.
»Gehört Ihnen der Wagen?«, begrüßte der ihn sofort.
»Nein«, gab Sebastian schnell zurück und konnte gerade noch seine Entrüstung zurückhalten. »Der gehört einer Kollegin. Wir sind vom LKA Stuttgart.« Er kramte in seiner Tasche und hielt dem Beamten seinen Dienstausweis vor die Nase.
Der kniff die Augen zusammen und betrachtete kurz den Ausweis. »LKA Stuttgart, soso. Auch für Sie gilt die Straßenverkehrsordnung. Und Sie parken hier verkehrswidrig in zweiter Reihe.«
Sebastian steckte seinen Ausweis zurück. »Natürlich. Und normalerweise handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit.«
»Normalerweise?« Der Beamte runzelte die Stirn.
»Normalerweise, ja. Aber in diesem Fall greift eine Ausnahme zu Paragraf 12, Absatz 4.«
Die Falten auf der Stirn des Beamten wurden tiefer. »Und die wäre?«
»Die dringende Verständigung über einen Fahrzeugmangel. Das ist in Satz zwei von Absatz vier geregelt. Deswegen auch die Warnblinkanlage.«
Der Beamte kratzte sich unter seiner Mütze und seufzte. »Wissen Sie was? Machen Sie doch, was Sie wollen, aber sehen Sie zu, dass das Fahrzeug so bald wie möglich hier wegkommt.« Er wandte sich ab und marschierte ohne ein weiteres Wort zu seinem Dienstwagen.
»Sie haben den Polizisten angeschwindelt«, sagte Franziska, nachdem der Streifenwagen losgefahren war.
»›Anschwindeln‹ ist nicht unbedingt der Begriff, den ich dafür benutzen würde.«
»Sondern?«
»Ausrede …« Sebastian räusperte sich. »Ja, Ausrede, das trifft es wohl am besten.«
Franziska lachte auf.
»Warum lachen Sie? Hab ich was Witziges gesagt?«
»Nein, nein. Aber ich habe nicht gedacht, dass Ihnen eine ›Ausrede‹ so leicht über die Lippen kommt.«
Auch Sebastian hätte das vor ein paar Monaten nicht für möglich gehalten. »Vielleicht liegt das ja an der Arbeit im Dezernat. Oder unserer Chefin.«
»Denken Sie, er hat Ihnen geglaubt?«
»Entweder das, oder mein Dienstausweis hat ihn beeindruckt.« Und ganz so ungewöhnlich fand Sebastian die Reaktion des Polizisten dann doch nicht. Schließlich sah der Fiat Panda auch ein wenig nach liegen gebliebenem Fahrzeug aus.
Franziska stieg ein und öffnete die Tür auf Sebastians Seite. Er nahm auf dem Beifahrersitz Platz, und obwohl er nicht zum ersten Mal in dem Wagen saß, versetzte ihn der Innenraum des Pandas immer wieder in Erstaunen. Nicht nur, weil die hintere Sitzbank monströsen Lautsprechern hatte weichen müssen, sondern auch über die Farbe so einiger Einbauteile. Türgriffe, Lüftungsdüsen, Drehschalter und einige andere Details hatte Franziska mit einem schlichten Pinsel pink angemalt. Deswegen auch Pink Lady. Aber im Gegensatz zum ungepflegten Äußeren des Wagens mit den auffälligen pinkfarbenen Felgen und Zierleisten schien der Innenraum wie immer frisch gereinigt und roch nach Putzmittel.
Kurze Zeit später hatte Franziska das Wohngebiet mit der Tempo-dreißig-Zone verlassen und beschleunigte ihren Fiat. Schnell zeigte die Tachonadel über sechzig, doch sie schien sich nicht um ihre Geschwindigkeit zu scheren. An der nächsten Kreuzung drängte sie sich auf die Vorfahrtsstraße und wechselte sogleich auf die linke von zwei Spuren, die in die Stuttgarter Innenstadt führten.
Sebastian tastete nach dem Haltegriff an der Tür. »Ich dachte, solche Veranstaltungen beginnen erst später. Es gibt also keinen Grund, die Geschwindigkeit zu übertreten.«
Franziska ging vom Gas, der Wagen wurde etwas langsamer, und sie wechselte auf die rechte Spur. Aber nur für wenige Augenblicke. Als sie beinahe die Stoßstange eines vorausfahrenden VW Golf erreichte, beschleunigte sie wieder und überholte den Wagen.
Es war aussichtslos. Sebastian klammerte sich an den Haltegriff. »Warum wollen Sie sich eigentlich Cems Auftritt anschauen? Sie mögen doch keinen Rock ’n’ Roll.«
»Ich habe nie gesagt, dass ich Rock ’n’ Roll nicht mag. Aber sich den ganzen Tag dieses Zeugs im Büro anzuhören, da gehört schon einiges dazu. Deswegen haben wir uns ja darauf geeinigt, morgens Elvis, nachmittags Metal.« Franziska schaltete einen Gang hoch. Inzwischen zeigte der Tacho weit über siebzig an. »Und außerdem ist er mein Arbeitskollege.« Sie wandte Sebastian den Kopf zu. »Ich würde auch kommen, wenn Sie auftreten.«
»Das wird wohl nicht geschehen.«
Franziska lächelte ihn an. »Deshalb der Konjunktiv.«
Sebastian deutete nach vorne. Der Fiat Panda näherte sich beängstigend schnell einer Harley-Davidson, deren beleibter Fahrer auf der linken Spur vor sich hin tuckerte.
»Kann der Dicke nicht die rechte Spur benutzen?« Franziska drückte auf die Hupe.
Nur langsam machte das Motorrad Platz und schwenkte auf die rechte Spur ein. Franziska gab erneut Gas. Doch als sie das Motorrad erreichte, beschleunigte der Fahrer bis auf ihre Geschwindigkeit und wandte ihnen den Kopf zu. Sebastian sah seinen mürrischen Blick aus dem bärtigen Gesicht. Im nächsten Augenblick nahm der Fahrer den linken Arm vom Lenker und hielt ihnen den ausgestreckten Mittelfinger hin. Die Lederbänder unter seinem Ärmel flatterten im Fahrtwind.
»Verdammt, ich werd jetzt gleich supersauer.« Franziska nahm eine Hand vom Lenkrad, beugte sich vor und öffnete den Deckel zum Handschuhfach.
»Franzi! Was machen Sie denn da?«, rief Sebastian aus.
Statt zu antworten, hielt Franziska plötzlich eine Polizeikelle in der Hand und winkte durch die Scheibe auf der Beifahrerseite.
Wie in Zeitlupe breitete sich auf dem bärtigen Gesicht des Fahrers ein ungläubiges Staunen aus. Dann erst schien die Bedeutung der Kelle in ihrer Gänze bei ihm angekommen zu sein. Schlagartig wurde das Motorrad langsamer und ließ den Panda überholen.
Auf Franziskas Gesicht lag ein breites Grinsen, als sie die Kelle wieder im Handschuhfach verstaute. Sie lehnte sich wieder zurück und beschleunigte ihren Wagen. »Geht doch.«
Eine Viertelstunde später erreichten sie das Rocktube auf dem Stuttgarter Killesberg. Wie zu erwarten, waren alle Parkplätze in der Nähe belegt, und Franziska musste ihr Auto in einiger Entfernung abstellen. Doch Sebastians anfängliche Befürchtung, es würde wieder anfangen zu regnen, schien unbegründet. Nur noch vereinzelt zogen Wolken über den Nachthimmel und verdeckten kurz den Blick auf die blasse Mondscheibe.
Nachdem sie den Eintritt bezahlt hatten, ging es eine steile Treppe hinunter in eine Art Keller. Scheinbar Dutzende Stimmen versuchten, sich gegenseitig zu übertönen, obwohl der Raum nur zu etwa zwei Dritteln gefüllt war. Sebastian schätzte, dass rund vierzig bis fünfzig Personen um die nierenförmigen Tische saßen. Einige der Frauen trugen bunte Petticoats, alle davon mit weißen Punkten, die Männer Jeans und T-Shirts zu nach hinten gegelten Haaren.
Die Einrichtung des Raums erinnerte an einen Musikclub, wie er wohl in den fünfziger Jahren ausgesehen haben musste. Im Schachbrettmuster führten schwarze und weiße Fliesen auf eine winzige Bühne, kaum größer als ein Wohnzimmerteppich. Pinkfarbene Neonröhren betonten die Kanten der abgesetzten Decke oberhalb davon und die Konturen der Bartheke links der Treppe. Die Wände schmückten Poster von Rock-’n’-Roll-Größen, in einer Ecke dudelte eine Wurlitzer Musikbox.
Dann entdeckte Sebastian Marga Kronthaler, ihres Zeichens Leiterin des Dezernats T.O.M. und seine direkte Vorgesetzte. Sie saß im hinteren Teil der Bar vor einer Bierflasche. Neben ihr vor einem lebensgroßen Plakat von Bill Haley im karierten Sakko standen zwei freie Barhocker.
Marga sah aus wie immer. Die rotblonden Haare lagen in Wellen auf ihren Schultern. Das eng anliegende dunkelgrüne Shirt betonte ihre schlanke und sportliche Figur, die sie trotz Mitte fünfzig immer noch besaß. Und auch ohne dass Sebastian es von seiner Position aus sehen konnte, wusste er, dass sie eine Röhrenjeans trug. Vermutlich hatte sie überhaupt keine anderen Hosen.
»Jetzt leck mich doch am Arsch«, sagte Marga, als sie vor ihr standen. »Nie hätte ich geglaubt, dass Sie irgendwo zu spät kommen. Ich dachte schon, ich hätte mich im Termin geirrt.«
»Wir wurden … wie soll ich sagen«, druckste Franziska herum, »aufgehalten. Von den Kollegen vom Streifendienst. Herr Franck hat das aber schnell gelöst.«
»Schnell gelöst, soso. Ich will’s gar nicht wissen.« Marga musterte Sebastian mit einem Stirnrunzeln.
»Was sehen Sie mich so an?«, fragte er.
»Sie schauen so anders aus. Haben Sie abgenommen?« Marga klatschte sich mit der flachen Hand an die Stirn. »Jetzt seh ich es erst: keine Krawatte und dann auch noch Jeans.« Sie zog ein breites Grinsen auf. »Ich wusste gar nicht, dass Sie so was besitzen, Herr Franck. Das ist doch eine Jeanshose, oder?«
Sebastian musterte sie mit schief gelegtem Kopf.
»Das war ein Scherz«, sagte Marga, als er nach einer Weile immer noch nicht reagiert hatte.
»Ich weiß.« Er hatte sich schon vor einiger Zeit abgewöhnt, ihre ironischen Bemerkungen zu kommentieren.
»Für gewöhnlich lachen Menschen darüber.«
»Ich bin wohl nicht der Typ dafür.«
»Da wär ich jetzt nie drauf gekommen.« Marga deutete auf die Barhocker neben sich. »Setzt euch. Ich musste schon einer Handvoll jungen, gut aussehenden Männern absagen, die sich neben mich setzen wollten.« Sie pustete sich eine Strähne aus der Stirn. »Und ich dachte bisher, der George-Clooney-Effekt wirkt nur auf Frauen.«
Kaum hatten Franziska und Sebastian Platz genommen, trat schon eine jüngere Frau mit wippendem Pferdeschwanz auf sie zu. Sie hatte ihr weißes Hemd zwischen Brust und Bauchnabel verknotet und schien auch sonst wenig Wert auf vollständige Kleidung zu legen. Da schon an den Schenkeln der Hosentaschenstoff hervorragte, dürften die ultrakurzen Jeansshorts auch kaum über ihre Pobacken reichen.
»Und ihr beiden, was soll ich euch bringen?«, flötete sie, und ihr Augenaufschlag verwirrte Sebastian für einen Moment.
Franziska bestellte einen Energydrink mit Wodka.
»Haben Sie Tee?«, fragte Sebastian. »Einen grünen Tee?«
Die Bedienung runzelte kurz die Stirn und lachte dann auf. »Nein, mein Süßer. Grünen Tee gibt’s bei uns nicht. Aber ich kann dir einen Club-Mate bringen.«
»Club-Mate? Ist das Tee?« Er schaute sich hilfesuchend nach Franziska um.
»Ein bisschen.« Sie verzog das Gesicht. »Man kann sich daran gewöhnen. Mit Wodka schmeckt’s aber lecker.«
Sebastian sah wieder auf. »Dann nehme ich doch lieber ein Glas Mineralwasser. Mit wenig Kohlensäure. Ohne Eiswürfel und ohne Zitrone. Oder doch, ein Spitzer Zitrone ist okay, aber nicht allzu kalt.«
»Nicht allzu kalt?« Die Bedienung musterte ihn. »Der Zitronenspritzer?«
»Nein, das Wasser natürlich.«
»Sonst noch was? Ein Schirmchen im Wasser?«
»Kein Schirmchen. Danke, aber nein.« Sebastian schüttelte den Kopf.
Die Bedienung wandte sich um, schlenderte davon und bestätigte damit auch gleich noch seine Vermutung: Die Shorts waren tatsächlich zu kurz für ihre Pobacken.
»Da ist Atze«, rief Franziska plötzlich aus. »Ich muss da mal hin, Hallo sagen.« Sie rutschte von ihrem Hocker und steuerte schnurstracks auf einen jüngeren Mann mit Hornbrille und hochgestelltem Hemdkragen am gegenüberliegenden Ende der Bartheke zu.
»Was macht die Kunst, Herr Franck?«, fragte Marga eher beiläufig, nachdem Franziska ihren Atze gefunden hatte und mit vollem Körpereinsatz auf ihn einredete.
»Kunst? Meinen Sie damit die Kunst schlechthin, oder war Ihre Frage eher als Redewendung nach meinem Befinden gedacht, wie sie auch Gotthold Ephraim Lessing in seinem Trauerspiel ›Emilia Galotti‹ verwendet hat?«
Marga seufzte. »Himmelarsch, können Sie eine Frage nicht einmal wie jeder andere Mensch beantworten? Ohne dieses saudumme Geschwätz drum herum.«
»Ich habe bereits geahnt, dass Sie sich eher nicht für deutsche Dichtkunst interessieren. Aber Ihre Frage war nun mal zweideutig.«
»Dann versuche ich’s mal unzweideutig: Als Ihre Chefin mache ich mir ernsthaft Sorgen um Sie. Seit Wochen vergraben Sie sich mit Dutzenden Aktenordnern in Ihrem Büro. Cem hat mir erst vor ein paar Tagen erzählt, dass Sie sogar schon dort übernachtet haben.«
»Ich habe bisher nur drei Mal in meinem Büro übernachtet. Und es sind sechsundsiebzig Aktenordner zu drei Fällen, um präzise zu sein.«
»Sapperlot.« Marga nahm einen Schluck von ihrem Bier. »Und warum genau diese drei?«
»Wahrscheinlichkeitsrechnung«, gab Sebastian zurück und hoffte, sich diesmal kurz genug gehalten zu haben.
»Krieg ich das genauer?«
Wie sollte er aus ihr nur schlau werden? »Sie wollten doch, dass ich … wie nannten Sie es gleich noch … auf dieses ›saudumme Geschwätz‹ verzichte.«
Marga verdrehte die Augen. »Herr Franck, eingestellte Ermittlungen wieder aufzunehmen ist aufwendig und teuer. Und es ist kein ›saudummes Geschwätz‹, wenn Sie mir erklären, warum und wofür ich meinen Schädel hinhalten soll.«
»Grund meiner Selektion ist simple Polizeistatistik. Je aktueller ein Fall, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er noch aufgeklärt wird. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen die entsprechenden Aufklärungsquoten nennen.«
Marga schüttelte den Kopf. »Und diese drei Fälle sind die aktuellsten bei uns im Dezernat?«
»Richtig.«
»Wollen Sie alle drei auf einmal angehen?« Auf Margas Stirn bildete sich eine senkrechte Falte. Vielleicht sollte sie ihm besser zuhören.
»Nein, ich habe mich Ende letzter Woche für einen davon entschieden.«
»Und warum genau für diesen? Ist da irgendwas besonders an dem Fall?«
Die Bedienung drängte sich an den Tresen. Mit einem knappen Lächeln stellte sie die Getränke ab und stapfte mit wippendem Pferdeschwanz davon.
Sebastian nahm einen Schluck von seinem Mineralwasser und wartete, bis sie sich außer Hörweite befand. »Es gibt keine Leiche.«
2
»Keine Leiche?«, entfuhr es Marga, und ein unangenehmes Gefühl zerrte an ihr.
Sie griff nach der Bierflasche. Und ahnte bereits, für welche Akten er sich entschieden hatte.
»Ich denke, Sie kennen den Fall«, sagte Sebastian. »Das verschwundene Fildermädchen. So jedenfalls hat die Presse monatelang davon berichtet.«
»Jasmin Leibrand.« Marga schluckte. »Jeder Polizist in Stuttgart kennt diesen Fall. Das war vor …«
»… sechs Jahren und drei Monaten.«
Eine raue, ärgerliche Stimme ganz in der Nähe drängte sich durch das Gewirr der anderen in den Vordergrund.
»Damals gab es einen Beitrag in ›Aktenzeichen XY‹.« Sie ließ die Bierflasche wieder los. »Jasmin war siebzehn, so alt wie Alex. Die beiden kannten sich.« Marga dachte an ihren ältesten Sohn, der inzwischen in Offenburg studierte und dort auch mit seiner Freundin wohnte. »Sie ist nachmittags von der Schule nicht nach Hause gekommen.«
Eine weibliche Stimme versuchte, zu beschwichtigen. Doch sie schien chancenlos. Die raue Stimme wurde nur noch lauter. Und erst jetzt erfasste Marga, dass die von Atze stammte, der am anderen Ende der Bartheke drauf und dran war, mit Franziska einen Streit vom Zaun zu brechen.
»Hatten Sie mit dem Fall zu tun?«
»Nein. Ich war zu der Zeit schon beim Rauschgiftdezernat. Aber wir haben natürlich so einiges mitbekommen.« Vor ihrem geistigen Auge sah Marga die Bilder von Jasmins blutgetränkten Kleidungsstücken, die Tage später in der Nähe des Jägerhauses im Sauhag, einem weitläufigen Waldgebiet auf den Fildern, gefunden wurden. Als dann die Einstiche im T-Shirt eindeutig einem Messer zugeschrieben werden konnten, gingen die Kollegen von einem Tötungsdelikt aus. »Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass ihr Vater sie für tot erklären ließ. Das war vor zwei Jahren oder so. Aber warum liegt der Fall bei uns? Ist das nicht viel zu früh?«
Sebastian schüttelte den Kopf. »Es gibt keine neuen Ermittlungsansätze. Der Täter muss sehr sorgsam vorgegangen sein. Am vermuteten Tatort, dort, wo ihre Kleidung aufgefunden wurde, fehlten konkrete Fremdspuren. Auch dem zeitweiligen Hauptverdächtigen konnte nichts nachgewiesen werden.«
»Berthold Hauer, Jasmins früherer Lehrer.« Nach dem Namen musste sie in ihrer Erinnerung keine Sekunde suchen.
»Richtig. Lehrer für Mathematik und Sport. Geboren am 17. Dezember 1972.«
Natürlich waren auch alle anderen Personen überprüft worden, die irgendwie mit Jasmin in Verbindung gestanden hatten. Bestimmt ein halbes Dutzend Mal. Aber nur gegen Berthold Hauer häuften sich letztlich die Verdachtsmomente, weil er offensichtlich die Finger nicht von ihr hatte lassen können. Männer eben. Auch manche Lehrer dachten wohl nur mit ihrem Schwanz. Als er sich dann noch während eines Verhörs in Widersprüche verstrickt hatte, wurde er für die ermittelnden Beamten zum Hauptverdächtigen. Denn nichts war schlimmer für einen Verdächtigen als Widersprüche in seiner Aussage. Sie kannte das von ihren eigenen Verhören. »Hauer soll ein Verhältnis mit ihr gehabt haben.«
Der Streit zwischen Franziska und Atze gewann an Schärfe. Mittlerweile konnte sich Marga problemlos zusammenreimen, um was es ging. Offenbar hatte Franziska mit einem anderen Mann ein Konzert besucht, und Atze hatte es mitbekommen. Der schien sich jedoch ob Franziskas Konzertbegleitung überhaupt nicht mehr beruhigen zu wollen. Die Augen unter seiner gerunzelten Stirn fixierten sie angriffslustig.
»Damals haben sich alle den Mund über ihn zerrissen. Auch kein Wunder, er hätte fast Jasmins Vater sein können.« Marga konnte sich noch gut an die Zeitungsberichte über Hauer erinnern. »Für die Presse-Seckel war er nicht nur verdächtig, sondern gleich Jasmins Mörder. Noch bevor er überhaupt wusste, wie um ihn geschehen war.«
»Und was glauben Sie?«
»Da gibt es nichts zu glauben.« Marga nahm einen Schluck von ihrem Bier. »Die Tatzeit konnte wegen der Blutrückstände an den Kleidungsstücken auf ein paar Stunden genau bestimmt werden. Und für die Zeit hatte Hauer ein Alibi von Jasmins Freundin … wie hieß die noch gleich?« Bisher hatte Marga gedacht, sie werde die bitteren Details zu diesem Fall nie vergessen können. Doch offenbar hatte hier die Zeit geholfen.
»Pauline Arendt.«
»Pauline Arendt … stimmt.«
Sebastian wiegte mit dem Kopf. »Ich bin mir da nicht mehr so sicher.«
Inzwischen verstand Marga jedes einzelne Wort der beiden Streithähne am anderen Ende der Bartheke, und die Konfrontation steuerte unausweichlich ihrem dramatischen Höhepunkt entgegen. Und der kam rascher, als sie erwartet hatte. Atze sprang von seinem Barhocker auf und eilte im Stechschritt zum Ausgang. Franziska folgte ihm, und im nächsten Moment waren beide auf die Treppe verschwunden. Wenigstens herrschte jetzt wieder etwas Ruhe.
»Mit was sind Sie sich nicht mehr so sicher?« Marga versuchte, in Sebastians Gesicht zu lesen, konnte sich jedoch keinen Reim auf seine Andeutungen machen.
»Mit dem Alibi von Berthold Hauer«, gab der schließlich zurück. »Aus heutiger Perspektive sollten wir es anders bewerten.«
»Aus heutiger Perspektive? Anders bewerten?« Was zum Teufel meinte er damit?
»Ja. Hauer und diese Pauline Arendt haben letztes Jahr geheiratet.«
Marga brauchte einen Moment, um die neuen Informationen aufzunehmen. Sie einzuordnen oder gar zu bewerten, wie Sebastian es ausgedrückt hatte, vermochte sie allerdings nicht. »Das Dezernat elf hat damals eine vierzigköpfige Soko auf den Fall angesetzt und konnte weder Hauer noch jemand anderem was nachweisen. Trotz einiger tausend Hinweise. Und Sie wollen den Fall jetzt wieder aufnehmen, nur weil der damalige Hauptverdächtige geheiratet hat?«
»Ich spreche nicht von einer gewöhnlichen Heirat.« Er reckte das Kinn. »Sondern davon, dass der ehemalige Hauptverdächtige Hauer just die Zeugin ehelicht, die ihn einige Jahre zuvor entlastet hat.«
Langsam lichtete sich der Nebel in ihrem Kopf. »Wollen Sie damit andeuten, dass …?«
»Genau das will ich«, unterbrach Sebastian. »Insofern erscheint es mir angebracht, dass wir darüber nachdenken, ob dieses Alibi wirklich so viel wert ist wie damals gedacht.«
»Ein weniger zuverlässiges Alibi macht Hauer noch lange nicht zu Jasmins Mörder.«
»Aber wieder zu einem Verdächtigen«, gab Sebastian zurück. Er nahm sein Mineralwasserglas zur Hand, betrachtete es mit einem zusammengekniffenen Auge, als wolle er prüfen, ob Schmutz am Glasrand haftete. »Und Verdächtige neigen dazu, die Unwahrheit zu sagen. Ich denke, das ist Grund genug, um uns den Fall näher anzuschauen.«
Marga nickte. Vermutlich hatte Sebastian recht. »Diese Pauline Arendt, hatte die damals schon ein Verhältnis mit Hauer?«
»Das geht aus den Akten nicht hervor. Es gibt nur Gerüchte über ein Verhältnis zum Mordopfer.«
»Und von wem stammen die Aussagen?«
Sebastian stellte sein Glas wieder ab, ohne dass er davon getrunken hatte. »Von zwei damaligen Schülerinnen am Humboldt-Gymnasium. Wollen Sie die Namen?«
»Nein.« Marga schüttelte den Kopf. »Aber bevor wir in dem Fall die Ermittlungen wieder aufnehmen, sollten Sie mit den beiden mal reden. Und am besten auch mit Berthold Hauer.« Sie nahm erneut einen Schluck von ihrem Bier. »Was macht der eigentlich jetzt?«
»Er unterrichtet immer noch am Humboldt-Gymnasium.«
»Was?« Marga glaubte, sich verhört zu haben. »Die haben ihn nicht entlassen?«
»Doch, schon. Aber er hat auf Wiedereinstellung geklagt und recht bekommen.« Sebastian nahm erneut sein Glas in die Hand. Diesmal trank er daraus, anstatt es nur zu betrachten, und stellte es vorsichtig wieder ab.
»Das war ja klar. Die stecken doch alle unter einem Hut.«
Sebastian hob die Augenbrauen. »Decke.«
»Was?«
»Decke. Man steckt unter einer Decke, nicht unter einem Hut. Man kann Dinge unter einen Hut bringen.«
Marga legte den Kopf schief, musterte ihn. »Machen Sie das bei Ihrer Freundin auch?«
Sebastian runzelte die Stirn, sah sie an, als hätte er nicht verstanden. »Was machen?«
»Klugscheißen.«
»Ich habe keine Freundin.«
»Dann wissen Sie ja jetzt, warum.« Marga nahm einen Schluck von ihrem Bier.
Franziska kam zurück, ließ sich auf den Barhocker fallen. Ihrer Miene nach zu urteilen, war der Streit mit Atze so ausgegangen, wie es sich angedeutet hatte.
Marga musterte sie. »Welche Laus ist Ihnen denn über die Leber gelaufen?«
Franziska atmete scharf aus. »Schlechtes Karma. Ganz schlechtes Karma.«
»Schlechtes Karma? Wer?«
»Atze.« Sie deutete mit dem Kinn in Richtung Treppe. »In seiner Gegenwart wird bestimmt sogar die Milch sauer.«
Marga musste lachen. »Beziehungsstress?«
»Könnte man sagen.« Franziska presste die Lippen aufeinander.
Sebastian räusperte sich. »Schluss mit Beziehungsstress. Die Kunst, Konflikte mit Herz zu meistern.«
Marga riss den Kopf herum. Hatte er das wirklich gesagt? Sie sah kurz zu Franziska, die vermutlich genauso ungläubig dreinschaute wie sie selbst, und dann wieder zu Sebastian. Er hatte es tatsächlich gesagt.
»Das ist der Titel eines Buches.« Er hob abwehrend die Hände. »Ich wollte nur helfen.«
»Sie lesen so was?« Marga hatte Mühe, ihre Erheiterung zu verbergen.
»Ich habe es überflogen. Es handelt sich wohl um triviale Ratgeber-Literatur. Aber vermutlich nicht uninteressant für junge Menschen mit Beziehungsproblemen.«
Marga biss sich auf die Zunge, um nicht sofort laut loszulachen.
»Ich habe keine Beziehungsprobleme.« Franziska klang, als wäre der Ratschlag eine persönliche Beleidigung für sie gewesen. »Es ist Atze, der ein Problem hat.«
»Atze?« Sebastian schien tatsächlich den Beziehungsberater spielen zu wollen.
»Ja.« Franziska umfasste ihr Glas, drehte es im Kreis. »Da war vor Kurzem ein Konzert in der Schleyer-Halle.« Sie senkte ihren Blick. »Grabnebelfürsten – das hätte ihm bestimmt auch gefallen. Aber er wollte nicht. Dann bin ich eben mit Fabian hin. Der hatte früher mal Probleme mit Atze, ist jetzt aber voll korrekt drauf.« Sie sah wieder auf. »Ich wäre auch mit Ihnen hingegangen, Chef.«
Sebastian zuckte zusammen, als hätte er einen Schlag bekommen. »Mit mir? Grabnebelfürsten?«
»Was ist mit den Grabnebelfürsten?«
»Nun ja«, druckste Sebastian herum. »Die sind nicht jedermanns Geschmack.«
»Und jetzt wird’s wohl auch nichts mehr mit Wacken nächstes Jahr.« Franziska redete einfach weiter. Offenbar hatte sie seine Antwort überhört.
»Wacken?« Sebastian hielt sich an seinem Glas fest, als könnte er sonst umfallen. Es war zu schön, die Veränderung in seinem Gesicht zu beobachten. Er schien die Luft anzuhalten, seine Augen wurden größer. Offenbar bereute er bereits, sich zu Franziskas Beziehungsstress geäußert zu haben.
»Ja, Wacken«, wiederholte die und zuckte mit den Schultern. »Aber vielleicht geht ja Fabian dann mit. Ich muss ihm gleich noch ’ne WhatsApp schreiben.« Sie nahm ihr Smartphone zur Hand und tippte darauf herum.
Je länger sich Franziska mit ihrem Telefon beschäftigte, desto entspannter wirkte Sebastians Gesichtsausdruck.
»Vielleicht wollten Sie ja mit?«, wandte Marga sich an ihn. »Ich habe gehört, dass es nächstes Jahr mehr Bands geben wird als jemals zuvor. Und vielleicht ist es nicht ganz so versifft wie zuletzt.«
Sebastian schüttelte kaum merklich den Kopf. Es schien, als wolle er Franziskas Aufmerksamkeit nicht noch zusätzlich auf sich lenken. »Sie gehen doch sicherlich noch eine rauchen, bevor es losgeht. Und hier gibt es keine Aschenbecher.«
»Ich hab mich entschlossen, aufzuhören.«
»Und das sagen Sie mit einem Lächeln im Gesicht?«
»Nein, mit einem Nikotinpflaster am Arm.« Marga deutete auf eine Stelle ein paar Zentimeter unterhalb ihrer linken Schulter.
Die Musik aus der Wurlitzer verstummte schlagartig, und ein Tusch erklang, der jeden anderen Laut im Rocktube übertönte. Sofort flogen alle Köpfe Richtung Bühne, auch Marga drehte sich auf ihrem Barhocker um hundertachtzig Grad. Auf der Bühne hinter dem Ständer eines nostalgisch wirkenden verchromten Mikrofons hatte sich ein sandblonder, breitschultriger Hüne mit Monster-Koteletten aufgebaut.
»Good evening, Rocktube«, schrie er in Robin-Williams-Manier ins Mikro, als auch die letzten Stimmen schwiegen.
Applaus brandete auf.
»Das ist Pete, der Inhaber«, rief Franziska gerade so laut, dass sie das Klatschen übertönte.
Mit einem zufriedenen Lächeln ließ Pete seine wasserblauen Augen über das Publikum schweifen. »Wie ihr es von uns gewohnt seid, bieten wir euch auch heute Abend ein ganz besonderes Rock-’n’-Roll-Event.«
Pete machte eine Pause, um den aufkommenden Applaus nicht übertönen zu müssen. »Viele kennen unseren heutigen Star schon von verschiedenen Werbeveranstaltungen, und wer ihn noch nicht kennt, wird ihn nach heute Abend nicht mehr vergessen. Wir haben ihn exklusiv für euch hierhergebracht.« Er deutete zu dem dunklen Vorhang hinter sich. »Und nun Bühne frei für den türkischen Elvis: Cem Akay.«
Erneut erklang ein Tusch, der Vorhang bewegte sich, und im nächsten Moment trat, mit einer Akustikgitarre in der Hand, ein kleiner, eher rundlicher Mann auf die Bühne. Trotz Plateauschuhen und perfekt modellierter Elvis-Perücke auf seinem Kopf überragte ihn Pete deutlich. Das weiße Schlaghosen-Kostüm mit Stehkragen und den Dutzenden sternförmiger Nieten wirkte wie direkt aus Las Vegas importiert, schien jedoch ziemlich knapp um die Taille zu sein. Womöglich war es aus diesem Grund auch nur bis zur Brust zugeknöpft. Die Fülle jedoch, die dort an Haaren spross, würde Dieter Thomas Kuhn mit seinem Brusthaar-Toupet vor Neid erblassen lassen.
Franziska kicherte hinter vorgehaltener Hand. »Cem sieht tatsächlich aus wie Elvis.«
Marga seufzte. »Eher wie Elvis im Endstadium und zwei Köpfe kleiner.« Hoffentlich brachte der seinen Auftritt hinter sich, ohne dass es peinlich wurde.
»Hallo, Rocktube.« Cem alias Elvis Presley wirkte wider Erwarten nicht nervös, sondern grinste lässig ins Publikum. In dem ungewohnt glatt rasierten Gesicht wirkte sein Grinsen ganz besonders strahlend. Pete gab seinen Platz frei, und als die Bühne schließlich ganz Cem gehörte, lehnte der seine Gitarre an die rückwärtige Wand, kam zurück und umfasste den Mikrofonständer mit einer Hand. Dann presste er die Knie zusammen, kippte nach vorne auf die Zehenspitzen und zeigte mit dem freien Arm ins Publikum. Wie zur Salzsäule erstarrt, hielt er so einige Augenblicke inne.
»You ain’t nothin’ but a hound dog«, intonierte Cem im typisch röhrigen Elvis-Timbre. Playback-Musik setzte ein, schallte durch den Kellerraum. »Cryin’ all the time.« Er sang weiter, ließ mit gespreizten Beinen die Hüften kreisen und bewegte sich dabei, als bestünden seine Gelenke nur aus Gummi. Ein ungewohntes Bild. Bisher dachte Marga, dass sie mit dem Kriminalkommissar Cem Akay eher an einen Mitarbeiter der langsameren Sorte geraten war. Wie man sich doch täuschen konnte.
Die Zuschauer pfiffen und johlten. Applaus brandete auf und steigerte sich während seiner Darbietung weiter.
Nachdem Cem »Hound Dog« beendet hatte, griff er nach seiner Gitarre und legte sie um. Als der Applaus sich schließlich gelegt hatte, trat er näher ans Mikro, schaute in die Runde. »Der nächste Song wird was ganz Spezielles. Elvis sang ihn als ›Don’t Be Cruel‹. Hört genau zu.«
Ein weiteres Mal machte Cem eine Handbewegung, die Musik begann erneut, und sogleich zupfte er die Akkorde auf seiner Gitarre mit. Kurze Zeit später setzte sein Gesang ein. Doch irgendwas daran kam Marga fremd vor. Es war nicht der Rhythmus, und es war auch nicht die Stimme, die beeindruckend authentisch klang. Sie brauchte einige Zeit, um zu erkennen, dass es sich nicht um den Originaltext handelte, sondern um Cems Interpretation von »Don’t Be Cruel« – und zwar in türkischer Sprache.
Inzwischen standen einige der Zuschauer vor ihren Stühlen, wippten und klatschten im Takt. Mit Ausnahme von Sebastian, der Cem kritisch beäugte, schien allen die Show zu gefallen. Cem war meilenweit davon entfernt, sich zu blamieren. Nie im Leben hätte Marga gedacht, dass ihr sonst so behäbiger Mitarbeiter sich derart leichtfüßig bewegen, derart gut singen konnte. Auch auf Türkisch hörte es sich tatsächlich an wie Elvis’ stammelnder Singstil. Doch noch beeindruckender als seine Stimme war seine Verkleidung, sein Auftreten. Wenn Marga nicht wüsste, dass da vorne auf der Bühne ihr Mitarbeiter Cem stand, hätte sie ihn wohl kaum erkannt.
Es war immer wieder erstaunlich, was mit einer Verkleidung möglich war. Durch Cems Kostüm und seine Perücke konnte sich wohl keiner der Zuschauer vorstellen, dass es sich bei ihm um einen Kriminalpolizisten handelte, der hier lediglich seinem Hobby nachging.
Mit diesem Gedanken nahm in Margas Kopf eine Idee Gestalt an. Und als sie länger darüber nachdachte, ging diese Idee allmählich in einen Plan über. Das Beste jedoch war, dass sie so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen konnte. Genauer gesagt, zwei Fälle: Zum einen den Fildermädchen-Fall, und da Sebastian ihrem Plan nach eine Zeit lang nicht im Büro sein würde, konnte sie sich endlich den Fall um den Mord an seinem Bruder Daniel genauer anschauen. Noch wusste er nicht, dass seit einigen Tagen die Ermittlungsakten aus Hannover in ihrem Schreibtisch lagen. Jetzt musste sie nur noch Sebastian dazu kriegen, mitzuspielen. Und sie wusste auch schon, wie.
3
Wer die Stuttgarter Bernhardstraße mit ihren mächtigen alten Laubbäumen stadtauswärts ging, wähnte sich in einer vornehmen Wohngegend. Nur wer genau hinsah, würde neben der doppelflügeligen Eingangstür des Gebäudes mit der Nummer 22 das weiße Schild mit dem baden-württembergischen Landeswappen sowie der Bezeichnung »Landeskriminalamt Außenstelle B5« bemerken. Im zweiten Stock der durch einen Pförtner und eine Schleuse gesicherten Jugendstilvilla befand sich die Dienststelle des neu geschaffenen Dezernats T.O.M. – »Tote ohne Mörder«. Ein recht hochtrabender Name für vier Mitarbeiter, drei Büroräume und Dutzende Kilometer Akten, die niemand mehr haben wollte.
Von ihrem Bürofenster aus konnte Marga die alten knorrigen Laubbäume sehen, die die Straße säumten. An diesem Morgen jedoch hatte sie dafür keinen Blick. Noch am Abend zuvor, nachdem sie von Cems Auftritt nach Hause gekommen war, hatte sie die alten Elternbriefe ihres Sohnes ausgegraben und Elenora Steinhoffs Telefonnummer gewählt. Alex’ ehemalige Klassenlehrerin besetzte mittlerweile die Direktorenstelle am Humboldt-Gymnasium und war somit die erste Anlaufstelle, um ihren Plan auf den Weg zu bringen. Und wie erhofft hatte Marga sie dazu bewegen können, gleich heute Morgen in der Bernhardstraße 22 vorbeizukommen. Vermutlich ging es Steinhoff wie allen anderen, die die Mauern dieser Schule jemals betreten hatten. Auch noch nach über sechs Jahren ließ Jasmins ungeklärter Todesfall Lehrer, Eltern und Schüler nicht zur Ruhe kommen. Es war wie eine offene Wunde, die nie zu heilen schien.
Marga kniff die Augen zusammen. Das quietschbunte Ziffernblatt der Wanduhr über der Tür zeigte zwanzig Minuten nach sieben. Somit blieb ihr noch eine gute halbe Stunde bis zum Termin mit Elenora Steinhoff. Sie wandte sich um, schaute hinunter zum Parkplatz. Sebastians protziger Sportwagen fehlte. Und solange der nicht im Büro war, konnte sie die Zeit für etwas nutzen, bei dem sie ihn keinesfalls in ihrer Nähe haben wollte.
Marga schloss die unterste Schublade ihres Schreibtisches auf, in der sie weit hinten die katalogdicke, grellgelbe Aktenmappe mehr versteckt denn verstaut hatte. Sie kramte danach. Eine giftgrüne Eckstein-Zigarettenschachtel rutschte aus den Tiefen der Schublade in ihr Sichtfeld, und zwar genau neben das Einwegfeuerzeug, das sie als Ersatz aufbewahrte. Sie seufzte, sah zu ihrem linken Oberarm mit dem Nikotinpflaster, dann wieder auf die Zigarettenpackung. Ihr Herzschlag beschleunigte sich. Es war schon verdammt schwierig, mit dem Rauchen aufzuhören – zu schwierig.
Sie riss die Packung auf, nahm das Feuerzeug in die Hand und Sekunden später einen tiefen Zug von der filterlosen Zigarette. Mit einem leichten Brennen schlug der Rauch gegen ihre Kehle. Dennoch schmeckte die Zigarette, und beim nächsten Zug spürte sie bereits den Nikotin-Kick im Kopf. Sie zog noch einige Male genussvoll und schaute dem Rauch nach, wie er sich an der Zimmerdecke auflöste. Leichter Schwindel setzte ein. Erst jetzt bemerkte sie, dass sie nur noch eine Kippe in der Hand hielt. Sie drückte sie schnell im Aschenbecher aus. Vielleicht hätte sie doch etwas langsamer rauchen sollen. Zu spät. Mit einem schlechten Gewissen förderte sie die gelbe Aktenmappe aus der Schublade auf den Schreibtisch.
»Raub mit Todesfolge«, verkündete der Titel und darunter in kleineren Buchstaben: »Stadtsparkasse Hannover, 10. September 2010«. In der Mitte prangte ein goldener Polizeistern mit dem weißen Sachsenross, dem Landeswappen Niedersachsens. Obwohl es sich um die Hauptakte mit Auszügen der Spurenakte handelte, war der Umfang nicht gerade üppig.
Marga löste die Gummizüge an den Ecken und klappte den Aktendeckel auf. Gleich auf der Innenseite, befestigt mit einer Büroklammer, hing das Bild eines Mannes Mitte zwanzig. Das also war Daniel Franck. Äußerlich hatte er nicht viel mit seinem Bruder Sebastian gemein. Im Gegensatz zu dessen beinahe hageren Gesichtszügen waren Daniels eher weich und offen. In Verbindung mit dem lockigen schwarzen Haar und den schelmisch dreinblickenden braunen Augen war er gewiss der Schwarm vieler Frauen gewesen.
Sie überflog den Bericht der Einsatzleitung. Danach hatte an jenem Freitagabend kurz vor sechzehn Uhr jemand den stillen Alarm im Polizeipräsidium Hannover ausgelöst. Sofort wurden Rettungswagen und ein Spezialeinsatzkommando angefordert sowie vier Streifenwagen in Bewegung gesetzt. Als diese jedoch achtzehn Minuten später die Filiale der Stadtsparkasse in der Magdeburger Straße erreichten, waren die Täter bereits flüchtig. Die Beamten konnten gefahrlos die Schalterhalle betreten, wo sie sechs Personen auf dem Boden sitzend und mit Kabelbindern gefesselt vorfanden. Rücklings vor einem Schalter lag ein männlicher lebloser Körper.
Daniel Franck. Scharf sog Marga die Luft ein, schloss für einen Moment die Augen. Mit einer neuen Zigarette in der Hand las sie schließlich weiter.
Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes am Boden feststellen. Von den überlebenden Personen war einer leicht im Gesicht verletzt, die anderen körperlich unversehrt, jedoch kaum ansprechbar. Alle sechs standen unter Schock. Lediglich der Filialleiter sowie einer der Kunden konnten zu dem Zeitpunkt angeben, dass es sich um drei mit Tiermasken vermummte Täter gehandelt hatte. Die sogleich ausgelöste Großfahndung blieb trotz vollständiger Abriegelung der Umgebung erfolglos.
Marga erschrak, als es plötzlich an ihrer Tür klopfte. Sie sah erneut zur Uhr. Fünf Minuten nach acht. Verdammt, sie hatte tatsächlich die Zeit vergessen. Schnell drückte sie die Zigarette aus, öffnete das Fenster hinter ihrem Schreibtisch und deponierte den Aschenbecher auf dem Sims.
»Ja.« Marga klappte den Aktendeckel zu und steckte die Mappe zurück in die Schublade.
Im Schlepptau von Franziska trat Elenora Steinhoff durch die Tür. Obwohl die deutlich jünger war als Marga, schien sie seit dem letzten Elternabend um Jahrzehnte gealtert. Steinhoff wirkte bereits jetzt wie eine pensionierte Lehrerin. Die angegrauten Haare endeten in einem kurzen Pferdeschwanz, ihre wässrigen Augen verschwanden halb unter dem Pony, halb hinter einer Janis-Joplin-Nickelbrille. Getreu dem Motto »Dem Alter haben sich alle zu stellen« konnte natürlich jeder zu seinen grauen Haaren stehen, auch mit Anfang vierzig. Aber aus welchem moralischen Anspruch heraus Steinhoff auf jede Form von Make-up verzichtete, erschloss sich Marga beim besten Willen nicht. Ein bisschen Puder, etwas Lidschatten sowie Wimperntusche, und sie würde trotz ihrer geschlechtsneutralen Kleidung aus beigefarbener Hose und einem Oberteil aus Sofakissenstoff um Jahre jünger wirken.
»Guten Morgen, Frau Steinhoff«, begrüßte Marga sie und kam um den Schreibtisch herum.
Steinhoff erwiderte den Gruß, blickte auf die Hand, die sie ihr entgegenhielt, und schüttelte sie schließlich.
»Nehmen Sie doch bitte Platz.« Marga deutete auf die beiden Stühle vor ihrem Schreibtisch.
Steinhoff betrachtete die Stühle, als wollte sie sichergehen, dass die nicht zusammenbrachen, sobald sie sich daraufsetzte. Einen Moment später hatte sie sich endlich dazu durchgerungen und ließ sich vorsichtig auf einem nieder.
»Können Sie sich noch an mich erinnern, Frau Steinhoff?«, begann Marga, als Franziska die Bürotür geschlossen hatte und sie wieder hinter ihrem Schreibtisch saß.
»Ich weiß nicht.« Steinhoff kniff die Augen zusammen. »Aber bei Tausenden Eltern und Schülern, denen ich bereits begegnet bin, sollten Sie das nicht überbewerten.« Ihre Stimme klang, wie sie aussah: ausdruckslos.
»Alexander Kronthaler. Das ist mein Sohn. Sie waren vor einigen Jahren seine Klassenlehrerin.«
Die Stirn oder der Teil, der unter Steinhoffs Pony noch zu sehen war, kräuselte sich. Offenbar durchforstete sie dahinter ihr geistiges Namensregister. Einen Augenblick später hellte sich ihr Gesicht auf. »Alexander, natürlich.« Ein dünnes Lächeln legte sich um ihre Lippen. »Ein aufgeschlossener Junge und trotzdem ziemlich ruhig. Das ist selten heutzutage. Er müsste jetzt so Anfang zwanzig sein.«
»Alex ist Jahrgang dreiundneunzig, nächsten Monat wird er vierundzwanzig.«
»Wie die Zeit vergeht. Und was macht er jetzt?«
»Er studiert Maschinenbau in Offenburg.«
»Ah.« Steinhoff hob den Kopf. Allmählich verlor sich ihre Reserviertheit. »Das passt zu ihm. Er war immer so gut in Mathematik. Und Physik hatte er als Leistungskurs, soweit ich mich noch erinnern kann.«
»Stimmt.« Marga musste für einen Moment an Alex’ Abiturzeugnis denken: Mathe, Physik und Chemie vierzehn oder fünfzehn Punkte, alles andere nur einstellig. Und zum Entsetzen seines Vaters, des angehenden Künstlers, nur vier Punkte in Bildender Kunst.
Steinhoff räusperte sich. »Ich habe nicht viel Zeit, Frau Kronthaler. Gestern Abend am Telefon sagten Sie, es gäbe neue Hinweise zu Jasmins Tod.«
»Genau … und zwar …« Marga brach ab, musste sich die Worte zuerst zurechtlegen.
»Was für Hinweise?«
Inzwischen hatte Marga den richtigen Einstieg gefunden und wiederholte Sebastians Formulierung vom Vorabend: »Wir müssen die Bewertung eines Alibis neu überdenken.«
»Wessen Alibi?« Steinhoffs Augen hinter den Brillengläsern blitzten für einen Moment auf.
»Tut mir leid. Aber ich kann den Ermittlungen in diesem frühen Stadium nicht vorgreifen.«
»Ermittlungen? Frühes Stadium? Ich dachte, die wurden eingestellt.«
»Wir werden sie aller Voraussicht nach wieder aufnehmen. Zuerst sind das natürlich nur Vorermittlungen.«
»Vorermittlungen wegen der Neubewertung eines Alibis?« Unter Steinhoffs Pony schien es zu arbeiten. »Dann kann es sich nur um das von Herrn Hauer handeln.«
Marga nickte. Damit hätte sie rechnen müssen. Es war sinnlos, diese Information zurückzuhalten. Schließlich gab es nur ein Alibi, das fallrelevant war. Sie entschied, vorerst nicht weiter darauf einzugehen. »Soviel ich weiß, sind einige der Lehrer von damals noch am Humboldt-Gymnasium. Auch der Herr Hauer.«
»Da haben Sie nicht unrecht. Aber seither hat jeder von uns mit Dutzenden Polizisten gesprochen. Was soll da nach sechs Jahren noch rauskommen?«
Der entscheidende Teil des Gesprächs stand bevor. Marga bemühte sich um einen sachlichen Tonfall. »Wir werden die Vorermittlungen nicht, wie soll ich sagen … konventionell durchführen.«
»Nicht konventionell durchführen?«, echote Steinhoff. »Was soll das heißen?«
»Keine sichtbare Polizei vor Ort, keine Befragungen, keine traditionelle Ermittlungsarbeit«, beeilte sich Marga zu sagen. »Und deshalb habe ich Sie angerufen.«
»Ich bin mir sehr wohl bewusst, was das Wort ›konventionell‹ bedeutet.« Ihr Tonfall klang jetzt fast schnippisch. »Dennoch weiß ich nicht, wie ich Ihnen dabei helfen kann.«
»Frau Steinhoff, wie sieht es auf Ihrer Schule mit Deutschlehrern aus?«
»Ich fürchte, ich verstehe nicht.« Steinhoff rutschte auf ihrem Stuhl nach vorne. »Was haben die Deutschlehrer des Humboldt-Gymnasiums mit Jasmins Tod zu tun?«
Marga entschloss sich zum Frontalangriff. »Wir wollen in Ihrem Gymnasium einen verdeckten Ermittler als Lehrer oder Aushilfslehrer für Deutsch einschleusen.«
Steinhoff blinzelte. Einmal, zweimal, dreimal. »Einen Polizisten als Deutschlehrer? Dazu ist das Studium ›Lehramt an Gymnasien‹ notwendig. Und das hat eine Regelstudienzeit von zehn Semestern.« Sie schüttelte den Kopf, schien nicht mehr damit aufhören zu wollen. »Das kann nicht gut gehen.«
»Sie kennen unseren Herrn Franck nicht. Er hat Literatur studiert und …« Marga brach ab. Mehr musste Steinhoff nicht über Sebastian wissen.
Die sah auf. »Sie meinen bestimmt Germanistik? Wo denn?«
Marga kramte in ihren Erinnerungen und fand tatsächlich den Namen der Universität. »Georg-August-Universität Göttingen.«
»Das trifft sich gut. Dort habe ich auch studiert. Wie alt ist denn der Herr Franck?«
»Mitte dreißig«, gab Marga zurück und war sich plötzlich unsicher, ob sie nicht besser Sebastians Studienabbruch hätte erwähnen sollen. »Herr Franck ist der Sprössling eines angesehenen Hannoveraner Kunstgaleristen, sehr geistreich und beredt.« Und ein Klugscheißer, dachte sie, sagte dann aber: »Ich denke, es gibt kaum ein Gebiet, in dem er sich nicht auskennt.«
»Oh. Solche Menschen liebe ich.« Wieder folgte ein dünnes Lächeln.
Das hätte Steinhoff nicht extra sagen müssen. Die Seelenverwandtschaft der beiden war nur schwer zu übersehen. »Schön. Dann helfen Sie uns dabei? Sie dürfen allerdings mit keinem Menschen darüber reden.«
»Ich weiß nicht.« Sie wiegte mit dem Kopf. »Eigentlich sind alle unsere Planstellen derzeit besetzt.«
Marga spürte, dass sie Steinhoff fast so weit hatte. »Ihnen liegt doch auch die Aufklärung dieses Mordes am Herzen.«
»Natürlich. Aber …«
»Und mit den Planstellen wird Ihnen bestimmt noch etwas einfallen.«
»Ich könnte …« Steinhoff sah an Marga vorbei, hinaus zum offenen Fenster. »Ja das würde vielleicht gehen«, sagte sie und ließ schließlich das erlösende Nicken folgen.
***
Als Sebastian irgendwann nach halb neun seinen Arbeitsplatz aufsuchen wollte, kam ihm auf der Treppe eine Frau undefinierbaren Alters entgegen, die er noch nie im LKA-Gebäude gesehen hatte. Ihr Gesicht verschwand zur Hälfte unter einem angegrauten Pony und einer Nickelbrille.
»Guten Morgen«, grüßte Sebastian.
»Morgen«, war ihre knappe Antwort. Obwohl die Frau es eilig zu haben schien, blieb ihr Blick beim Vorbeigehen einen Moment länger an Sebastian hängen als notwendig.
Schon auf dem Gang hörte Sebastian sein Telefon im Büro klingeln. Er beschleunigte seinen Schritt, riss die Tür auf und nahm das Telefon ab. »KOK Franck.«
»Kronthaler«, drang Margas Stimme aus dem Hörer. »Ich habe Sie gerade auf den Parkplatz fahren sehen. Kommen Sie kurz bei mir vorbei?«
»Gleich?«
»Klang das, als ob ich es anders gemeint haben könnte?«
So früh am Morgen wollte Sebastian sich nicht auf eine Diskussion mit ihr einlassen. Er legte auf, marschierte über den Gang zu Margas Büro und trat ein, ohne anzuklopfen.
»Morgen, Frau Kronthaler.« Sebastian sah sich um, sog ein paarmal Luft durch die Nase ein. »Hier riecht’s nach Rauch. Haben Sie geraucht?«
»Nicht wirklich.« Ihre Antwort klang nur wenig nach der Wahrheit.
Sebastian reckte den Kopf, spähte hinaus durch die geöffneten Fensterflügel. »Ich kann von hier aus den Aschenbecher draußen auf dem Fenstersims sehen. Da sind zwei Kippen drin.«
»Mein lieber Scholli. Haben Sie auch richtig gezählt?«
Sebastian verkniff sich eine Antwort.
»Dann hab ich wohl doch mehr geraucht als gedacht.« Marga zog eine alberne Grimasse.
»Tragen Sie diese Nikotinpflaster noch?«
Margas Blick wanderte zu ihrem Oberarm. Sie nickte.
»Und trotzdem rauchen Sie?«
»Diese Pflaster wirken bei mir nicht. Meine Haut ist wohl zu dick.«