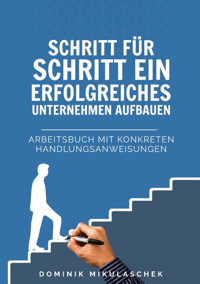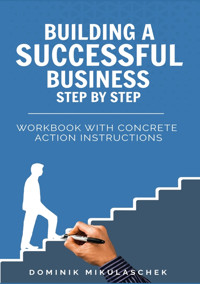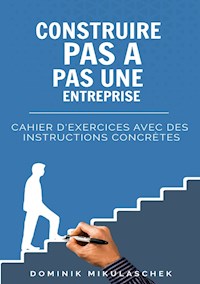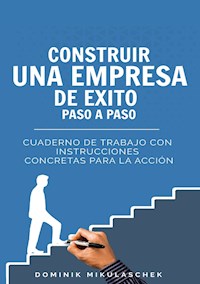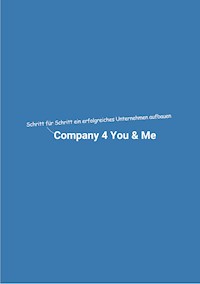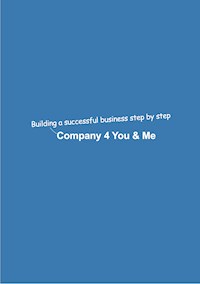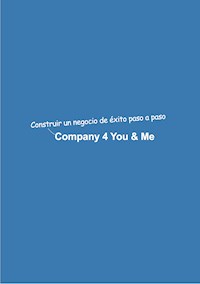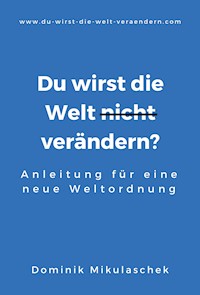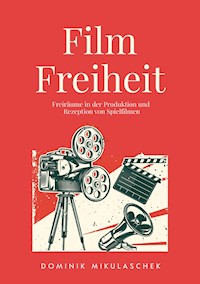
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch werden die Gestaltungsmöglichkeiten des einzelnen Bildes bis hin zu einer komplexen Filmsprache erörtert, der Gebrauch hinsichtlich unterschiedlicher Erzählstile bzw. dem Anspruch des Erzählten und ihrer letztendlichen Aufnahme durch den Rezipienten. Im Weiteren werden die Möglichkeiten untersucht, sich filmisch auszudrücken und die Produktion und Rezeption von zwei unterschiedlichen Spielfilmen analysiert. Das Buch beschränkt sich hier hinsichtlich der Analyse auf das Hollywood-Kino und die damalige Nouvelle Vague. Es werden hier die beiden Filme »Ausser Atem« von Jean-Luc Godard und »Der Weisse Hai« von Steven Spielberg analysiert und gegenübergestellt. Die beiden Filme werden aus zwei Blickwinkeln betrachtet, aus der Sicht der Produktion, welche Regeln und letztendlich Freiheiten hat man im Allgemeinen einen Spielfilm zu gestalten und zum anderen, welche Folgen diese Anwendungen von Regeln und Freiheiten schließlich für die Rezeption haben. Weiteres soll das Buch darüber Aufschluss geben, welche Überlegungen hinsichtlich der Produktion getroffen werden können, Spielfilme so zu gestalten, dass diese von einem breiten Publikum ohne Probleme möglichst gut verstanden werden und weshalb es auf der anderen Seite so schwierig ist, Nouvelle Vague Filme einem breiten Publikum schmackhaft zu machen und sich in der Filmgeschichte kommerziell nicht durchgesetzt haben. Im Weiteren wird erörtert, wie man das Verständnis für Nouvelle Vague Filme erweitern kann, indem man sich verschiedene Codes der Filmsprache erlernt und bewusst macht und wie man als Filmemacher und Rezipient durch dieses Wissen ein Mehr an Freiheit erlangt hinsichtlich der Produktionsmöglichkeiten und der Rezeption dieser Filme.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mag. Dominik Mikulaschek, geboren 1983, studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaften in Wien und lebt als Autor und Unternehmer in Linz.
In diesem Buch werden die Gestaltungsmöglichkeiten des einzelnen Bildes bis hin zu einer komplexen Filmsprache erörtert, der Gebrauch hinsichtlich unterschiedlicher Erzählstile bzw. dem Anspruch des Erzählten und ihrer letztendlichen Aufnahme durch den Rezipienten. Im Weiteren werden die Möglichkeiten untersucht, sich filmisch auszudrücken und die Produktion und Rezeption von zwei unterschiedlichen Spielfilmen analysiert. Das Buch beschränkt sich hier hinsichtlich der Analyse auf das Hollywood-Kino und die damalige Nouvelle Vague. Es werden hier die beiden Filme »Ausser Atem« von Jean-Luc Godard und »Der Weisse Hai« von Steven Spielberg analysiert und gegenübergestellt. Die beiden Filme werden aus zwei Blickwinkeln betrachtet, aus der Sicht der Produktion, welche Regeln und letztendlich Freiheiten hat man im Allgemeinen einen Spielfilm zu gestalten und zum anderen, welche Folgen diese Anwendungen von Regeln und Freiheiten schließlich für die Rezeption haben. Weiteres soll das Buch darüber Aufschluss geben, welche Überlegungen hinsichtlich der Produktion getroffen werden können, Spielfilme so zu gestalten, dass diese von einem breiten Publikum ohne Probleme möglichst gut verstanden werden und weshalb es auf der anderen Seite so schwierig ist, Nouvelle Vague Filme einem breiten Publikum schmackhaft zu machen und sich in der Filmgeschichte kommerziell nicht durchgesetzt haben. Im Weiteren wird erörtert, wie man das Verständnis für Nouvelle Vague Filme erweitern kann, indem man sich verschiedene Codes der Filmsprache erlernt und bewusst macht und wie man als Filmemacher und Rezipient durch dieses Wissen ein Mehr an Freiheit erlangt hinsichtlich der Produktionsmöglichkeiten und der Rezeption dieser Filme.
Mag. Dominik Mikulaschek
Filmfreiheit
Freiräume in der Produktion und Rezeption von Spielfilmen
tredition GmbH
© 2023 Dominik Mikulaschek
ISBN Softcover: 978-3-347-87265-3
ISBN Hardcover: 978-3-347-87267-7
ISBN E-Book: 978-3-347-87286-8
ISBN Großschrift: 978-3-347-87288-2
Druck und Distribution im Auftrag des Autors: tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
1.) Einleitung
2.) Die Basis
2.1.) Das einzelne Bild
2.2.) Die Aneinanderreihung einzelner Bilder → Das bewegte Bild
2.3.) Die Montage → Die Entstehung einer neuen Kunst
2.4.) Erzählen → Film
2.5.) Erzählen in der Literatur → Film verstehen
2.6.) Erzählen im Film
3.) 2-Extreme ↔ Filme machen
3.1.) Konventionelles Erzählen → Hollywood erzählt
3.2.) Alternatives Erzählen?
3.3.) Aristoteles Vs. Bertold Brecht → Hollywood Vs. Nouvelle Vague → Steven Spielberg Vs. Jean-Luc Godard → Konventionell Vs. Alternative
3.4.) Aristoteles → Hollywoodkino → Steven Spielberg → Der Weiße Hai
3.5.) Bertold Brecht → Nouvelle Vague → Jean-Luc Godard → Ausser Atem
3.6.) Die wesentlichen praktischen Unterschiede: Nouvelle Vague ±? Hollywood
4.) 2-Extreme ↔ Filme rezipieren
4.1.) Der Rezipient entscheidet?
4.2.) Der Rezipient ↔ Der Weiße Hai/Ausser Atem
5.) Die mögliche Freiheit
5.1.) Der möglichst freie Rezipient
5.2.) Der möglichst freie Künstler
5.3.) Kunst?
5.4.) Der möglichst freie Rezipient → Der möglichst freie Künstler → Der möglichst freie Mensch
5.5.) Ein möglichst freier Mensch
6.) Anhang
6.1.) Bibliographie
6.2.) Filmographie
6.3.) Internet
6.4.) Bilder
1) Einleitung
Die Freiheit, ein Wort, das eine unfassbare Größe in sich beinhaltet, aber im selben Moment das Gegenteil - die Unfreiheit. Der Mensch hat im Laufe seiner Entwicklung verschiedenste Systeme entwickelt. So gibt es sie z.B. für die Politik, die Wirtschaft, die Wissenschaft und was manche anders vermuten würden, auch für die Kunst. Selbst dieses Buch, das ich schreibe, ist mit einem gewissen Regelwerk behaftet. Am Ende des Tages nützen die meisten von uns, ohne darüber nachzudenken, tagtäglich Systeme und Regelwerke, doch die wenigsten von uns bauen diese Systeme und Regelwerke auf, weshalb den meisten Personen dafür das Verständnis fehlt. Auch beim Thema Spielfilm gibt es Systeme und Regelwerke, die man nützen kann, aber nicht nützen muss. „Der Mensch ist furchtsam und voller Entschuldigungen; er ist nicht länger aufrecht; er wagt nicht zu sagen »Ich denke«, »Ich bin«, sondern zitiert irgendeinen Heiligen oder Weisen.“1 Dieser Verunsicherung bin ich auch sehr oft in meinem Studium der Theater-, Film- und Medienwissenschaften begegnet bzw. bei meinen eigenen Filmprojekten. Wie funktioniert das, einen Film zu machen? Wie erzählt man eine Geschichte im Film, wie muss man filmen, worauf muss man achten, ….. Die Verunsicherung steht im Vordergrund, die andauernde Selbstanklage, die Angst vor Misserfolg, etwas „Falsches“ zu machen, der andauernde Vergleich mit Anderen, ….. „Man vermeidet vom Inhalt zu reden. Man redet nur von der Form, von einer Form, die im Übrigen keine wirkliche Form mehr ist. Ich verstehe nicht, warum man so einen Wirbel um das Ganze macht.“2
Das schafft meines Erachtens unfreie Künstler, aber auch unfreie Rezipienten. Die Frage, die mich vor allem beschäftigt: „Wie werde ich ein möglichst freier Filmemacher, ein freier Künstler und letztendlich freier Mensch, nütze diese Systeme und Regelwerke des Films und schaffe mir im selben Moment die Möglichkeit die verlangten Konventionen zu brechen, um am Ende des Tages eine eigene unverkennbare Handschrift zu entwickeln?“ „Film ist eine Darstellung der Welt.“3 Die zweite wesentliche Frage dieser Arbeit soll die kognitiven Gewohnheiten des Rezipienten untersuchen. Wie reagiert dieser auf diese mögliche Freiheit bzw. konventionelle Filme. Ist es möglich, einen freien Rezipienten zu begegnen? Was sind die wesentlichen Probleme, die einen freien Rezipienten verhindern? „Halbwissen. - Der, welcher eine fremde Sprache wenig spricht, hat mehr Freude daran als der, welcher sie gut spricht. Das Vergnügen ist bei den Halbwissenden.“4? „Bei Kunstwerken oder Objekten müsste man eigentlich sagen: »Es geht um die Ausstrahlung«. Eine Fernsehserie wird nur produziert, um ausgestrahlt zu werden.“5! All diese Fragen werde ich im Laufe dieser Arbeit stellen und erörtern. Um diese Brücken darzustellen, werde ich meine Überlegungen zur Sprache des Films vom kleinsten Element an, das einzelne Bild bis hin zu einer komplexen Sprache, ihren Gebrauch hinsichtlich unterschiedlicher Erzählstile bzw. der Anspruch des Erzählten und ihrer letztendlichen Aufnahme durch den Rezipienten darstellen. Weiteres werde ich meine Auffassung über den Gebrauch von Kunst darlegen und einen Begriff eines freien Rezipienten, Künstlers und Menschen schmieden. Als praktisches Analysefeld habe ich die zwei Filme Jean-Luc Godards »Ausser Atem« und Steven Spielbergs »Der Weiße Hai« ausgewählt. Mittels einer Analyse beider Filme werde ich meine theoretischen Darlegungen veranschaulichen.
1… Emerson: Selbstvertrauen, in: M.Werle, Josef [Hrsg.]: Klassiker der philosophischen Lebenskunst: Von der Antike bis zur Gegenwart. München: Wilhelm Goldmann Verlag. 2000. S. 479.
2… Godard, Jean-Luc: Das Gesagte kommt vom Gesehenen: drei Gespräche 2000 / 2001 /. Bern [u.a.]: Gachnang & Springer. 2002 . S.38.
3… Ebd. S.21.
4… Nietzsche: Der Mensch mit sich alleine, in: M.Werle, Josef [Hrsg.]: Klassiker der philosophischen Lebenskunst: Von der Antike bis zur Gegenwart. München: Wilhelm Goldmann Verlag. 2000. S. 508.
5… Godard, Jean-Luc: Das Gesagte kommt vom Gesehenen: drei Gespräche 2000 / 2001 /. Bern [u.a.]: Gachnang & Springer. 2002. S. 66.
2.) Die Basis
2.1.) Das einzelne Bild
Wo beginnt und hört ein Bild auf? Rein von seiner physischen Beschaffenheit ist ein Bild durch seine Umrandung, den Bildrand begrenzt. Das, was sich innerhalb dieses Randes befindet, ist der Inhalt des Bildes. Der Filmemacher begrenzt die von ihm vorgefundene Welt mit einem Objektiv, das ihm ein gewisses Aufnahmeformat erlaubt. Es ist ein Ausschnitt, der von ihm vorgefundenen Welt. Das einzelne Bild ist somit der Grundstein des Films. In jedem Film finden wir verschiedenste Darstellungen. Jedes Bild, egal was es zeigt, wird über unsere Augen wahrgenommen und ein innerlicher Dialog beginnt. Man nimmt es auf der Verstandesebene und der Gefühlsebene wahr. Nimmt man nun die reinste Form eines Bildes, das weiße Bild zur Hand. Der Projektor durchscheint ein leeres Negativ und ein weißes Bild kommt zustande. Der Rezipient beginnt nun dieses Bild zu deuten und versucht sich das Gesehene zu erklären. Dabei werden unterschiedlichste Reaktionen hervorgerufen, weil das Bild von jedem anders verstanden wird und somit jeden in eine andere Gefühlslage versetzt. Anhand dieses einfachen Beispiels erkennt man, wie komplex das Medium Film ist. Denn die meines Erachtens einfachste Form eines Bildes, ein weißes Bild, kann bereits eine Vielzahl an Assoziationen bewirken. „Eine Einstellung enthält so viel Information, wie wir darin lesen wollen, und welche Einheiten auch immer wir innerhalb der Einstellung definieren, sie sind willkürlich festgesetzt.“6 Die Fotografie, der Vorgänger des Films hat sich das einzelne Bild zur Aufgabe gemacht. Kann die Fotografie überhaupt als Kunstform behandelt werden?
„Ob ein bestimmter Mensch im Profil »mehr er selbst« ist als von vorn, ob die Innenseite oder die Außenseite einer Hand wichtiger, ob ein bestimmter Berg besser von Norden oder besser von Westen zu nehmen ist – das alles sind Dinge, die sich nicht errechnen lassen, sondern erfühlt werden müssen.“7
„Übrigens wird sich später zeigen, dass bei der künstlerischen Behandlung der Fotografie (resp. des Filmbildes) durchaus nicht immer solche »Einstellungen« gewählt werden, die das Charakteristische des betreffenden Gegenstandes am besten zeigen, sondern häufig bewusst andere, zur Erzielung besonderer Wirkungen.“8
Weiteres fügt er die Möglichkeit des Variierens der räumlichen Tiefe, der Farben, der Beleuchtung, des Bildausschnittes und der Einstellungsgröße an. Was erkenne ich anhand dieser Feststellungen? Das Erschaffen eines Bildes bedarf vieler Entscheidungen, die nicht allgemein mittels feststehender Regeln bestimmt werden können. Die Fotografie ist jene Kunst, die uns die Wirklichkeit neu vor Augen führt und dem Künstler verschiedenste Auswahlmöglichkeiten zugesteht, diese darzustellen. „Die Kunst verfremdet die gewohnte Wahrnehmung der Alltagswelt, der Ideologie, anderer Kunstwerke usw., indem Material aus diesen Quellen entnommen und transformiert wird.“9 Das einzelne Bild, die Fotografie hat sich so den Olymp der Kunst erkämpft.
2.2.) Die Aneinanderreihung einzelner Bilder → Das bewegte Bild
Der wesentliche Unterschied zwischen der Fotografie und dem Film ist, dass im Film die Bilder aneinandergereiht werden und durch den Kinematographen in Bewegung gesetzt werden. Dieser belichtet 24 Bilder/s, was dem menschlichen Auge die Illusion von einer natürlichen Bewegung ermöglicht. Ein Raum kann nun nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich festgehalten werden. Die Fotografie enthält eine Momentaufnahme. Theoretisch hat man aber die Möglichkeit eine Fotografie in Spielfilmlänge zu gestalten, indem man das Foto dementsprechend lang belichtet. Doch letztendlich ist es ein »einzelnes Bild« das in Ruhe verharrt. Ich möchte es anhand des weißen Bildes verdeutlichen. Das weiße Bild erkennt man auf einer Fotografie rein auf seinen Inhalt bezogen genauso, wie wenn man es im Film betrachtet. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass eine gewisse Anzahl an weißen Bildern in einer gewissen Zeit abgespielt werden. In der Fotografie begegne ich immer einem Bild, in einem Film immer einer Mehrzahl an Bildern. Diese Bilder stehen zueinander im Verhältnis und ermöglichen dem Film eine weitere Dimension des Ausdrucks.
2.3.) Die Montage, die Entstehung einer neuen Kunst
Doch wie die Fotografie, musste sich nun auch der Film einer Kritik aussetzen. So wurde ihm vorgeworfen, dass er wie die Fotografie lediglich die Wirklichkeit mechanisch wiedergebe und zusätzlich wurde ihm die Kopie des Theaters vorgeworfen. „(…): Film kann nicht Kunst sein, denn er tut ja nichts als einfach mechanisch die Wirklichkeit zu reproduzieren.“10
„Die Kinematographie war nichts weiter als Fotoreportage, Jahrmarktssensation bewegter Bilder, und eine durch die Reproduktionstechnik ermöglichte Herstellung des Schauspiels als Massenartikel, als mechanisch wiederholbares, transportierbares, exportierbares Schauspiel.“11
Das Geschehene wird lediglich abgefilmt und durch den Kinematographen wiedergegeben. Dem Film fehlte sozusagen eine eigene Sprache.
„Solange ein Film nur aus einer Aufnahme besteht – die freilich einige Minuten andauern kann -, zeigt er noch keinen Sprachcharakter im eigentlichen Sinne, abgesehen von der bereits festgestellten Tatsache, dass die Vorführung dieser Aufnahme eine Mitteilung ist.“12
Wie in der Fotografie die verschiedenen Varianten angegeben wurden, ein Bild zu gestalten, stand nun auch der Film vor dem Problem, seine eigene Sprache zu finden. Denn die Möglichkeiten, die die Fotografie mit sich bringt, kann sich der Film ebenfalls zu eigen machen, doch das kann nicht als eigene Sprache definiert werden. Es ist lediglich ein Bestandteil seiner Sprache. Man musste dort ansetzen, wo auch der wesentliche Unterschied zwischen Fotografie und Film herrschte. Der Film hatte die Zeit, die ihm neben dem Raum zu Verfügung stand und musste nun eine Lösung finden, diese in seinem Arbeitsprozess auf eigene Art und Weise zu nutzen. Erst durch das Entdecken der Montage entsteht eine eigene Sprachsystematik.
„(…) und damit beginnt die eigene Sprache des Films. Denn: sobald in der Zusammenfügung von zwei oder mehr Bildern etwas zum Ausdruck kommt, was in den einzelnen Bildern nicht enthalten ist, »spricht« der Filmregisseur (oder derjenige, der für die Montage verantwortlich ist) durch die Form der Bilderkombination.“13
Durch die Montage erkennt man, „Jedes Bild wirkt auf andere und reagiert auf andere, in »allen seinen Ansichten« und »durch all seine Grundbestandteile«.“14 „Ich kann eben noch hundert Meter von einem Haus entfernt gestanden haben und stehe nun plötzlich davor“.15 Durch das Erkennen, dass der Raum und die Zeit durch ihr individuelles Zusammenfügen neu gestaltet werden können, lässt den Film seine eigene Sprache erkennen und hebte ihn in den Olymp der Kunst.
2.4.) Erzählen → Film
Es ist eines der Grundbedürfnisse des Menschen, Geschichten zu erzählen. Wahrscheinlich haben sich bereits die ersten Menschen auf dieser Welt auf irgendeine Weise etwas erzählt.
„Die Erzählung beginnt mit der Geschichte der Menschheit; nirgends gibt und gab es jemals ein Volk ohne Erzählung; alle Klassen, alle menschlichen Gruppen besitzen ihre Erzählungen, und häufig werden diese Erzählungen von Menschen unterschiedlicher, ja sogar entgegengesetzter Kultur gemeinsam geschätzt. Die Erzählung schert sich nicht um gute oder schlechte Literatur, sie ist international, transhistorisch, transkulturell, und damit einfach da, so wie das Leben.“16
Im Laufe der Zeit haben sich die Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen, begonnen zu vervielfältigen und eine große Breite an Ausdrucksmöglichkeiten ist entstanden.
„Was Erzählen seinem Wesen nach ist, lässt sich dabei übrigens nicht so leicht definieren, und man tut gut daran, von einem eher intuitiven Verständnis des Begriffs auszugehen, dass man erst allmählich und mit größter Vorsicht präzisiert. Sinnvoll scheint es, Erzählen im Rahmen von Kommunikation und Informationsverarbeitung zu studieren: Wer erzählt, gibt originelle menschliche Erfahrungen weiter, und er tut dies auf eine sinnlich-anschauliche Weise, die mit zeitlicher Dauer und Prozesshaftigkeit der Darstellung rechnet.“17
Es entsteht der Tanz, die Sprache, die Schrift, die Malerei, die Architektur, das Theater, die Fotografie, der Film, …. Die Breite an Ausdrucksmöglichkeiten hat sich stetig weiterentwickelt. Der Film ist einer dieser vielen Möglichkeiten sich auszudrücken und hat im Laufe eines Jahrhunderts verschiedenste Ausdrucksformen bzw. Erzählweisen hervorgebracht. Doch bevor ich auf diese näher eingehe, möchte ich einen Vergleich zur Literatur herstellen, um die Entwicklung der Filmsprache und deren breites Vorkommen, leichter verständlich zu machen.
2.5.) Erzählen in der Literatur → Film verstehen
„Wir wissen sehr wohl – und das ist hier die Ironie -, dass wir lernen müssen zu lesen, bevor wir versuchen können, Literatur zu genießen oder zu verstehen; aber wir neigen dazu zu glauben, dass jeder einen Film lesen kann. Es ist wahr, jeder kann einen Film sehen. Aber einige Leute haben es gelernt, visuelle Bilder zu verstehen – physiologisch, ethnografisch und psychologisch -, und dies weitaus besser als andere. (…) Der Betrachter konsumiert nicht nur, sondern er nimmt aktiv – oder potenziell aktiv – am Prozess teil. Film ist keine Sprache, aber er ist wie eine Sprache, und da er wie