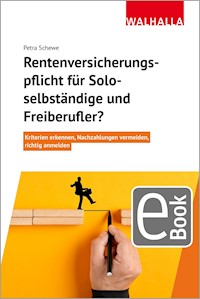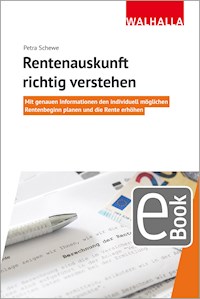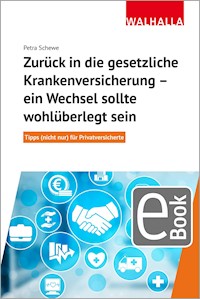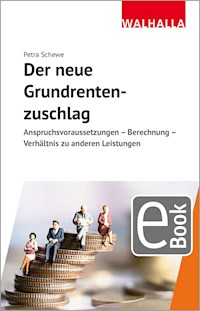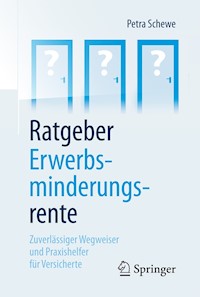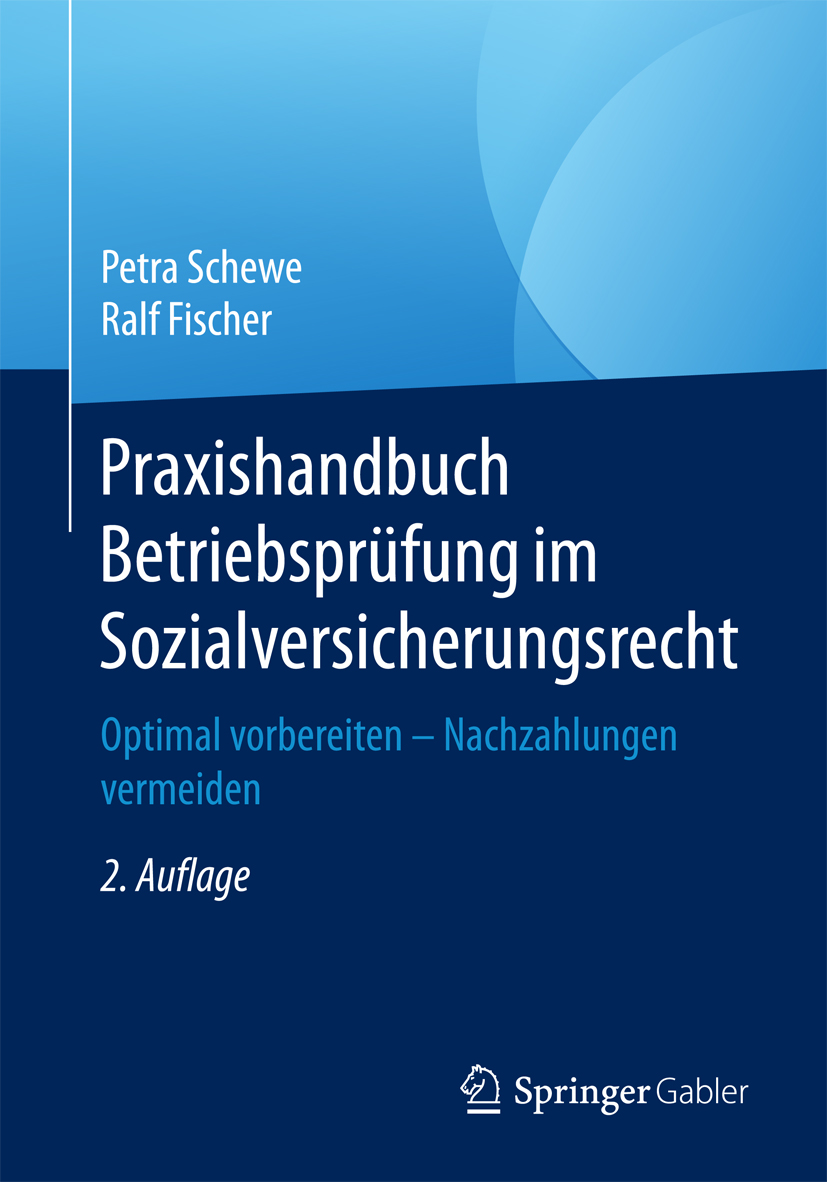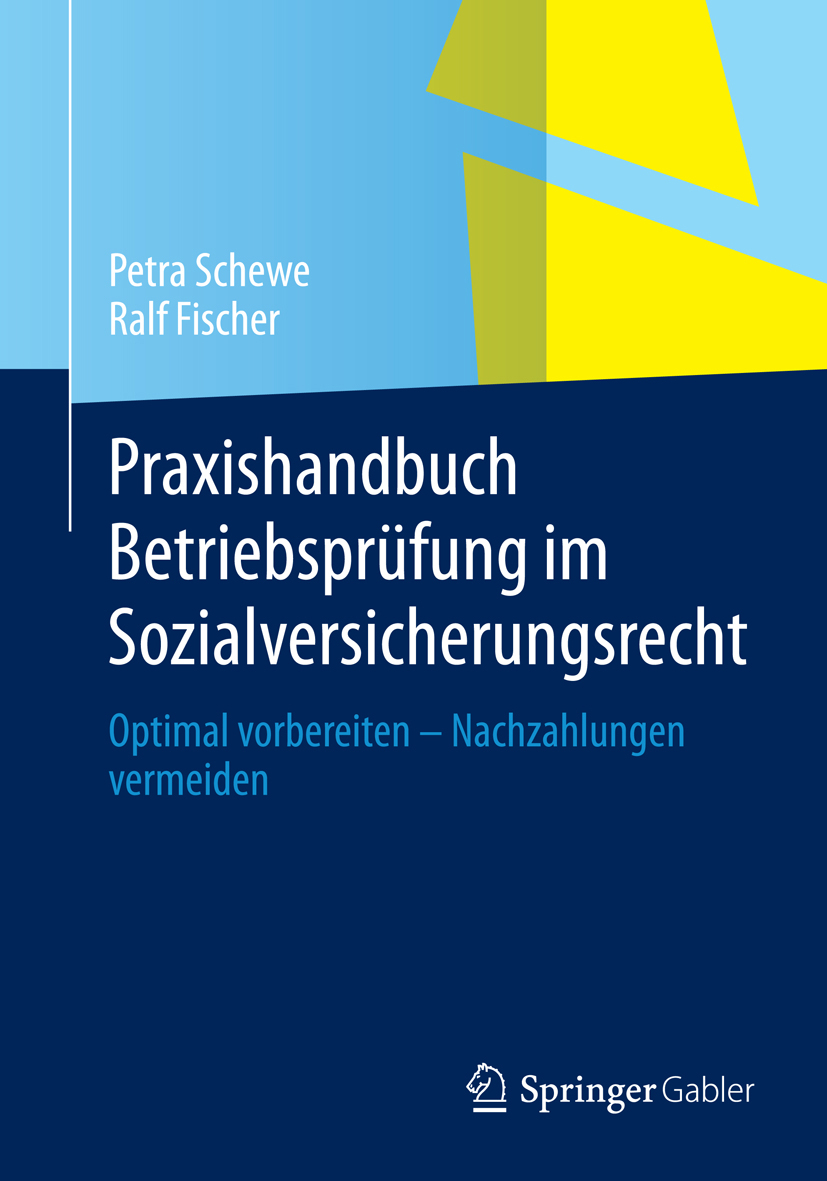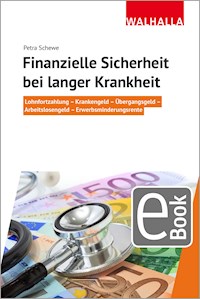
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Walhalla Digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Langzeit krank – wer zahlt?
Alle Leistungen von Arbeitgebern, aus Versicherungen, Krankenkassen, Rentenversicherung oder sonstigen Ämtern oder Einrichtungen sind an bestimmte Voraussetzungen und Fristen gebunden. Erfüllen Erkrankte diese nicht, so erhalten sie keine finanzielle Unterstützung – auch bei wirklich dringendem Bedarf.
Es gilt daher, gesetzliche oder behördliche Vorgaben zu kennen und zu verstehen, mögliche Fristen einzuhalten und die richtigen Anträge bzw. Anträge richtig zu stellen.
Praxisnah und ohne Beamtendeutsch
- führt dieser Leitfaden durch den Behördendschungel,
- erläutert die gesetzlichen Vorgaben,
- gibt Hinweise zum Ausfüllen von Formularen und erklärt deren Hintergründe.
Der Praxisratgeber Finanzielle Sicherheit bei langer Krankheit unterstützt mit vielen Tipps, Fallbeispielen und Abbildungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Ähnliche
1. Auflage
© WALHALLA Fachverlag, Regensburg
Dieses E-Book ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden. Eine entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe oder Leihe an Dritte ist nicht erlaubt. Auch das Einspeisen des E-Books in ein Netzwerk (z. B. Behörden-, Bibliotheksserver, Unternehmens-Intranet) ist nicht erlaubt. Sollten Sie an einer Serverlösung interessiert sein, wenden Sie sich bitte an den WALHALLA-Kundenservice; wir bieten hierfür attraktive Lösungen an (Tel. 0941/5684-210).
Hinweis: Unsere Werke sind stets bemüht, Sie nach bestem Wissen zu informieren. Eine Haftung für technische oder inhaltliche Richtigkeit wird vom Verlag aber nicht übernommen. Verbindliche Auskünfte holen Sie gegebenenfalls bei Ihrem Rechtsanwalt ein.
Kontakt: Walhalla Fachverlag Haus an der Eisernen Brücke 93042 Regensburg Tel. (09 41) 56 84-0 Fax. (09 41) 56 84-111 E-Mail [email protected] Web
Kurzbeschreibung
Langzeit krank – wer zahlt?
Alle Leistungen von Arbeitgebern, aus Versicherungen, Krankenkassen, Rentenversicherung oder sonstigen Ämtern oder Einrichtungen sind an bestimmte Voraussetzungen und Fristen gebunden. Erfüllen Erkrankte diese nicht, so erhalten sie keine finanzielle Unterstützung – auch bei wirklich dringendem Bedarf.
Es gilt daher, gesetzliche oder behördliche Vorgaben zu kennen und zu verstehen, mögliche Fristen einzuhalten und die richtigen Anträge bzw. Anträge richtig zu stellen.
Praxisnah und ohne Beamtendeutsch
führt dieser Leitfaden durch den Behördendschungel,erläutert die gesetzlichen Vorgaben,gibt Hinweise zum Ausfüllen von Formularen und erklärt deren Hintergründe.Der Praxisratgeber Finanzielle Sicherheit bei langer Krankheit unterstützt mit vielen Tipps, Fallbeispielen und Abbildungen.
Autor
Petra Schewe, Dipl.-Betriebswirtin, ist erfahrene Rentenberaterin, Dozentin und Fachautorin. Sie leitet das Institut für Betriebswirtschaft und Rentenberatung in Bad Nauheim.
Schnellübersicht
Vorwort
1. Überblick: Möglichkeiten finanzieller Sicherheit bei langer Krankheit
2. Entgeltfortzahlung
3. Krankengeld
4. Übergangsgeld
5. Arbeitslosengeld
6. Wege zur Erwerbsminderungsrente
7. Wer hilft während dieser Zeit?
Auszüge aus referenzierten Vorschriften
Vorwort
Vorwort
Abkürzungen
Vorwort
Alle Zahlungen bzw. Leistungen von Arbeitgebern, aus Versicherungen, Krankenkassen, der Rentenversicherung oder sonstigen Ämtern oder Einrichtungen sind an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Erfüllen Sie diese Voraussetzungen nicht, so erhalten Sie – auch bei wirklich dringendem Bedarf – keine finanzielle Unterstützung.
Es gilt, gesetzliche oder behördliche Vorgaben zu erkennen und zu verstehen, rechtzeitig die richtigen Anträge zu stellen und diese auch korrekt auszufüllen.
Dieser Leitfaden führt Sie durch den Behördendschungel der einzelnen Ämter, erläutert Ihnen die gesetzlichen Vorgaben, gibt Hinweise zum Ausfüllen von Formularen und erklärt deren Hintergründe.
Praxisnah, mit zahlreichen Abbildungen, ohne Beamtendeutsch.
Viel Gesundheit und eine gute Unterstützung!
Bad Nauheim, Dezember 2020Petra Schewe
Abkürzungen
Abs.AbsatzAUArbeitsunfähigkeitAz.AktenzeichenBABundesagentur für ArbeitBSGBundessozialgerichtBSGEEntscheidungen des BundessozialgerichtsDRVDeutsche Rentenversicherungetc.et ceteraff.fortfolgendeggf.gegebenenfallsGKVGesetzliche Krankenversicherunginkl.inklusiveLFZGEntgeltfortzahlungsgesetz(Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber)MD(K)Medizinischer Dienst (der Krankenkassen)REFAVerband für Arbeitsstudien und BetriebsorganisationSGBSozialgesetzbuchSGB IISozialgesetzbuch – Zweites Buch(Grundsicherung für Arbeitsuchende)SGB IIISozialgesetzbuch – Drittes Buch(Arbeitsförderung)SGB VSozialgesetzbuch – Fünftes Buch(Gesetzliche Krankenversicherung)SGB VISozialgesetzbuch – Sechstes Buch(Gesetzliche Rentenversicherung)SGB VIISozialgesetzbuch – Siebtes Buch(Gesetzliche Unfallversicherung)SGB IXSozialgesetzbuch – Neuntes Buch(Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen)SGB XISozialgesetzbuch – Elftes Buch(Soziale Pflegeversicherung)SGB XIISozialgesetzbuch – Zwölftes Buch(Sozialhilfe)sog.sogenannte/rTVSGGesetz für schnellere Termine und bessere VersorgungTzBfGTeilzeit- und Befristungsgesetzu. a.unter anderemu. U.unter Umständenz. B.zum Beispiel1. Überblick: Möglichkeiten finanzieller Sicherheit bei langer Krankheit
1. Grundsatz
2. Soziale Sicherungssysteme für den Krankheitsfall
3. Checkliste: Mögliche finanzielle Unterstützung abhängig von der Krankheitsdauer
1. Grundsatz
Wer wegen einer Krankheit lange Zeit nicht arbeiten kann, ist häufig auf finanzielle Hilfen angewiesen. Unterstützende Leistungen sind in vielen Gesetzen, Richtlinien und Verträgen verankert. Es besteht somit eine Verpflichtung – zum Beispiel von Arbeitgebern, Sozialkassen und dem Staat –, finanzielle Hilfen anzubieten.
Die folgenden Hinweise richten sich in erster Linie an Arbeitnehmer und gesetzlich (Pflicht-)Versicherte in den Versicherungssystemen der gesetzlichen Krankenkassen, der Arbeitslosenversicherung und der Deutschen Rentenversicherung.
Alle Zahlungen bzw. Leistungen aus privaten oder gesetzlichen Versicherungen, Krankenkassen oder sonstigen Ämtern oder Einrichtungen sind an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Erfüllen Sie diese Voraussetzungen nicht, so erhalten Sie – auch bei wirklich dringendem Bedarf – keine Leistungen.
Deshalb ist es von maßgeblicher Bedeutung, die jeweiligen Voraussetzungen der einzelnen Möglichkeiten für eine finanzielle Unterstützung im Krankheitsfall zu kennen. Jedes Kapitel dieses Buches beschreibt daher am Anfang die einzelnen Voraussetzungen, die zu erfüllen sind, um die entsprechende Hilfe zu erhalten, und führt Sie anschießend durch den weiteren Weg der Anträge und Formulare.
2. Soziale Sicherungssysteme für den Krankheitsfall
Die im Folgenden aufgeführten Rechtsinstrumente sind die Sicherungsinstrumente, die – je nach Länge und Schwere der Krankheit – in unserem Sozialversicherungssystem zur Verfügung stehen.
a) Entgeltfortzahlung im Job
Gesetzlich ist geregelt, dass das Arbeitsverhältnis während einer Krankheitsphase fortbesteht. Für diese Zeit ist deshalb grundsätzlich (nach dem Lohnfortzahlungsgesetz bzw. Entgeltfortzahlungsgesetz – LFZG) vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer 6 Wochen lang der Lohn fortzuzahlen (§ 3 LFZG), wenn einige Voraussetzungen erfüllt werden. Eine Beschränkung auf eine kürzere Zeit als 6 Wochen ist nicht zulässig. Tarifverträge oder Ihr Arbeitsvertrag können allerdings eine längere Zeit als die gesetzlich vorgeschriebenen 6 Wochen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall beinhalten.
b) Krankengeld
Krankengeld wird durch eine gesetzliche Krankenversicherung dem Grund nach dann gezahlt, wenn ein Versicherter seine Arbeitsleistung nicht mehr erbringen kann. Diese Leistungsansprüche sind im Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) in den §§ 44 bis 51 zu finden.
Bei einer privaten Krankenversicherung wird ein (privatrechtlicher) Vertrag geschlossen. Der Vertrag enthält individuelle Vereinbarungen und ist normalerweise nach einem Baukastensystem aufgebaut. So ist es möglich, verschiedene Leistungen zu buchen, die je nach Zubuchung Kosten verursachen.
Die Zahlung von Krankengeld durch die private Krankenversicherung wird als Krankentagegeld bezeichnet. Je nach Vertrag können verschiedene Möglichkeiten (Höhe, Dauer der Zahlung, etc.) vereinbart werden. Es muss daher der individuelle Vertrag geprüft werden, um die Einzelheiten zur Zahlung von Krankentagegeld erkennen zu können. Wichtig in diesem Zusammenhang ist insbesondere, dass durch die Zahlung von Krankentagegeld nicht automatisch Pflichtbeiträge zur Rentenkasse fließen (im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenversicherung). Das hat den Nachteil, dass ggf. eigene Pflichtbeiträge gezahlt werden müssen, um die besonderen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erwerbsminderungsrente erfüllen zu können (siehe Kapitel 6 Erwerbsminderungsrente).
In den folgenden Ausarbeitungen in Kapitel 3 wird daher nur auf die Darstellung der gesetzlichen Krankenversicherung mit dem Krankengeld eingegangen, da diese einheitlich geregelt ist.
c) Übergangsgeld
Übergangsgeld kann bei medizinischer sowie beruflicher Rehabilitation (Anschlussheilbehandlung) oder auch Wiedereingliederung beim Arbeitgeber gezahlt werden. Die Rechtsgrundlagen dazu befinden sich im Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), dort in Kapitel 11, inbesondere im § 66.
Es wird gezahlt, wenn in dieser Zeit kein Arbeitseinkommen erzielt wird bzw. die Entgeltfortzahlung beim Arbeitgeber beendet ist.
d) Arbeitslosengeld
Die gesetzliche Arbeitslosenversicherung zahlt während einer Arbeitslosigkeit sogenannte Lohnersatzleistungen; geregelt ist das im Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) – Arbeitsförderung.
Auch wenn der Anspruch auf Krankengeld ausgeschöpft ist, kann bei andauernder Arbeitsunfähigkeit Arbeitslosengeld (sog. „Nahtlosigkeits-Arbeitslosengeld“) beantragt werden. Diese Zahlung ist eine Sonderform des Arbeitslosengeldes und soll die Zeit überbrücken, bis andere Leistungen (zum Beispiel eine Erwerbsminderungsrente) gezahlt werden. Der Anspruch besteht auch bei einem bestehenden Arbeitsverhältnis.
e) Erwerbsminderungsrente
Die gesetzliche Rentenversicherung unterstützt ihre Versicherten durch die Übernahme von Kosten für zum Beispiel Rehabilitationsmaßnahmen etc. Sie zahlt unter bestimmten Voraussetzungen Renten wegen Alters, wegen Todes oder auch Renten bei Krankheit. Die Regelungen zum Rentenrecht sind dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) zu entnehmen. Die Einzelheiten zu den Renten bei Krankheit (Erwerbsminderungsrenten) finden Sie u. a. in § 43 SGB VI.
Damit Sie Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente haben, müssen Sie besondere versicherungsrechtliche Voraussetzungen erfüllen, eine Wartezeit vorweisen und es muss eine Erwerbsminderung vorliegen. Für vor dem 02.01.1961 Geborene existiert darüber hinaus eine Übergangsregelung bei Berufsunfähigkeit. Eine Rentenzahlung wegen Erwerbsminderung kann befristet oder unbefristet gewährt werden.
3. Checkliste: Mögliche finanzielle Unterstützung abhängig von der Krankheitsdauer
Nachfolgende Checkliste soll Ihnen einen Überblick über mögliche finanzielle Unterstützungen geben. Die genauen Voraussetzungen und Hintergründe entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Kapitel.
Der Anspruch besteht für maximal sechs Wochen.
Die Anspruchsdauer kann unterschiedlich sein.
Besonderheiten bestehen beim Beginn der Erkrankung sowie beim Hinzutreten von Erkrankungen. Die Fristen betragen 6 Monate bzw. 12 Monate.
Höhe der Zahlung: 100 % des normalen Bruttoentgeltes. Es sind Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen.
Krankengeld schließt sich nahtlos an die Lohnfortzahlung des Arbeitgebers an. (Zu beachten ist, dass insgesamt 78 Wochen Geld gezahlt wird, also vom Arbeitgeber und der gesetzlichen Krankenkasse zusammengezählt.)
Besonderheiten bestehen bei verschiedenen Erkrankungen oder häufigen (kürzeren) Erkrankungen. Hier sind sog. Blockfristen zu beachten.
Höhe der Zahlung: 70 % des beitragspflichtigen Bruttoentgeltes, höchstens jedoch 90 % des Nettoeinkommens.
Bei der Arbeitsagentur Versicherte erhalten Arbeitslosengeld. Die Dauer richtet sich nach den individuellen Gegebenheiten.
Besonderheiten bestehen bei einer möglicherweise vorhandenen Leistungsminderung. Ist sie nur vorübergehend, wird „normales“ Arbeitslosengeld nach den Grundlagen der „Arbeitsfähigkeit“ gezahlt. Besteht eine dauerhafte Leistungsminderung, muss eine Rente wegen Erwerbsminderung beim zuständigen Rentenversicherungsträger beantragt werden. Zur Überbrückung der Zeit bis zur Bewilligung der Erwerbsminderungsrente kann Arbeitslosengeld nach der Nahtlosigkeitsregelung beantragt werden. Dieser Anspruch endet mit der Feststellung der verminderten Erwerbsfähigkeit durch die Rentenversicherung.
Höhe der Zahlung: ca. 60 bis 67 % des letzten (pauschal errechneten) Nettoeinkommens, abhängig von Kindern und Steuerklasse.
Erwerbsminderungsrente wird nur demjenigen gezahlt, der durch Krankheit oder Unfall nicht mehr in der Lage ist, mehr als sechs Stunden am Tag zu arbeiten. Nötig sind hierfür ärztliche Gutachten, die durch die Rentenversicherung „in Auftrag“ gegeben werden, und (im Grundsatz) das Vorliegen von 36 Monaten an Pflichtversicherungszeiten innerhalb der letzten fünf Jahre. Die Zahlung einer Erwerbsminderungsrente wird häufig auf (zunächst) 3 Jahre beschränkt.
Höhe der Zahlung: Unterschiedlich je nach bisher erfolgter Einzahlung zuzüglich einer Zurechnungszeit. Die Höhe kann der Renteninformation bzw. Rentenauskunft, die regelmäßig zugesandt wird, entnommen werden. Wird nur eine teilweise Erwerbsminderung festgestellt, so wird auch nur die Hälfte des in der Rentenauskunft genannten Betrages gezahlt.
Wird nach dem Auslaufen des Arbeitslosengeldes keine Erwerbsminderung festgestellt, bleibt häufig nur Arbeitslosengeld II (Hartz IV).
Höhe der Zahlung: Pauschaler Regelsatz zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Vorhandenes Vermögen muss bis auf Schonbeträge aufgebraucht werden.
Gegebenenfalls wäre noch zu prüfen, ob ein neuer Anspruch auf Krankengeld oder Arbeitslosengeld erwirkt wurde.
2. Entgeltfortzahlung
1. Voraussetzungen für die Entgeltfortzahlung
2. Nachweis der Arbeitsunfähigkeit
3. Dauer der Entgeltfortzahlung
4. Höhe der Entgeltfortzahlung
5. Praxisbeispiel: Frau Musterfrau und die Herzerkrankung
1. Voraussetzungen für die Entgeltfortzahlung
Die Regelungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes zur Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gelten für alle Arbeitnehmer (Angestellte, Arbeiter, Auszubildende, Minijobber). Es gibt auch keine Unterschiede zwischen den neuen und den alten Bundesländern. Lediglich für Beamte oder beamtenähnliche Beschäftigungen bzw. Heimarbeiter und Hausgewerbetreibende existieren einige Sonderregelungen. Ferner können abweichende – günstigere – Regelungen in Tarifverträgen oder in einzelvertraglichen Bestimmungen vereinbart worden sein.
Nicht alle Mitarbeiter eines Unternehmens haben einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Die grundsätzlichen Voraussetzungen sind:
Das Arbeitsverhältnis muss mindestens 4 Wochen (28 Kalendertage) bestehen (ggf. können in einem Tarifvertrag andere Fristen vereinbart sein).
Es muss (unverschuldete) Arbeitsunfähigkeit vorliegen (belegt meistens durch Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung durch einen Arzt).
Bei neu gegründeten Arbeitsverhältnissen kommt es erst nach einer 4-wöchigen Wartezeit zu einem Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Erkranken Sie also in den ersten 4 Wochen, so haben Sie erst ab der 5. Woche einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung vom Arbeitgeber. Bis dahin erhalten Sie Krankengeld von der Krankenkasse.
Auch Berufskrankheiten, Sport- oder sonstige Unfälle führen zu einer Arbeitsunfähigkeit mit Lohnfortzahlungsanspruch. Der Anspruch besteht nur dann nicht, wenn die krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit selbst verschuldet wurde (Ausnahmen zum Beispiel Leberspende).
Eine selbstverschuldete Krankheit liegt etwa vor bei Unfällen, die durch Alkohol- oder Drogenmissbrauch herbeigeführt wurden oder bei einem grob fahrlässigen Verstoß gegen die Unfallverhütungsvorschriften.
2. Nachweis der Arbeitsunfähigkeit
Der Arbeitnehmer hat seine Arbeitsunfähigkeit gegenüber dem Arbeitgeber nachzuweisen. Bei einer vorliegenden Erkrankung mit Arbeitsunfähigkeit muss der behandelnde Arzt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (sog. AU-Bescheinigung) ausfüllen. Die Bescheinigung geht im Original an die Krankenkasse, ein Durchschlag ist für den Arbeitgeber vorgesehen und (seit 01.01.2016) erhält der Versicherte ebenfalls einen Durchschlag.
Einzelheiten über das gesamte Verfahren enthält die Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie. Unter bestimmten Voraussetzungen können Ärzte (Vertragsärzte) die Arbeitsunfähigkeit auch per Videosprechstunde feststellen. Hintergrund ist eine Neuregelung aufgrund der Corona-Infektionen mit dem neu eingefügten § 4b (veröffentlicht im Bundesanzeiger, BAnz AT 10.07.2020 B5). Bedingung ist, dass der Versicherte in der Arztpraxis bekannt ist und die Untersuchung per Videosprechstunde möglich ist.
Die Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie kann auf den Seiten des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) in aktueller Fassung eingesehen bzw. downgeloadet werden:
→ www.g-ba.de/richtlinien/2/
Die Arbeitsunfähigkeit und deren Dauer ist dem Arbeitgeber unverzüglich (also schnellstmöglich) mitzuteilen. Das kann formlos, zum Beispiel durch einen Telefonanruf oder durch Kollegen, erfolgen.
Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als 3 Tage, ist spätestens am vierten Tag eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, aus der die voraussichtliche Dauer ersichtlich ist.
Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als auf der Erstbescheinigung vermerkt, ist unverzüglich eine neue Bescheinigung mit der weiteren Dauer vorzulegen.
Erkrankt der Arbeitnehmer im Ausland, ist er verpflichtet, den Arbeitgeber schnellstmöglich (per Fax, Mail oder telefonisch) über die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer zu unterrichten sowie seinen Aufenthaltsort und seine Rückkehr ins Inland mitzuteilen. Die Rückkehr ins Inland ist ebenfalls der Krankenkasse anzuzeigen.
Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Entgeltfortzahlung zu verweigern, solange der Arbeitnehmer die ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht vorlegt und das Nichtvorlegen zu vertreten hat. Sobald der Arbeitnehmer die Bescheinigung vorlegt, muss der Arbeitgeber die Lohnfortzahlung leisten.
Wichtig: In vielen Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder einzelvertraglichen Bestimmungen können abweichende Regelungen getroffen worden sein.
Zum 01.01.2016 wurden die Formulare für die Arbeitsunfähigkeit geändert. Der seitdem geltende „gelbe Schein“ soll das gesamte Verfahren vereinfachen. Er wird genutzt für die Attestierung der Arbeitsunfähigkeit sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber, für den Übergang zum Krankengeld und als Bescheinigung für die Krankenkasse sowie als Durchschlag für den Arzt.
Ein Exemplar müssen Sie Ihrem Arbeitgeber (ohne Diagnose) aushändigen, ein Exemplar müssen Sie Ihrer Krankenkasse senden (unverzüglich, wenn Sie bereits Krankengeld erhalten), ein Exemplar ist für Ihre Unterlagen bestimmt und ein Exemplar behält der Arzt.
3. Dauer der Entgeltfortzahlung
Die Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber beträgt nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz 6 Wochen (genau 42 Tage). Diese Begrenzung gilt grundsätzlich für jeden Fall der Arbeitsunfähigkeit. Die Anspruchsdauer verlängert sich auch dann nicht, wenn eine neue Krankheit hinzutritt.
Grundsätzliches zur 6-Wochen-Frist:
Krankzeiten, die während der Arbeitszeit bzw. anschließend auftreten:
→ die 6-Wochen-Frist beginnt am nächsten Tag
Krankzeiten vor Arbeitsbeginn:
→ die 6-Wochen-Frist beginnt an diesem Tag
Krankzeitenbeginn an einem Sonn- oder Feiertag:
→ die 6-Wochen-Frist beginnt an diesem Tag
Ruht das Arbeitsverhältnis (unbezahlter Urlaub, Bezug von Mutterschaftsgeld):
→ die Frist beginnt nicht
Grundsätzlich ist der erste Tag der Arbeitsunfähigkeit, also wenn noch gearbeitet wurde, kein Krankheitstag. Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung beginnt somit erst am nächsten Tag. Für den Tag mit (etwas) Krankzeit wird noch Arbeitsentgelt gezahlt (keine Lohnfortzahlung). Die Zeit der Lohnfortzahlung beginnt erst danach und wird (mindestens) 6 Wochen geleistet.
Krankheit A tritt am 01.07. auf:
→ Lohnfortzahlungsanspruch maximal vom 01.07. bis zum 11.08. (42 Tage)
Krankheit B tritt am 23.07. dazu:
→ Lohnfortzahlungsanspruch immer noch bis zum 11.08.
Sind die Krankheiten jedoch völlig unabhängig voneinander (auch in zeitlicher Hinsicht), so beginnt ein neuer Lohnfortzahlungszeitraum.
Krankheit A tritt am 01.07. auf:
→ Lohnfortzahlungsanspruch maximal vom 01.07. bis zum 11.08. (42 Tage)
Krankheit B tritt am 31.08. auf:
→ Neuer Lohnfortzahlungsanspruch von 42 Tagen ist entstanden.
Lange Krankzeiten derselben Krankheit: Von dem Grundsatz der Lohnfortzahlung von 6 Wochen wird abgewichen, wenn eine lange Krankheit (dieselbe Krankheit) sich wiederholt. Wurden aufgrund derselben Erkrankung mehrfach Lohnfortzahlungen geleistet, so werden diese Zeiten addiert.
Die Addition der Krankheitszeiten umfasst die Dauer der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (Krankenscheine), stationäre medizinische Vorsorgemaßnahmen sowie ambulante und stationäre Rehabilitations-Maßnahmen.
Liegt zwischen zwei Erkrankungen, die auf dieselbe Krankheit zurückzuführen sind, ein Zeitraum von mindestens 6 Monaten, besteht auch für die zweite Erkrankung wieder ein Anspruch auf Lohnfortzahlung von 6 Wochen. Liegt in diesen 6 Monaten aber eine andere Erkrankung vor, hat dies keine Auswirkungen auf den Lohnfortzahlungsanspruch.
Liegt zwischen zwei Erkrankungen, die auf dieselbe Krankheit zurückzuführen sind, ein Zeitraum von weniger als 6 Monaten, so müssen zwischen dem erstmaligen Beginn der Erkrankung und der neuen Erkrankung mindestens 12 Monate vergangen sein – dann existiert wieder ein neuer Anspruch auf Entgeltfortzahlung.
1. Krankheit A vom 01.01. bis 31.03. (Lohnfortzahlung)
2. Krankheit A vom 01.05. bis 30.06. (keine Lohnfortzahlung)
3. Krankheit A vom 01.08. bis 30.09. (keine Lohnfortzahlung)
4. Krankheit A vom 01.02. bis 30.04. des Folgejahres (Lohnfortzahlung)