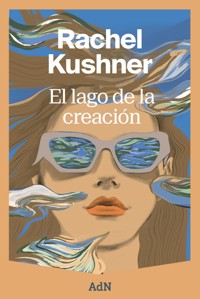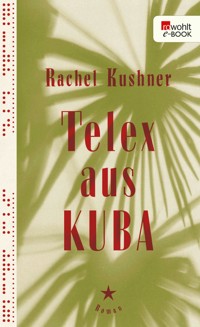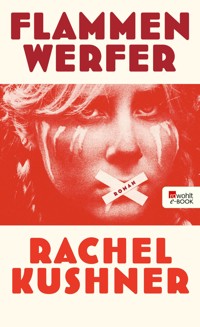
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die literarische Sensation aus den USA! Dieses Buch ist ein erzählerisches Naturereignis – ein Roman über eine schnelle junge Frau auf einem Motorrad, ihre Liebschaften im New Yorker Kunst-Underground der späten Siebziger und ihre politischen Verwicklungen im Italien der Roten Brigaden. 1975: Die Hobby-Motorradrennfahrerin Reno (so ihr Spitzname, nach ihrem Geburtsort) kommt nach einem Rekordversuch auf den großen Salzseen nach Manhattan, um in die kreativ explodierende Künstlerszene SoHos einzutauchen. In einer Welt, in der die Grenzen zwischen Leben und Kunst verschwimmen, trifft sie auf eine Schar von Träumern, Revoluzzern und Phantasten. Unter ihnen auch Sandro Valera, erfolgreicher Konzeptkünstler und exzentrischer Erbe einer italienischen Reifen- und Motorrad-Dynastie, in den sie sich verliebt. Aber bei einem Besuch bei seiner Familie in deren Sommerresidenz am Comer See gerät sie in den Strudel einer echten Revolte, die sich in Streiks, Straßenkämpfen, Entführung und Mord Bahn bricht … Als dieser Roman 2013 in New York erschien, löste er ein unbeschreibliches Echo unter Rezensenten und Autoren aus. Von Jonathan Franzen über Joshua Ferris zu Colum McCann – unterschiedlicher könnten die Romanciers nicht sein, einheitlicher nicht die Ansicht, dass «Flammenwerfer» im Sturm über alle vorgefassten Meinungen, was heute einen guten Roman auszumachen habe, hinwegfegt und all seine Leser mitreißt und begeistert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 695
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Rachel Kushner
Flammenwerfer
Roman
Über dieses Buch
Die literarische Sensation aus den USA!
Dieses Buch ist ein erzählerisches Naturereignis – ein Roman über eine schnelle junge Frau auf einem Motorrad, ihre Liebschaften im New Yorker Kunst-Underground der späten Siebziger und ihre politischen Verwicklungen im Italien der Roten Brigaden.
1975: Die Hobby-Motorradrennfahrerin Reno (so ihr Spitzname, nach ihrem Geburtsort) kommt nach einem Rekordversuch auf den großen Salzseen nach Manhattan, um in die kreativ explodierende Künstlerszene SoHos einzutauchen. In einer Welt, in der die Grenzen zwischen Leben und Kunst verschwimmen, trifft sie auf eine Schar von Träumern, Revoluzzern und Phantasten. Unter ihnen auch Sandro Valera, erfolgreicher Konzeptkünstler und exzentrischer Erbe einer italienischen Reifen- und Motorrad-Dynastie, in den sie sich verliebt. Aber bei einem Besuch bei seiner Familie in deren Sommerresidenz am Comer See gerät sie in den Strudel einer echten Revolte, die sich in Streiks, Straßenkämpfen, Entführung und Mord Bahn bricht …
Als dieser Roman 2013 in New York erschien, löste er ein unbeschreibliches Echo unter Rezensenten und Autoren aus. Von Jonathan Franzen über Joshua Ferris zu Colum McCann – unterschiedlicher könnten die Romanciers nicht sein, einheitlicher nicht die Ansicht, dass «Flammenwerfer» im Sturm über alle vorgefassten Meinungen, was heute einen guten Roman auszumachen habe, hinwegfegt und all seine Leser mitreißt und begeistert.
Vita
Rachel Kushner, geboren 1968 in Eugene, Oregon, studierte Literatur und kreatives Schreiben in Berkeley und an der Columbia University, und sie arbeitete als Redakteurin für diverse Kunst- und Literaturmagazine. Sie liebt schnelle Motorräder und Skirennen. Sie lebt in Los Angeles, ist verheiratet und hat einen Sohn. «Flammenwerfer» ist, nach «Telex to Cuba», ihr zweiter Roman. Mit beiden Büchern war sie für den National Book Award nominiert, was noch niemandem vor ihr gelungen ist.
Bettina Abarbanell, geboren in Hamburg, lebt als Übersetzerin in Potsdam. Sie übersetzte u.a. Denis Johnson, Jonathan Franzen, Elizabeth Taylor und F. Scott Fitzgerald. 2014 wurde sie mit dem Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Übersetzerpreis ausgezeichnet.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel «The Flamethrowers» bei Scribner, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2016
Copyright © 2015 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«The Flamethrowers» Copyright © 2013 by Rachel Kushner
Umschlaggestaltung any.way, Hamburg, nach dem Original von Simon & Schuster, New York, USA; Entwurf: Charlotte Strick
Umschlagabbildung mit freundlicher Genehmigung der London School of Economics, Red Notes Archive, London. Zeitschrift: I Volsci, März 1980, Ausgabe Nr. 10
ISBN 978-3-644-03781-6
Hinweis: Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
1. Er tötete ihn mit einem Motorradscheinwerfer (den er gerade in der Hand hatte)
2. Der Geist Amerikas
3. Es war ein weiter Weg gewesen bis zu diesem Moment jäher Gewalt,
4. Platzpatronen
5. Valera ist tot,
6. Nachgemachtes Leben
7. Das kleine Sklavenmädchen
8. Lichter
9. Es war Milch,
10. Gesichter
I.
II.
III.
11. So, wie wir waren
12. Die Sears’sche Schaufensterpuppennorm
13. Das Zittern des Laubes
14. Die Regeln der Gewalt
15. Der Marsch auf Rom
16. Nutten und Kinder
17. Nach Lust und Laune: Das Leben von Ronnie Fontaine
18. Hinter der grünen Tür
19. Der Tag, an dem Rom gegründet wurde, 21. April,
20. Ihre Schnelligkeit
Ein Portfolio, zusammengestellt von Rachel Kushner
[Kapitel]
[Kapitel]
[Kapitel]
[Kapitel]
[Kapitel]
[Kapitel]
[Kapitel]
[Kapitel]
Danksagung
Fotonachweis
Dieses Buch ist für Cynthia Mitchell.
Und für Anna, wo immer sie ist (und wahrscheinlich nicht ist).
Fac ut ardeat
1.Er tötete ihn mit einem Motorradscheinwerfer (den er gerade in der Hand hatte)
Valera war hinter seiner Staffel zurückgeblieben und damit beschäftigt, die Scheinwerferkabel eines anderen Motorrads zu kappen. Der Fahrer, Copertini, war tot. Seltsamerweise empfand Valera keine Trauer, dabei waren Copertini und er Waffenbrüder gewesen und schon zusammen unter dem weißen Neonlicht der Via del Corso entlanggerast, lange bevor sie sich 1917 beide freiwillig zum Motorradbataillon gemeldet hatten.
Ausgelacht hatte ihn Copertini, als er auf den Straßenbahnschienen der Via del Corso, die in einer nebligen Nacht so glatt sein konnten, ausgerutscht und hingeflogen war.
Copertini hielt sich für den besseren Fahrer, und nun war er es, der in den dichten Wäldern zu viel Gas gegeben hatte und mit dem Kopf voran gegen einen Baum gekracht war. Der Rahmen seiner Maschine war völlig verbogen, aber die Scheinwerferbirne hatte einen unversehrten Glühfaden, dessen schwaches Licht jetzt auf ein Fleckchen Erde und steife Gräser schien. Copertinis Motorrad war ein anderes Modell als Valeras; die gleichen Glühbirnen hatten sie trotzdem. Valera konnte gut eine Reserve gebrauchen. Eine Reserve wäre praktisch.
Er hörte das ferne Zischen eines Flammenwerfers und das versprengte Echo von Granatfeuer. Die Kämpfe fanden auf der anderen Seite eines tiefen Tals statt, nahe beim Isonzo. Es war friedlich und verlassen hier, nichts als das silbrige Geplapper von Laub, das sich im Wind bewegte.
Er hatte sein Motorrad abgestellt, das auf dem Gepäckträger befestigte Carcanogewehr dort gelassen und machte sich jetzt an dem Scheinwerfer zu schaffen, versuchte, den Lampensockel durch Drehen aus der Fassung zu lösen. Es ging nicht. Er riss an der Verankerung, als ein Mann hinter zwei Pappelreihen hervorgeschossen kam, unverkennbar deutsch in seiner grün-gelben Uniform und ohne Helm, wie ein aufs Schlachtfeld geschickter Rugbyspieler.
Mit einem Ruck löste Valera das schwere Messinggehäuse und warf sich dem Mann entgegen. Der Deutsche ging zu Boden. Valera taumelte hinterher. Der Deutsche rappelte sich hoch und versuchte auf Knien, den Scheinwerfer zu packen, in Größe und Form einem Rugbyball ähnlich, nur schwerer, mit einem Zopf aus gekappten Kabeln, die wie ein durchtrennter Sehnerv daran hingen. Valera kämpfte darum. Zweimal gelang ihm ein Grubber-Kick, doch am Ende hatte der Deutsche die Lampe. Valera warf ihn um, kniete sich ihm aufs Gesicht und bog seine Finger von der Lampe los. Hier gab es schließlich keine Strafe für Foulspiel, niemanden, der ihm im stillen Wald die rote Karte zeigen konnte. Seine eigene Einheit war Kilometer voraus, und irgendwie hatte dieser einsame Deutsche sein Rudel verloren und sich zwischen die Pappeln verirrt.
Der Deutsche bäumte sich auf, um einen Schulterstoß zu machen.
Valera schlug ihm mit dem Scheinwerfer den Schädel ein.
2.Der Geist Amerikas
Ich ging aus der Sonne und schnallte mir den Kinnriemen auf. Schweiß sammelte sich entlang meiner Schlüsselbeine, tropfte mir über den Rücken in die Nylonunterwäsche und lief unter der Lederkombi an meinen Beinen hinunter. Ich nahm den Helm ab und zog die schwere Lederjacke aus, legte beides auf den Boden und öffnete die Lüftungsreißverschlüsse der Hose.
Lange stand ich da und beobachtete die langsam dahintreibenden Wolken, große bauschige Haufen, an der Unterkante flach geschoren, als schmölzen sie auf einem heißen Rost.
Es gab Dinge, etwa den Effekt des Windes auf die Wolken, die ich schlicht ignorieren musste, wenn ich mit hundertsechzig Stundenkilometern über den Highway fegte. Ich war nicht in Eile, unter keinerlei Zeitdruck. Beim Schnellfahren geht es nicht unbedingt um Zeit. Als ich an jenem Tag auf der Moto Valera von Reno aus gen Osten unterwegs war, ging es darum, dass ich die auf meinen Tank geklebte Karte von Nevada durchqueren wollte, während ich den tatsächlichen Staat durchquerte. Zuerst der vertraute Orbit östlich von Reno – Bordelle und Schrottplätze, das große qualmende Elektrizitätswerk und sein Fadenspiel aus Drahtspulen, Federn und Zäunen, vereinzelte Güterzüge und der mäandrierende, sommerflache Truckee, der mich wie die Bahngleise bis Fernley begleitete, wo sie beide nach Norden abbogen.
Von da an war das Land bar aller Farbe und Besonderheit, nackte Erde mit Salbeibüschen und unablässig gleicher Highway. Ich beschleunigte. Je schneller ich fuhr, umso verbundener fühlte ich mich mit der Landkarte. Sie sagte mir, dass ich neunzig Kilometer hinter Fernley nach Lovelock kommen würde, und neunzig Kilometer, nachdem ich Fernley verlassen hatte, kam ich nach Lovelock. So bewegte ich mich von einem Punkt auf der Karte zum anderen. Winnemucca. Valmy. Carlin. Elko. Wells. Ich spürte ein großes Sendungsbewusstsein, selbst als ich unter der Markise eines Truckstops saß, mir der Schweiß an den Schläfen herunterlief und eine namenlose Brise, heiß und trocken, die Feuchtigkeit aus meinem dünnen Unterhemd blies. Fünf Minuten, sagte ich mir. Fünf Minuten. Wenn ich länger blieb, könnte mir der Ort, den die Landkarte abbildete, auf den Leib rücken.
Auf einer Reklametafel über dem Highway stand SCHAEFER. WENN’S MAL MEHRERE SEIN SOLLEN. Ein Hüttensänger landete auf einem Sumachbusch unter den hohen Beinen der Tafel. Der Vogel surfte auf dem schlaffen Zweig; sein Gefieder war von einem so schieren, ebenmäßigen Blau, als wäre es industriell pulverlackiert worden. Ich dachte an Pat Nixon, ihre dunklen, glänzenden Augen und formellen Kleider, steif vor Stärke und Perlenstickerei. Whiskeyfarben getöntes, zu einer starren Welle hochgepeitschtes Haar. Der Vogel probierte einen kurzen Pfiff aus, einen einsamen Mittagslaut, der sich zwischen den endlosen Reihen von Bewässerungsrädern jenseits des Highways verlor. Pat Nixon kam aus Nevada, wie ich und der sittsame kleine Staatsvogel, so blau im Vergleich zum Tag. Eine taffe, toupierte Schönheitssalongöre, die First Lady geworden war. Jetzt würden wir wahrscheinlich Rosalynn Carter bekommen, mit ihrer spröden Stimme und ihrem großen, flachen, freundlichen Gesicht, das vor Nächstenliebe glühte. Aber Pat war es, die mir ans Herz ging. Menschen, die schwerer zu lieben sind, stellen eine Herausforderung dar, und die Herausforderung macht es einfacher, sie zu lieben. Man fühlt sich dazu getrieben. Wer die Liebe einfach haben will, will eigentlich gar keine Liebe.
Ich bezahlte mein Benzin zu den Geräuschen eines Videospiels namens Night Driver. Ein paar Männer saßen in tiefliegenden Cockpits aus glitzerndem, geformtem Plexiglas und lenkten ruckartig, bleichknöchelig, um den Leitplankenreflektoren auf beiden Seiten der Straße auszuweichen. Die Plexiglascockpits rüttelten und schwankten, während die Männer sich aus Katastrophen herauszusteuern versuchten und fluchten und wütend mit dem Handballen aufs Steuer hauten, wenn sie doch irgendwo reinkrachten und in Flammen aufgingen. Das hatte ich nun schon an mehreren Raststätten erlebt. So erholten Männer sich vom Fahren. Später erzählte ich Ronnie Fontaine davon. Ich dachte, es wäre etwas, das er besonders lustig finden würde, aber er lachte nicht. Er sagte: «Tja, siehst du. So ist das mit der Freiheit.» Ich sagte: «Wie?» Und er: «Niemand will sie.»
Mein Onkel Bobby, der seinen Lebensunterhalt mit dem Transport von Schrott verdiente, zuckte in den letzten Momenten seines Lebens mit dem Bein, weil er, noch im Krankenhaus liegend, die Kupplung zu treten versuchte – sein Körper war entschlossen, den Kipplaster zu bedienen, zu kuppeln und zu schalten, während er im Klinikbett auf den Tod zuraste. «Er starb bei der Arbeit», sagten seine beiden Söhne ungerührt. Er war zu gemein, als dass sie ihn hätten lieben können. Scott und Andy hatten jeden Sonntag seinen Laster abschmieren müssen, und jetzt war er tot, und sie hatten die Sonntage für sich und konnten ihre eigenen Laster abschmieren. Bobby war der Bruder meiner Mutter. Früher hatten wir alle zusammengelebt. Meine Mutter arbeitete abends, und Bobby war unser Elternersatz. Wenn er mit Lasterfahren fertig war, setzte er sich, unerklärlicherweise nackt, vor den Fernseher und ließ uns den Programmschalter bedienen, damit er nicht aufstehen musste. Sich selbst briet er ein großes Steak, und uns setzte er Instantnudeln vor. Manchmal nahm er uns mit zu einem Kasino und ließ uns dann mit Flaschenraketen auf dem Parkplatz allein. Oder er lieferte sich Rennen mit den anderen Autos auf der I-80, mit mir, Scott und Andy auf der Rückbank, wo wir uns die Augen zuhielten. Ich komme aus einer draufgängerischen, unsentimentalen Familie. Sandro verwendete das mitunter gegen mich. Er behauptete, ich sei in sein Leben getreten, um ihn zu quälen, dabei war es andersherum. Er tat, als wäre er mir hilflos ausgeliefert, aber die hilflos Ausgelieferte war ich. Sandro hatte alle Macht. Er war vierzehn Jahre älter als ich und ein erfolgreicher Künstler, groß und gutaussehend in seiner Arbeitskleidung und den Stahlkappenstiefeln – die gleiche Art von Klamotten, die auch Bobby, Scott und Andy trugen, aber an Sandro ergaben sie einen anderen Sinn: Er war ein Mann mit einem Familienerbe, der mit Nagelpistole und Bohrmaschine umgehen konnte, jemand, den das Geld nicht verweichlicht hatte, der sich wie ein Arbeiter und manchmal wie ein Penner kleidete, aber dabei elegant aussah und sich von der Frage, ob er in einer gegebenen Situation dazugehörte (schon die Frage bewies das Nicht-Dazugehören), nicht behelligen ließ.
Sandro hatte in seinem Loft ein Foto über dem Schreibtisch hängen, das ihn auf einem Sofa neben Morton Feldman mit seiner Colaflaschenbrille zeigte, kühl und unnahbar, eine geladene Schrotflinte in den Händen, deren Lauf das Bild wie eine lange Hälfte des Buchstabens X diagonal durchkreuzte. Es nachgerade aufschlitzte. Das Foto war schwarzweiß, aber man konnte sehen, dass Sandros Augen weißlich blau waren wie die eines Wolfs, was ihm eine kalte, hinterlistige Intensität verlieh. Das Bild war in Rhinebeck aufgenommen worden, wo seine Freunde Gloria und Stanley Kastle ein Haus hatten. Sie erlaubten ihm, auf ihrem Grundstück mit den diversen Handfeuerwaffen und Gewehren, die er gesammelt hatte, zu schießen, manche von der Firma seiner Familie hergestellt, bevor sie sich aus dem Waffengeschäft zurückgezogen hatte. Sandro mochte Schrotflinten am liebsten, er meinte, falls man tatsächlich mal jemanden töten müsse, sei es das, was man brauche, eine Schrotflinte. Auf diese Weise ließ er einen in seinem leichten, kaum italienisch gefärbten Akzent kurz und knapp wissen, dass er, wenn nötig, jemanden töten könnte.
Frauen gefiel das. Sie baggerten ihn direkt vor meinen Augen an, wie die Galeristin Helen Hellenberger etwa, eine strenge, aber schöne Griechin, die sich zurechtmachte, als wäre es für immer 1962, mit schwarzem Hemdkleid und hochtoupiertem Haar. Wir liefen ihr auf der Spring Street in die Arme, kurz bevor ich nach Reno aufbrach, um die Moto Valera für diese Unternehmung abzuholen. Helen Hellenberger, in ihrem engen Kleid und flachen Lederschuhen, die große schwarze Aktenmappe in der Hand wie einen Werkzeugkoffer, hatte gesagt, sie würde ja so gerne mal in Sandros Atelier kommen. Müsse sie erst darum betteln? Sie hatte ihm die Hand auf den Arm gelegt und anscheinend erst wieder loslassen wollen, wenn er ja gesagt hätte. Sandro war bei der Erwin-Frame-Galerie. Helen Hellenberger wollte ihn für ihre eigene Galerie abwerben. Er versuchte, sie umzudirigieren, indem er ihr mich vorstellte, nicht als seine Freundin, sondern als «eine junge Künstlerin, frisch von der Uni», als wollte er sagen, mich kriegst du nicht, aber hier ist etwas, was du vielleicht mitnehmen könntest. Ein Angebot, das sie erst umschiffen musste, bevor sie ihn weiterbearbeiten und dazu bringen konnte, ihrem Atelierbesuch zuzustimmen.
«Mit einem Kunstabschluss von der …?», fragte sie mich.
«UNR», antwortete ich. Ich wusste, dass die Initialen der Uni ihr nichts sagen würden.
«Sie ist von der Land Art beeinflusst», sagte Sandro. «Und ihre Ideen sind toll. Sie hat einen sehr schönen Film über Reno gemacht.»
Helen Hellenberger repräsentierte die bekanntesten Land-Art-Künstler, alle lange dabei, alle erste Garde, und umso peinlicher war es mir, dass Sandro sie drängte, mich und meine Arbeit kennenzulernen. Ich war noch nicht so weit, bei Helen Hellenberger auszustellen, und indem er das Gegenteil behauptete, kränkte Sandro mich, auch wenn er das nicht unbedingt beabsichtigte. Vielleicht wusste er es auch. Fand es auf eine perverse Art witzig, mich an seiner Stelle anzubieten.
«Oh. Wo, sagten Sie –» Sie heuchelte minimale Höflichkeit, gerade genug, damit er zufrieden war.
«Nevada», sagte ich.
«Nun, da können Sie ja jetzt wirklich etwas über Kunst lernen.» Sie lächelte ihn an, als deponiere sie ein Geheimnis zwischen ihm und sich. «Wo Sie mit Sandro Valera zusammen sind. Was für ein Mentor für jemanden, der gerade erst aus … Idaho? … kommt.»
«Reno», sagte Sandro. «Sie fährt bald wieder hin, um da draußen ein Kunstprojekt zu machen. Sie will eine Linie über die Salzwüste ziehen. Das wird toll. Und subtil. Sie hat sehr subtile Ideen bezüglich der Linie und des Zeichnens.»
Er hatte versucht, den Arm um mich zu legen, aber ich war von ihm abgerückt. Ich wusste, wie diese schöne Frau, die mit der Hälfte ihres Stalls schlief – jedenfalls Ronnie Fontaine zufolge, und der gehörte selbst zu ihrem Stall –, mich sah: Ich störte bloß ein bisschen ihre Bemühungen, Sandros Repräsentantin zu werden.
«Sie fahren also in den Westen?», hatte sie gesagt, bevor wir auseinandergingen, und mich dann mit nicht ganz echt wirkendem Interesse nach den Einzelheiten meines Projekts befragt. Erst viel später dachte ich an diesen Moment zurück, betrachtete ihn genauer. Sie fahren weg? Reno, Idaho. Weit weg.
Als meine Abreise näher rückte, führte Sandro sich auf, als käme ich womöglich nicht wieder, als überließe ich ihn der Einsamkeit und Langeweile, eine Buße, mit der er sich notgedrungen abfinden müsse. Er verdrehte die Augen wegen der Verabredung, zu der Helen Hellenberger ihn genötigt hatte.
«Ich werde hier von Aasgeiern gefressen», sagte er, «während du über die Salzwüste jagst und meine unbekannten Rivalen dich anschmachten wie die Idioten. Das machst du nämlich mit den Leuten», hatte er gesagt, «du hinderst sie am Denken. Mit deiner jugendlichen Energie.»
Wenn’s mal mehrere sein sollen. Ich saß an der Raststätte, blickte auf die Reklametafel und war so naiv zu glauben, meine jugendliche Energie wäre genug.
Zu Helen Hellenbergers Stall von Land-Art-Künstlern gehörte auch der berühmteste, Robert Smithson, der drei Jahre zuvor, als ich noch an der UNR studierte, gestorben war. Von ihm und der Spiral Jetty hatte ich durch einen Nachruf in der Zeitung erfahren, nicht durch mein Kunstinstitut, das provinziell und konservativ war (insofern traf Helens brüskierende Bemerkung ins Schwarze, denn ich lernte von Sandro tatsächlich mehr, als uns an der Uni beigebracht worden war). In dem Nachruf kam der Vorarbeiter zu Wort, der die Spiral Jetty gebaut hatte – er erzählte, wie schwierig es gewesen sei, auf so weichem Boden zu bauen, und dass er beinahe sehr teures Gerät verloren hätte. Er habe Männer und Frontlader aufs Spiel gesetzt und es schon bereut, sich überhaupt auf die Sache eingelassen zu haben, und dann taucht der Künstler in der Sommerwüste Utahs auf, es sind 48 Grad, und der Typ trägt schwarze Lederhosen. Auch ein Zitat von Smithson selbst war abgedruckt, Umweltverschmutzung und Industrie, hieß es da, könnten etwas Wunderschönes sein, und er habe für sein Projekt diesen Teil des Großen Salzsees wegen des Bahnliniendurchstichs und der Unterwasser-Ölbohrungen gewählt, weil dadurch die Frischwasserzufuhr künstlich beschränkt worden und der Salzgehalt derart gestiegen sei, dass außer roten Algen nichts mehr wachsen könne. Das hatte ich mir sofort ansehen wollen, dieses Werk eines New Yorker Künstlers in Lederhosen, der die Abraumhaldenwelt des Westens mehr oder weniger so beschrieb, wie ich sie kannte, und seiner Aufmerksamkeit für wert befand. Ich fuhr hin, überquerte den höchsten Punkt Nevadas und kam knapp oberhalb der Grenze zu Utah hinunter. Ich beobachtete das Wasser, das seltsame Strömungsblüten trieb, schaumig, weiß und zerfranst. Sie sahen fast wie Schnee aus, bewegten sich aber wie Seife, zitternd und gewichtslos. Stachelige Wüstenpflanzen am Ufer waren in einen Eispelz aus weißem Salz gehüllt. Die Spiralmole war überschwemmt, aber ich konnte sie unter der Wasseroberfläche sehen. Sie bestand aus dem Basalt des Seeufers, der zu einem neuen Gebilde geformt war. Die besten Ideen waren oft so einfach, im Grunde offensichtlich, nur dass noch keiner darauf gekommen war. Ich schaute auf das Wasser und das ferne Ufer des Sees, ein großes Becken Leere, zerklüftete Felsen, hohe Sonne, Stille. Ich würde nach New York ziehen.
Was paradox war, weil der Künstler seinerseits aus New York hierhergekommen war, um seine speziell an den Westen des Landes geknüpften Träume wahrzumachen. Ich stammte von hier, aus der Helm tragenden, Kipplaster fahrenden Welt, die von den Land-Art-Künstlern verklärt wurde. Warum tat Helen Hellenberger dann so, als verwechsle sie Nevada mit Idaho? Es war paradox, aber auch eine Tatsache, dass man erst nach New York ziehen musste, um ein Künstler des Westens zu werden. Wenn es das war, was ich werden würde. «Sie ist von der Land Art beeinflusst», hatte Sandro verkündet, aber das diente ihm auch als Ausrede dafür, dass er mit einer so jungen Frau zusammen war, für die keine vorzeigbare Herkunft sprach und keine Leistung. Nur sein Wort.
Als ich ein Kind war und in den Sierras Ski lief, hatte ich das Gefühl, auf den Berghängen zu zeichnen, schwungvolle, anmutige Linien zu ziehen. So hatte ich mit dem Zeichnen begonnen, erzählte ich Sandro, als kleines Mädchen von fünf, sechs Jahren auf Skiern. Später, nachdem mir das Zeichnen zur Gewohnheit geworden war, zu einer Lebensweise, einem Zeitvertreib, dachte ich dabei immer ans Skilaufen. Dann fing ich an, Rennen zu fahren, Slalom und Riesenslalom, und es kam mir vor, als folgte ich bereits vorgezogenen Linien, sodass die primäre Herausforderung, in wettbewerbsfähiger Zeit ins Ziel zu kommen, von der technischen überlagert wurde, exakt in diesen Linien zu bleiben, von den Starttoren an keine Spuren zu hinterlassen, denn je stärker man die Metallkanten seiner Skier einsetzte, je breiter der Keil, den man hinterließ, umso langsamer wurde man. Es galt, keinen Schnee hinter sich aufzuwirbeln. Spurlos zu bleiben. Die Skier so flach wie möglich auf dem Boden zu halten. Die Furchen, die durch die Bambustore und um sie herumführten, tiefe Gräben, wenn der Schnee weich war, ließen sich meiden, indem ich hoch fuhr, einen hohen, anmutigen Kurs wählte und ohne jähe Schlenker oder zittrige Kanten zur Ziellinie raste.
Skirennen fahren war Zeichnen nach Zeit, sagte ich zu Sandro. Endlich hatte ich einen Zuhörer, der mich verstehen wollte: Die beiden Dinge, die ich liebte, waren das Zeichnen und die Geschwindigkeit, und mit dem Skifahren hatte ich sie kombiniert. Skifahren war Zeichnen, um zu siegen.
In unserem ersten gemeinsamen Winter fuhren Sandro und ich über Weihnachten nach Rhinebeck zu den Kastles. Eines Nachts schneite es heftig, und am Morgen lieh ich mir Langlaufskier und lief über einen zugefrorenen Teich, machte Spuren darauf, die ein großes X bildeten, und fotografierte sie. «Das wird gut», sagte Sandro, «dein X.» Aber ich war nicht zufrieden. Die tapsigen Kleckse der Skistöcke alle drei Meter, zu viel Anstrengung. Langlauf war wie Joggen. Es war wie Gehen. Kontemplativ und aerob. Eine Spur war besser, wenn sie sauber war, wenn sie bei unnatürlicher Geschwindigkeit entstand. Ich fragte die Kastles, ob wir uns ihren Geländewagen ausleihen dürften. Auf der schneebedeckten Wiese hinter dem zugefrorenen Teich zeichneten wir Doughnuts, indem ich das Lenkrad herumwirbelte, wie Scott und Andy es mir beigebracht hatten, und Sandro lachte, als die Reifen schlitterten. Ich machte breite, kreisförmige Spuren auf der Wiese und fotografierte auch die. Aber es war nichts weiter als eine schöne Zerstreuung auf dem Land. Ich glaubte, Kunst erwachse aus einer grüblerischen Einsamkeit. Ich fand, sie müsse ein Risiko beinhalten, ein echtes Risiko.
Meine fünf Minuten auf dem Rastplatz waren fast vorüber. Ich flocht mir die Haare neu, die vom Wind verklettet und von der Polsterung meines Helms an komischen Stellen gewellt waren.
Ein paar Fahrer diskutierten über LKW-Farben. Ein purpurner Sattelschlepper glänzte wie Traubeneis zwischen den Reihen anderer Laster. Ein Becher Cola segelte auf seine Kühlerhaube zu, gab mit einem Knall und Eiswürfelgeklapper sein Votum ab. Die Männer lachten und gingen auseinander. Nevada war ein Ton, ein Licht, eine Stumpfheit, alles Teil von mir. Aber jetzt wiederzukommen war anders. Ich war weggegangen. Ich war nicht hier, weil ich hier hängengeblieben war, sondern um etwas zu tun. Es zu tun und dann nach New York zurückzukehren.
Einer der Fahrer sprach mich an. «Ihrs?»
Einen Moment lang dachte ich, er meinte den Sattelschlepper. Aber er wies mit dem Kinn auf die Moto Valera.
Ich sagte ja und flocht mir weiter die Haare.
Er lächelte freundlich. «Wissen Sie was?»
Ich erwiderte das Lächeln.
«Wenn man Sie im Leichensack vom Highway schafft, sehen Sie nicht mehr annähernd so gut aus.»
ALLE FAHRZEUGE MIT NUTZTIEREN MÜSSEN GEWOGEN WERDEN. Ich fuhr an der Wiegestation vorbei, beschleunigte schnell durch den dritten Gang in den Mittelbereich des vierten, bis ich bei hundertzehn Stundenkilometern war. Ich konnte die gezackten Gipfel hoher Berge sehen, Sommerfirn, durch den Filter des Wüstendunsts strumpfhosenbräunlich gefärbt. Ich fuhr jetzt hundertdreißig. Nicht mehr annähernd so gut. Die Menschen lieben tödliche Unfälle. Ich zog den Gashebel voll auf, noch immer im vierten Gang, abwartend.
Ein Stück vor mir auf der rechten Fahrbahn blinkte die Rückseite von etwas Silbernem auf. Ich nahm Gas weg, schaltete aber nicht herunter. Als ich näher kam, erkannte ich die vertrauten Rundungen eines Greyhounds. Bildet den Charakter, sagte meine Mutter oft. Sie war in den frühen Fünfzigern mal allein mit Bussen durch die Gegend gefahren, eine Episode kurz vor meiner Geburt, die nie weiter erklärt wurde und nicht ganz ungefährlich schien, eine junge Frau, die sich mal mit diesem, mal mit jenem Bus treiben ließ und sich auf Tankstellenklos kaltes Wasser ins Gesicht klatschte. Das Filmmaterial lief in kontrastreichem Schwarzweiß durch meinen Kopf, in Streifen geschnittenes Licht, verzweifelte Frauen, die sich versehentlich mit Telefonkabeln strangulierten oder, allein mit dem Geld, an einem bewölkten Strand saßen und tranken, eine große Sonnenbrille im Gesicht. Das Leben meiner Mutter war nicht so glamourös. Sie war Telefonistin, und wenn es in ihrer Vergangenheit etwas noir-Ähnliches gab, dann nur den düsteren Teil davon, den Umstand also, dass sie weiblich, arm und allein war, was in einem Film schon ausreichte, um die Intrige einzuführen, in ihrem Leben aber nur meinen Vater anzog. Er verschwand, als ich drei war. Kein großer Verlust, meinten alle in der Familie, Onkel Bobby sei mir ein besserer Vater, als mein eigener es hätte sein können. Als ich mich dem Greyhound näherte und zum Überholen ansetzte, sah ich, dass die Fenster engmaschig vergittert und geschwärzt waren. Aus der losen unteren Heckverkleidung bliesen unbekümmert die Abgase, an der Seite stand NEVADA STRAFVOLLZUG. Ein mobiles Gefängnis, mit Insassen, die nicht rausgucken konnten. Aber vielleicht machte Rausgucken es noch schlimmer. Als Kind war ich mal mit meinem Fahrrad um das Bezirksgefängnis herumgefahren und hatte einen Mann gesehen, der durch die Gitterstäbe seines Fensters auf mich runterstarrte. Ein feiner Regen fiel. Ich hörte auf, in die Pedale zu treten, und sah zu seinem kleinen Gesicht hoch, das von einem erdschweren Fladen fettiger blonder Haare gerahmt war. Der Regen war fast unsichtbar. Der Mann steckte einen Arm durch die Stäbe. Um den Regen zu spüren, dachte ich. Er zeigte mir den Mittelfinger.
«Spar dir deine Freiheit für einen Regentag auf», hatte jemand in Rudy’s Bar in SoHo, wo Sandro und Ronnie gern hingingen, an die Toilettenwand geschrieben. Es blieb den ganzen Sommer dort stehen, auf Augenhöhe über dem Waschbecken. Keine Widerworte, keine Streichungen. Nur dieser blanke Befehl, wenn man sich vorbeugte und die Hände unter dem Wasserhahn drehte.
Ich zog an dem Bus vorbei, schaltete in den Fünften und beschleunigte auf hundertvierzig. Die orange Nadel auf dem schwarzen Zifferblatt meines Tachos war ruhig und stabil. Ich schmiegte mich in die Verkleidung. Sie hatte mich auf den ersten Blick begeistert, als ich das Motorrad bei dem Händler in Reno abholte. Glitzerndes Blaugrün, wie Tiefkühleis. Es war eine brandneue 650 Supersport. Sogar ein 77er-Modell, vom kommenden Jahr. So neu, dass in den Vereinigten Staaten niemand außer mir eine besaß. Ich hatte noch nie eine Moto Valera in dieser Farbe gesehen. Die Maschine, die ich am College gehabt hatte, Baujahr 65, war weiß gewesen.
Ich fuhr Motorrad, seit ich vierzehn war. Angefangen hatte ich in den Wäldern hinter unserem Haus mit Scott und Andy, die Yamaha DTs hatten, die ersten richtigen Geländemotorräder. Bevor ich selbst fahren lernte, saß ich hinten auf den Scramblers meiner Cousins, Straßenmotorrädern, die sie hergerichtet hatten, ohne Fußrasten für den Sozius, sodass ich die Beine zur Seite strecken und hoffen musste, mich nicht am Auspuff zu verbrennen. Sie waren nicht für den Verkehr zugelassen, hatten weder Scheinwerfer noch Nummernschild, aber Scott und Andy fuhren trotzdem überall in Reno mit mir herum. Nur nicht vorne an unserem Haus vorbei, denn meine Mutter hatte mir verboten, bei meinen Cousins mitzufahren. Wenn sie Wheelies oder Sprünge machten, hielt ich mich fest und lernte schnell vertrauen. Allerdings nicht Scott oder Andy – einer von ihnen riss bei einem Wheelie mal das Motorrad zu hoch, sodass es mit mir nach hinten kippte (er hatte noch nicht gelernt, auf die Fußbremse zu treten und die Maschine so nach vorn zu neigen), und der andere sprang auf einer Baustelle über einen Schutthaufen, nachdem er gesagt hatte, ich solle mich festhalten. Das war Andy. Er landete zu steil auf dem Vorderrad, und wir flogen über den Lenker. Ich vertraute nicht ihren Fähigkeiten; dazu hatte ich keinen Grund, denn sie bauten regelmäßig Unfälle. Ich vertraute der Notwendigkeit des Risikos, der Bedeutung, die ihm beizumessen war. Als ich aufs College kam, kaufte ich mir eine Moto Valera, die ich später wieder verkaufte, um nach New York zu ziehen. Ich dachte, wegen meines neuen Lebens in der großen Stadt würde ich das Interesse daran verlieren, aber so war es nicht. Vielleicht wäre es anders gewesen, hätte ich nicht Sandro Valera kennengelernt.
Ich fuhr jetzt hundertsechzig und versuchte, in meiner gebückten Haltung vernünftig zu lenken, während Insekten gegen den Windschutz tickten, ploppten und klatschten.
Die Gedanken schweifen zu lassen war Selbstmord. Ich hatte mir versprochen, das nicht zu tun. Auf der linken Spur war ein Winnebago mit einem VW Käfer im Schlepptau. Er fuhr ungefähr sechzig, schien auf der Straße stillzustehen. Wir befanden uns in unterschiedlichen Realitäten: schnell und langsam. Es gibt keine feststehende Realität, nur kontrastierende Gegenstände. Selbst die Erde bewegt sich. Plötzlich war ich direkt hinter der Stoßstange des Käfers und musste auf die rechte Spur ausscheren. Die Straße war in schlechtem Zustand, und ich fuhr in ein Schlagloch. Das Vorderrad brach aus. Ich hoppelte und schlingerte. Das Vorderteil des Motorrads wackelte wie verrückt. Ich wagte es nicht, die Bremse zu berühren, sondern versuchte, das Gewackel auszusitzen. Über meine Spur eiernd, rechnete ich schon damit, dass ich mich gleich hinlegen würde, dabei hatte ich die Salzwüste noch gar nicht erreicht. Doch dann beruhigte das Vorderrad sich allmählich und richtete sich wieder gerade aus. Ich fuhr auf der linken Spur zurück, wo der Belag besser war. Das Gewackel, das mich erfasst hatte, war mein Weckruf gewesen. Ich konnte von Glück sagen, dass ich nicht gestürzt war. «Jeder hat ein Recht auf Geschwindigkeit», lautete der neue Werbespruch von Honda, aber Geschwindigkeit war kein Recht. Geschwindigkeit war ein Fahrdamm zwischen Leben und Tod, und man konnte nur hoffen, auf der Seite des Lebens herauszukommen.
Gegen Abend hielt ich an, um zu tanken. Der weite Himmel war jetzt ein kaltes Mittelblau mit einem einzelnen Stern darin, einem einsamen, strahlend weißen Nadelstich. Ein Auto hielt auf der anderen Seite der Zapfsäulen. Die Fenster waren unten, und ich hörte einen Mann und eine Frau reden.
Der Mann schraubte die Tankkappe ab und knallte den Stutzen in die Öffnung, als ginge er nur mit Kraft richtig hinein. Dann ruckelte er ihn auf anzügliche Art abwechselnd rein und raus. Er kehrte mir den Rücken zu. Ich beobachtete ihn, während ich meinen Tank füllte. Als ich fertig war, stieg die Frau aus. Sie sah in meine Richtung, schien mich aber nicht wahrzunehmen.
«Du hast deine Wahl getroffen», sagte sie. «Und ich treffe meine. Arsch.»
Irgendetwas an dem Licht, an seiner Schummrigkeit und dem tiefer werdenden Blau über uns, das den Insekten der Dämmerung den Einsatz gab, ließ ihre Stimmen nah und intim klingen.
«Du nennst mich Arsch nach dem, was du von mir verlangt hast? Und jetzt ist das nichts? Ich bin ein Arsch?»
Der Mann zog den Stutzen aus dem Tank und machte damit eine ruckartige Bewegung in ihre Richtung. Benzin schwappte auf ihre nackten Beine. Er tankte weiter. Hinterher hängte er den Stutzen nicht wieder in die Halterung seitlich der Säule, sondern ließ ihn fallen wie einen Gartenschlauch nach dem Sprengen. Er holte Streichhölzer aus seiner Tasche und begann, sie anzuzünden und nach der Frau zu werfen. Jedes entzündete Streichholz flog im Bogen durch das dämmrige Licht und ging aus, bevor es sie erreichte. Benzin rann ihr an den Beinen hinunter. Ein Streichholz nach dem anderen zündete er an und bewarf sie damit, kleine Funken – Drohungen oder Versprechen –, die matt erloschen.
«Hörst du mal auf damit?», sagte sie, während sie ihre Beine mit den blauen Papierhandtüchern aus einem Spender neben den Zapfsäulen trockentupfte.
Klickend und summend sprangen die geneigt montierten Natriumlichter über uns an. Auf dem Highway kam ein LKW vorbei und betätigte seine Druckluftbremsen.
«He», sagte er. Er packte eine Haarlocke von ihr.
Sie lächelte ihn an, als wollten sie gleich zusammen eine Bank ausrauben.
Die Nacht brach hier von einem Moment auf den anderen herein. Ich fuhr weiter, während die Dunkelheit die Wüste verwandelte. Sie war jetzt durchlässiger, grenzenloser, obwohl mein Sichtfeld sich auf einen Traktorstrahl beschränkte, der einen dünnen Fächer vor mir auf die Straße breitete. Das ungeheure Ausmaß an Finsternis wurde nur selten von einer schwachen Fluoreszenz durchbrochen – ein, zwei Tankstellen. Ich dachte über den Mann nach, der versucht hatte, die Frau anzuzünden. Er hatte nicht wirklich versucht, sie anzuzünden. Bestimmte Akte, gleich wie real, sind nur Gesten. Er meinte: «Was, wenn ich es tun würde?» Und sie meinte: «Nur zu.»
Die Luft wurde kalt, als ich eine höhere Ebene des von warm nach kalt geschichteten Wüstenparfaits erklomm. Der Wind drang durch meine Lederkleidung, wo er nur konnte. Mit solcher Kälte hatte ich nicht gerechnet. Meine Finger waren fast zu steif, um die Bremse zu betätigen, als ich mein Ziel erreichte, eine kleine Stadt mit großen Kasinos an der Grenze zu Utah, wo ein Diamond-Jim-Schriftzug in der Nacht golden leuchtete. Nur ein Spaßverderber konnte behaupten, Neon sei nicht schön. Hüpfend und tanzend jagten die Buchstaben ihr eigenes Nachbild. Aber von einem Ende der Hauptstraße zum anderen nichts als BESETZT-Schilder in Glutorange. Ich hielt vor einem der vollen Motels, auf dessen Parkplatz lauter Rennwagentransporter standen, und hoffte, hier hätten sie vielleicht Erbarmen mit mir. Ich kämpfte mit den Handschuhen, und als ich sie endlich abgestreift hatte, bekam ich den Kinnriemen des Helms kaum auf. Meine Hände hatten sich auf zwei Funktionen reduziert, Gas geben und bremsen. Ich versuchte, Geld und Führerschein aus meiner Brieftasche zu nehmen, aber meine tauben Finger weigerten sich, diesen einfachen Akt auszuführen. Ich mühte und mühte mich, die Beweglichkeit wiederzuerlangen. Schließlich schaffte ich es, den Helm abzusetzen, und ging ins Büro. Eine Frau sagte, sie seien ausgebucht. Aus einem Hinterzimmer kam ein Mann dazu, ungefähr so alt wie ich. «Ich mach das schon, Laura.» Er sagte, er sei der Sohn des Besitzers, und ich schöpfte ein wenig Hoffnung. Ich erklärte ihm, dass ich den ganzen Weg aus Reno hergekommen sei und unbedingt einen Platz zum Schlafen brauchte, weil ich vorhätte, in der Salzwüste anzutreten.
«Vielleicht lässt sich da was arrangieren», sagte er.
«Wirklich?», fragte ich.
«Ich kann nichts versprechen, aber wollen wir nicht im Kasino was trinken gehen und uns darüber unterhalten?»
«Unterhalten?»
«Vielleicht kann ich was arrangieren. Zumindest spendiere ich Ihnen einen Drink.»
Es schienen immer der Sohn der Macht, die Tochter der Macht zu sein, die bereit waren, sie zu missbrauchen.
«Eher nicht», sagte ich. «Wo ist Ihr Vater?»
«Im Pflegeheim.» Er wandte sich zum Gehen. «Okay, letztes Angebot, ein Drink.»
Ich sagte nein und ging. Draußen vor dem Büro sprach mich ein anderer Mann an.
«Hallo», sagte er. «So ein Blödmann. Das war Schwachsinn.»
Der Mann hieß Stretch. Er war der Hausmeister und bewohnte eins der Zimmer. Er war braun gebrannt wie ein Bauarbeiter im Sommer, aber großen Arbeitseifer strahlte er nicht aus. Er trug Jeans und ein Hemd in dem gleichen verblichenen Blauton und hatte eine Rockerfrisur, als wäre es 1956, nicht 1976. Er erinnerte mich an den jungen Herumtreiber in Jacques Demys Film Das Fotomodell, der die Zeit vor seiner Einberufung totschlägt, indem er umherstreift und eine Schönheit in einem weißen Cabriolet durch die Ebenen und in die Hügel Hollywoods hinein verfolgt.
«Hören Sie, ich muss die ganze Nacht den Rennwagen von dem Blödmann bewachen», sagte Stretch. «Ich brauche mein Zimmer nicht. Und Sie brauchen einen Platz zum Schlafen. Wollen Sie nicht da übernachten? Ich verspreche Ihnen, Sie nicht zu belästigen. Das Zimmer hat einen Fernseher. Und im Kühlschrank gibt’s Bier. Es ist einfach, aber besser, als ein Bett mit ihm zu teilen. Ich klopfe morgen früh an, wenn ich duschen will, aber dabei bleibt es, das schwöre ich Ihnen. Ich hasse es, wenn er jemanden auszunutzen versucht. Es kotzt mich an.»
Das war ein Akt der Barmherzigkeit von der Art, die man nicht hinterfragt. Ich vertraute ihm. Zum Teil, weil er mich an besagte Filmfigur erinnerte. Ich hatte Das Fotomodell zusammen mit Sandro gesehen, kurz nachdem wir uns kennengelernt hatten, was ein Jahr her war. Die Pointe wurde zu einem Witz zwischen uns: «Vielleicht morgen. Vielleicht nie. Vielleicht.» Der Film beginnt mit Ölbohrtürmen, deren Pumpschwengel sich vor dem Fenster des Liebesnests eines jungen Paars in Venice auf und ab bewegen. Das Paar sind der Herumtreiber und eine Freundin, die ihm nichts bedeutet. Der Anfang war Sandros Lieblingsszene und der Grund, warum er diesen Film so mochte, Ölbohrtürme direkt vor dem Fenster, rauf, runter, rauf, runter, während das Mädchen und der Junge sich im Bett fläzten, stritten und in ihrem baufälligen, von Industriebauten überschatteten Bungalow herumpusselten. Danach verwendeten wir oft das Wort Bungalow. «Kommst du heute Abend in meinen Bungalow?», fragte Sandro mich gern. Dabei war es ein Gebäude aus Glas und Gusseisen, dreihundertsiebzig Quadratmeter pro Stockwerk.
Stretch zeigte mir sein Zimmer. Es war aufgeräumt und ein bisschen rührend. Der Sohn des Besitzers hatte die Hälfte des Raums mit seiner Sammlung alter Cruiser-Fahrräder sowie stapelweise hölzernen Milchkästen voller Schraubenschlüssel und Fahrradteile zugestellt. Stretch sagte, er habe sich daran gewöhnt. Auf einer Seite des Waschbeckens stand eine Kochplatte, auf der anderen hatte er sein Rasierzeug und Brylcreem deponiert. Es sah aus wie das Set für einen Film über einen Herumtreiber namens Stretch, der in einer kleinen Glücksspielstadt an der Grenze Nevadas lebt.
In einem mexikanischen Restaurant gegenüber vom Motel bestellte ich Fisch, der im Ganzen kam. Ich stocherte darin herum, unsicher, was die richtige Methode war, und beschloss dann, den Kopf abzuschneiden. Er lag auf meinem Teller wie ein vom Rumpf getrenntes Flugzeugcockpit. In seinem Innern keine nach Menthol riechenden Piloten, sondern das dunkle Gekröse des einstigen Fischhirns. Ich musste mich abwenden und beobachtete zwei Männer, die in einer Nische auf der anderen Seite saßen, auch sie wahrscheinlich hier, um einen fahrbaren Untersatz durch die Salzwüste zu manövrieren. Große Schnurrbärte, von Sonne und Wind gegrillte Gesichter, Hosenträger links und rechts der majestätischen Wänste. Die Kellnerin brachte ihnen zwei Enchilada-Teller, große Seen aus heißem Käse und Bohnen. Als sie die Teller abstellte, hörten die Männer auf zu reden und nahmen sich jeder einen Moment Zeit, um still ihr Essen zu betrachten, es wirklich zu betrachten. Das machten alle Menschen in Restaurants: innehalten, um das Essen zu begutachten, aber es fiel mir nur auf, wenn ich allein war.
Stretchs Bettwäsche war aus weichem Baumwollflanell, sicher nicht vom Motel. Dass Männer sich nach häuslicher Behaglichkeit sehnten, überraschte mich immer wieder. Sandro hatte als Junge auf dem Boden geschlafen, hatte gefunden, er verdiene kein Bett. Es war eine Entsagung, mit der er seine Privilegien zurückweisen, sie ablehnen konnte. Mir war es egal, ob ich ein Bett verdiente oder nicht, aber ich kam nur schwer zur Ruhe. Lastwagen vom Highway polterten durch meinen leichten Schlaf. Mir wurde nicht warm, und ich breitete meine Jacke über die Decke, mit der Lederseite nach oben wie eine Brotkruste. Ich machte mir Sorgen, dass Stretch sich zu mir ins Bett stehlen würde. Als ich mir das ausgeredet hatte, machte ich mir Sorgen über den nächsten Tag und meine Geschwindigkeitsprüfung auf dem Salz. Was würde mir passieren? In gewisser Hinsicht war es egal. Ich war hier. Ich zog es durch.
In den Tiefen des kalten Motelschlafs träumte ich von einer gigantischen Maschine, einem Flugzeug, so groß, dass es den Himmel mit Metall und den Harkgeräuschen gedrosselter Motoren erfüllte. Ich war nicht in Nevada, sondern zu Hause in New York, das von der schrecklichen Maschine, einem hundertfach vergrößerten Passagierflugzeug, überschattet und verdunkelt wurde. Sie flog langsam, wie kurz vor der Landung, aber ohne Lichter unter den Tragflächen. Während sie tiefer und tiefer sank, sah ich die riesigen, hässlichen Landeklappen, voller Nieten, offen an schmierigen Scharnieren, bis nichts mehr vom Himmel übrig war als ein blaugraues Fahrwerk und ein umfassendes Kreischen.
Am Morgen kam Stretch herein und duschte. Während das Wasser lief, zog ich schnell meine Lederkombi an. Ich war dabei, das Bett zu machen, als er herauskam, mit dem Handtuch um die Hüften. Groß, blond und schlaksig wie eine Giraffe, mit Wassertropfen auf der von der heißen Dusche geröteten Haut. Er bat mich, einen Moment wegzuschauen. Als er sich umzog, spürte ich seine Nacktheit, aber genauso gut hätte er behaupten können, meine zu spüren, gleich unter meinen Kleidern.
Fertig angezogen, setzte er sich aufs Bett und kämmte sich das nasse Haar zu seiner eigenen Siebziger-Jahre-Version eines Entenschwanzes, streng und ordentlich, aber über den ganzen Nacken reichend. Das wichtige Thema Kleinstadthaar. Ich schnürte meine Stiefel. Wir redeten über die Geschwindigkeitsprüfungen, die heute anfingen. Ich erzählte ihm, dass ich mitmachen würde, sagte aber nichts von Kunst. Das war keine Lüge. Ich war ein Mädchen aus Nevada und Motorradfahrerin. Landgeschwindigkeitsrekorde hatten mich schon immer interessiert. Das kombinierte ich jetzt mit einer New Yorker Rationalität, mit abstrakten Ideen über Spuren und Geschwindigkeit, was Stretch nicht unbedingt zu wissen brauchte. Es hätte mich wie eine Touristin wirken lassen.
Stretch sagte, der Sohn des Motelbesitzers schicke eine Corvette an den Start, aber er könne nicht mal den Ölstand oder den Reifendruck messen, Mechaniker arbeiteten daran, und ein Fahrer gehe für ihn ins Rennen.
«Ich muss die Rennformulare für ihn ausfüllen, weil er nicht weiß, was ‹Hubraum› heißt.» Er lachte und verstummte dann.
«Ich bin noch nie einem Mädchen begegnet, das ein italienisches Motorrad fährt», sagte er nach einer Weile. «Es ist, als wären Sie nicht echt.»
Er musterte meinen Helm, die Handschuhe, meinen Motorradschlüssel auf seinem Schreibtisch. Das Zimmer schien den Atem anzuhalten, der Motelvorhang wurde vom Luftzug des halb geöffneten Fensters gegen die Scheibe gesogen, und ein Streifen Sonne flackerte unter seinem Saum, aber der lichtabweisende Stoff hielt die Außenwelt fern.
Er wünschte, er könne mein Rennen sehen, sagte er, aber er sei hier angebunden, müsse eine schimmelige Dusche neu fliesen.
«Macht nichts», sagte ich. Ich war erleichtert. Ich spürte, dass dieses Zwischenspiel, meine Nacht in Stretchs Bett, sich lieber nicht mit meinem nächsten Ziel überlappen sollte.
«Glauben Sie, Sie kommen hier noch mal durch?», fragte er. «Ich meine, jemals?»
Ich blickte auf die Kästen mit Werkzeug und die chaotische Sammlung Fahrräder, manche davon in gutem Zustand, andere verrostete Skelette mit eingeschmolzenen Ketten, die der Sohn des Besitzers vielleicht nur aufbewahrte, weil das Zimmer des armen Stretch so viel Stauraum bot. Ich dachte daran, dass Stretch die ganze Nacht auf einem Parkplatz hatte sitzen müssen, anstatt sich in sein eigenes Bett zu legen, und ich schwöre, ich war drauf und dran, mit ihm zu schlafen. Ich sah unser Leben vor mir, Stretch, wie er am Ende eines Arbeitstags, mit Mörtelstaub bedeckt oder sauber, Kniestrümpfe über seine langen, kegelförmigen Waden zog. Die kleinen Episoden der Grobheit und der Gnade, die er erlebt hatte und in Miniaturform mit mir nachspielen würde.
Ich stand auf, nahm meinen Helm und meine Handschuhe und sagte, ich käme wohl nicht so schnell wieder her. Dann umarmte ich ihn zum Dank.
Er sagte, nun müsse er vielleicht noch einmal duschen, und zwar kalt, und irgendwie fand ich das nicht unangenehm, sondern süß.
Später erinnerte ich mich vor allem daran, wie er meinen Namen ausgesprochen hatte. Es hatte geklungen, als glaubte er, mich zu kennen.
Gelegentlich ließ ich meine Gedanken in den luftigen Raum zwischen mir und Stretchs wie auch immer gearteter Vorstellung von mir fallen. Er würde verstehen, woher ich kam, selbst wenn wir uns nicht über Filme oder Kunst unterhalten könnten. «Warst du in Vietnam?», würde ich ihn fragen, darauf gefasst, dass eine furchtbare Geschichte herausgesprudelt käme und ich ihn trösten könnte, während wir im Führerhaus eines alten weißen Pickups saßen, vor uns über dem flachen Rand des Horizonts von Nevada die Wüstensonne, orange und riesengroß. «Ich?», würde er sagen. «Ach was.»
Auf der kurzen Fahrt von der Stadt zur Salzwüste glitzerte das Land unter der Morgensonne. Weiß, Sand, Rosé und Malve – das waren die Farben hier, der Sandton an manchen Stellen ins Grünliche changierend, mit sporadischen Ausbrüchen pulverigen Gelbs, wildwüchsigen Sonnenblumen, drei Blüten pro Schaltknüppelstiel.
Das letzte Unternehmen der kleinen Glücksspielstadt war ein Gelände mit Wohnwagen, allein auf einem Felsen ausgesetzt. ALKOHOL, TANZ UND NACKTE FRAUEN. Ich dachte wieder an Pat Nixon, an Unterwäsche in einer Pat-Nixon-Farbpalette. Bleicher Pfirsich oder zitronenheller Chiffon. Als Teenager in Reno hatte ich mir, als ich die Wörter Mustang Ranch hörte, ein großzügiges Landhotel vorgestellt, goldgeäderte Spiegel und runde Betten mit samtbezogenen Zierkissen in Hundeform. In Wirklichkeit war die Mustang Ranch nur eine Ansammlung heruntergekommener Wirtschaftsgebäude mit trübsinnigen, drogenabhängigen Frauen darin. Selbst nachdem ich verstanden hatte, was es war, schien es mir noch natürlich genug, bei Mustang Ranch an Landluxus zu denken, abgesenkte Wohnzimmer mit Hausbar, wo vielleicht jemand Wanda Jackson auflegte, «Tears at the Grand Ole Opry». Aber in solchen Etablissements hörten sie die Top Forty oder die Geräusche des Generators.
Jenseits der Zufahrtsstraße, die von der Interstate abging, brannte und schimmerte ein weißer See, der wie eine flach gehaltene Messerklinge zur Sonne zurückloderte. Schieres Weiß, das sich bis in derart weite Ferne erstreckte, dass man am Horizont eine leichte Krümmung der Erde ausmachte. Ich hörte den reißenden Schall eines Militärjets wie eine gigantische Maurerkelle, die durch nassen Beton gezogen wird, sah aber nur Blau über mir, ein rohes, sattes Blau, wie aus einem inneren Stück Himmel geschnitten. Der Jet hatte keinen Kondensstreifen hinterlassen, nur ein durchdringendes Geräusch, das aus mehr als einer Richtung zu kommen schien. Ein weiterer Jet schrammte über das Becken, hoch und unsichtbar. Ich musste sie auch in der Nacht gehört haben. Es gab einen Truppenübungsplatz in der Nähe, AREA G auf meiner Karte, eine graue Klammer. Ich dachte an Satelliten, sowjetische, die ich mir wie den klassischen globusförmigen Helm eines Tiefseetauchers vorstellte, eine funkelnde Kugel, die ihren Groove an den Himmel kratzte wie eine Plattennadel. Alles in Area G weggeräumt, einfahrbare Dächer geschlossen, Raketen für den angekündigten Forschungssatelliten aus dem Blickfeld gerollt, Umbau der Militärkulissen für den nächsten Akt.
Ich fragte mich, warum das Militär die Salzwüste nicht für sich beanspruchte, für seine eigenen Tests. Was für Tests, wusste ich selbst nicht, irgendwas mit Hitze, Geschwindigkeit, Schub und kreischenden Motoren. Die amerikanische Legende Flip Farmer war über diese Salzwüste gerast und hatte auf achthundert Stundenkilometer beschleunigt, in einem dreirädrigen, vierzehn Meter langen Aluminiumkanister mit dem Triebwerk eines Phantom-Jets der Navy. Warum Flip, ein normaler Bürger, und nicht die Militärs? Man sollte meinen, dass sie Interesse an einem Gelände für unkontrollierte und fast echolose Geschwindigkeit hätten. Aber die Militärs wollten keine gewaltige Salzwüste. Sie überließen sie, mehr oder weniger, Flip Farmer, dem Landgeschwindigkeitsweltrekordhalter.
Als junges Mädchen hatte ich Flip Farmer geliebt, so wie manche Mädchen Ponys, Eiskunstlauf oder Paul McCartney liebten. Ich hatte ein Poster von Flip und seinem Siegerwagen, dem Victory of Samothrace, über meinem Bett hängen. Flip mit seinem Cornflakeslächeln, in seinem silbrig blauen Landgeschwindigkeitsanzug (mit Reißverschluss), dessen Ripstop-Stoff an manchen Ecken und Falten ins Violette spielte, und den geschnürten, vanilleeisfarbenen Rennstiefeln. Er hatte einen Helm unter dem Arm, silbern, mit dem Schriftzug «Farmer» in kunstvollen purpurnen Lettern darauf. Bei den Vorbereitungen auf mein eigenes Rennen hatte ich das Bild kürzlich bei Strand in einem Buch über sein Leben wiedergefunden. Der Victory of Samothrace stand direkt hinter ihm auf dem Salz. Der Wagen war violett wie der Unterton seines feuerfesten Anzugs, mit der Hand verriebene, leicht glänzend lackierte Farbe, silberne Akzente auf Ansaugtrichtern und Heckkotflügel. Schieres Gewicht und schiere Energie, aber zugleich auch gewichtslos, mit einer gewaltigen Kielflosse, einem Haken, um an den Wolken zu kratzen.
Als ich zwölf war, kam Flip einmal durch Reno und gab in einem Kasino Autogramme. Ich hatte kein Hochglanzfoto, das er signieren konnte, also reichte ich ihm meine Hand. Wochenlang steckte ich sie beim Duschen in eine Plastiktüte, mit einem Gummiband ums Handgelenk. Das war noch keine richtige romantische Schwärmerei. Es gibt verschiedene Grade der Bereitschaft. Junge Mädchen machen sich keine Vorstellung von Sex, von ihrem Körper zusammen mit dem eines anderen. Das kommt später, aber vorher ist da nicht gar nichts, sondern eine unschuldige Verlagerung, ein Träumen, und Idole sind perfekt für die Träume eines jungen Mädchens. Sie sind nicht real. Sie sind nicht die Tankstellenwärter, die dich ins Hinterzimmer zu locken versuchen, der Zeitungsjunge, der dich in einen Werkzeugschuppen, der Vater einer Freundin, der dich in sein Auto zu locken versucht. Sie locken überhaupt nicht. Sie winken dich herbei, aber wie eine Fata Morgana. Flip Farmer war gefahrlos unerreichbar. Er war etwas Besonderes. Ich wählte ihn unter allen Männern auf der Welt, und er signierte meinen Handrücken und lächelte mit sehr weißen, geraden Zähnen. Er schenkte uns allen, Kindern und Erwachsenen, die wir bei Harrah’s Schlange standen, das gleiche Lächeln. Wir waren keine Individuen, sondern eine Oberfläche, über die er sich bewegte, lächelnd und entrückt. In Wahrheit hätte ich das Autogramm höchstwahrscheinlich von meiner Hand abgewaschen, wenn er meinen Blick erwidert hätte.
In dem Jahr, als Flip durch Reno kam, war er bei seinem Landgeschwindigkeitsrekord nur knapp dem Tod entronnen. Sein Fallschirm war zu früh aufgegangen, kurz nachdem der Wagen 820 Stundenkilometer erreicht hatte. Der Schirm schoss aus dem Heck des Victory und riss ab, woraufhin der Wagen zwischen den Kilometermarkierungen hin und her schleuderte. Das glich Flip noch aus, aber ohne Fallschirm war es ihm unmöglich, abzubremsen. Er fuhr noch immer achthundert. Er wusste, dass die Bremsen schmelzen und durchbrennen würden, sobald er sie auch nur leicht berührte, und dann hätte er gar keine Bremsen mehr. Sie waren für Geschwindigkeiten von weniger als 240 Stundenkilometern ausgelegt. Er musste den Wagen von selber langsamer werden lassen, doch er wurde nicht langsamer. Während er beinahe ohne Widerstand über das Salz flog, wurde Flip klar, dass gleich sowieso alles vorbei wäre. Ob er die Bremsen benutzte oder nicht, binnen kurzem wäre alles zu Ende. Also benutzte er sie doch. Er trat mit dem linken Schuh ganz leicht auf das Pedal. Es sackte bis zum Boden durch. Der Wagen segelte in unvermindertem Tempo weiter. Er trat mehrmals hintereinander auf die Bremse – nichts. Nur das dumpfe Geräusch des Pedals, das auf den Boden traf, während die Welt jenseits des durchsichtigen Dachs seiner Plastikluftblase sich verflüssigte.
Er flog am Null-Kilometerpunkt vorbei, dem Ende der offiziellen Rennstrecke. Sein Team und mehrere Reporterteams sahen zu. Er fuhr jetzt sechshundertfünfzig. Der Boden war hier nicht mehr eben. Das Triebwerk war aus, und er hörte nur noch das Scheppern und Knallen der Aufhängung, die über den groben Salzboden donnerte. Dort in seinem Cockpit, bald Sarg, hatte er Zeit zu denken, Zeit festzustellen, wie klein und vertraut dieser Raum war. Wie intim und ruhig. Der Wagen war mit weißem Rauch gefüllt. Als er es aufgegeben hatte, auf seine Nichtbremsen zu treten, und auf den Tod wartete, fiel ihm ein, dass der Rauch Salz war, in fliegendes Pulver verwandelt, nachdem es von den Rädern zermahlen und durch die Achsen in das enge Cockpit geblasen worden war.
Hinter einem weißen Nebel, der seinen Blick aus dem Dachfenster verschwimmen ließ, ragte eine Reihe von Strommasten auf. Er versuchte, zwischen ihnen hindurchzufahren, mähte aber mehrere davon um. Dann fuhr er geradewegs in den flachen Salzsee hinein, sodass das Wasser links und rechts des Victory in die Höhe spritzte. Endlich wurde der Wagen langsamer – fünfhundert Stundenkilometer, dreihundertfünfzig. Doch dann wurde er einen drei Meter hohen Salzdamm hinaufgeschossen, der errichtet worden war, als man entlang des südlichen Randes der Salzwüste einen Entwässerungsgraben ausgehoben hatte. Die Welt ging in die Vertikale. Er sah ein Viereck klaren, wolkenlosen Himmels. Eine erzwungene Betrachtung der Ewigkeit, unberührtes, engelhaftes Blau, ein klassisches Vorspiel des Todes. Wenn nur ein einziges Fischerboot, ein winziger Schlepper von einer Wolke da gewesen wäre, ja, selbst der kleinste Wattebausch aus Nebel vor dem blauen Hintergrund, hätte er Hoffnung gehabt. Aber da war nur Blau. Er schoss auf einen Entwässerungsgraben jenseits des Damms zu. Der Graben war mit Regenwasser gefüllt. Der Victory krachte hinein. Als der Wagen mit der Schnauze voran sank, drückte Flip in Panik das Dach auf. Wenn er erst unter Wasser wäre, hätte er dazu keine Chance mehr. Er riss sich die Sauerstoffmaske vom Gesicht und versuchte, sich aus dem Fahrersitz zu schälen. Er saß fest. Er kam nicht hinter dem Lenkrad heraus. Der Wagen sank. Sein feuerbeständiger Anzug hatte sich an den Nachbrennerreglern verhakt. Der Victory war jetzt tief unter Wasser, und er versuchte noch immer, den Stoff seines Ärmels von den Reglern zu lösen. Als gerade der letzte Rest Sauerstoff aus seinem Gehirn verschwand, befreite er sich und schwamm auf die zitternde Helligkeit über ihm zu, wo die Sonne durchs Wasser drang. In einem Schlick aus Hydrazin, das sich an der Oberfläche sammelte, tauchte er auf. Rettungskräfte kamen angerannt. Sie zerrten ihn weg, kurz bevor das Hydrazin sich entzündete und es einen Knall gab und kurz darauf einen noch viel lauteren, gefolgt von heftigem Gebrodel, als der Victory of Samothrace unter Wasser explodierte wie Brennstäbe in einem Reaktorbecken.
Im Jahr darauf baute Flip sich in seiner Werkstatt in Watts, Los Angeles, einen neuen Wagen, den Victory of Samothrace II, mit einem noch größeren Flugzeugtriebwerk und bulligen Scheibenbremsen. Das war 1965. Die Unruhen begannen, und sein Warenlager fing Feuer, vielleicht war es auch Brandstiftung. Der Victory of Samothrace II wurde schwer beschädigt. Für die Saison auf der Salzwüste, die nur von August bis September oder Oktober dauert, wenn der Regen kommt und das alte Seebett in ein riesengroßes flaches Becken verwandelt, konnte Flip den Wagen nicht mehr rechtzeitig reparieren. In jenem Jahr kam der Regen früh, und der Samothrace war nicht fertig. Ich las das alles in Flips Autobiographie mit dem Titel Gewinnen. Unruhen und Regen wurden in dem Buch als Missgeschicke der gleichen Kategorie dargestellt: erst eins, dann das andere. Unruhen in Watts, Regen in der Wüste. Der lächelnde, spießige Flip, der erzählt, wie er und das Team sich in ihrer Werkstatt verbarrikadiert und mit einer improvisierten Version von Minigolf die Zeit vertrieben hatten, während Rowdys selbstgebastelte Bomben warfen. «Mannometer», schrieb Flip oder sein Ghostwriter, «was für ein Jahr der dummen Zufälle.»
In der Saison nach den Unruhen in Watts hatte Flip sich den Weltrekord wiedergeholt und ihn bis zum vergangenen Jahr, 1975, behalten, als ein Italiener in einem mit Raketenbrennstoff betriebenen Fahrzeug schneller war als er und Flip offiziell seinen Rückzug erklärte. Jetzt macht er Fernsehreklame für Nachrüst-Stoßdämpfer. Der Italiener, Didi Bombonato, wird von Valera-Reifen unterstützt, und da beginnen sich die Linien zu kreuzen. Didi Bombonato würde auf den Bonneville Flats sein, um einen neuen Rekord aufzustellen. Sandro ist Sandro Valera, von der Firma Valera-Reifen und Moto-Valera-Motorräder.
Auf den Flats verschwor sich die Sonne mit dem Salz und erzeugte ein Gas aus Helligkeit und Hitze, das von allen Richtungen herströmte, sodass die reflektierten Strahlen von dem gehämmerten weißen Boden abprallten und mir durch die Lederhose hindurch die Hinterseite meiner Oberschenkel versengten.
Ich parkte und ging an den offenen Boxen entlang. Die Leute schoben Rennwagen und Motorräder von Tiefladern herunter und auf Werkbänke hinauf, entrollten Kabel, um sie in Stromgeneratoren zu stecken, gossen Benzin aus größeren Kanistern in Plastikgießkannen mit Einfülltrichtern um. Rosa Benzin und synthetisches rotes Motoröl sickerten in das Salz wie Schlachtereirückstände. Das Salz selbst hatte von nahem betrachtet die Farbe ungebleichten Zuckers, aber das Sonnenlicht benutzte es, als wäre es das leuchtendste Weiß. Nur wenn eine Wolke kurz an der Sonne vorbeitrieb und die Erde in einer anderen Stimmung präsentierte, kühl und angenehm düster, offenbarte das Salz seinen eigentlichen hellen Beigeton. Wenn die Wolke weiterzog, nahm alles den weißen Schimmer von Molybdän-Öl an.
Ich hörte das seidige Gleiten von Werkzeugschubladen, das Klirren von Schraubenschlüsseln, die auf harten Sandboden fielen. Braun gebrannte kleine Jungen flitzten auf Fahrrädern an mir vorbei, die Netz-Baseballkappen hoch auf dem Kopf, ihre Väter und Onkel nachahmend, die sich um Werkbänke drängten und über Fahrzeuge beugten, die Gürtelschnallen zur Seite gezogen, um den Lack nicht zu zerkratzen. Hinter den Werkbänken fächelten sich voluminöse Frauen Luft zu und bewachten die Igloo-Kühlboxen. An jedem Platz gab es so eine Frau, die auf einem wackligen Aluminiumgartenstuhl saß und mit ihrem Gewicht die geflochtene Karositzfläche dehnte, die Beine gespreizt, die enormen Waden großen, schlichten Gesichtern gleich. Sie öffneten und schlossen die Kühlboxen, um Getränke und Sandwiches herauszuholen oder auch nur nach ihnen zu schauen, so wie ihre Ehemänner die roten Metallschubladen aufeinandergestapelter rollender Werkzeugkästen öffneten und schlossen. Die Frauen wirkten zutiefst gelangweilt, das jedoch mit Stolz, wie Veteranen des Geschehens.
Vom Übungsgelände wurden Wagen hergeschoben. Dicke Salzringe hatten sich um die Profile aller Reifen gebildet wie nichtschmelzender Schnee. Ich füllte mein Anmeldeformular aus und wartete auf die Inspektion meines Motorrads. Der Valera-Korso traf ein, ein Konvoi aus LKWs, Wohnwagen und klimatisierten Bussen mit getönten Scheiben und Generatoren in Industrieausführung. Sie parkten auf ihrem eigenen Bereich des Salzes. Er war mit Seilen abgesperrt, Zutritt verboten. Ich gab mein Formular ab. Bis meine Klasse an der Reihe war, würde es noch ein paar Stunden dauern. Ich ging zur Startlinie. Die Kampfrichter ähnelten den Männern, die ich am Abend zuvor in dem mexikanischen Restaurant gesehen hatte, große Schnurrbärte, Sonnenbrillen und Lärmschutzkopfhörer sowie Walkie-Talkies, die sie sich über den Dienstjacken an die Brust geschnallt hatten.
Beim Landgeschwindigkeitsrekord hat jeder Rennfahrer die Bahn für sich. Man fährt allein, aber die gefahrene Zeit wird an der Klasse gemessen, in der man antritt – in meinem Fall nichtmodifizierte 650-Kubikzentimeter-Zweizylinder. Niemand teilt die Strecke mit einem anderen, und so sind den ganzen Tag ununterbrochen Fahrzeuge im Rennen, ein Kommen und Gehen in der gleißenden weißen Hitze, jeder Unfall oder Erfolg ein individuelles Ereignis. Es gab zwei Schlangen, eine für Kurzstrecke, eine für Langstrecke. In beiden standen Autos und Motorräder jeder Art, Dragster mit Achtzylindermotoren, Streamliner gleich Sprengköpfen auf Rädern mit winzigen horizontalen Kabinen, in denen die Fahrer flach auf dem Rücken liegend Zentimeter über dem Boden eingesargt waren, und die eleganten Lakester aus poliertem Aluminium, abgerundet und glatt wie benutzte Seifenstücke, mit Kotflügeln, die beinahe die Straße touchierten. Es gab altmodische Roadster mit glänzendem neuem Anstrich, Überrollbügeln und großen schablonierten Zahlen an den Türen. Klassische amerikanische Muskelautos. Einen rosa-gelben 1953 Chrysler Town & Country, eine Fata Morgana in Technicolor, die auf Sprungfedern vor sich hin wippte.
Nach meinem Jahr in New York hatte ich praktisch vergessen, dass es eine Welt der Anderswos gab, Menschen, die außerhalb der Stadt lebten und ihre Freizeit nach ihrem eigenen Gusto verbrachten. Es gab eine Menge Familienteams, und in ein paar Fällen war es die Mutter, die teilnahm. Nicht in vielen, aber ich war nicht die einzige Frau, wenn auch vielleicht die einzige auf einem Motorrad. Und dann der Jux mit den Starthilfewagen, die den Rennfahrern an der Startlinie Anschub gaben. Alles, was Räder hatte und fuhr, konnte dafür eingesetzt werden: ein Schulbus. Eine «Just-married»-Kiste mit hinten drangebundenen Konservendosen. Ein Eiscremewagen. Je raffinierter und professioneller der Rennwagen, desto lächerlicher und maßlos unpraktischer schien sein Starthilfewagen. Was den Eiscremewagen betraf, hatte ich mich allerdings getäuscht. Er fuhr vor und eröffnete sein Geschäft, und sofort standen Jungs mit Bleistifthälsen vor dem Fenster Schlange. Ein Rettungswagen kam, und ich fragte mich, was passiert und wie schlimm wohl die Verletzung war. Aber der Rettungswagen leistete nur Starthilfe, er schob einen Lakester von der Startlinie, dessen Fahrer ein weißes Sanitäterhemd und mit unechtem Blut getränkte Kostümverbände trug.
Alle paar Minuten heulte ein Motor auf, wenn ein Fahrzeug von der Startlinie schoss und unter jedem seiner Hinterreifen