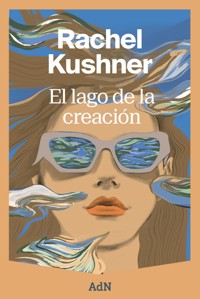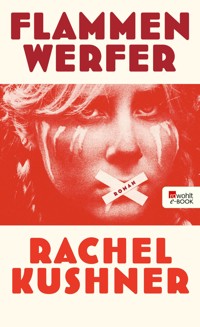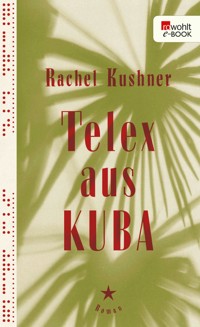
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In 'Telex aus Kuba', einem packenden Roman über die kubanische Revolution, sind sie alle versammelt – die Castros, Che Guevara, der Diktator Batista und US-Präsident Eisenhower. Aber erzählt wird die Geschichte hauptsächlich von zwei Jugendlichen, Everly Lederer und K.C. Stites, die füreinander bestimmt zu sein scheinen: sie die Tochter des Chefs einer amerikanischen Nickelmine und er der Sohn eines leitenden Angestellten der United Fruit Company. Aus den Brüchen zwischen dem, was sie voller Faszination und Erschrecken wahrnehmen, tritt allmählich die Geschichte eines ebenso wagemutigen wie bisweilen absurden Freiheitskrieges zutage. Verwickelt in ihn sind, mit oft dubiosen Interessen, auch ein französischer Agent mit SS-Vergangenheit, eine kubanische Tänzerin mit erotischem Hang zur Macht, zahlreiche karrierebewusste Saubermänner und ihre dekadenten Gattinnen, Dschungelkämpfer und schmutzige Geschäftemacher. Rachel Kushner hat einen tropisch glitzernden historischen Moment des 20. Jahrhunderts mit großer Raffinesse so verdichtet, dass er die Ereignisse wie durch ein Brennglas zeigt. Man liest mit allen Sinnen, sieht, schmeckt, fühlt mit den Figuren und überlässt sich Kushners herausragender erzählerischer Kraft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Rachel Kushner
Telex aus Kuba
Roman
Über dieses Buch
Bestsellerautorin Rachel Kushner begeistert mit ihrem ersten Roman "Telex aus Kuba"», für den sie ebenso wie für "Flammenwerfer" für den National Book Award nominiert war, was noch niemandem vor ihr gelungen.
In «Telex aus Kuba», einem packenden Roman über die kubanische Revolution, sind sie alle versammelt – die Castros, Che Guevara, der Diktator Batista und US-Präsident Eisenhower.
Aber erzählt wird die Geschichte hauptsächlich von zwei Jugendlichen, Everly Lederer und K.C. Stites, die füreinander bestimmt zu sein scheinen: sie die Tochter des Chefs einer amerikanischen Nickelmine und er der Sohn eines leitenden Angestellten der United Fruit Company. Aus den Brüchen zwischen dem, was sie voller Faszination und Erschrecken wahrnehmen, tritt allmählich die Geschichte eines ebenso wagemutigen wie bisweilen absurden Freiheitskrieges zutage.
Verwickelt in ihn sind, mit oft dubiosen Interessen, auch ein französischer Agent mit SS-Vergangenheit, eine kubanische Tänzerin mit erotischem Hang zur Macht, zahlreiche karrierebewusste Saubermänner und ihre dekadenten Gattinnen, Dschungelkämpfer und schmutzige Geschäftemacher.
Rachel Kushner hat einen tropisch glitzernden historischen Moment des 20. Jahrhunderts mit großer Raffinesse so verdichtet, dass er die Ereignisse wie durch ein Brennglas zeigt. Man liest mit allen Sinnen, sieht, schmeckt, fühlt mit den Figuren und überlässt sich Kushners herausragender erzählerischer Kraft.
«Ein brillant gemaltes, verspieltes, literarisch anspielungsreiches und farbiges Revolutionspanorama. Faszinierend.» Die Welt
«Ein auf jeder Seite mitreißender, dschungelartig dichter Roman.» (Süddeutsche Zeitung)«Ein außerordentliches Kunststück, voll sprudelndem Leben.» Paula Fox
«Vielschichtig und faszinierend.» The New York Times Review
«Mit der Wucht eines Tropensturms erzählt Rachel Kushner … Castros Revolution aus der Sicht zweier Teenager, die der kolonialen Oberschicht entstammen.» Fokus
«Rachel Kushner hat ihre Geschichte mit genialer Lässigkeit aufgeschrieben, […] ein großartiger Sommerroman.» Literatur Spiegel
«Das faszinierende Porträt einer Gesellschaft am Abgrund.» Brigitte
«Ein genauso bilderreiches wie subtiles, momenthaft verweilendes Epos.» Der Tagesspiegel
«Mit witzig-ironischem Blick schildert die Autorin, wie sich zweitklassige Manager und zwielichtige Gestalten aus den USA auf den Plantagen als Herren aufspielen. Es ist das Portrait einer dekadenten Gesellschaft, kurz vor der Vertreibung aus dem Paradies.» SRF Kultur 2
Impressum
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel «Telex from Cuba» bei Scribner, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2019
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Telex from Cuba» Copyright © 2008 by Rachel Kushner
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt nach einem Entwurf von Anzinger und Rasp, München
Umschlagillustration Kerstin Koletzki/bobsairport
ISBN 978-3-644-04991-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Dieses Buch ist für Jason Smith
Karte
Dort wo alles friedlich lacht –
Lust und Heiterkeit und Pracht.
– «Einladung zur Reise»
* PROLOG *
Dort auf dem Globus war er, eine gestrichelte Linie in dunklerem Blau auf dem heller blauen Atlantik. Wörter in blasser Kursivschrift: Wendekreis des Krebses. Die Erwachsenen sagten, sie solle aufhören zu fragen, was das sei, als wäre ihre langweilige Antwort befriedigend: «Ein Breitengrad, in diesem Fall der dreiundzwanzigeinhalbte.» Sie stellte sich Gänseblümchenketten aus Seegras vor, die über das Wasser bis an einen fernen Horizont reichten. Auf dem Globus gab es verschiedene Blauschattierungen, die sich in Schichten um die Kontinente legten. Aber wie konnte das Meer, das doch zu keinem Land gehörte, geographische Zonen haben? Unterteilungen auf einer Oberfläche, der Regen und Grenzen gleichgültig sind, die keinen Gegenstand an einem Punkt festzuhalten vermag? Sie hatte mal einen alten Globus gesehen, auf dem ein einziger Ozean, Ozean genannt, die ganze Erde umspannte. Anstelle des Nordpols gab es da eine Gegend, die «Himmel» hieß. Anstelle des Südpols die «Hölle».
Aus einer Liste von Themen wählte sie die Farbe Schwarz und schrieb ihr Buchreferat, obwohl sie fand, dass sie der Schatzinsel unrecht tat, indem sie die Geschichte auf diverse schwarzfarbige Dinge reduzierte, denn um Schwarz ging es darin nicht, eher vielleicht darum, dass Jungen Väter brauchen und Kinder manchmal klüger sind als Erwachsene und nicht für die gleichen Laster anfällig. Die Piratenflagge war schwarz, auch der Schwarze Hund, der so geheimnisvoll im Admiral Benbow auftaucht und Rum verlangt. Es gab schwarze Nächte auf der einsamen Insel, verstohlenes Herumgeschleiche in weiterer Schwärze: dem Schwarz der Gefahr. Außerdem die «schwarzen Flecken», die Piraten einem gaben – eine Art Drohung. Eigentlich ein Todesurteil. «Wer hat mir den schwarzen Fleck geschickt?», fragte Silver. Dieses konkrete Todesurteil: auf einem Blatt Papier verschmierte Holzasche. Das Blatt aus einer Bibel gerissen, die nun ein Loch in der Offenbarung hatte. Und Löcher sind auch schwarz.
Sie hatte von Sargassum gelesen, einer nomadischen Seegrasstadt, und gehofft, sie würden Teile davon entdecken. Auch anderes Zeug schwamm im Ozean: Treibgut, Gegenstände, die Seeleute über Bord werfen, um die Schiffslast zu erleichtern, und Strandgut, von der Brandung erfasst und mit aufs offene Meer genommen, Kokosnüsse zum Beispiel, die an den Küsten Europas angeschwemmt wurden, bevor irgendwer wusste, was in westlicher Richtung lag. Vielleicht wurden dort immer noch Kokosnüsse angeschwemmt, aber sie hatten nichts Unheimliches oder Zauberhaftes mehr an sich, weil man sie jetzt auch im Laden kaufen konnte. Damals zeigten die Menschen sie als exotische Glücksbringer herum. Oder schnitten sie auf. Eine seltsame weiße Flüssigkeit strömte heraus, fettig und übelriechend. Nicht giftig, nur nach einer so langen, beschwerlichen Reise verfault, eine Frucht, die Tausende Kilometer von ihrer Heimat unter den grünen Blättern einer Palme entfernt war.
Von Grün zu Rot gelangt man leicht: Es sind Zwillinge. Membrane, so dünn wie Netzhäute, an den Rückseiten verbunden. Ihr Vater sah Rot als Grün und Grün als Rot. Ein Dauerzustand, versicherte er ihr. Und auf den Antillen wuchs ein rotes Gras, aus dem man grünen Farbstoff machen konnte.
Jetzt stellt euch rote Samtvorhänge vor.
Öffnet sie.
Dahinter befindet sich ein Raum mit perfekter Akustik. Darin ein funkelndes schwarzes Klavier. Sie kann ihr Gesicht darin sehen, als stünde sie über eine flache Schüssel Wasser gebeugt. Sie setzt sich hin und spielt – Chopin, ein Prélude zum Abschiednehmen, zum Träumen in einer Molltonart.
Dreht den Globus langsam einmal ganz herum und kehrt dorthin zurück, wo die gestrichelte blaue Linie die Insel Kuba streift.
Sie wird den Wendekreis des Krebses überqueren und ihr neues Leben beginnen.
* Erster Teil *
* 1 *
Es war das Erste, was ich sah, als ich an jenem Morgen die Augen aufmachte. Ein orangefarbenes Rechteck von der Farbe heißer Lava an meiner Schlafzimmerwand. Es kam von dem Licht, das in einem staubigen Strahl durchs Fenster strömte und wie ein langsamer, ruhiger Film an der Wand spielte. Nur dieses sonderbare orangefarbene Licht. Ich war mir sicher, dass es jeden Moment verschwinden würde, wie ein Regenbogen, der auftaucht und im Nu wieder verblasst, du schaust dorthin, wo er eben noch war, und er ist nicht mehr da, höchstens ganz, ganz schwach, und auch das bildest du dir vielleicht nur ein, weil du dich daran erinnerst, was du gerade gesehen hast.
Ich ging zum Fenster und blickte hinaus. Der Himmel war neblig-violett, wie die Farbe der zarten Haut unter Mutters Augen, Halbkreise, die dunkel wurden, wenn sie müde war. Die Sonne eine verschwommene, tiefrote Kugel. Man konnte sie durch den Nebel direkt anschauen, wie einen Edelstein unter Lagen von Seidenpapier. Wahrscheinlich blühte uns irgendeine Art seltsames Wetter. Im Osten Kubas gab es Tage, an denen ich gleich morgens beim Aufwachen merkte, dass sich das Wetter radikal verändert hatte. Von meinem Fenster aus konnte ich die Bucht sehen, und wenn ein tropischer Sturm aufzog, streute die aufgehende Sonne Lichtbänder in die dichten Wolken, die sich am Horizont über dem Wasser türmten, und färbte sie rosa, als würden sie von innen beleuchtet. Ich liebte das Gefühl, mitten in einem drastischen Umschwung aufzuwachen, zu wissen, dass die Dienstboten, wenn ich hinunterging, hin und her rennen, die Terrassenmöbel hereinholen und Bretter vor die Fenster nageln würden, während draußen, in der warmen, böigen Luft, die erste Riesenwelle als glasige grüne Wand heranbrandete und das Ufer gleich hinter unserem Garten durchnässte. Wenn der Sturm schon angefangen hatte, prasselte der Regen aufs Haus, und es war so dunkel in meinem Zimmer, dass ich die Nachttischlampe einschalten musste, um auch nur die Uhrzeit zu erkennen. Ich fand Veränderungen aufregend, und als ich an diesem Morgen aufwachte und ein Rechteck aus orangefarbenem Licht an meiner Wand sah, hell wie glühende Kohlen, schien es, als würde gleich etwas ganz Besonderes passieren.
Es war früh am Morgen, und Mutter und Papa schliefen noch. Mein Bruder Del war zu dem Zeitpunkt schon drei Wochen weg, seit unserer Rückkehr aus den Weihnachtsferien in Havanna. Obwohl Papa nicht offen darüber sprach, wusste ich, dass Del mit Raúls Kolonne oben in den Bergen war. Ich hatte für den Billardsalon in Mayarí nie viel übriggehabt, aber seit Dels Verschwinden lungerte ich öfter dort herum. In Preston etwas über die Rebellen zu erfahren war schwierig. Die Kubaner wussten zwar alle, was los war, aber in Gegenwart von Amerikanern sagten sie nichts. Die Firma übte ziemlich starken Druck auf die Arbeiter aus, damit sie sich von jedem fernhielten, der irgendwas mit den Rebellen zu tun hatte. Wer hätte da mit dem dreizehnjährigen Sohn des Chefs geredet? In Mayarí betranken sich die Leute und machten den Mund auf. Eine Woche davor hatte mich ein alter campesino an der Schulter gepackt. War mit seinem Gesicht so nah an meins herangekommen, dass ich seinen Rumatem riechen konnte. Und etwas über Del gesagt. Dass er noch jung sei, aber bald zu einem der ganz Großen werden würde. Einem Befreier der Menschen. Wie Bolívar.
Ich hörte Annie Frühstück machen, Schubladen öffnen und schließen. Ich schlüpfte in meine Pantoffeln und ging hinunter. In der Küche war es so dunkel, dass ich kaum etwas erkennen konnte. Annie hatte alle Fenster verriegelt und die Jalousien heruntergelassen. Ich fragte sie, warum sie nicht die Fensterläden aufklappte oder eine Lampe einschaltete.
Dienstboten haben komische Angewohnheiten – abergläubische –, man weiß nie so genau, was sie umtreibt. Annie ging in der Dämmerung nicht gern nach draußen. Wenn Mutter darauf bestand, dass sie eine Besorgung machte, band Annie sich einen Schal vor den Mund. Sie sagte, bei Dämmerung versuchten böse Geister, Frauen in den Mund zu fliegen. Annie und unsere Wäscherin Darcina hörten beide gern diesen verrückten Gesundbeter Clavelito im Radio, auf CMQ. Darcina weinte manchmal nachts. Sie sehne sich so danach, mit ihren Kindern zusammen in einem Bett zu schlafen, sagte sie. Mutter kaufte ihr ein tragbares Radio, damit sie nicht so allein war, und der Gerechtigkeit halber bekam dann auch Annie eins. Was Gerechtigkeit anging, war Mutter ganz groß. Clavelito sagte den Leuten, sie sollten ein Glas Wasser aufs Radio stellen, seine Stimme würde dann das Wasser weihen oder so ähnlich, und sowohl Annie als auch Darcina machten das.
Annie sagte, sie hätte die Läden wegen der Luft draußen geschlossen. Sie sei ganz trüb, kitzle sie in der Nase und mache sie heiser. Wahrscheinlich hätten diese guajiros mal wieder ihren Müll verbrannt. Annie mochte die campesinos nicht. Sie war Hausangestellte, das ist eine andere Klasse.
Ich setzte mich mit der neuen Ausgabe von Unifruitco, unserer Firmenzeitschrift, an den Küchentisch. Sie kam alle zwei Monate heraus, deshalb waren die Nachrichten immer schon etwas veraltet. Dies war die Januarausgabe von 1958, und auf der Titelseite waren mein Bruder und Phillip Mackey mit einem Schwertfisch abgebildet, den sie im Oktober davor in der Nipe-Bucht gefangen hatten. Damit hatten sie den ersten Preis beim herbstlichen Angelturnier gewonnen. Es war schon seltsam, dieses Foto jetzt zu sehen, da beide fort waren und mein Bruder sich für so etwas wie Angelturniere nicht mehr interessierte. Auf der nächsten Seite war ein Foto von Papa mit Batista und Botschafter Smith auf unserer Yacht abgedruckt, der Mollie and Me. Ich blätterte weiter, während Annie Pastetenteig vorbereitete. Sie schnitt kleine Kreise aus dem Teig, belegte sie mit Käse und Guavenpaste, faltete sie zu Halbmonden und verteilte sie auf einem Backblech. Annies pastelitos de guayaba, warm aus dem Ofen, waren das Leckerste auf der Welt. Manche Amerikaner in Preston erlaubten ihren Bediensteten nicht, einheimische Sachen zu kochen. Mutter war da wesentlich aufgeschlossener, und einige kubanische Gerichte liebte sie heiß und innig. Mutter kochte nicht selbst. Sie schrieb Listen für Annie. Annie nahm dann zum Beispiel einen riesigen Red Snapper und füllte ihn mit Kartoffeln, Oliven und Sellerie, legte ihn in Butter und Limonensaft ein und backte ihn im Ofen. Das war mein Leibgericht. Sechs Monate davor, an meinem dreizehnten Geburtstag im Sommer ’57, hatte Annie gesagt, da ich jetzt ein junger Mann sei und schneller erwachsen würde, als sie gucken könne, wolle sie mir schon mal einen Rumkuchen für meine Hochzeit backen. Als dreizehnjähriger Junge denkt man nicht unbedingt ans Heiraten. Klar hatte ich schon mit ein paar Mädchen rumgemacht, aber so was wie eine förmliche Werbung gab es nicht. Ein Rumkuchen hält sich zehn oder fünfzehn Jahre, und Annie meinte, bis dahin würde ich ja wohl erwachsen sein und eine Frau gefunden haben. Sie ließ in der Maschinenwerkstatt der Firma extra eine fünfstöckige Dose für diesen Kuchen anfertigen. Weiß gestrichen, obendrauf der handgemalte Schriftzug Kimball C. Stites und an den Seiten Griffe, mit denen man die Kuchenschichten herausziehen konnte. Was aus dem Kuchen oder der mit meinem Namen versehenen Dose geworden ist, weiß ich nicht. In der Eile des Aufbruchs verlorengegangen vermutlich, wie so viele von unseren Sachen.
Annie schob gerade ihre pastelitos in den Ofen, als ich Papas Schritte die Treppe herunterpoltern und Mutter hinter ihm herrufen hörte: «Malcolm! Malcolm, bitte, sei in Gottes Namen vorsichtig!»
Ich rannte in die Diele und traf Papa unten an der Treppe. Er stürmte an mir vorbei, als wäre ich unsichtbar, riss die Haustür auf und sprang, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, die Verandatreppe hinunter. Ich lief in meinem Schlafanzug hinter ihm her. Er steuerte auf die Dienstbotenunterkünfte hinter dem Haus zu und hämmerte bei Hilton Hardy an die Tür. Hilton war Papas Chauffeur.
«Hilton! Aufwachen!» Er klopfte erneut. Jetzt erst bemerkte ich, dass Papa unter der Anzugjacke noch sein knitteriges Pyjamahemd trug.
«Mr. Stites, Mr. Hardy ist bei seiner Familie in Cayo Mambí», rief Annie durch das Fenster der Vorratskammer. Die geschlossenen Jalousien ließen ihre Stimme gedämpft klingen. «Mrs. Stites hat ihm die Erlaubnis gegeben.»
Papa fluchte laut und rannte zur Garage, wo Hilton die Firmenlimousine geparkt hatte, einen funkelnden schwarzen Buick. Wir hatten zwei davon – Dynaflows, mit verchromten ovalen Lüftungslamellen an den vorderen Kotflügeln. Papa öffnete die Garagentüren und setzte sich in den Wagen, startete ihn aber nicht. Er stieg wieder aus und rief zum Haus hoch: «Annie! Wo hat Hilton die Schlüssel von dem verdammten Ding?»
«An einem Haken da drinnen, Mr. Stites. Mr. Hardy hat alle Schlüssel an Haken», rief sie zurück.
Papa fand den Schlüssel, startete den Buick und fuhr rückwärts aus der Garage. Ich sah vom Gartenweg aus zu und wagte nicht zu fragen, was los war. Er brauste die Einfahrt hinunter, dass der Kies nur so spritzte, und bog rechts auf die Avenida ab.
Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Papa am Steuer seines eigenen Wagens sitzen sah. Er hatte sonst immer einen Fahrer. Papa trug jeden Tag einen weißen Segeltuchanzug mit perfekten Bügelfalten, gestärkt bis zum Gehtnichtmehr. Weißes Hemd, weiße Krawatte und Panamahut. Auf seinen nachmittäglichen Runden wurde er von Hilton Hardy in der Buick-Limousine chauffiert. Bei jedem Halt servierte ihm eine Sekretärin einen kleinen Schwarzen, kubanischen Kaffee für zwei Cent. Sie wussten genau, zu welcher Zeit er kam und wie er seinen Kaffee mochte: ein fingerhutgroßer Schluck ohne Zucker. Ein «halber Halber», wie er es nannte. Seiner Meinung nach wurde er nie krank, weil sein Magen mit dem Zeug beschichtet war. Papa war altmodisch. Er hatte seine Gewohnheiten, und er nahm sich Zeit. Er war keiner, der sich hetzen ließ.
Ich erinnere mich noch gut daran, wie die Zuckerrohrschneider lebten: in Einzimmerbaracken, sogenannten bohios. Nackter Erdboden, ein Topf in der Mitte des Raums, keine Fenster, kein Wasser, kein Strom. Licht kam nur durch den offenen Eingang und die Ritzen in den mit Stroh verkleideten Palmblätterwänden. Sie schliefen in Hängematten. Sie wohnten dort unbefugt, aber die Firma duldete es, denn irgendwo mussten sie während der Erntezeit ja bleiben. In den restlichen Monaten des Jahres – der toten Zeit, wie sie sagten – waren sie desolajos. Ich weiß nicht, was sie dann machten. Auf der Suche nach Arbeit durch die Gegend wandern, nehme ich an. In dem Barackendorf, wo die Zuckerrohrschneider wohnten – dem Batey – liefen überall nackte Kinder herum. Schuhe besaß keiner, und die Füße der Leute hatten rundherum harte Schalen aus Hornhaut. Sie kochten ihre Mahlzeiten unter freiem Himmel, auf Mangrovenholzkohle. Holten sich ihr Wasser aus einem Zapfhahn am Rand der Zuckerrohrfelder. Sie mussten es in Eimern tragen, aber die Firma erlaubte ihnen, so viel zu nehmen, wie sie wollten. Damit erging es ihnen eindeutig besser als den Bergarbeitern drüben in Nicaro. Die waren Angestellte der US-Regierung und mussten sich ihr Wasser aus dem Fluss holen – dem Levisa –, in den auch die Abgänge von der Nickelgrube geschüttet wurden. Die Nicaro-Arbeiter tranken aus dem Fluss, badeten im Fluss, wuschen ihre Wäsche im Fluss. Wenn man sein Fahrrad nach dem Regen im Levisa wäscht, wird es blitzsauber. Das weiß jeder Kubaner. Keine Ahnung, wieso, aber es funktioniert wirklich. Wenn es geregnet hatte, trafen sich alle dort unten, und die Jungs und Männer wateten in Unterhosen in den Fluss, um dort ihre Autos und Fahrräder zu waschen.
Die amerikanischen Kinder und Jugendlichen, die in der Avenida wohnten, durften Preston eigentlich nicht verlassen und schon gar nicht ins Batey der Zuckerrohrschneider gehen. Ich glaube, das war Firmenpolitik. Innerhalb Prestons durften wir überallhin. Jenseits der Ortsgrenzen riskierten wir Ärger. Aber Hatch Allains Sohn Curtis Junior und ich gingen andauernd ins Batey. Wir waren Jungs und von Natur aus neugierig. Manchmal fanden dort Tanzabende statt, bei denen wir uns einschlichen. Curtis mochte kubanische Mädchen. Das war auch so was – einige amerikanische Jugendliche gingen nur mit Kubanern. Phillip Mackey und Everly Lederers Schwester Stevie aus Nicaro zum Beispiel, und beide wurden dann in die Staaten aufs Internat geschickt. In Phillips Fall lag das allerdings nicht nur an den Mädchen, sondern auch daran, dass er und mein Bruder in Schwierigkeiten geraten waren, weil sie den Rebellen geholfen hatten. Dem armen Curtis gaben die kubanischen Mädchen nie die Chance, in Schwierigkeiten zu geraten. Er war schmutzig und hatte abstehende Ohren, und die Mädchen mochten ihn einfach nicht. Ich versuchte ihm zu erklären, dass man sich ein bisschen unnahbar geben musste, so ein bisschen nach dem Motto «Friss, Vogel, oder stirb», selbst wenn man sich in Wahrheit nicht so fühlte, aber das kapierte Curtis einfach nicht.
Es war Papas Idee, den Zuckerrohrschneidern ein Stück Land zu geben, damit sie für sich selbst sorgen, Yucca und Süßkartoffeln anbauen konnten. Er glaubte an die Autarkie. Er holte Pfarrer Crim herüber, als Leiter der Landwirtschaftsschule von United Fruit. Die Kinder der Zuckerrohrschneider waren überwiegend Analphabeten. Sie lernten praktische Dinge: Ackerbau und Haushaltsführung, methodistische Werte. Papa betrachtete es als seine Pflicht, ihnen eine Ausbildung zu ermöglichen, aber er hätte keine Kinder von der Straße bei uns aufgenommen, wie meine Mutter es tun wollte. Meine Mutter war die wahre Liberale. Sie gab den Leuten an der Hintertür zu essen. Sie hätte sie auch ins Haus gelassen, wenn mein Vater ihr keine Grenzen gesetzt hätte. Wenn es im Batey ein Kind gab, dem es schlechtging, das verkrüppelt, zurückgeblieben oder krank war, schickte meine Mutter jemanden hin, der es abholte und ins Krankenhaus der Firma brachte. Zur Weihnachtszeit setzte sie sich auf ihr Pferd und ritt mit Geschenken und Spielsachen übers Land. Sie hätte das gern allein gemacht, aber mein Vater erlaubte es nicht. Also ritt immer einer der Wachleute von United Fruit hinter ihr her. Es waren wohl eher Polizisten als Wachleute; sie trugen Schusswaffen und guamparas – so was Ähnliches wie Macheten, mit einer großen, flachen Klinge, mit der man jemandem eins überziehen konnte. Meine Mutter ritt auf ihrem Pferd überall auf dem Land herum. Einmal nahm sie Leute von National Geographic mit auf ihre Tour, die eine Menge Fotos machten. Das ist für mich immer noch die beste Zeitschrift. Wenn meine Mutter angeritten kam, strömten die Kubaner aus ihren Häusern und scharten sich um sie. Sie liebten sie. Sie wollten sie berühren. So eine Wirkung hatte sie.
Papa war gerade bei seinem Bruder in Indiana zu Besuch, als er sie zum ersten Mal sah, in der Nähe von Crawfordsville. Mutter war das Benzin ausgegangen. Er sah sie am Straßenrand entlanglaufen – plötzlich sei da dieser Engel gekommen, sagte er immer. Mutter war einmal Maikönigin gewesen und Präsidentin von Kappa Kappa Gamma am DePauw. Als sie starb, musste ich der Verbindung ihre Anstecknadel zurückgeben. Harlan Sanders – das ist Colonel Sanders – stammte auch aus Indiana und war zeit seines Lebens in Mutter verliebt. Einmal, auf dem Weg nach Cumberland Falls, waren wir seine Gäste im Sanders Motor Court. Seine fatale Schwäche für sie war ihm deutlich anzumerken. Als er uns begrüßte, zitterten ihm die Hände, und er wurde rot. Ich glaube, Papa fand das amüsant. Er gab gern mit ihr an. Mutter war eine schöne Frau und immer sehr gepflegt. Sie wusch sich das Gesicht nie mit Seife, nur mit Creme, und achtete auf ihre Gesundheit. Sie ließ die Bediensteten Joghurt herstellen, als es noch sehr ungewöhnlich war, welchen zu essen. Jeden Abend vor dem Schlafengehen saß sie an ihrem Tisch und bürstete sich hundertmal die Haare. Als Junge bemerkt man solche Sachen. Zwei- oder dreimal im Jahr fuhr Papa mit uns nach Miami, um neue Kleidung für Mutter zu kaufen. Er reservierte dann im Burdines einen Raum nur für uns allein. Er, Del und ich saßen zusammen mit Mutter da, während die Mannequins uns verschiedene Sachen vorführten. Gefiel uns etwas, probierte Mutter es an, kam aus der Kabine und drehte sich einmal um sich selbst. Wenn wir uns einig waren, dass es schön aussah, kaufte Papa es. Mutter sagte, sie würde nie etwas tragen, was ihre Männer nicht für gut befunden hätten. Anfangs wollte ich den Nachmittag nicht in einem Ankleideraum verbringen. Aber mit der Zeit fand ich Gefallen an dem Ritual und daran, wie schön Mutter sich kleidete. Als Del sich mit Phillip Mackey herumzutreiben begann, ließ sein Interesse an Familienunternehmungen nach, und er kam nicht mehr mit nach Miami. Ohne ihn machte es nicht so viel Spaß, aber Mutter war glücklich, dass ich dabei war, und mich erfüllte es mit Stolz, ihr beim Aussuchen ihrer Kombinationen zu helfen, der Sohn zu sein, auf den sie sich verlassen konnte. Später, als ich auf der Militärschule war, zogen wir uns für Tanzabende und offizielle Anlässe fein an, und dank Mutter wusste ich, wie ich mich zurechtzumachen hatte. Das war mir wichtig. Eleganz bedeutete für Mutter, eine schlichte Aufmachung zu wählen und mit einem einzelnen auffälligen Detail – einer Krawatte vielleicht – zu kombinieren, um einen kleinen Akzent zu setzen. Ich denke heute noch an sie, wenn ich mich fein mache.
Hütten mit nacktem Erdboden, kein fließend Wasser – die Art, wie diese Menschen wohnten, war für mich ganz normal. Ich war ein Kind. Aber Mutter gefiel es nicht, obwohl Papa sie daran erinnerte, dass ihre Firma ihnen höhere Löhne zahlte als jedes kubanische Zuckerunternehmen. Mutter fand es einfach furchtbar, wie auf den kubanischen Plantagen gearbeitet wurde. Der Gedanke, dass eine Rasse ihre eigenen Leute ausbeutete, brach ihr das Herz. Die Zuckerrohrschneider waren zwar alle Jamaikaner – es war kein einziger Kubaner dabei –, aber ich wusste, was sie meinte: Einheimische nutzten andere Einheimische aus, braun gegen schwarz, so ungefähr. Sie war stolz auf Papa, stolz darauf, dass die United Fruit Company einen gewissen Standard hielt, aus Fairnessgründen bessere Löhne zahlte als nötig. Sie hoffe, sagte sie immer, das werde die Kubaner dazu bewegen, ihre Leute ein bisschen besser zu behandeln.
Ich wusste, dass etwas Schlimmes passiert war, als ich Papa so im Pyjamaoberteil davonbrausen sah. Ich lief wieder ins Haus, um mich anzuziehen, und hörte Mutter währenddessen mit Mr. LaDue telefonieren. Sie entschuldigte sich für den frühen Anruf. «Mr. Stites hat mich gebeten, Sie zu informieren, dass auf den Zuckerrohrfeldern ein Feuer ausgebrochen ist», sagte sie. Natürlich war es ein Feuer. Nichts anderes hätte das seltsame orangefarbene Licht erklären können. «Er hat mich gebeten, Ihnen zu sagen, dass er hingefahren ist.» Selbst in einer Krise wahrte Mutter immer die Form, blieb korrekt und gefasst. So war sie bis zum Schluss. Leicht war das nicht für sie, das können Sie mir glauben. Alles zu verlieren. Und nicht nur das Haus, unsere ganze Welt, sondern auch ihren ältesten Sohn, der da oben bei diesen Leuten war.
Danach war Mutter in der Küche und sprach mit Annie, und es schien mir das Beste, leise zu sein und mich unbemerkt hinauszuschleichen. Unser Haus lag ganz am Ende der Avenida direkt an der Uferbefestigung, gegenüber von meiner Schule, der Preston Academy for American Children. Ich öffnete das Tor und ging nach rechts in Richtung Marktplatz. Die Avenida war die Straße, wo die Geschäftsführer wohnten, mit abgesperrtem Tor und Wächtern am Eingang. In Preston gab es eine Hackordnung, und wir wohnten im größten Haus am Ende der Straße und hatten unsere eigenen Privatwächter, einen für den Tag und einen für die Nacht. Die Nachtwächter hießen serenos, und einer von ihnen saß immer bis zum Morgengrauen auf unserer Treppe. Es war noch früh – kaum sechs Uhr – und auf der Straße alles friedlich und ruhig. Das Einzige, was ich hörte, waren die Pfauen von Mrs. LaDue. Jedes Haus in der Avenida hatte eine Laube mit Bougainvilleen am Eingangstor und herrlichen Gärten. Die Firmengärtner hielten alles tadellos gepflegt. Eine Brise strich über die Bougainvilleen und wehte leuchtend rosafarbene Blätter über den Gehweg. Auf jeder Veranda lag, mit einem Gummiband zusammengerollt, die neuste Unifruitco. Ich kam am Schwimmbad vorbei, wo wir am Wochenende davor, als die Cabot Lodges bei uns zu Besuch waren, eine große Grillparty veranstaltet hatten. Henry Cabot Lodge war ein älterer Mann, aber er hatte in Harvard zum Schwimmteam gehört und war mit uns Kindern aufs Dreimeterbrett geklettert, um Saltos und Hechtsprünge zu machen. Die Cabot Lodges waren vor ein paar Tagen nach Boston zurückgekehrt. Jetzt lag das Becken verlassen und ruhig da. Ich sah, dass sich etwas auf der Wasseroberfläche sammelte, ein gräulicher Film. Es war Asche, die aus der Luft herunterschwebte.
Die Wachstation befand sich am Ende der Straße. Ich winkte dem Wärter zu und ging weiter. Vom Marktplatz aus, wo der Hauptsitz der Firma mit Papas Büro war, konnte ich rechts die Fabrik sehen. Während der Erntezeit war sie vierundzwanzig Stunden am Tag in Betrieb, hell erleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Die Maischapparate liefen, der Zuckersirup kochte, die Zentrifugen summten. Aus den zwei riesigen Fabrikschornsteinen hätte eigentlich Rauch aufsteigen müssen, aber sie waren beide kalt. Mit geschnittenem Zuckerrohr beladene Waggons standen direkt vor der Fabrik auf den Schienen, bereit, hineingerollt und in die Maischapparate geleert zu werden. Frisch geschnittenes Zuckerrohr darf nicht lange liegen, sonst wird es sauer und trocknet aus. Der ganze Gewinnungsprozess war darauf ausgelegt, dass das nicht passierte.
In Preston war die Luft immer vom Geruch nach siedendem Zuckerrohrsirup, sogenanntem meladura, erfüllt. Ein warmer, malziger Geruch, den ich liebte. Ich habe ihn heute noch in der Nase. An diesem Morgen nahm ich verschiedene Gerüche wahr, die mir nicht unbedingt vertraut waren. Ich lief zum Bahnübergang. Der Schrankenwärter würde schon wissen, was los war und wo ich Papa finden konnte, dachte ich mir. Jenseits der Tennisplätze lagen der Golfplatz und die Polofelder, dahinter war meilenweit nichts als Zuckerrohr. Ein gelblicher Köter, einer von diesen dürren, kleinen kubanischen Hunden, trottete neben mir her. Je näher ich den Feldern kam, desto stärker wurde der eigenartige Geruch. Der Hund lief im Zickzack und hielt schnuppernd die Nase in die Luft. Es roch nach verbranntem Zucker, ein scharfer, rußiger Geruch, wie wenn einer von Annies Kuchen überquoll und auf den Ofenboden tropfte.
Am Bahnübergang stand kein Wärter, was mich wunderte. Drei Gleise liefen hier zusammen, und andauernd kamen Züge. Einer, zur Hälfte mit gehäckseltem Zuckerrohr gefüllt, stand verlassen da, als hätte jemand von einem Moment auf den anderen die Arbeit eingestellt. Ich stieg über die Schienen und ging auf der Zufahrtsstraße an einer Reihe Arbeiterhütten vorbei. Am Morgen entzündeten die Arbeiter dort normalerweise Feuer, um sich Süßkartoffeln zu kochen, die sie später auf den Feldern aßen. Aber es war niemand zu sehen. Vielleicht ist das idiotisch, aber ich weiß noch, dass ich dachte: Wenn hier kein Kochfeuer brennt, wie hat dann das Zuckerrohr Feuer gefangen?
Von der Zufahrtsstraße aus sah ich eine schwarze Rauchwolke aufsteigen. Vielleicht waren wir ja bombardiert worden, dachte ich. In der Woche davor hatte Batista Phosphorkanister über der Sierra Cristal abwerfen lassen, dem Bergland oberhalb der Stadt, wo die Rebellen sich versteckten. Der Rauch zog über Preston hinweg, und am nächsten Tag fiel Regen und bedeckte die ganze Stadt mit schmierigem Ruß. Auch im Bergland regnete es, aber dort brannten die Feuer weiter. Weißer Phosphor lässt sich nicht mit Wasser löschen; er liebt die Feuchtigkeit. Die Feuer brannten tagelang, töteten Tiere und ein paar von den guajiros, die da oben lebten. Guajiros sind eine Sache, Amerikaner eine ganz andere. Uns hätte Batista nicht bombardiert. Wir waren praktisch die einzige Unterstützung, die er im Osten Kubas noch hatte.
Ungefähr einen halben Kilometer die Straße hoch sah ich Papa im schwarzen Buick vorfahren. Hatch und Rudy Allain saßen bei ihm im Wagen. Hatch war der Plantagenboss, sein Bruder Rudy der Mann, der die Maschinen und die Bewässerungsanlage der Fabrik reparierte. Das Feuer war im südlichen Teil unserer Felder ausgebrochen. Als ich näher kam, spürte ich die sengende Hitze auf meinem Gesicht und der Vorderseite meiner Kleider. Ich hörte das trockene, leckende Geräusch von Flammen. Durch die Hitzewellen konnte ich Papa mit Rudy reden und den alten Mr. LaDue aus der anderen Richtung zu ihnen hinlaufen sehen. Ein paar untergeordnete Angestellte kamen in einem Firmenlaster die Straße heraufgerast. Rudy brüllte Papa etwas zu. Ich war jetzt ganz dicht bei ihnen, aber ich konnte trotzdem nicht hören, was er sagte. Es gab einen lauten Knall wie bei einer Explosion. Zuckerrohr ist flüchtig, vor allem wenn es Erntereife erreicht hat. Schwarzer Rauch strömte empor, so schnell, dass es aussah wie rückwärts laufendes Wasser. Papa hob die Machete eines Arbeiters vom Boden auf und rannte auf die schmale Schneise zwischen zwei brennenden Feldern zu. Er lief direkt hinein und verschwand in Rauch und Flammen.
In Papas Büro im Firmengebäude hing eine Karte von Oriente. Das war die Gegend, in der wir lebten, und es war Kubas größte, ärmste und schwärzeste Provinz. Sie hat das beste Klima und das fruchtbarste Land für den Zuckerrohranbau. Castro hat sie inzwischen völlig zergliedert, aus welchem Grund auch immer; noch so eine absurde Aktion, wie unsere Stadt Preston in «Guatemala» umzubenennen – was überhaupt keinen Sinn ergibt. Damals jedenfalls war die ganze östliche Hälfte der Insel eine einzige Provinz, Oriente eben. Auf der Karte in Papas Büro waren die Ländereien der United Fruit Company grün markiert. Praktisch die ganze Karte war grün – 133500 Hektar anbaufähiges Land –, mit Ausnahme eines kleinen grau unterlegten Gebiets, das nicht uns gehörte und mit «Eigentum anderer» beschriftet war. Was für Dimensionen das waren – man macht sich keine Vorstellung. Vierzehntausend Zuckerrohrschneider. Achthundertfünfzig Eisenbahnwaggons. Eine eigene Maschinenwerkstatt, damit jedes Teil der Fabrik repariert werden konnte. Ein eigener Flugplatz. Zwei DC-3, eine Lockheed Lodestar und Papas private Cessna Bobcat, die er benutzte, um Land zu inspizieren oder schnell mal ins fünfundvierzig Kilometer entfernte Banes zu fliegen, wo die andere Fabrik der Firma war. Wir hatten eine eigene Flotte von Zuckerschiffen, die zwischen Boston und der Fabrik verkehrten. Man konnte im Pan-American Club sitzen, an dem Wall aus Panoramafenstern, der wie der Bug eines Ozeanriesen über das Wasser ragte, und zuschauen, wie die Schiffe ankamen und mit Säcken voll Rohzucker beladen wurden. Während der Erntesaison verarbeitete unsere Fabrik fünfzehn Millionen Pfund Zucker am Tag.
Die Zuckerrohrschneider bekamen ihren Lohn immer am Ende der Saison ausbezahlt. Bevor ihm diese schlimme Sache passierte, errechnete Mr. Flamm, der Zahlmeister, in einem riesigen Kassenbuch, was sie verdient hatten. Die Arbeiter standen auf der Straße Schlange, und Mr. Flamm öffnete den Reißverschluss einer grünen Ledermappe und teilte Pesos aus. Die Geldtasche hatte ein großes Schloss unten am Reißverschluss und das Firmenlogo vorne aufgeprägt. Wenn ein Arbeiter seinen Lohn empfangen hatte, strich Mr. Flamm ihn von der Liste. Die Arbeiter mussten neben ihrem Namen unterschreiben, dass sie ihren Lohn in voller Höhe erhalten hatten. Die meisten stammten aus Jamaika. Sie sprachen korrektes Englisch, aber den eigenen Namen konnte so gut wie keiner schreiben. Stattdessen sollten sie einfach ein Kreuz daneben machen. Manche hatten keine Nachnamen, nur Spitznamen. Hatch Allain stand dabei und passte auf, dass nicht getrickst wurde. Alles wurde in bar geregelt. Sie bekamen den vollen Lohn bar auf die Hand, abzüglich dessen, was sie im Firmenladen, dem almacén, hatten anschreiben lassen. Wenn sie ihren Lohn schon vorher anbrachen, wurde es ins Kassenbuch eingetragen. Die Firma erlaubte ihnen das, damit sie vor dem Zahltag zu essen hatten. Ein Auto oder ein Maultier besaß keiner, deshalb mussten sie in Preston einkaufen. Eine Zeitlang hatte die Firma sie am Ende jedes Arbeitstages entlohnt, doch Papa sagte, es sei besser, das Geld zurückzuhalten und erst am Ende der Saison auszuzahlen. Einige der Männer, die zum Zuckerrohrschneiden aus Jamaika herüberkamen, merkten nämlich bald, dass ihnen die Arbeit nicht besonders gut gefiel, und gingen von der Fahne, ohne der Firma je ihre Schiffspassage von Kingston zurückzuzahlen. Zuckerrohrschneiden ist brutale, brutale Arbeit, einer der härtesten Jobs auf der Welt. Man steht von morgens bis abends gebückt unter der sengenden Sonne und schlägt mit einer flachen Machete Zuckerrohrstängel ab. Messerscharfe Blätter, mit denen man sich in Fetzen schneiden kann. Manche bekommen einen Hitzschlag; auch Herzinfarkte gab es auf unseren Feldern. Man muss schnell arbeiten, weil sonst der Zucker verdirbt. Wenn das Zuckerrohr länger als ein paar Stunden liegt, steigt der Säuregehalt, und es fermentiert. Die Arbeiter schnitten das Rohr und befreiten es von den Blättern. Schnürten es zu Bündeln und luden die Bündel auf Ochsenkarren und von den Ochsenkarren auf Zuckerrohrwaggons, die zur Verarbeitung direkt in die Fabrik rangiert wurden. Es war ein Achtzehnstundentag, mit vielleicht vier Stunden Schlaf. Die Männer standen vor Morgengrauen auf und arbeiteten nach Einbruch der Dunkelheit beim Licht von Öltöpfen weiter. Wenn man sie erst am Schluss der Erntesaison bezahlt, bleiben sie und bringen die Arbeit zu Ende.
Die Zuckerrohrschneider in Preston waren nicht immer aus Jamaika gekommen. Bis in die vierziger Jahre hinein heuerte die Firma hauptsächlich Haitianer an. Jedes Jahr fuhr Papa mit dem Schiff nach Cap-Haïtien, um einen ganzen Pulk von ihnen zur Erntesaison nach Kuba zu holen. Er kannte da drüben einen Herrn, einen ungemein eleganten Franzosen namens Mr. Bloussé, der dafür sorgte, dass soundsoviele Arbeiter herüberkamen und unser Zuckerrohr schnitten. Ich war noch ganz klein, aber ich erinnere mich daran, wie eins dieser Schiffe, ein Trampdampfer mit zwei Schornsteinen, in der Bucht von Preston anlegte, voller Männer, deren schwarze Arme ich über den Schiffsrand hängen sah. Sie wurden vom Schiff auf offene Waggons verfrachtet und weitertransportiert. Wenn ich heute drüber nachdenke, könnten es Zuckerrohrwaggons gewesen sein. Zuckerrohrwaggons sind letztlich nichts anderes als Käfige mit ovalen Eisenstangen, die sich wie der Brustkorb eines Wals nach außen biegen, damit die Zuckerrohrstangen hineinpassen. Die Haitianer wurden darin auf ein bestimmtes Gelände gerollt, eine Art Gehege, und bekamen Salze verabreicht. Dann untersuchte sie der Arzt vom Firmenkrankenhaus, Dr. Romero, der auch unseren Dienstboten das Gesundheitszeugnis ausstellte – jeder musste eins haben, sonst durften sie nicht bei einem arbeiten. Danach ließen sie die Männer mehrere Tage lang in dem Gehege, um sicherzugehen, dass sie keine ansteckenden Krankheiten hatten, Ophthalmie oder Ähnliches. Auf diesen Schiffen wurden manchmal üble Sachen eingeschleppt – von Ophthalmie zum Beispiel kann man blind werden.
Als ich ein Junge war, hatten wir noch Eiskästen, und das Eis dafür wurde in einem Jutezuckersack geliefert, mit Sägemehl rundherum, damit es nicht schmolz. Jeden Tag kam ein kleines Pferd mit einem Karren die Avenida hinunter, und der Eismann lieferte uns unseren hundert Pfund schweren Eisblock. Nach dem Zahltag und kurz bevor die Zuckerrohrschneider wieder auf den Dampfer nach Haiti zurück verschifft wurden, gingen die Haitianer nach Mayarí, um sich Koffer zu kaufen und sie mit Dingen zu füllen, die sie mit nach Hause nahmen, knallige Seidenhemden in Rot oder Gelb, billigen Schmuck, kubanischen Rum und dergleichen mehr. Einer kaufte sich einen Hundert-Pfund-Eisblock. Ohne es irgendwem zu sagen, legte dieser Mann das Eis in seinen Koffer und nahm es mit aufs Schiff. Als sie in Le Cap anlegten, wollte er den Kapitän umbringen, weil er meinte, der habe ihm sein Eis geklaut.
Zuckerrohrbrände hatte es früher schon hier und da gegeben. Als ich sechs war, schlug einmal der Blitz ein, und ein paar hundert Hektar fingen Feuer. Die Firma weckte die Arbeiter, und an die tausend Mann hackten mit Macheten auf die Schneisen ein, um sie zu verbreitern und so zu verhindern, dass der Brand die Straße übersprang. Sie legten Gegenfeuer, damit das Feuer, wenn es eine Schneise erreichte, keine Nahrung mehr fand. Zuckerrohrbrände sind notorisch schwer zu löschen. An jenem Morgen sah ich, wie die Flammen sich über den südlichen Teil unserer Felder ausbreiteten. Auch wenn jeder einzelne Arbeiter dadraußen mithalf, war mir schleierhaft, wie sie das Feuer unter Kontrolle bekommen wollten.
Rudy sprach gerade mit Mr. LaDue und ein paar anderen, als ich angelaufen kam. Ich hatte noch nie eine Schneise geschlagen, aber ich griff mir eine Machete, die an dem kleinen Unterstand lehnte, wo der arme Mr. Flamm – er ruhe in Frieden – früher immer die Arbeiter ausgezahlt hatte. Mr. Flamm war ein zarter kleiner Mann mit Hornbrille gewesen, und sie hatten ihm den Unterstand gebaut, damit er nicht in der prallen Sonne stehen musste, während er den Zuckerrohrschneidern ihren Lohn aushändigte. Die Machete war schwer. Ich hätte einen Dreck damit ausrichten können, aber ich wollte es trotzdem versuchen. Ich lief auf die Schneise zu, in der Papa verschwunden war. Rudy packte mich an den Schultern und versperrte mir den Weg. «Moment, Sohnemann», sagte er. «Nützt uns nix, wenn du in dem Feld da verbrennst.» Genau in der Sekunde fuhren zwei Männer im Lastwagen vor und brüllten Rudy zu, sie bekämen das Hauptventil nicht auf. Rudy sagte, ich solle ihm folgen. Wir liefen los und sprangen in einen der Lastwagen. Er fuhr uns ein Stück die Zufahrtsstraße hinunter und parkte bei einem Zapfhahn, dem Zugang zur Hauptleitung der Bewässerungsanlage. Rudy bückte sich und begann, mit einem Schraubenschlüssel den Bolzen am Zapfhahn zu lockern. Er nahm den Bolzen ab und drehte das Ventilrad gegen den Uhrzeigersinn. Nichts geschah. Es kam kein Tropfen Wasser heraus. Er probierte es erneut. Das Rad war jetzt ganz aufgedreht.
«Verdammt.» Er warf den Schraubenschlüssel auf den Boden. Die Luft war voller Rauch, und Rudys gutes Auge war rot und gereizt. Das andere war aus Glas. Ich musste husten und zog mir das Hemd über die Augen.
Er drehte noch einmal am geöffneten Rad. «Ein Scheißpech haben wir, K.C.»
Jetzt kamen noch mehr Männer, Leute vom Hauptsitz der Firma. Papas Sekretär, Mr. Suarez, war bei ihnen – womöglich der einzige Kubaner der ganzen Truppe. Alle hatten Macheten in der Hand und trugen Schals um den Mund gebunden. Sie steuerten auf die Schneise in der Nähe des kaputten Hauptventils zu. Dort waren keine Zuckerrohrschneider. Auch keine Fabrikarbeiter. Nur Männer aus der Verwaltung – Landwirtschaftsspezialisten und Bürohengste.
«Das Batey ist eine Geisterstadt», brüllte Hatch Allain, der Plantagenboss, im Näherkommen. «Ich habe den Wärtern gesagt, sie sollen überall an die Tür klopfen und die Leute wecken. Bald müssten mindestens hundert Mann hier sein.»
Die Hitze von den Flammen drückte mir aufs Gesicht, als bekäme ich einen Sonnenbrand. Ich hustete die ganze Zeit, obwohl ich mir das Hemd über den Mund gezogen hatte. Wie Papa es mitten in dem Feuer aushalten konnte, ist mir ein Rätsel.
Mr. LaDue kam die Straße herunter, und Rudy rief ihm zu, das Ventil sei kaputt und es gebe kein Wasser. Mr. LaDue sah noch älter aus als sonst. Er war halb rasiert und hatte Rasierschaum am Hals.
«Wenn wir das Feuer nicht vor der Zufahrtsstraße stoppen können, geht die ganze Stadt in Flammen auf», sagte er zu Rudy.
Nach und nach tauchten immer mehr Männer auf, und Rudy und Hatch brüllten ihnen ihre Anweisungen zu – wo sie in die Felder hineingehen, wie weit unten sie das Rohr abschlagen sollten. Ich wollte auch helfen. «Rudy, Hatch, lasst mich mitmachen.» Aber Rudy sagte, ich solle nach Hause laufen und meine Mutter bitten, Mr. Smith, den amerikanischen Botschafter, anzurufen. Was Botschafter Smith gegen ein Zuckerrohrfeuer unternehmen sollte, war mir zwar nicht klar, aber ich tat, was Rudy sagte.
Die Rauchwolke vom Feuer trieb jetzt über die Bucht. Es sah aus, als schiebe sich ein gewaltiger schwarzer Ozeandampfer über den Himmel. Als ich nach Hause rannte, um Mutter Rudys Nachricht zu überbringen, fiel Asche auf die Stadt herunter. Wie Schnee, feine graue Flocken, die herabschwebten und auf den heißen Luftzügen vom Feuer wieder hochwehten. Eher wie die künstlichen Flocken in einer Schneekugel als echter Schnee. Sie wirbelten herum, ein kreiselnder Sturm aus Zuckerrohrasche.
Mr. Bloussé, der die Arbeiter aus Haiti rekrutierte, kam uns einmal in Preston besuchen. Er war schneidig wie ein Filmstar: blondes Haar, pomadisiert und glänzend, ein Seidenplastron um den Hals. Er trug französisch geschnittene Hemden mit schwarzen Onyxmanschettenknöpfen und militärische Jodhpurhosen. Hinter ihm stand ein Diener, ein haitianischer Junge, der die ganze Zeit mucksmäuschenstill war, ein komischer Kerl. Ab und zu schnippte Mr. Bloussé mit den Fingern und sagte etwas auf Französisch zu ihm, dann rannte der Junge los, um irgendeinen Auftrag auszuführen. Ich hatte angenommen, er verstehe nur Französisch oder eine Variante davon, ein muttersprachliches Patois, doch dann sprach Mr. Bloussés kleiner Haitianer mich einmal plötzlich auf Englisch an. Mr. Bloussé war mit Papa im Wohnzimmer, und der Junge fragte mich, als ich im Flur an ihm vorbeikam, ob wir Bücher hätten, die er sich anschauen könne. Ein Junge, der Koffer trug und Mr. Bloussés Schuhe putzte. Geduldig und als hätte er keinen Gedanken im Kopf, stand er dort im Flur. Und doch konnte er offenbar lesen, und zwar auf Englisch. Ich gab ihm ein paar Zeitschriften zum Anschauen und fragte ihn, wie er Lesen gelernt habe. Er sagte, Mr. Bloussé habe es ihm beigebracht. Das gehöre zu seiner Ausbildung. Ich weiß nicht, was für eine Ausbildung das war. Später arbeitete er für die Lederers in Nicaro. Eine von den Töchtern, die rothaarige Everly, folgte ihm auf Schritt und Tritt. Es war genau derselbe Junge, nur dass er inzwischen erwachsen geworden war – einer von vielen haitianischen Dienstboten in Nicaro, aber mit einer seltsamen Geschichte, die ich zufällig kannte.
Mr. Bloussé brachte Mutter Luxeuil-Spitze und Papa eine Flasche teuren Cognac mit. Er und Papa saßen jeden Abend bis spät in der Nacht zusammen, tranken und rauchten Zigarren. Papa sammelte Spirituosen aus aller Welt. Auf einem Mahagoni-Wagen hatte er kleine, mit Kümmelschnaps gefüllte Glasbären aus Russland stehen und Flaschen mit gelbem und grünem Chartreuse – der gelbe leuchtete; es sah aus, als schiene eine Glühbirne von unten durch das Glas. Er hatte Orgeat und sirupartigen, weißen Pfefferminzlikör in Kristallkaraffen. Spanischen Cidre und Birnenschnaps, mit einer ganzen, in der Flasche schwimmenden Birne. Der stammte aus Portugal. Die Flasche war durchsichtig, und die Birne wirkte wie ein Fisch unter der Wasseroberfläche eines Teichs. Die jüngeren Männer aus der Geschäftsführung kamen vorbei, um im Wohnzimmer zu sitzen, Cognac zu trinken und sich mit Mr. Bloussé zu unterhalten. Er war in der französischen Fremdenlegion gewesen und auf der ganzen Welt herumgekommen. In Sansibar, einfach überall. Alle bewunderten ihn. Er war reich, besaß ein prachtvolles Anwesen in Cap-Haïtien. Ich weiß noch, wie er von seinen drei Töchtern erzählte. Sie waren gerade im heiratsfähigen Alter, vielleicht siebzehn oder achtzehn. Einige der Männer wollten Treffen mit Mr. Bloussé vereinbaren und um seine Töchter werben. Ich stellte sie mir wie französische Tropenprinzessinnen vor, hübsche Mädchen in raffinierten Kleidern, denen Dienstboten in einem Innenhof mit Palmblättern Luft zufächelten.
«Ja, ich weiß, dass Seine Exzellenz in Havanna ist, aber mein Mann ist der Meinung, er sollte Bescheid wissen», sagte Mutter zu jemandem von der Botschaft.
«Ob wir die Feuerwehr gerufen haben? Ja, Ma’am.»
«Nun, ich bin mir nicht sicher, warum er wollte, dass ich Sie anrufe, aber einen Grund wird er schon gehabt haben. Wenn Sie ihm also bitte ausrichten würden, dass Evelyn Stites angerufen hat, im Auftrag von Malcolm Stites, und dass wir es hier mit einem erheblichen Brand zu tun haben.»
«Ja, Ma’am, wir haben die Feuerwehr gerufen.»
Mutter war zu höflich, um der Botschaftsdame zu sagen, dass es sich um United-Fruit-Territorium handelte und wir die Feuerwehr waren.
Nach diesem Anruf fing Mutter an zu weinen, klammerte sich an mich und ließ mich nicht wieder los. Weinen war etwas, das Papa nicht duldete. Ich verstand, dass dies ihre Chance war, es trotzdem zu tun. Ich erzählte ihr nicht, dass Mr. LaDue gesagt hatte, die ganze Stadt drohe in Flammen aufzugehen. Das war nicht nötig. Durch das Fenster konnten wir beide sehen, wie Ho, unser Gärtner, seinen Schlauch nach oben richtete, um das Dach und die Hauswände zu befeuchten.
Gegen Mittag war der Rauch von den Zuckerrohrfeldern so dicht geworden, dass er die Sonne ausblendete. Es war mitten am Tag, und es gab nur noch einen Rest Dämmerlicht, wie an einem Sommerabend um neun. Mutter und Annie und die anderen Hausangestellten rannten umher und klemmten feuchte Handtücher in die Fensterrahmen und unter die Türen. Die Sekretärin von Botschafter Smith, vielleicht auch die Sekretärin der Sekretärin, rief an, um Mutter mitzuteilen, dass sie sich bemüht, Seine Exzellenz aber noch nicht ausfindig gemacht habe. Botschafter Smith war nie in seinem Büro, wenn Papa ihn brauchte. Wenn die Arbeiter in den Streik traten oder es ein Missverständnis mit Batistas Leuten über Exportgebühren gab, rief Papa ihn an, und der Botschafter, meist gerade auf dem Golfplatz oder im Yachtclub oder Gastgeber eines Wohltätigkeitsballs, ließ sich alle Zeit der Welt, bevor er sich kümmerte. Er war ein echter Vertreter der besseren Gesellschaft New Englands, Yale University, das ganze Programm. Der Havanna Yachtclub war derart exklusiv, dass er den Präsidenten von Kuba abgelehnt hatte. Batista war ein Mulatte aus Banes, der anderen United-Fruit-Stadt. Sein Vater hatte als Zuckerrohrschneider für uns gearbeitet. Auch Batista hatte für uns gearbeitet, bei der Eisenbahn. Er begann als Hilfsfahrer einer Firmendraisine – eines offenen Fahrzeugs mit angeflanschten Rädern, das auf Schienen fuhr – und wurde später zum Schrankenwärter befördert.
Ich war im Wohnzimmer und hörte Radio, um herauszufinden, was in den Bergen vor sich ging. Auf die Idee, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden sein könnte, war ich nicht gekommen, aber ich hatte instinktiv Radio Rebelde hereinzukriegen versucht. Sie sendeten jeden Abend um siebzehn und einundzwanzig Uhr, drahtlos, auf dem Zwanzig-Meter-Amateurfunkband, und der Empfang war glasklar. Papa erlaubte nicht, dass ich das hörte, aber wenn er nicht in der Nähe war, tat ich es trotzdem, weil ich hoffte, etwas über meinen Bruder zu erfahren. Sie berichteten über Raúls Kolonne, über diesen oder jenen Sieg und die entsetzlichen Phosphorbombeneinschläge in den Bergen, und einmal hörte ich etwas von «mutigen Ausländern», die der Bewegung dienten. Aber niemand nannte Del beim Namen. Im Rückblick scheint es erstaunlich, dass sie sich eine so kolossale Propagandachance durch die Lappen gehen ließen. Der älteste Sohn ihres Feindes Nummer eins, des La-United-Chefs, hatte sich der Bewegung angeschlossen, und sie nutzten es nicht für ihre Zwecke.
Als ein paar Monate später – im Sommer desselben Jahres, 1958 – die Männer aus Preston und Nicaro entführt wurden, luden die Rebellen Fotojournalisten von Life ein, auf die Sierra Maestra zu kommen und sie in ihrem Lager zu besuchen. Den in der Zeitschrift abgedruckten Bildern nach zu urteilen veranstalteten die Leute da oben eine Riesensause – Entführer und Geiseln tranken zusammen Rum und rauchten Zigarren, alberten herum und lagen barfuß in Hängematten. Mr. Lederer aus Nicaro posierte mit dem Hüftholster eines Rebellen und gezogener Pistole, und die Bildunterschrift lautete, die Kubaner hätten ihm den Spitznamen «Desperado» gegeben. Was für eine Entführung sollte das sein? Die Rebellen schafften es, wie echte Helden auszusehen, vom Typ romantische Revolutionäre, und das auf den Seiten des Life-Magazins. Es hätte einen ziemlichen Skandal gegeben, wenn ruchbar geworden wäre, dass sie einen jungen Amerikaner auf ihrer Seite hatten. Noch dazu nicht irgendeinen, sondern ein Aushängeschild des amerikanischen «imperialismo» – Delmore Stites, Sohn von Malcolm Stites, Manager des kubanischen Zweigs der Firma United Fruit.
Ich fummelte am Radioapparat herum, bis ich Rebelde drinhatte. Angeblich hatten sie den Highway östlich von Camagüey unpassierbar gemacht. Man sagte ihnen nach, dass sie gern übertrieben, wenn es um die Darstellung ihrer Vorstöße ging, deshalb glaubte ich es nicht recht. Plötzlich hörte ich die Wohnzimmertür aufgehen und schaltete blitzschnell das Radio aus. Ein rußbedeckter Mann stand im Türrahmen. Er sah aus wie ein Schornsteinfeger, von oben bis unten verkohlt. Die Haare auf seinem Kopf waren stellenweise abgebrannt. Es war Papa. Seine Augenbrauen waren weg. Auch sein Schnurrbart. Er hatte einen ramponierten Benzinkanister in der Hand, einen dieser grün-gelben Firmenkanister, wie es sie in Rudys Werkstatt gab. Ohne ein Wort zu sagen, stand er da und ließ den Kanister auf den Wohnzimmerboden fallen, der, offenbar leer, vom Holz abprallte. Papa trug nie etwas anderes als das Firmenleinen. Er war das Inbild eines United-Fruit-Mannes, groß und furchteinflößend in seinem perfekt gebügelten Anzug. Und hier stand er nun, mit verdreckter weißer Hose und ohne Jacke. Im Pyjamaoberteil, die Ärmel aufgekrempelt, an Händen und Armen Brandwunden von der Farbe eines rohen Steaks.
Der zerbeulte Kanister lag auf dem Boden, ohne Verschluss. Papa stand in seinen angekokelten, rußverschmierten Sachen davor. Er sah zu schmutzig aus, um sich auf seine eigenen Möbel zu setzen.
«Den habe ich da draußen auf den Feldern gefunden», sagte er.
Ich war mir nicht sicher, ob ich still sein oder antworten sollte. Aber ich wusste, was das hieß. Jemand hatte das Feuer gelegt. Wenn das Zuckerrohrunternehmen irgendwem gehörte, dann Papa. Dass Menschen es zerstören wollten, das war, als wollten sie ihn zerstören. Und uns.
«Es ist widerwärtig, wozu diese Leute bereit sind.» Er fing an zu husten. «Diese Schweinehunde.» Der Rauch hatte ihm fast die Stimme geraubt. «Diese verdammten Schweinehunde. Das nennen sie verhandeln?»
Papa setzte sich auf den Stuhl mir gegenüber und stützte den Kopf in die Hände.
«Erst sagen sie, sie wollen mit uns reden, eine Vereinbarung treffen. Und im nächsten Moment versuchen sie, uns niederzubrennen.»
Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass Papa angefangen hatte, Nachrichten ins Rebellenlager zu schicken, um mit Raúl zu verhandeln. Spätestens da begriffen die amerikanischen Manager in Oriente, was die Stunde geschlagen hatte, und bemühten sich eifrig, die Türen für die Rebellen offen zu halten, weil sie hofften, ihre Unternehmungen, ihre Amigo-Geschäfte inklusive Steuerfreiheit, weiterführen zu können, sollten die Rebellen plötzlich die neue Regierung stellen. Papa machte natürlich weiterhin Geschäfte mit Batista – er war schließlich der Präsident –, doch Batista hatte die Kontrolle über Oriente verloren. Das war eine Tatsache, auch wenn die Leute in Havanna, Botschafter Smith und Batistas Generäle, es nicht wahrhaben wollten. Und so hatte Papa eigenmächtig versucht, einen Kommunikationskanal zu schaffen. Bestimmt versuchte er auch Del zurückzugewinnen. Das Problem war nur, dass Del nicht nach Hause kommen wollte.
«Wir hatten eine Abmachung», sagte Papa, «und die lautete, dass ich mit ihnen verhandle und sie uns in Ruhe lassen. Ich habe Raúl Castro einen Brief nach da oben geschickt. Sie haben es schwarz auf weiß. Und dann fallen sie uns in den Rücken und attackieren uns.»
Noch nie hatte mein Vater mir solche Sachen anvertraut. Arbeit war Arbeit, und zu Hause hängte er sie an den Garderobenhaken; das war sein Prinzip.
«Ich habe dieser Schwuchtel Raúl persönlich versprochen, dass ich Dulles an die Strippe kriegen und ihn dazu bringen würde, die Waffenlieferungen zu stoppen. Das habe ich auch getan, ich habe meinen Teil der Verabredung eingehalten – und was ist der Dank? Dass ein Haufen Einheimischer aus den Bergen gelaufen kommt und Brände legt.»
Der graue Bereich auf der Karte in Papas Büro, auf dem «Eigentum anderer» stand, war eine ziemlich große Plantage in der Nähe von Birán, südwestlich von uns. Sie gehörte Don Ángel Castro, dem Vater von Fidel und Raúl. Er hatte dort aus irgendeinem ungewöhnlichen Grund eine Menge Land erworben. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hatte – wahrscheinlich, indem er Grenzverläufe verschob. Er verkaufte uns sein Zuckerrohr, aber das Land wollte er nicht hergeben. Alle kannten die Familie. Wenn sie aus Havanna zu Besuch waren, wo sie alle zur Schule gingen, drückten sich die Kinder, vor allem Raúl und Fidel, in Mayarí herum, in den Billardsalons und bei den Hahnenkämpfen. Später sagte Fidel, als Heranwachsende hätten sie Preston nicht betreten, zu keiner unserer gesellschaftlichen Veranstaltungen eingeladen werden und unsere Strände nicht nutzen dürfen. Aber sie waren auch keine Angestellten der United Fruit Company, und alles, jeder einzelne Quadratzentimeter, war Privateigentum. Und selbst wenn sie Angestellte gewesen wären – Kubanern war der Zutritt zu bestimmten Orten, zum Beispiel dem Pan-American Club, eben nicht gestattet. Allerdings hätten sie dort auch gar nicht hingehen wollen. Alle blieben unter sich. Amerikaner unter Amerikanern. Kubaner unter Kubanern. Jamaikaner unter Jamaikanern. Ich weiß noch, dass ich Raúl tuntig fand. Die Leute behaupteten, er sei einer von denen. Sie wissen schon. Ein maricón. Und dass er eine chinesische Mutter habe; er sah orientalisch aus, und in der Hinsicht waren sie abergläubisch. Ich weiß nicht, ob das stimmte oder nur Gerede war. Fidels Mutter – Lina – war das Dienstmädchen des Alten, sie hatte Kinderlähmung gehabt und seitdem einen verkümmerten Arm. Del und ich gingen oft oben in Birán jagen, Perlhühner und blaue Tauben, und sahen dann Don Ángel mit einer dicken Zigarre im Mund in seiner guayabera auf der Veranda sitzen. Wir blieben immer stehen und grüßten ihn. Als er uns das erste Mal zu einem Glas Wasser heraufbat, starrte ich die ganze Zeit fasziniert Linas verkümmerten Arm an, so wie Jungs eben sind. Nach echter guajiro-Art stand das Haus auf Stelzen, und darunter liefen Hühner und Ziegen herum.
Monate vor dem Feuer hatte Papa Verdacht zu schöpfen begonnen, dass einige der Zuckerrohrschneider mit den Rebellen sympathisierten. Er ließ Pfarrer Crim Bericht über die Arbeiter erstatten. Und man mag es rassistisch nennen, vor allem heutzutage, aber es war nur vernünftig, bei jedem Schwarzen – ob Kubaner, Haitianer oder Jamaikaner – mit Ärger zu rechnen. Zwei Monate bevor das Feuer gelegt wurde, war einer der Zuckerrohrschneider in Mr. Flamms Büro aufgetaucht. Er wollte einen Gutschein über einen Teil seines Lohns haben, um im almacén anschreiben zu können. Aber er hatte schon mehr ausgegeben, als er für die gesamte Erntesaison bekommen würde. Manche von den Männern waren da unklug. Sie holten sich Gutscheine und kauften im Firmenladen Gerätschaften, die sie für ein Viertel des Werts in Mayarí weiterverkauften, bloß um Bargeld zu haben. Und es für Fusel und Lotterietickets zu vergeuden. Wenn dann der Zahltag kam, stand ihnen nichts mehr zu. Sie schufteten ohne Bezahlung wie die Tiere, nur um gegenüber der Firma schuldenfrei zu werden. Dieser Zuckerrohrschneider also und Mr. Flamm hatten eine Auseinandersetzung. Mr. Flamm wollte ihm keinen Ladenkredit mehr geben, er zeigte ihm die Bücher und versuchte ihm zu erklären, warum, aber der Mann wollte nichts davon hören. Was für eine Schande. Deshalb taucht man doch noch lange nicht mit der Machete in einer Firmenzentrale auf. Mr. Flamm war ein winzig kleiner Mann mit Drahtbrille. Hätte bloß jemand den Kerl aufgehalten, bevor er mit seiner Machete zu ihm reinging. Danach sagte Hatch, keine Schwarzen mehr in den Büros. Mr. Flamm verblutete noch an Ort und Stelle, dort in der Buchhaltung. Das ist doch keine Politik, das ist geisteskrank. Es gab eine Menge Zuckerrohrschneider, Tausende, und wie gesagt, sie hatten kaum Namen. Sie kamen auf Schiffen aus Kingston und wohnten in diesen Löchern. Der, der Mr. Flamm umgebracht hat, konnte fliehen. Ich weiß nicht, ob er je geschnappt wurde.
Die Firmenmitarbeiter, die um Mr. Bloussés Töchter werben wollten, kamen zu uns nach Hause, um sich mit Mr. Bloussé zu treffen. Drei waren es, die mit glattgekämmten Haaren, im Abendanzug und nach Vitalis riechend bei uns erschienen. Drei gelangweilte, einsame Junggesellen. Sie bezogen ein gutes Gehalt, hatten keine Kosten, wohnten mietfrei; die Firma bezahlte alles. Aber sie wussten nicht, wohin mit dem Geld, wofür sie es hätten ausgeben sollen, und mit den Kubanerinnen konnten sie nicht anbändeln. Jedenfalls nicht mit den hellhäutigen der Oberschicht. Das erlaubten die Kubaner nicht; aus ihrer Sicht waren wir Amerikaner Bastarde. Wir hatten nicht das richtige Blut. Reiche Kubaner, Plantagenbesitzer und Politiker, schickten ihre Kinder nach Europa zur Schule – Paris oder Madrid – und nicht in die USA. Sie wollten, dass ihre Töchter spanische Aristokraten heirateten, keinen Bauerntrampel aus Kansas. Gelang es diesen Männern doch einmal, sich mit einer Kubanerin zu verabreden, mussten sie mit deren Mutter, Schwester und Großmutter – einer strengen dueña im schwarzen Spitzenschal, die das Treffen beaufsichtigte – auf der Veranda sitzen. In Oriente ging man nie allein mit einer jungen Kubanerin aus. Aber diese Männer waren das alles nicht gewohnt und nahmen gern eine Abkürzung. Papa sagte, er habe eine Menge guter Leute, ausgezeichnete Mitarbeiter, verloren, weil sie sich wegen einer Kubanerin in Schwierigkeiten gebracht hatten. In diesen Dingen war Papa empfindlich. Wir mochten zwar das Land besitzen, aber er musste mit den Kubanern klarkommen, um sich Batista und die Guardia Rural gewogen zu halten, diese Sorte lateinamerikanischer Faktoten, und es war besser, einen Mitarbeiter zu feuern, als irgendwen zu beleidigen. Papa machte es sich zum Prinzip, in Junggesellenhaushalten nur dicke alte Jamaikanerinnen arbeiten zu lassen. Je jünger der Mitarbeiter, desto dicker, älter und hässlicher die Hausangestellte. Keine jungen, hübschen Frauen für diese Männer. Papa selbst hatte immer einen Sekretär. Er arbeitete bis spätabends und sagte, er wolle keine Sekretärin, die nach Hause gehen müsse, um das Abendessen für ihre Familie zuzubereiten.
Als Mr. Bloussé das nächste Mal nach Preston kam, brachte er seine Frau und die drei Töchter mit. Sie wohnten im firmeneigenen Hotel unten am Hafen – ich bin sicher, dass es inzwischen völlig verwahrlost ist, wie alles in der Stadt. Ich habe Bilder gesehen, einfach furchtbar, wie diese Orte dem Verfall anheimgegeben werden. In jedes Haus stopfen sie zehn Familien und lassen die Gebäude verrotten, kein neuer Anstrich, keine Wartung. Es war ein sehr elegantes Hotel, mit dunkelroten Wänden und Mahagonimöbeln. Mr. Bloussé, seine Frau und seine Töchter bezogen ihre Zimmer und kamen dann zum Abendessen zu uns. Als sie vor der Tür standen, fiel Mutter die Kinnlade fast bis zum Boden runter. Mr. Bloussés Frau war Haitianerin – sie war schwarz, und ich meine schwarz, und die Töchter genauso. Annie wollte sie nicht bedienen. Ich glaube, sie empfand es als Kränkung, andere Schwarze zu bedienen, noch dazu derart dunkelhäutige. Es gibt da einen Kodex. Die Junggesellen, die Mr. Bloussé mit ihrem pomadigen Haar und ihrem Vitalisduft hatten beeindrucken wollen, bekamen Wind davon, und kein einziger tauchte auf, um die Töchter kennenzulernen. Die Werbung war abgeblasen. Die Männer rissen hinterher Witze darüber, bezeichneten Mr. Bloussé als Niggerfreund und Schwarzgrundel. Aber Papa hörte ich nie ein Wort dazu sagen. Ich wusste, dass er die Vermischung der Rassen missbilligte. Die Kubaner fingen manchmal was mit Schwarzen an und nannten ihre Freundinnen dann mi negrita. Und die Chinesen heirateten notgedrungen Kubanerinnen, denn chinesische Frauen gab es ja nicht. Vielleicht war das der Grund, warum die Leute viele von ihnen beschuldigten, homosexuell zu sein. Und Raúl Castro auch, schließlich sah er halb chinesisch aus. Bei uns zu Hause arbeiteten zwei Chinesen, einer kümmerte sich um den Gemüsegarten und einer um die Blumen. Zur Bedienung der Zentrifugen in der Zuckerfabrik hatte Papa ein ganzes Dorf von ihnen eingestellt. In dem Raum war es heiß wie im Hades. Wenn die Zentrifugen den kochenden Zuckerrohrsirup umrührten, versprudelten die letzten Unreinheiten, und die Zuckerkristalle wurden herausgeschleudert. Die Chinesen trugen bei der Arbeit knappe Unterhosen, die wie Speedo-Badehosen aussahen. Kubaner weigerten sich wegen der Hitze, diese Arbeit zu machen. Jeder Chinese hatte einen Becher Salz und einen Eimer Wasser, und sie trugen die kleinen Speedos, weil da