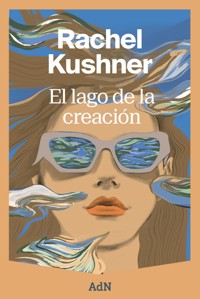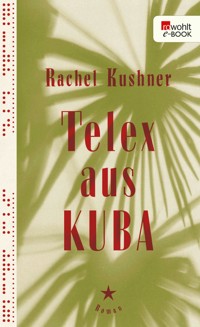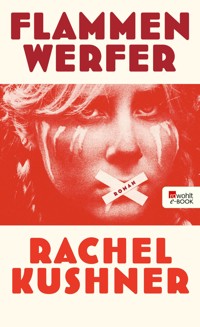9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Rachel Kushner ist für ihren Mut, ihren Ehrgeiz und ihren Killerinstinkt bekannt. In Harte Leute versammelt sie eine Auswahl ihrer Essays, die sich mit den drängendsten kulturellen, künstlerischen und politischen Themen unserer Zeit ebenso befasst wie mit Kushners schriftstellerischen Grundlagen und Wurzeln. Das Buch enthält Texte über Jeff Koons, Denis Johnson und Marguerite Duras, über den Besuch in einem palästinensischen Flüchtlingslager, ein illegales Motorradrennen in Baja California, die wilden Streiks im Italien der Siebzigerjahre, ihre Liebe zu Oldtimern und ihr Leben als Jugendliche in der Musikszene von San Francisco. Es schließt mit einem Finale furioso: einem wilden Manifest über «harte Leute». Zwanzig rasiermesserscharfe Essays von einer der großen Stimmen der zeitgenössischen US-Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Rachel Kushner
Harte Leute
Essays
Über dieses Buch
Rachel Kushner ist für ihren Mut, ihren Ehrgeiz und ihren Killerinstinkt bekannt. In Harte Leute versammelt sie eine Auswahl ihrer Essays, die sich mit den dringendsten kulturellen, künstlerischen und politischen Themen unserer Zeit ebenso befassen wie mit Kushners schriftstellerischen Grundlagen und Wurzeln.
Das Buch enthält Texte über Jeff Koons, Denis Johnson und Marguerite Duras, über den Besuch in einem palästinensischen Flüchtlingslager, ein illegales Motorradrennen in Baja California, die wilden Streiks im Italien der Siebzigerjahre, ihre Liebe zu Oldtimern und ihr Leben als Jugendliche in der Musikszene von San Francisco. Es schließt mit einem Finale furioso: einem wilden Manifest über «harte Leute».
Zwanzig rasiermesserscharfe Essays von einer der großen Stimmen der zeitgenössischen US-Literatur.
Vita
Rachel Kushners erste zwei Romane «Flammenwerfer» (2015) und «Telex aus Kuba» (2017) waren beide New York Times-Bestseller und Finalisten des National Book Award. «Ich bin ein Schicksal» (2019) war ein internationaler Bestseller, Finalist des Man Booker Prize und Gewinner des Prix Médicis étranger. Ihre Bücher sind in 26 Sprachen übersetzt. Sie hat Stipendien der Guggenheim Foundation und der American Academy of Arts and Letters erhalten und lebt in Los Angeles.
Bettina Abarbanell, geboren in Hamburg, lebt als Übersetzerin – u.a. von Jonathan Franzen, Denis Johnson und F. Scott Fitzgerald – in Potsdam. Ihr Werk wurde vielfach ausgezeichnet, etwa mit dem Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Übersetzerpreis.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel «The Hard Crowd» bei Scribner, New York.
Die Übersetzerin dankt dem Deutschen Übersetzerfonds e.V. für die Unterstützung ihrer Arbeit an diesem Buch.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«The Hard Crowd» Copyright © 2021 by Rachel Kushner
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Ann Summa
ISBN 978-3-644-00958-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
The Girl on a Motorcycle
Wir sind hier alle Waisenkinder
Erd-Engel
In der Gesellschaft von Fernfahrern
Schlechte Kapitäne
Happy Hour
Unterwegs auf den Seitenstraßen
Fliegende Autos
Bilderbuchpferde
Nicht in der Band
Hochentzündlich
Jack Goldstein, The ...
William Eggleston, Standbild ...
Larry Fink, Black ...
Danny Lyon, 88 Gold ...
Andy Warhol, Standbild ...
Julie Buck und ...
Lee Lozano, Punch, ...
Allen Ginsberg, Sandro ...
Robert Heinicken, Cliché ...
David Salle, The ...
Gabriele Basilico, Contact, ...
Enrico Castellani, Superficie, ...
Alberto Grifi und ...
Vom Cover von ...
Tano D’Amico, At ...
«Mara» ist Mara ...
Populäre Mechanik
Der Untergang der HMS Bounty
Duras mit s
Brauchen wir Gefängnisse?
Die Rebellin
Lippenstiftspuren
Häschen
Nackte Kindheit
Harte Leute
Dank
Quellen
Bildnachweise
Dieses Buch ist für Peter Kushner und Pinky Drosten Kushner
Was andere von mir aufnehmen, spiegelt sich in mir wider und bildet die Atmosphäre namens: «Ich».
The Girl on a Motorcycle
Wenn ich an Sommertagen zum Spielen nach draußen geschickt wurde, versteckte ich mich oft in der Garage. Deren Attraktionen für ein Kind waren ein Roller mit Holzrädern, mit dem ich auf dem glatten Zementboden herumfuhr; stapelweise Pfirsichkisten, die geplündert werden konnten, bis meine Mutter Zeit fürs Einmachen fand; und eine 1955er Vincent Black Shadow. Die Vincent war das Motorrad meines Vaters, das er 1965, drei Jahre vor meiner Geburt, in England gekauft hatte. Meine Eltern lebten zu der Zeit mit meinem älteren Bruder, der noch ein Baby war, in einer Wohnung ohne fließend warmes Wasser im Londoner Stadtteil Kentish Town, damals ein Arbeiterviertel, in dem auch ein berühmter Theoretiker der Arbeiterklasse – Karl Marx – einmal gelebt hatte. Während meine zweiundzwanzigjährige Mutter oben auf dem Herd Windeln auskochte (in einem Topf, den sie an einem Gemeinschaftswasserhahn im Flur füllte), verbrachte mein Vater die Tage damit, auf der Straße vor dem Mietshaus an seinem Motorrad zu werkeln. Wenn es zu dunkel dafür wurde, ging er in die Kneipe, um Bücher zu lesen, denn der Strom in der Wohnung meiner Eltern lief über einen Münzautomaten und war unerschwinglich, zumindest für sie. Mein Vater behauptet noch heute, dass Kneipenkultur und Klassenbewusstsein zusammengehörten, weil alle des kostenlosen Stroms wegen in Bars gingen. (Mit «alle» meint er, glaube ich, Männer.) Aber an Guy Fawkes Night, so erzählt man sich in unserer Familie, blieb mein Vater zu Hause bei meiner Mutter, und sie sahen gemeinsam aus dem Fenster und schauten zu, wie die Leute ausgediente Möbel und anderen Müll zu einem lodernden Feuer auf der Straße zerrten, wie es an diesem Tag, zum Gedenken an Guy Fawkes’ 1605 unternommenen Versuch, das Parlament in die Luft zu jagen, Brauch war. Als eine Frau einen leeren Kinderwagen zum Feuer schob, drückte meine Mutter den Kleinen schnell meinem Vater auf den Arm und rannte hinunter, um sich den Wagen zu holen. Sie wollte ihn so unbedingt haben, dass sie die Frau unter Tränen anflehte, ihn nicht zu verbrennen. Die Frau lenkte ein und gab ihn meiner Mutter. Es war ein Silver Cross – Luxusausführung –, allerdings ziemlich verdreckt und wegen einer ausgeleierten Feder krängend. Meine Mutter liebte ihre schiefe Kiste und schob meinen Bruder darin gern durch den Regent’s Park, während mein Vater endlos an seiner Vincent herumbastelte.
Gelegentlich fuhr mein Vater auf der Vincent zum Ace Cafe, einem rund um die Uhr geöffneten Diner mit gigantischem Neonschild, in dem das Phänomen des «Café-Rennens» populär gemacht wurde. Eine Vincent Black Shadow war exotisch im Ace, wo die Leute zumeist mit Rennlenkern und zurückversetzten Fußrasten aufgemotzte Triumphs, BSAs und Nortons besaßen, aber zu ihrer Zeit war die Vincent eine sehr schnelle Maschine mit gigantischem Motor (1000 ccm). Als mein Vater das erste Mal zum Ace rausfuhr, das an einer Ringstraße im Nordwesten Londons lag, war draußen vor dem Haus, wo die Motorräder in funkelnden Reihen geparkt standen, gerade ein Streit im Gange. Irgendein irregeleiteter Störenfried verteidigte die Mods (im Ace traf sich ausschließlich die Rockerszene). Mary Quant und die Modewelt hatten die Mods und ihren dandyhaften, androgynen Look, ihre Vespas und Lambrettas zu einem aufkommenden Trend erklärt – einem, der die Rocker als Inbegriff der Coolness abzulösen drohte. Mein Vater fragte einen der Rocker: «Worum geht’s hier denn?» Der Mann sagte: «Das sind Scheiß-Weiber, darum geht’s!» Er meinte die Mods.
Die Rocker waren Männer und wollten, dass man das auch erfuhr. Die Mods waren Weiber. Und auch Frauen waren Weiber, die Kinderwagen schoben. Das war alles vor meiner Zeit, spielte aber in meiner Vorstellungswelt, da draußen in der Garage, eine große Rolle. Was war ich? Ein Kind, das versessen auf das Motorrad seines Vaters war.
Gegen Ende jenes Jahres zogen meine Eltern auf einem griechischen Frachter in die Vereinigten Staaten zurück, und die Vincent kam mit. Ihr rostiger schwarzer Benzintank hat eine Delle, seit sie achtlos vom Frachter auf eine Laderampe fallen gelassen worden war. Wenn ich allein in der Garage war, hob ich die grüne Segeltuchhülle an und lauschte auf das Ticken und Singen ihres Aluminiumgussmotors, der sich in der Sommerhitze regte. Sie war völlig verschmutzt, und trübschwarzes Öl tropfte in eine Schüssel unter ihrem Motor, aber selbst dort auf ihrem Mittelständer, mit beiden Rädern in der Luft, und obwohl sie nur einmal im Jahr gestartet wurde, kam sie mir vor wie ein lebendiges Wesen. Meinem älteren Bruder hätte nichts gleichgültiger sein können als der Unterschied zwischen Universal- und Sechskantschlüsseln; ich war es, die im Regen stand, wenn die Fahrer bei der Rallye der britischen Motorrad-Oldtimer vorbeikamen, zusammen mit meiner Mutter im Matsch am Straßenrand versank und sich, mit sieben, überlegte, dass Motoröl unter den Nägeln, die Fähigkeit, einen Viertaktmotor zu kickstarten oder eine Fußkupplung zu bedienen, nicht nur von Fertigkeiten zeugte, sondern von Charakter.
In dem englisch-französischen Spielfilm The Girl on a Motorcycle von 1968 schenkt Alain Delon seiner jungen Geliebten Marianne Faithfull eine Harley-Davidson. Über weite Strecken des Films sitzt sie auf dem Motorrad und fährt glücklich und vom Wind gepeitscht durchs Land. Das Motorrad war ein Hochzeitsgeschenk: ein fahrbarer Untersatz, der sie aus dem Elsass, wo sie mit ihrem ahnungslosen Lehrer-Ehemann lebt, nach Heidelberg bringen sollte, wo sie sich Delon um der Aufmerksamkeit und Erniedrigung willen (in einer unbeabsichtigt geschmacklosen Szene schlägt er sie mit einem Rosenstrauß auf den Hintern) hingibt.
Obwohl wir sie allein auf der Harley sitzen sehen, ist es Delon, der ihr Schicksal antreibt. Er hat ihr das Motorrad geschenkt, um sie von ihrem Ehemann weg und unter seine Kontrolle zu bringen. Trotzdem kommt man am Wesen der Maschine, die von einer mächtigen Schubkraft bewegt und von der Fahrerin gelenkt wird, nicht vorbei. Wenn sie darauf sitzt, ist sie allein und schnell. Sie fährt bei Sonnenaufgang über die französisch-deutsche Grenze, in einem engen Ledereinteiler mit nichts darunter, und fragt sich, ob der grinsende Beamte sie auffordern wird, den Reißverschluss zu öffnen (der Originaltitel lautete ursprünglich Naked under Leather, daher auch der deutsche Titel Nackt unter Leder). Der Beamte tätschelt ihren Hintern und winkt sie durch. Sie ist zwar zu Delon unterwegs, könnte theoretisch aber überall hinfahren – eine Tour durch Bayern oder nach Polen machen, während Delon raucht und grübelt, gemeingefährlich gut aussehend und allein.
Motorräder kamen nicht als Geschenke von Männern oder Transportmittel zu Männern in mein Leben, sondern als Maschinen, die gefahren werden wollten. Mein erstes Bike war eine Moto Guzzi 500, die schließlich einen Moto-Guzzi-Mechaniker anzog. Der Mechaniker, der zehn Jahre älter war und eine stärkere Persönlichkeit hatte als ich, entpuppte sich als dominierend und manipulativ, ein wenig wie Alain Delon es gegenüber Marianne Faithfull ist. Und bedauerlicherweise stand ich, wie Faithfulls Charakter im Film, unter seinem Einfluss, selbst wenn mein Interesse an Motorrädern – nach der Guzzi wechselte ich zu japanischen Straßenmaschinen – absolut eigenständig war. Der Mechaniker half mir, eine rennfertige Kawasaki Ninja für ein gefährliches, illegales Straßenrennen herzurichten, an dem auch er teilnahm. An dem Rennen teilzunehmen hieß, seinem Leistungs- und Mutstandard gerecht zu werden und sich zugleich allein auf die Reise zu machen. Ich glaube, ich brauchte seine Anerkennung, wollte aber zugleich von dieser Dynamik befreit sein. Selbst wenn es ein Mann ist, der eine Frau auf die Reise schickt – für die Dauer dieser Reise ist sie kinetisch, entfesselt und für sich.
Auf einer Landkarte kennzeichnet eine dicke schwarze Linie den Transpeninsular Highway, oder Highway 1, der sich ganz durch Baja California zieht – eine lang gestreckte vielgestaltige Halbinsel, die vom mexikanischen Festland durch die lauwarmen, lebensreichen Gewässer des Golfs von Kalifornien getrennt ist. Der Highway 1 ist die größte und wichtigste Straße durch Baja California. Sie wurde 1973 fertiggestellt, Zeugnis der Modernisierung und erste Verbindung zwischen Nord und Süd in einem Gebiet, wo die Menschen einst, durch riesige Flächen rauer Wüste und hoher Gebirge voneinander abgeschieden, über ihre eigene Region hinaus kaum Verbindung gehabt hatten.
Eine dicke schwarze Linie auf einer Landkarte kann für Uneingeweihte irreführend sein. Als ich besagtes Rennen 1992, mit vierundzwanzig Jahren, fuhr, wurde der Highway 1 nur auf einer Reihe von Mautstrecken zwischen Tijuana und Ensenada regelmäßig instand gehalten (wenn auch ohne so luxuriöse Dinge wie Leitplanken oder Fahrbahnmarkierungen) – ein winziges Teilstück der 1770 Kilometer langen Straße. Jenseits von Ensenada bestanden die befestigten Straßen aus direkt auf den Erdboden geschüttetem Schotter, hatten also genauso viele Senken und Kurven wie das Land darunter. Solche Straßen halten nicht gut, und so gab es auf der gesamten Strecke bis zum Ende der Halbinsel riesige Schlaglöcher, manche davon klaffende, fünfzehn Meter lange Flächen bröckelnder Befestigung. Die häufigen und dramatischen Senken, vados genannt, konnten mit Sand oder Wasser gefüllt sein und in einer eiskalten Wüstennacht auch mal mit einer schlafenden Kuh, die im Straßenbelag noch Restwärme vom Tag gefunden hatte. Baja California ist bergig und die Straße, abgesehen von ein paar geraden Abschnitten, eine gewundene Aneinanderreihung von uneinsehbaren Kurven und Serpentinen. Viele der Kurven waren nicht mit Warnschildern markiert, und auf der Straßenoberfläche lag oft ein Film aus Dieselkraftstoff, der aus Pemex-Tanklastern geschwappt war. Manchmal verengte sich die Straße plötzlich auf eine einzige Spur, oder der glatte Belag wurde jäh zur Waschbrettpiste, ein brutaler Wechsel des Untergrunds, der bei einem unvorbereiteten Kfz einen Achsbruch und bei jemand auf dem Motorrad ein totales Desaster verursachen konnte, besonders wenn dieser Jemand so dumm war, an einem einzigen Tag die ganze Baja-Halbinsel hinunterzurasen, eine Strecke, für die eine Durchschnittsgeschwindigkeit – Serpentinen, schlafende Kühe und alles eingerechnet – von über 160 Stundenkilometern nötig ist.
Dieses Straßenrennen, Cabo 1000 genannt, war früher ein jährlich stattfindendes Ereignis, das in San Ysidro begann, der letzten amerikanischen Stadt vor der Grenze zu Mexiko, und in Cabo San Lucas, an der Spitze der Baja-Halbinsel, ungefähr 1700 Kilometer weiter südlich, endete. Mit dem Auto ist das eine vier oder fünf Tage lange, schwierige Fahrt bei extremen Witterungsbedingungen und Straßenzuständen. Die erwähnte geforderte Durchschnittsgeschwindigkeit schloss das Abbremsen in Städten ein (eine Ehrensache, die ein paar Teilnehmer stets missachteten) sowie Zwischenstopps, um Wasser zu trinken, zu tanken oder etwas zu reparieren. Um also die durchschnittlichen 160 km/h zu schaffen, musste eine Teilnehmerin auf den geraden Strecken Vollgas geben und so schnell fahren, wie ihr Motorrad es hergab.
Ich hatte zur Vorbereitung auf das Cabo-Rennen monatelang an meiner Ninja 600 gearbeitet. Sie hatte das perfekte Format dafür: war stark, aber klein und wendig genug, um sich in Gebirgskurven gut manövrieren zu lassen. Um die Geschwindigkeit und Leistung zu steigern, rüstete ich das Motorrad mit Aftermarket-Ventilen aus rostfreiem Stahl, einem überarbeiteten Zylinderkopf, einem Hochleistungsvergaserdüsensatz und einer Vier-in-eins-Auspuffanlage mit Drag-Endrohren nach. Ich diskutierte lange mit Freunden darüber, welche Art von Reifen ich wählen sollte, Gespräche, in denen wir das Für und Wider von Leistung und Haltbarkeit gegeneinander abwogen. Für Bodenhaftung und Kurvenfahrten würde ich einen relativ weichen Reifen brauchen, aber ein zu weicher Reifen wäre schon nach der Hälfte der Strecke zerfetzt. Kleine Details, wie die richtige Tönung des Visiers zu finden und sich ein System zu überlegen, wie man es während der Fahrt säubern konnte, waren wichtig. Manche entschieden sich für Tear-offs, Plastikfolien, die man abziehen konnte, sobald sie mit Insekten und Dreck verschmutzt waren. Wade Boyd, ein Isle-of-Man-Veteran, der das Cabo-Rennen viele Male gewonnen hatte (in einem Jahr nahm er auf einem fast spielzeugkleinen Motorrad, einer Zweitakt-350er, teil), hatte sich einen alten, aufgeschnittenen Tennisball auf den Lenker montiert, in dem ein Schwämmchen zum Herausnehmen und Abwischen des Visiers feucht gehalten wurde. Wade war Metallbauer von Beruf, und seine Cabo-Maschine war mit diversen maßgefertigten Anbauten bestückt, die ihm siegen halfen. Er entwarf einen automatischen Kettenöler sowie einen Glasfaser-Doppeltank, der unglaubliche vierzig Liter Benzin fasste (ein typisches Motorrad fasst zwischen fünfzehn und zweiundzwanzig). Seine Maschine sah aus wie eine schwangere Spinne.
In den Wochen vor dem Rennen hatte ich an der Küchenwand des Lagerhauses in San Franciscos Woodward Street, wo ich mit meinem damaligen Freund – dem Moto-Guzzi-Mechaniker – und zwei weiteren Kumpels aus der Motorradszene wohnte, eine Karte von Baja hängen, auf der die Ortschaften mit Pemex-Tankstellen markiert waren. Ich hatte gehört, dass einige dieser Tankstellen ohne Vorwarnung wegen Benzinknappheit oder aufgrund einer Laune des Besitzers geschlossen haben konnten. Ich würde also zusätzliches Benzin mitführen müssen. In einem Bootszubehörladen in Oakland kaufte ich mir einen Zusatztank samt elektrischer Pumpe und beleuchtetem Kippschalter für den Lenker, montierte ihn mithilfe des Freundes auf dem Sozius und verband ihn per Schlauch mit dem Originaltank.
Die letzten paar Tage der Vorbereitung des Motorrads waren hektisch, und als mein Freund, unser Mitbewohner Peter Waymire alias Stack (kurz für Stackmaster – Stapelmeister –, weil er so viele Unfälle baute) und ich aufbrachen, hatten wir die ganze Nacht durchgemacht, alles an unseren Bikes noch einmal nachgeschraubt und geprüft beziehungsweise, in Stacks Fall, den Motor überhaupt erst zusammengesetzt.
Wir fuhren um sechs Uhr morgens in San Francisco los, um nach der Ankunft an der Grenze noch genügend Zeit zum Schlafen zu haben, bevor das Rennen früh am nächsten Morgen begann. Die meisten Teilnehmer des Cabo-Rennens kamen aus SF, und da Tijuana zwölf Stunden südlich davon liegt, transportierten die Leute ihre Motorräder auf Anhängern oder Pritschenwagen dorthin, um Lauffläche und Fahrerenergie zu schonen. Niemand von uns besaß einen Truck, aber mein Freund hatte eine 1960er Tohatsu, ein seltenes japanisches Motorrad, an einen Mann in Los Angeles verkauft, der bereit war, für den Transport bis zu ihm einen Ryder-Truck zu bezahlen. Für den Käufer der Tohatsu war das billiger, als sich das Motorrad schicken zu lassen; für uns bedeutete es den kostenlosen Transport über die Hälfte der Strecke bis zur Grenze. Das Lagerhaus, in dem wir wohnten, hatte früher zu einer Aftermarket-Motorradzubehörfirma namens Hap Jones gehört und war voll von alten japanischen Sammlerstücken wie besagter Tohatsu sowie den hässlichen Aftermarket-Harley-Davidson-Zubehörteilen, für die Hap Jones berühmt war. Der Sohn des Firmengründers erbte das Lagerhaus, als sein Vater starb, und da er selbst keinerlei Interesse an Motorrädern hatte, vermietete er es uns billig und machte auch keinerlei Anstalten, Anspruch auf die Restbestände aus der väterlichen Firma zu erheben. Mein Freund versuchte permanent, alte Motorräder und toten Hap-Jones-Lagerbestand loszuwerden, indem er in Walneck’s Classic Cycle Trader inserierte, dem meistgelesenen Kleinanzeigenblatt für Motorradklassiker. Er tat das so regelmäßig, dass er und die Frau, die bei Walneck’s irgendwo in Illinois ans Telefon ging, sich schon beim Vornamen nannten (er behauptete, sie wolle unbesehen mit ihm schlafen).
Am Nachmittag kamen wir mit dem Ryder-Truck in Los Angeles an. Der Tohatsu-Käufer wohnte in einem schicken Teil von West Hollywood und wartete an der Straße, als wir vorfuhren. Er hatte ein akkurates Wild Angels-Image, mit perfekt gekrempelten Jeans und hochgegelter Tolle. Mein Freund und Stack tauschten Blicke der Sorte klar, Angeber, als der Typ mehrere Hundert Dollar für ein unserer Meinung nach albernes Motorrädchen hinblätterte. Es war ein seltsamer Moment: Hier standen wir, mit unseren eben vom Truck abgeladenen räudigen, zusammenmontierten Bikes, in geflickschusterter Ledermontur und mit Kevlar-Handschuhen, unterwegs zur Teilnahme an einem supergefährlichen, bunt gemischten Jeder-gegen-jede-Rennen. Und dort war dieser ganz andere Typus, aber ebenfalls ein Enthusiast. Er hatte enorme Anstrengungen unternommen, um eine obskure Maschine zu erwerben, und mit seiner Kleidung und der sorgfältigen Frisur hatte er sein Leben offensichtlich auf die Art von Motorrädern zugeschnitten, die er liebte. Er machte sein Ding; es war anders als unseres, aber wir waren allesamt Freaks.
Stack war in L.A. aufgewachsen, und auf seine Empfehlung hin fuhren wir zu einem Nahost-Imbiss am Hollywood Boulevard. Wir aßen unsere Falafel draußen auf dem Gehweg sitzend, wo wir unsere Maschinen im Auge behalten konnten. L.A. ächzte gerade unter einer Hitzewelle, und an dem Nachmittag zeigte das Thermometer knapp 38 Grad. Ich zerfloss in meinen schweren Lederklamotten und war todmüde, weil ich in der Nacht nicht geschlafen hatte. Auf dem Freeway gen Süden gerieten wir in den Berufsverkehr, und vor uns lagen noch 240 Kilometer. Stack war Motorradkurier in L.A. gewesen, und mit seinen instinktiven Fahrkünsten und seiner L.A.-Freeway-Erfahrung nahm er uns mit auf ein Abenteuer, bei dem wir mit achtzig Sachen zwischen den Spuren entlangrasten. Jeder Motorradfahrer fährt durch Gassen, nur nicht mit achtzig Stundenkilometern. Ich war die ganze Zeit kurz vor einem Herzinfarkt, erwartete ständig, dass jemand die Spur wechseln und mich schneiden würde. Aber meinen Freund, der Stack folgte, darum zu bitten, langsamer zu fahren, war ausgeschlossen – und wäre Wasser auf seine Mühle gewesen. «Fahr aggressiv oder stirb im Sattel», hätte er gesagt.
Bei Sonnenuntergang kamen wir in San Ysidro an, einer kleinen Stadt mit einem Motel 6, einem Denny’s gleich gegenüber, ein paar Geldwechselbuden und einer gewaltigen Kontrollstation am Grenzübergang nach Tijuana. Nach dem Zwischen-den-Spuren-Abenteuer lagen meine Nerven blank, und das Rennen hatte noch nicht mal angefangen. Es begann mir besser zu gehen, als ich meine Freundin Michelle entdeckte, die in Shorts, Bikinioberteil und robusten, mit lila Filzstift aufgehübschten Motocross-Stiefeln auf ihrer Honda CBR über den Motel-6-Parkplatz fuhr. Michelle war eine von drei Frauen unter den neunundzwanzig Teilnehmern des Rennens, mich eingeschlossen, und eine versierte Motorradfahrerin. Sie kam mit uns zum Essen im Denny’s, wo mein Freund darüber redete, dass er ein Ausnahme-Informatiker hätte werden können, wenn er gewollt hätte (er verdiente sich den Lebensunterhalt als Mechaniker und damit, in unserem Lagerhaus Cannabis anzubauen), und dass die Kellnerin ihm «den Blick» zugeworfen habe («den Schwanzblick», war sein Ausdruck; überall warfen Frauen – große, kleine, alte, junge, dicke, dünne – ihm den Schwanzblick zu). Als er aufstand, um auf die Toilette zu gehen, brach Michelle in Gelächter aus. Sie hatte selbst mal eine romantische Begegnung mit ihm gehabt und war vorsichtig. Ich schämte mich für ihn und hatte meine eigenen Zweifel.
Nach dem Essen war ein Teilnehmertreffen anberaumt, und alle versammelten sich um den Motel-Pool, um Lee Jones, der das Cabo-Rennen organisierte, sprechen zu hören. Ich verwende hier nicht Lees echten Namen, aber er war Hochadel in der Motorradszene. Wenn man sich für Cabo anmeldete, stellte man ihm einen Scheck aus (im Jahr meiner Teilnahme kostete es hundert Dollar). Das Geld würde angeblich an die Grundschulen von Baja California gehen, und niemand stellte die Legitimität von Lees philanthropischen Unternehmungen je infrage. Er war ein stoischer Mann mit stahlgrauem Haar und dazu passenden Augen, und er besaß einen berühmt-berüchtigten Motorrad-Kurierdienst mit Lieferanten, die wie Glenn Danzig aussahen. Die Leute sagten gerne, Lee sei «von Hells Angels großgezogen» worden, und sie sagten es ehrfürchtig, so als wäre er bei Wölfen aufgewachsen. Lee wies uns an, no comprendo vorzuschützen, sollten wir von federales rausgewunken werden. Jeder bekam einen auf Spanisch geschriebenen Brief ausgehändigt, den wir auf der Fahrt dabeihaben sollten. Er war anscheinend von der Handelskammer und besagte, dass wir eine Wohltätigkeitsfahrt machten, um Geld für die Kinder von Baja California aufzubringen. Es wurde davon gesprochen, wie unwahrscheinlich es war, dass dieser Brief sich als nützlich erweisen würde: Niemand hatte vor anzuhalten, falls ein federale uns dazu aufforderte. Ein renntaugliches Motorrad kann einem Cop – egal welchen Zuständigkeitsbereichs, auch des amerikanischen – ohne Weiteres davonfahren, und zu Hause in SF taten es viele dieser Fahrer regelmäßig aus Spaß (bei meinem ersten Date mit jenem Freund hatte er sie auf seiner Dual-Sport-KLR 650 abgehängt, indem er eine steile kleine Treppe hinunterraste und mit mir hintendrauf von einer einen Meter hohen Böschung sprang). Am nächsten Morgen, schon beim Rennen, kam ich an Kindern vorbei, die am Straßenrand standen, aber ich fuhr 195 km/h und sah sie nur als verschwommene Flecken. Ich vermute, die Kinder von Baja California hatten wenig mehr von unserer Wohltätigkeitsfahrt, als einen kurzen Blick auf heulende, Staub aufwirbelnde Motorräder zu erhaschen.
Bei dem Treffen waren auch zwei Frauen anwesend, die den Crash Truck fahren würden, einen Lkw, mit dem die Siebensachen aller Teilnehmer nach Cabo San Lucas transportiert und die Motorräder eingesammelt werden sollten, die auf dem Highway 1 liegen blieben oder einen Unfall bauten. Ein Typ, an dessen Namen ich mich nicht erinnere, begleitete die Crash-Truck-Frauen. Ich habe seinen Namen vergessen, weil wir ihn sofort «Reggae on the River» zu nennen begannen, nach einem Sommermusikfestival auf dem Eel River, das lässige, langhaarige Typen wie ihn anzog. Reggae on the River hatte ursprünglich vorgehabt, selbst an dem Rennen teilzunehmen, aber auf der San-Ysidro-Ausfahrt zum Motel 6 war seine Vorderbremsanlage ausgefallen, und beim Herunterschalten vor einer Kreuzung, als er das Motorrad zum Stehen bringen wollte, hatte er sich das Getriebe zerstört (und die Sohlen seiner Stiefel waren komplett geschmolzen).
Nach dem Teilnehmertreffen ging ich ins Bett. Es war zehn Uhr, und der Motelwecker würde um halb vier klingeln. Mein Freund war noch auf dem Parkplatz und tat allerletzte Handgriffe an seinem Motorrad, überzeugt, dass er die berüchtigten und favorisierten Lee Jones und Wade Boyd wegpusten würde. Ich döste ein, wurde aber immer wieder von Stimmen draußen geweckt; ein ehemaliger Mitbewohner von uns, Sean Crane, unterhielt sich mit jemandem über die Pros und Kontras von synthetischem Motoröl. Sean hatte ein süßes, aber schuldbewusstes, mädchenhaftes Lächeln und langes, welliges Haar, und er trug eine schwarze Lederkombi mit den aufgenähten weißen Knochen eines Skeletts. Wenn er auf einem Rennmotorrad saß, sah er aus wie eine Todeserscheinung. Sean fuhr auf der Straße, als wäre er auf einer Rennstrecke: Er war talentiert, ging aber enorme Risiken ein. Beim Cabo-Rennen des Vorjahres hatte er mit einem anderen Fahrer, einem Mann aus Los Angeles, gezockt, den, wie sich herausstellte, niemand sonst kannte. Sean hatte ihn an einer Klippe in einer schwer einsehbaren Kurve ausgebremst, sodass er ins Schleudern geriet, über die Klippe stürzte und auf dem Luftweg in ein Krankenhaus in San Diego gebracht werden musste. Er verlor am Ende ein Bein. Sean fuhr einfach weiter.
Um halb fünf wurden wir auf dem dunklen Parkplatz des Motel 6 nebeneinander aufgereiht und ließen alle neunundzwanzig die Motoren aufheulen, ein Schwarm wütender Bienen. Der Morgen graute noch nicht einmal andeutungsweise, und dichter Nebel verdeckte den Vollmond; das Rennen war extra auf einen Vollmondtag gelegt worden. Ich hatte keinem meiner Freunde Glück gewünscht oder überhaupt viel geredet, war vom Moment des Weckerklingelns an voll darauf konzentriert gewesen, mich anzuziehen, das Motorrad warm laufen zu lassen, letzte Vorbereitungen zu treffen – etwa dafür zu sorgen, dass meine von einer Reißverschlusstasche geschützte Karte sicher auf dem Benzintank befestigt war – und dann in Stellung zu gehen. Die Menschen, die ich kannte, waren zu dunklen, unvertrauten Silhouetten mit Ledermontur und Integralhelmen geworden, deren Visiere heruntergeklappt waren. Mein Freund rollte neben mich und hob den wildlederbehandschuhten Daumen, aber ich war schon in meiner eigenen Welt, eingeholt von der Angst und anderen, positiveren Gefühlen – Aufregung, Vorfreude –, und kurz darauf fuhren wir in einer kakofonischen Gruppe vom Parkplatz. Er vollführte einen Schlenker um mich herum und schoss davon. Ich war allein und dachte: Jetzt übernehmen Entropie und Fahrkünste; das ist der Moment, ich bin auf mich allein gestellt. Diejenigen, die an der Spitze waren und bis zu 260 km/h schnell fuhren, würden bei Sonnenuntergang in Cabo ankommen, während andere erst im Verlauf der Nacht, in fünfzehn bis zwanzig Stunden, ins Ziel einrollen würden. Ich überquerte die Grenze nach Mexiko und erreichte die erste lange Steigung, einen dunklen Berg hinauf. Meine Scheinwerfer durchschnitten den feuchten Ozeannebel. Ich war irgendwo in der Mitte des Felds und versuchte, fokussiert zu bleiben, ging durch, was ich wusste, was man mir gesagt, was ich zu erwarten, wie ich wachsam zu sein hatte.
In den Bergen zwischen Tijuana und Ensenada war der Nebel dicht. Die Straßen waren glatt und voller Haarnadelkurven. Als ich in Ensenada ankam, hatte ich den schlimmsten Nebel hinter mir, aber die dunkle, schlafende Stadt barg ihre eigenen Gefahren. Die Temposchwellen waren nicht farblich gekennzeichnet wie in den Staaten, und so flog ich mit 130 km/h unversehens über mehrere davon, das heißt, ich segelte durch die Luft und landete – da die Federung des Motorrads besonders hart war, damit ich knappe und präzise Kurven fahren konnte – äußerst unsanft.
Bei Geschwindigkeiten ab 130 km/h verbrennt Benzin exponentiell schnell, bei über 200 Sachen verfliegt es förmlich. Als ich zum ersten Mal meinen Zusatzbenzinschalter umlegte – ein beruhigendes blaues Licht zwischen meinen orange leuchtenden Instrumenten –, war es ein wunderbares Gefühl, die Nadel meiner Benzinanzeige langsam steigen anstatt fallen zu sehen, während weitere 16 Liter den Tank der Ninja füllten.
Hinter El Rosario ebnete sich die Landschaft, und ich fuhr durch eine bewirtschaftete Niederung. Der Morgen graute, der Nebel löste sich in große, durchscheinende Wölkchen auf, die über die Straße trieben, als ein Bauer direkt vor mir auf die Straße fuhr. Er hatte mich wohl nicht gesehen, in seinem ramponierten Pick-up mit einem einzelnen Scheinwerfer auf dem Dach, der trübes Licht abgab. Ich musste scharf bremsen, um nicht mit ihm zusammenzustoßen. Dummerweise bremste ich auf Schotter. Das Motorrad geriet in ein sogenanntes Lenkerschlagen (auch Tank Slapper genannt), bei dem das Vorderrad die Kontrolle verliert und heftig hin und her wackelt, sodass die Lenkerenden abwechselnd gegen den Tank schlagen. Es ist eine nicht beherrschbare Situation, die man am besten einfach aussitzt. Irgendwann hatte ich das Motorrad wieder unter Kontrolle und fuhr weiter, während das Adrenalin durch meine Adern schoss und es um mich herum allmählich heller wurde.
Die Sonne stand hoch am Himmel, als ich den ersten Tankhalt einlegen musste. Auf den zurückliegenden paar Hundert Kilometern durch die Vizcaino-Wüste, wo es von volkswagengroßen Felsbrocken wimmelte, manche mit behelfsmäßigen Grabmarkierungen wie Kerzen, Gottheitsfiguren und Plastikblumen verziert, hatte ich ein schwerfälliges Wohnmobil nach dem anderen überholt. Ich war bis zu der trostlosen, windigen Raststätte Cataviña gekommen, ein gutes Drittel des Weges die Baja-Halbinsel hinunter. Als ich an der Pemex-Tankstelle anhielt, fürchtete ich, der Wart würde darauf bestehen, den Tank für mich zu füllen. Wenn man mit dem Auto kommt, tun sie das immer, und ich wollte nicht, dass er Benzin über den Rand des Zusatztanks verschüttete. Doch nachdem er mir dabei zugesehen hatte, wie ich den Helm abnahm, meine Kette richtete und ölte und einen halben Liter Öl in den Motor goss, begriff er, dass ich eine eigene Agenda hatte, lächelte und reichte mir den Benzinschlauch. Ich fühlte mich gut – stark und im Rhythmus.
Gegen zwölf hatte ich die Hälfte der Strecke geschafft. Ich war überholt worden, hatte selbst ein paar Teilnehmer überholt und wusste, dass ich mich irgendwo im Mittelfeld befand. 800 Kilometer südlich, kurz vor Guerrero Negro, der Stadt, die sich entlang der Nord-Süd-Grenze von Baja California erstreckt, ist die längste ununterbrochene Gerade auf dem Transpeninsular Highway. Tief in meine Montur geduckt, fuhr ich mit 190 Sachen darauf und drehte den Gashebel bis zum Anschlag hoch. Ich erreichte 228 Stundenkilometer; so schnell war ich noch nie gefahren.
Ich konnte die riesige Metallskulptur sehen, die die Nord-Süd-Grenze kennzeichnet, ein an die zwanzig Meter hohes Gebilde aus Stahlträgern, das, wie ich gehört habe, ein Vogel sein soll, aber eher wie ein auf Grund gelaufener Ölbagger aussieht. Vor mir am rechten Straßenrand stand eine Gruppe geparkter Motorräder. Ich erkannte Wade Boyd, der kilometerweit vor mir hätte sein sollen, und einen anderen Mann, den wir Doc nannten. Ein dritter, der bei ihnen am Straßenrand gehalten hatte, scherte plötzlich vor mir auf den Highway ein. Entweder hatte er mich nicht gesehen, oder ihm war nicht klar, wie schnell ich fuhr. Es war jemand, den ich aus unserer Bikerkneipe in San Francisco kannte, deren Name – Zeitgeist – auf den Rücken seiner rot-schwarzen Ledermontur gestickt war. Nach vielen Stunden der Einsamkeit und intensiven Konzentration war ich froh, diese vertrauten, lächerlichen Lederklamotten zu sehen. Doch dann setzte die Realität ein – dass er nur 50, ich dagegen 210 Stundenkilometer fuhr –, und im Nu war ich dicht hinter ihm. Ich scherte aus. Als ich gerade um ihn herumgefahren war, sah ich, dass die Straße eine unangekündigte, extrem scharfe Linkskurve machte. Aus der anderen Richtung kam ein Lastwagen, sodass ich nicht beide Spuren würde nutzen können. Ich fuhr viel, viel, viel zu schnell, um mich mit dem Motorrad weit genug in die Kurve zu legen, und wollte auch nicht darunter zerquetscht werden. Ich beschloss, von der Straße abzufahren.
Das Gelände jenseits der Straße war ein flacher, sandiger Graben, was im Rückblick wie unglaubliches Glück erscheint – auf dem größten Teil der Strecke führt die Straße zwischen zerklüfteten Felsen auf der einen und Meeresklippen auf der anderen Seite entlang oder zwischen großen Steinen auf beiden Seiten. Aber eine so radikale Oberflächenveränderung bei Tempo 210, selbst wenn der neue Untergrund Sand ist, kann nicht folgenlos bleiben, und als ich vom Asphalt herunterfuhr, katapultierte mich das Motorrad in die Höhe. Meine Erinnerung an dieses Ereignis ist in Bilder zersplittert: Ich sehe den Reifen die Straße verlassen, und dann bin ich mitten in der Luft über dem Motorrad, davon getrennt, hoch über den Instrumenten und dem Lenker, und als Nächstes ist da ein schneller Sturz und ein brutaler, dumpfer Aufprall, wohl mit dem Kopf, wie ich angesichts des enormen Kraters auf der Rückseite meines teuren Renn-Helms später ermitteln konnte. Ich werde wieder hochgeschleudert, mein Körper wird auf den Boden geknallt, mit dem Hüftknochen zuerst, und dieser vorstehende, verletzbare Knochen fühlt sich an, als wäre er zu einer Tüte Staub geworden. Dann hüpfe ich noch einmal kurz hoch und komme endlich trudelnd zum Liegen. Ich schrie in meinem Helm, gedämpfte Schreie, während der Schmerz in meinem Körper raste. Man hört immer, dass dies der Moment ist, in dem die Endorphine zu wirken beginnen, sodass die Menschen nicht mal merken, dass sie verletzt sind, aber ich empfand lebhafte, furchtbare Schmerzen.
Zeitgeist, der Fahrer, der vor mir auf die Straße gefahren war, kam angerannt. Ich schmeckte Blut im Mund und versuchte, mich aufzusetzen. Das Motorrad hatte sich zweimal überschlagen, mich dabei wie durch ein Wunder nicht getroffen, und Teile der Plastikverkleidung, Fußrasten, ein Bremshebel und anderes Ninja-Schrapnell lagen über den sandigen Graben verstreut. Überall Benzin und Öl. Ich war enttäuscht und wütend. Ich konnte nicht glauben, dass ich nach all der Vorbereitungsarbeit einen Unfall gebaut hatte. Ich dachte immer nur: Mein Motorrad, mein Motorrad. Dann hatte ich das Gefühl, mich übergeben zu müssen, also sagte ich: «Nimmst du mir mal den Helm ab?» Zeitgeist schien besorgt und war überzeugt, dass ich mich nicht rühren und den Helm aufbehalten sollte. Ich versuchte selbst, ihn abzunehmen, aber der Wunsch, bewusstlos zu werden, war stärker als der Wunsch, mich zu übergeben. Als ich aufwachte, hielt mich der Biker, den wir Doc nannten, im Arm, und ich hatte den Helm nicht mehr auf.
Doc war tatsächlich ein Doktor. Er hatte eine Hausarztpraxis im Süden von San Francisco, glaube ich, aber später hörte ich, dass er Gefängnisarzt in Folsom geworden war. Doc hatte eine schwarze, mit Tabletten vollgestopfte Arzttasche dabei und vermittelte zwei gegensätzliche, aber gleichermaßen gruselige Eindrücke: Er war immer verdächtig sediert, mit schweren Lidern und einem sanften, nur halb bewusst wirkenden Kichern, und er fuhr mit berüchtigter Aggressivität. Niemand versuchte, ihn zu überholen, weil klar war, dass er einen schneiden und die ganze Straße für sich beanspruchen würde. Trotz dieser Marotten war ich froh, dass ein echter Arzt anwesend war. Ich sagte Doc, dass mein Fußgelenk wehtat. Er zog mir den Stiefel aus. Mein Fuß schwoll an. Doc brüllte, Wade solle ihm eine Rolle Klebeband zuwerfen, und begann dann, meinen Fuß damit zu umwickeln, über der Socke, sehr fest. Er steckte meinen Fuß wieder in den Stiefel, und während ich vor Schmerzen aufschrie, sagte er: «Zieh den Stiefel nicht aus. Du kriegst ihn nicht wieder an.»
Just in dem Moment kam ein mexikanischer Krankenwagen auf uns zugeheult und schoss von der Straße in den Graben, wobei er all die von meiner Ninja abgeplatzte teure Glasfaserverkleidung überfuhr und pulverisierte. Doc und Wade fassten mich eilig unter den Achseln und richteten mich auf, und den Männern, die aus dem Krankenwagen ausstiegen, einer Art Boy-Scout-Bus der Sechzigerjahre mit einem roten Kreuz an der Seite, rief Doc zu: «Geht ihr gut. Alles völlig okay. Kein Krankenwagen.» Es lief das Gerücht um, dass die Kliniken auf der Halbinsel teurer Schwindel seien. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder je gestimmt hat, aber Doc und Wade glaubten es. Die beiden trugen mich über die Straße zu einem alten Hotel, das genau dort am Highway war.
Als sie mich auf den Stufen ablegten, hörte ich Doc mit seiner halb sedierten Stimme murmeln: «Oh, wow, Mann, das ist ja ein Jammer.» Ich schaute über die Straße und sah, wie meine geschrottete Kawasaki Ninja auf der Ladefläche eines Pick-ups festgeschnallt wurde. Der Truck fuhr auf den Highway und beschleunigte in Richtung Norden. Mein Motorrad war gestohlen worden, und es gab nichts, was ich dagegen tun konnte.
Wie sich herausstellte, war der Motor des Favoriten Wade Boyd explodiert. Doc, der ihn am Straßenrand stehen sah und selbst ebenfalls mit mechanischen Problemen zu kämpfen hatte, war in der Hoffnung, Wade könne ihm helfen, an den Rand gefahren. Der dritte Fahrer, der Typ in der Zeitgeist-Montur, der vor mir auf den Highway gefahren war, hatte aus Nettigkeit angehalten. Nachdem er ihnen was zu rauchen gegeben und mehr oder weniger meinen Unfall verursacht hatte, war Zeitgeist weitergefahren. Doc hatte eine lecke Auspuffdichtung, die konnte Wade ohne neue Dichtung auch nicht reparieren. Da er annahm, dass es mir im Wesentlichen gut ging, startete Doc sein Motorrad, das schrecklich klang: schwach und stotternd. Wade lachte und sagte: «Mit dem Ding willst du noch ganz nach Cabo fahren?» Doc nickte. «Das ist besser, als auf den Crash-Truck zu warten. Ihr werdet den ganzen Tag hier sein.» Er fragte mich noch einmal, ob ich Schmerzmittel aus seiner Arzttasche haben wolle (was ich verneinte), und fuhr davon; sein Motorrad keuchte die Straße hinunter wie ein krankes Tier.
Doc hatte recht. Wade und ich warteten den ganzen Tag. Als der Crash Truck schließlich auftauchte, war es nach Mitternacht. Hinten im Wagen rollten zwischen den Reisetaschen und Werkzeugen aller Teilnehmer leere Bierdosen herum, und Reggae on the River und die beiden Frauen schienen sich prächtig zu amüsieren. Ich erzählte ihnen vom Diebstahl meines Motorrads und erntete ein tröstendes «Scheiße, nicht dein Ernst!» von Reggae on the River, der meinen Kummer trotz Betrunkenheit nachfühlen konnte. Nachdem sie Wades Motorrad auf den Anhänger des Trucks geladen hatten, beschlossen Reggae und die Crash-Truck-Frauen, vor der Weiterfahrt gen Süden in dem Hotelrestaurant zu essen. Mir tat alles weh, und ich war erschöpft, aber mit meinem wahrscheinlich gebrochenen Fußgelenk war ich einfach zu schwach, um zu protestieren.
Nachdem in diesem alten Hotel tellerweise Essen und viele weitere Biere konsumiert worden waren, fuhren wir endlich los. Ich schlief hinten im Pick-up unter einer Decke ein. Um vier herum wachte ich an einer Tankstelle bei Loreto von Reggae on the Rivers Stimme auf. «Oh, Scheiße. Alter. Nicht im Ernst!» Er hielt den leeren Seesack eines der Teilnehmer hoch, dessen gesamter Boden durch Reibung weggebrannt war. Nachdem Wades Motorrad in Guerrero Negro auf den Truck geladen worden war, hatten Reggae und die beiden Frauen das Gepäck der Teilnehmer neu verstaut und sich bei vielen Reisetaschen nicht die Mühe gemacht, sie zu sichern. Der Seesack, den er jetzt hochhielt, war nachlässig an die Heckklappe gehängt worden, und wenn Sachen herumrutschten, wurde er über die Ladefläche geschleift, während viele andere Taschen hinausfielen und sich auf dem Highway zwischen Guerrero Negro und Loreto verteilten. Meine eigene Tasche, mit all meinen Kleidungsstücken, meiner Kamera, meinen Hausschlüsseln, all meinen Ausweispapieren und dem Großteil meines Geldes darin, war verschwunden.
Kurz vor Mittag des nächsten Tages kamen wir in Cabo San Lucas an. Die Motorräder waren vor dem touristischen Siegesfeier-Restaurant, dem Giggling Marlin, aufgereiht. Alle begrüßten uns in ihren Shorts und Cabo-1000-T-Shirts. Wades Freundin war extra seinetwegen mit dem Flugzeug hergeflogen und kam mit kalten Margaritas für uns aus dem Marlin gelaufen. Nachdem Wade wegen seiner Panne ausgeschieden war, hatte der lange blonde Randy Bradescu, der ein Motorradgeschäft im Marine County besaß, das Rennen gewonnen. Zweiter war Lee Jones geworden. Mein Freund war am hinteren Ende des Hauptfelds ins Ziel gefahren. Er sagte, er habe das Essen im Denny’s am Abend zuvor nicht vertragen, am Morgen sei er noch ganz vorne gewesen, habe dann aber den ganzen Weg bis nach Cabo alle paar Kilometer an den Rand fahren und kotzen müssen. Wie ich später feststellte, war das bei diesem Mann ein Muster: Immer gab es ranziges Essen, bedürftige Frauen, unsinnige Regeln und eifersüchtige, unfähigere Männer, die ihn behinderten. Im Licht meines eigenen Unfalls erschienen mir seine Probleme zunehmend grotesk.
Während Krüge voll Margarita herumgingen, wurden Geschichten ausgetauscht. Meine Freundin Michelle hatte, zur Überraschung und Irritation vieler der männlichen Teilnehmer, einen mehr als respektablen sechsten Platz belegt. Stackmaster fuhr gleich hinter Michelle ins Ziel, obwohl seine Kopfdichtung die ganze Zeit geleckt hatte und er immer wieder hatte anhalten müssen, um mehr Dichtmittel aufzutragen. Als er in Cabo ankam, war sein Motor über und über mit dem klebrigen orangenen Zeug bedeckt. Sean Crane, der Süße, mit seiner Skelettaufdruck-Montur, war zwischen Tijuana und Ensenada unverfroren auf dem Hinterrad durch die Reihe von Mautstellen geprescht, weil er sich weigerte, die ungefähr drei Dollar fünfzig zu bezahlen. Er setzte einen ganzen Konvoi von federales in Bewegung, die dann irrtümlich meinen Freund James verhafteten. Irgendwann ließen sie James gehen, nicht ohne ihn ein Bußgeld dafür zahlen zu lassen, dass er in einer 80er-Zone 190 gefahren war. Ich hörte zu, trank die Hälfte meiner Margarita und humpelte dann zum Hotel gleich nebenan, um zu schlafen. Es war drei Uhr am Nachmittag, und ich war seit achtundvierzig Stunden wach. Als ich mich auszog, sah ich, dass die Innenseiten meiner Beine so dunkel waren wie eine Schiefertafel; um den lädierten Hüftknochen herum war alles granatapfelrot, und an den Armen hatte ich einen Asphaltausschlag, Abschürfungen, die ich mir beim Aufprall auf dem Boden zugezogen hatte, weil meine Ledermontur eine Nummer zu groß war. Ich zog die Stiefel aus, ließ aber Docs Klebeverband über meiner Socke.
In den nächsten zwei Tagen konnte ich wegen meines Fußgelenks kaum laufen, die Blutergüsse wurden dunkler und größer, und nachts wachte ich regelmäßig davon auf, dass die seegroßen Verschorfungen an der Hotelbettwäsche klebten. Ich ließ meinen Fuß röntgen und erfuhr, dass es nur eine schwere Verstauchung war. Mein Freund bezahlte das Zimmer, da mein ganzes Geld ja weg war, und half mir, von A nach B zu kommen, weil ich nicht alleine gehen konnte. Ich glaube, er war stolz, seit sich die Kunde verbreitet hatte, dass ich mit 210 Sachen gecrasht war, während Doc und Wade vom Straßenrand aus zugesehen hatten. Ein spektakulärer Sturz, an dem ich eigentlich nicht selbst schuld war. Doch paradoxerweise hatte ich seit dem Unfall das Gefühl, diesen Freund und sein dominierendes Wesen nicht mehr zu brauchen. Ich hatte ohne ihn gelitten und bestanden. Es war so viel Schlimmes passiert – der Unfall, der Diebstahl meines Motorrads –, aber ich war seltsam glücklich. Ich war nicht ernsthaft verletzt, und meine Haltung war intakt. Ich tat das Geschehene mit einem Lachen ab.
Die Gruppe gut erhaltener Freundinnen, die hergeflogen waren, um ihre Freunde in Cabo zu treffen, liehen mir saubere Kleider, einen Badeanzug, Shampoo und Sandalen, da all mein Zeug von der Ladefläche des Trucks gerutscht war, während Reggae und die Frauen im Fahrerhaus Party machten. Auf Lee Jones’ Ratschlag hin ging ich zum amerikanischen Konsulat in Cabo, um zu versuchen, mein Motorrad wiederzufinden. Anscheinend war es gang und gäbe, dass die Fahrzeuge von Ausländern, die einen Unfall gehabt hatten, zum Schrottplatz nördlich von Guerrero Negro gebracht wurden, wo sie zum Privateigentum der Familie wurden, die den Platz betrieb. Ich bekam das Gefühl, dass die Familie Kontaktpersonen hatte, die an tückischen Stellen des Highway 1 lauerten, wie etwa der ungekennzeichneten Linkskurve, wo es mich gerissen hatte. Mein Motorrad war so schnell, kaum dreißig Minuten nach meinem Unfall, gestohlen und dann ganz ruhig auf eine Ladefläche geschoben und festgeschnallt worden. Nach einer Reihe längerer Telefonate hatte eine Frau vom Konsulat es aufgespürt. Sie sagte: «Hier ist die Adresse, aber es liegt an Ihnen, ob Sie es wiederbekommen. Die Leute werden Bargeld erwarten.»
Nach zwei Tagen Cabo hatten wir alle genug. Randy Bradescu, der das Rennen gewonnen hatte, flog von Cabo aus zu einem anderen Rennen in Florida und ließ mir sein Motorrad da, damit ich zu besagtem Schrottplatz fahren konnte, wo meins angeblich gelandet war. Seins war eine BMW K100, wegen ihres klobigen, quadratischen Motors manchmal Flying Brick genannt, Fliegender Ziegelstein. Sie war riesig und kopflastig und für mich schwer zu lenken, aber ich schaffte es. Auf dem Highway Richtung Norden machte unsere große Gruppe halt für die Nacht in Mulegé, einem herrlichen Ort, mit einer blaugrünen Bucht, weißem Sandstrand und dem langsam dahinströmenden Rio Mulegé, an dessen Ufern Schatten spendende Dattelpalmen wuchsen. Dort schwamm ich im Meer, und mein Asphaltausschlag löste sich in nässende, grüngelbe Fäden auf, die sich abschälten und um mich herumtrieben wie Seetang.
Als ich am nächsten Morgen das Hotelzimmer verließ, bemerkte ich eine gigantische Tarantel an der Tür. Auch Skorpione gab es in Mulegé. Beim Frühstück ließ ein durchreisender Typ, der Green-Tortoise-Busfahrer gewesen war und zwanzig Jahre lang Busladungen von Menschen die Baja-Halbinsel rauf und runter chauffiert hatte, einen Skorpion seinen Arm hochkrabbeln. Wir warteten alle atemlos ab, bis er ihn von seinem Handgelenk auf den Boden schnipste und mit dem Stiefel zertrat.
Wir fuhren weiter gen Norden zu dem Schrottplatz; die ganze Gruppe, immer für eine neue Herausforderung zu haben, war gespannt, ob ich mein Motorrad zurückbekommen würde. Wir erreichten das eingezäunte Gelände kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Ich klopfte an die Tür des benachbarten Hauses, und mein Freund und Stackmaster schlichen auf den Hof, um sicherzugehen, dass mein Motorrad wirklich da war. Wade kam zur Unterstützung mit mir hinein, während Stack und mein Freund die Ninja vom Hof schoben. Mit meinem schlechten Spanisch schaffte ich es, mein eigenes Motorrad für 150 Dollar, die ich mir von meinen Mitfahrern geliehen hatte, zurückzukaufen.
Jedes einzelne Teil, das bei dem Unfall hatte abbrechen können, war abgebrochen. In der zunehmenden Dämmerung klaute Stack einen Autoscheinwerfer von dem Schrottplatz, brachte ihn dort an, wo meiner gewesen war, und befestigte ihn mit Klebeband. Mein Freund bog, trat und begradigte Fahrgestell und Lenker, bis das Motorrad beinahe fahrbar war. Als Fußrasten rammte Stack Flachschraubendreher in die Motorverkleidung. Mein Freund startete die Maschine, indem er sie kurzschloss (der Schlüssel war beim Sturz im Anlasser abgebrochen).
Insgeheim wollte ich dieses Motorrad nicht fahren. Es war ein Wrack – das Fahrgestell verbogen, die Lenkung aus dem Lot, der Tank zerbeult und voller Krater, der Auspufftopf aufgeschlitzt (was ich am nächsten Morgen zu reparieren versuchte, indem ich eine aufgeschnittene Cola-Dose mit Sicherheitsdraht darum herumwickelte). Aber mein Freund drängte mich, die Unglücksmaschine zu fahren, und die Alternative war Randys BMW, die zu groß für mich und schwierig zu handhaben war. Ich ließ sie zum Abtransport auf dem Crash Truck stehen und setzte mich auf meine Ninja – das Ding, das mich bei 210 km/h abgeworfen und sich dann mehrfach überschlagen hatte.