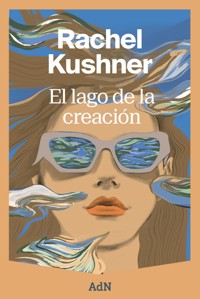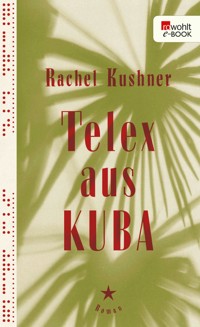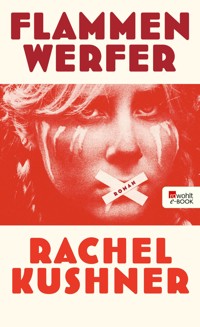Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hierax Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ausgezeichnet mit dem SPIEGEL Buchpreis 2025 Sadie Smith – 34, skrupellos, verführerisch, ehemalige FBI-Agentin – wird von einem namenlosen Auftraggeber in eine entlegene Gegend in Südfrankreich geschickt. Ihr Auftrag: Sie soll eine Kommune anarchistischer Umweltaktivisten infiltrieren, die im Verdacht steht, Anschläge verübt zu haben. Sadie blickt zunächst mit Verachtung auf die Idealisten und die französische Provinz mit ihren verschlafenen Dörfern und Höfen. Doch dann gerät sie in Kontakt mit Bruno Lacombe, dem Vordenker der Gruppe. Bruno lehnt die Zivilisation ab, er lebt in einer Neandertalerhöhle und sieht die Rettung der Menschheit in der Rückwendung zu ihren Ursprüngen. Die Auseinandersetzung mit ihm lässt Zweifel in der eigentlich so abgebrühten Sadie keimen, und sie, die die Fäden in der Hand zu halten glaubte, gerät mehr und mehr in seinen Bann. «Das Elektrisierende an diesem Roman ist die Verknüpfung von aktueller Politik mit einer dunklen Gegengeschichte der Menschheit. Kushners aufregende Ideen haben uns mitgerissen. Der ganze Roman ist ein tiefgründiger, unwiderstehlicher Pageturner.» Die Booker-Prize-Jury «Rachel Kushner erfindet den Spionageroman auf coole, hochintelligente Weise neu.» Hernán Díaz «Rachel Kushner ist die aufregendste Autorin ihrer Generation.» Bret Easton Ellis
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rachel Kushner
See der Schöpfung
Roman
Über dieses Buch
Sadie Smith – 34, skrupellos, verführerisch, ehemalige CIA-Spionin – wird von einem namenlosen Auftraggeber in eine entlegene Gegend in Südfrankreich geschickt. Ihr Auftrag: Sie soll eine Kommune anarchistischer Umweltaktivisten infiltrieren, die im Verdacht steht, Anschläge verübt zu haben. Sadie blickt zunächst mit Verachtung auf die Idealisten und die französische Provinz mit ihren verschlafenen Dörfern und Höfen. Doch dann gerät sie in Kontakt mit Bruno Lacombe, dem Vordenker der Gruppe. Bruno lehnt die Zivilisation ab, er lebt in einer Neandertalerhöhle und sieht die Rettung der Menschheit in der Rückwendung zu ihren Ursprüngen. Die Auseinandersetzung mit ihm lässt Zweifel in der eigentlich so abgebrühten Sadie keimen, und sie, die die Fäden in der Hand zu halten glaubte, gerät mehr und mehr in seinen Bann.
«Das Elektrisierende an diesem Roman ist die Verknüpfung von aktueller Politik mit einer dunklen Gegengeschichte der Menschheit. Kushners aufregende Ideen haben uns mitgerissen. Der ganze Roman ist ein tiefgründiger, unwiderstehlicher Pageturner.» Die Jury des Booker Prize
Vita
Rachel Kushners Romane Flammenwerfer (2015) und Telex aus Kuba (2017) waren beide New-York-Times-Bestseller und Finalisten des National Book Award. Ich bin ein Schicksal (2019) war ein internationaler Bestseller, Booker-Prize-Finalist und Gewinner des Prix Médicis Étranger. Ihre Bücher sind in 26 Sprachen übersetzt. Rachel Kushner lebt in Los Angeles. Zuletzt erschien von ihr Harte Leute (2022).
Bettina Abarbanell, geboren in Hamburg, lebt als Übersetzerin – u. a. von Jonathan Franzen, Denis Johnson, Rachel Kushner, Elizabeth Taylor und F. Scott Fitzgerald – in Potsdam. Ihr Werk wurde vielfach ausgezeichnet, etwa mit dem Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Übersetzerpreis.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel «Creation Lake» bei Scribner, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Creation Lake» Copyright © 2024 by Rachel Kushner
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München, nach dem Original von Penguin Random House UK
Coverabbildung Illustration von Jennifer Dionisio, nach einer Fotografie von Harri Peccinotti für das «Nova Magazine» (Oktober 1972)
ISBN 978-3-644-00959-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Jason
Still, so lieb euch ein Schwank ist!
Lieg du hier, denn dort kommt die Forelle, die mit Kitzeln gefangen werden muss.
Maria, aus Was ihr wollt
I
Die Wonnen der Einsamkeit
Neandertaler neigten zur Depression, meinte er.
Sie neigten auch zur Sucht und insbesondere zum Rauchen.
Wobei es wahrscheinlich sei, dass diese edlen und geheimnisvollen Taler (wie er die Neandertaler mitunter nannte) das Nikotin durch eine eher krude Methode aus der Tabakpflanze gewonnen hätten, etwa durch Kauen der Blätter, bevor es zu jenem entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der Welt gekommen sei: als der erste Mann das erste Tabakblatt ins erste Feuer gehalten habe.
Als ich diesen Teil von Brunos E-Mail überflog, von «Mann» über «Tabakblatt» und «Feuer» zu «gehalten», sah ich einen Fünfzigerjahre-Rocker in weißem T-Shirt und schwarzer Lederjacke vor mir, der ein brennendes Streichholz an die Spitze seiner Camel hält und inhaliert. Der Rocker lehnt an einer Mauer – denn das machen die, sie lehnen und lungern herum – und stößt den Rauch aus.
Bruno Lacombe erklärte Pascal in diesen E-Mails, die ich heimlich las, die Neandertaler hätten sehr große Gehirne gehabt. Zumindest seien ihre Schädel sehr groß gewesen, und wir könnten doch mit ziemlicher Sicherheit annehmen, schrieb er, dass diese Schädel mit Gehirn gefüllt gewesen seien.
Er benutzte moderne Metaphern, um die imposante Größe der Taler’schen Hirnschale zu beschreiben, verglich sie mit der von Zweiradmotoren, die ja, wie er anmerkte, auch nach ihrem Hubraum bemessen würde. Von allen menschenähnlichen, aufrecht auf zwei Beinen stehenden Gattungen, die in der vergangenen Million Jahre auf der Erde gelebt hätten, so Bruno, sei die Hirnschale des Neandertalers mit ihren kolossalen 1800 Kubikzentimetern ganz weit vorn.
Ich sah einen König der Straße vor mir, ganz weit vorn.
Ich sah seine Lederweste, seinen dicken Bauch, die ausgestreckten Beine, die Motorradstiefel auf vorverlegten breiten, verchromten Fußrasten. Sein Chopper ist mit einer Affenschaukel ausstaffiert, an deren Griffe er kaum herankommt, wobei er so tut, als bekäme er davon nicht schwere Arme und stechende Schmerzen in der Lendengegend.
Ausgehend von ihren Schädeln, schrieb Bruno, wissen wir, dass die Neandertaler enorme Gesichter hatten.
Ich sah Joan Crawford vor mir, diese Größenordnung von Gesicht: dramatisch, brutal, bezwingend.
Und in dem Naturkundemuseum, das beim Lesen seiner E-Mails in meinem Kopf entstand, ein Museum, dessen Dioramen von Gestalten im Lendenschurz mit gelben Zähnen und verfilzten Haaren bevölkert waren, hatten diese von Bruno beschriebenen frühen Menschen fortan allesamt – auch die Männer – Joan Crawfords Gesicht.
Sie hatten ihre helle Haut und ihr flammend rotes Haar. Als ein genetisches Merkmal der Taler, so Bruno, habe man im Zuge der wissenschaftlichen Fortschritte bei der Genkartierung eine Neigung zur Rothaarigkeit identifiziert. Und über solche Forschungsergebnisse, solche Beweise hinaus, schrieb Bruno, könnten wir unsere natürliche Intuition nutzen und vermuten, dass die Gefühle der Neandertaler, wie bei typischen Rotschöpfen, stark und heftig gewesen seien, große Höhen und Tiefen umfassend.
Noch ein paar Dinge, schrieb Bruno an Pascal, die wir heute über die Neandertaler wissen: Sie konnten gut rechnen. Sie mochten keine Menschenansammlungen. Sie hatten starke Mägen und neigten nicht sonderlich zu Geschwüren, aber dass sie sich ständig von Gegrilltem ernährten, schadete ihrem Darm genauso, wie es unserem schaden würde. Sie waren überaus anfällig für Zahnfäule und Zahnfleischerkrankungen. Und sie hatten überentwickelte Kiefer, wunderbar geeignet, um Knorpel und Knochen zu zerkauen, jedoch ineffizient bei weicheren Speisen, Kiefer, die zu viel des Guten waren. Bruno beschrieb den Kiefer des Neandertalers seiner Überentwicklung wegen als ein Mitleid erregendes Merkmal, die Bürde eines Quadratkiefers. Er sprach von versunkenen Kosten, als wäre der Körper eine Kapitalanlage, eine Anlageinvestition und jedes Körperteil eine wie mit Bolzen im Fabrikboden fixierte Maschine, lauter gekaufte Gerätschaften, die nicht wieder veräußert werden konnten. Die Neandertalerkiefer waren versunkene Kosten.
Dennoch, die schweren Knochen und der robuste, wärmeerhaltende Körperbau seien zu bewundern, schrieb Bruno. Vor allem verglichen mit den Streichholzgliedmaßen des modernen Menschen, Homo sapiens sapiens. (Das Wort «Streichholz» verwendete Bruno nicht, aber da ich übersetzte, weil er auf Französisch schrieb, schöpfte ich aus dem Vollen des Englischen, dieser extrem überlegenen Sprache, die meine Muttersprache ist.)
Die Taler, schrieb er, hätten Kälte sehr gut überlebt, wenn schon nicht die Zeiten, so jedenfalls gehe die Geschichte über sie – eine Geschichte, die wir differenzierter betrachten müssten, wenn wir die Wahrheit über die ferne Vergangenheit erfahren und eine Ahnung von der Wahrheit über die unsrige, heutige Welt bekommen wollten und davon, wie wir darin leben und die Gegenwart bewohnen könnten und wohin wir morgen gehen sollten.
Mein Morgen war gründlich durchgeplant. Ich würde mich mit Pascal Balmy treffen, Leiter von Le Moulin, an den diese Mails von Bruno Lacombe gerichtet waren. Und ich brauchte die Hilfe der Neandertaler nicht, um zu wissen, wohin ich musste: Pascal Balmy sagte, wir würden uns um eins im Café de la Route auf dem Marktplatz des kleinen Dorfs Vantôme treffen, und dort würde ich sein.
Weil Bruno Lacombe in meinen Briefings als Lehrer und Mentor von Pascal Balmy und seiner Gruppe dargestellt worden war, suchte ich in seinen E-Mails nach Aufschlüssen darüber, was sie schon getan hatten und was sie noch planten.
Sechs Monate zuvor waren auf dem Gelände eines gewaltigen industriellen Wasserspeichers, der unweit von Le Moulin, in der Nähe des Dorfs Tayssac, gebaut wurde, Erdbaumaschinen sabotiert worden. Fünf riesige Bagger, jeder einzelne von ihnen Hunderttausende Euro wert, wurden im Schutz der Nacht in Brand gesetzt. Pascal und seine Gruppe standen unter Tatverdacht, Beweise gab es bisher jedoch nicht.
Brunos Mails an Pascal deckten zwar ziemlich viel ab, aber etwas Belastenderes als seine Feststellung, dass Wasser ins Grundwasser gehöre und nicht in industrielle Auffangbecken, hatte ich nicht entdeckt. Bruno fand es beklagenswert, dass der Staat gemeint habe, es sei eine gute Idee, Grundwasser aus unterirdischen Hohlräumen, Seen und Flüssen abzuzapfen und dieses Wasser in großen, mit Plastik ausgekleideten «Megabassins» zu speichern, wo es Wandergifte absorbieren und in der Sonne verdampfen würde. Das sei eine tragische Idee, mit einer zerstörerischen Kraft, die vielleicht nur jemand verstehen könne, der beträchtliche Zeit unter der Erde verbracht habe. Wasser sei schließlich bereits gespeichert, schrieb er, in den natureigenen, genialen Filtrier- und Aufbewahrungseinrichtungen innerhalb der Erde.
Bruno Lacombe, das wusste ich, war gegen die Zivilisation, ein «Antizivilo» im Aktivistenslang. Und das ländliche, südwestliche Département Guyenne – sowie dieser entlegene Winkel davon, in den ich mich gerade begeben hatte – war für Höhlen bekannt, in denen es Hinweise auf frühe Menschen gab. Aber ich hatte angenommen, Bruno würde Pascals Strategien steuern, die staatlichen Industrieprojekte hier in der Gegend zu stoppen. Auf die Idee, dass dieser Mentor von Pascal dem fanatischen Glauben an eine gescheiterte Gattung anhängen könnte, war ich nicht gekommen.
Wir sind uns alle einig, schrieb Bruno, dass es der Homo sapiens war, der die Menschheit Hals über Kopf in die Landwirtschaft, das Geldwesen und die Industrie trieb. Aber das Rätsel, was mit dem Neandertaler und seinem bescheideneren Leben passiert ist, bleibt ungelöst. Mensch und Neandertaler, so Bruno, hätten sich womöglich gute zehntausend Jahre überschnitten, nur verstehe bisher niemand genau, ob und wie diese beiden Gattungen interagiert hätten. Ob sie zum Beispiel voneinander gewusst, aber Abstand gehalten hätten. Oder ob Europa in der Zeit ihrer Überschneidung so spärlich bevölkert gewesen sei, dass inmitten schroffer und unwegsamer, von Wald, Gebirge, Fluss und Schnee geprägter Gebiete die eine Gattung nicht habe ahnen können, dass die andere da war. Andererseits hätten Genforscher herausgefunden, dass sie sich vermischt, Nachwuchs miteinander gezeugt und mithin durchaus gewusst hätten, dass der andere «da war». Waren das Liebesverbindungen gewesen? Oder Vergewaltigungen, also Kriegsbeute? Wir würden es nie erfahren, schrieb er.
Zuerst fragte ich mich, ob diese E-Mails über die Neandertaler eine List waren, eigens von Bruno platziert, um von seiner eigentlichen Korrespondenz mit Pascal und den Moulinarden abzulenken, falls sich jemand Zugang zu seinem Account verschaffte. Er machte dort lange Ausführungen, schrieb aber nichts über Sabotage und kam immer wieder auf die Neandertaler zurück – eine Gattung, die es nicht gepackt hatte, seien wir mal ehrlich, sonst wäre sie ja noch da, und das war sie nicht. Sie war vor Tausenden von Jahren verschwunden, niemand schien zu wissen, warum, und kein Neandertaler hatte sich gemeldet, um es uns zu erklären.
Bruno sperrte sich gegen die Annahme, der Homo sapiens sei einfach cleverer und anpassungsfähiger als der Neandertaler gewesen, kräftiger, robuster. Da er die beiden Gattungen als Gegner darstellte, sah ich sie nicht mehr in dem Diorama vor mir, sondern in einem Mixed-Martial-Arts-Wettkampf, mit dem Homo sapiens als Kombattanten, der in einer Siegesserie entweder nach und nach oder mit einem Schlag den Ring eroberte.
Es ist verlockend, schrieb Bruno, den Neandertaler als einen schwachen Rivalen zu betrachten, der vom Homo sapiens vernichtend geschlagen wurde (es war, als hätte er Zugang zu meinem geistigen Bild von den beiden Gattungen, die am Wettkampftag gegeneinander antraten), doch das sei eine zu billige Lösung des Rätsels.
Wenn es Krieg zwischen ihnen gegeben habe, müsse es ein «weicher» Krieg gewesen sein, ein langsames und erbarmungsloses Konkurrieren um Ressourcen. Die Neandertaler, schrieb Bruno, waren erfahrene, geschickte Jäger, doch als es in Europa wärmer wurde, änderten sich die Kompetenzmaßstäbe. Das Eis war weg und eine andere Körperart gefordert, leichter und auf Ausdauer angelegt, dazu neue Methoden des Fährtenlesens mittels großer, koordinierter Gruppen und andere Waffen und Werkzeuge. Während der Neandertaler mit einem Nahdistanz-Wurfspieß mutig sein Leben riskierte, setzte der Homo sapiens auf den Langdistanz-Speer. Das Töten aus der Entfernung war weniger heldenhaft. Es bedeutete, dass man töten konnte, ohne sich selbst der unmittelbaren Lebensgefahr auszusetzen, dem blutigen Gemetzel, wie es die Waffen der Taler verlangten. Dennoch, so Bruno, sei das Konzept eines durch die Luft geschleuderten Speers, als das weitaus klinischere Jagdverfahren, mit Sicherheit eine erfolgreiche Methode. Ein weiterer Vorteil dürfe der leichtere Körperbau des Homo sapiens gewesen sein, der weniger Nahrung gebraucht habe. Außerdem habe er – oder vielmehr sie – sich häufiger fortgepflanzt, wenn auch nicht wesentlich. Man nehme an, dass die weibliche Homo sapiens nur wenig mehr Nachkommen hervorgebracht habe als die Neandertalerin. Nach langen Zeitabschnitten jedoch, Tausenden von Jahren, summierten sich diese Zahlen zu enormen Bevölkerungsunterschieden.
Und doch, so Bruno weiter, trügen viele Menschen noch Spuren des Neandertalers in sich. Zwei Prozent, vier Prozent, der Grad an vorzeitlichem Leben sei frappierend, wenn man bedenke, dass es seit vierzigtausend Jahren keine Neandertalergemeinschaften mehr gebe, die aktiv zum Genpool beitrügen. Es komme einem vor, als würden unsere Chromosomen sich an diesen uralten Anteil klammern wie an ein kostbares Andenken, ein Erbstück, das Überbleibsel einer Person tief in unserem Inneren, die unsere Welt vor dem Fall kannte, vor dem Absturz der Menschheit zu einer grausamen Klassen- und Herrschaftsgesellschaft.
Manche würden vielleicht sagen: «Zwei Prozent Taler, vier Prozent, na, das ist doch nicht viel, ein Rundungsfehler. Bleiben satte achtundneunzig Prozent sapiens.»
Stimmt, schrieb Bruno. Werfen wir einen Blick auf den Mehrheitsanteil. Leugnen wir nicht, dass wir vom Homo sapiens quasi besetzt sind, ja dass wir, ob wir es wollen oder nicht, selbst sapiens sind, ein Mensch, der sich, darauf können wir uns alle einigen, in der Krise befindet. Jemand, dessen Todestrieb am Steuer sitzt.
H. sapiens braucht Hilfe. Aber er will keine.
Wir haben, schrieb Bruno, ein langes zwanzigstes Jahrhundert durchgestanden, all seine Niederlagen, Fehlschläge und Konterrevolutionen. Inzwischen ist mehr als ein Jahrzehnt des einundzwanzigsten Jahrhunderts vergangen und die Zeit gekommen, das Bewusstsein umzuformen. Nicht durch Ismen. Nicht mit Dogmen. Sondern indem wir die mystischsten Wahrheiten heraufbeschwören, die wir bisher vor uns selbst geheimgehalten haben: diejenigen, die unsere Vergangenheit betreffen.
Ein Psychoanalytiker sucht nach Hinweisen auf Verdrängung, darauf, was eine Patientin oder ein Patient vor anderen verborgen hält und, wichtiger noch, vor sich selbst. Was am tiefsten von allem verdrängt wurde, ist die Geschichte derer, die zuerst da waren, die vor uns da waren, lange vor dem Beginn der Aufzeichnungen. Wir müssen herausfinden, was diese früheren Leben für uns und für unsere Zukunft bedeuten könnten.
Nein, ich bin kein Primitivist, schrieb Bruno, wie um diesen Vorwurf mal schnell abzuwehren.
Ich blicke nach vorn, schrieb er, und jede Erörterung alter Geschichte findet nur in Bezug auf Kommendes statt.
Seht hoch, forderte er in dieser E-Mail an Pascal Balmy und die Gruppe.
Das Dach der Welt ist offen.
Lasst uns Sterne zählen und in ihrem leuchtenden Blick leben.
Anders gesagt, in der tiefen Vergangenheit dieser Sterne, oder noch anders, in unserer Zukunft, die so licht ist wie der Polarstern.
Das Dach dieses Hauses war nicht offen, Gott sei Dank.
Aber im ersten Stock war es in zwei Zimmern undicht. Das ganze Dach, das aus flachen, handbehauenen Schieferziegeln bestand, musste ausgetauscht werden, und Lucien Dubois und Agathe stritten darüber, ob man Geld ins Haus pumpen und es restaurieren oder die Verluste abbuchen und es verkaufen sollte.
Das Haus war dreihundert Jahre alt. Lucien hatte es von seinem Vater geerbt, der es wiederum von seinem Vater geerbt hatte. Ich hatte ihn gefragt, wann die Familie des Vaters seines Vaters es erworben habe, worauf er unsicher schien, was er antworten sollte, als verrate die Frage meine Ahnungslosigkeit.
«Es war, ähm, immer schon unser Familiensitz, von Anfang an.»
Luciens Tante Agathe entstammte der anderen Seite, der Familie seiner Mutter. Agathe war keine Dubois. Sie wohnte nicht allzu weit vom Haus der Dubois entfernt und kümmerte sich darum. Ich hatte Lucien und Agathe über das Dach und die Zukunft des Hauses streiten hören, als er sie anrief, um ihr mitzuteilen, dass ich herkommen würde.
Es war mir egal, was Lucien beschloss. Ich wohnte nur vorübergehend in dem Haus. Auch mit undichtem Dach war es als Hauptquartier für meine Zwecke hier im Guyenne-Tal perfekt. Der Weg zu der Gruppe von Leuten, auf die ich ein Auge haben sollte, Le Moulin, war nicht weit. Es lag gut geschützt am Ende einer langen privaten Zufahrt. Jeder Wagen, der von der kleinen Straße weit unterhalb des Hauses auf den geschotterten Weg einbog, würde sich mir selbst ankündigen, zumal ich, um alles mitzubekommen, die Fenster im ersten Stock offen ließ. Außerdem hatte man von hier oben einen guten Blick. Von dem Zimmer aus, das ich mir ausgesucht hatte, weil das Dach auf dieser Seite des Hauses nicht leckte, konnte ich das gesamte Tal sehen. (Es half, dass ich ein leistungsstarkes Fernglas hatte, mit Nachtsicht von US-Armee-Qualität.)
Die Straße zum Haus führte durch dichten Laubwald, was Leute, die nicht schon wussten, dass es sich hier befand, nicht gerade ermutigte, den Abzweig von der winzigen Landstraße D43 zu nehmen, an dem ich auch selbst erst vorbeigefahren war.
Es gab kein Schild, kein Tor, keinen Briefkasten, keinerlei Hinweis darauf, dass ich Luciens Familienanwesen erreicht hatte, nur einen schmalen Tunnel in den Wald hinein. Als ich dort einbog, segelte ein großer, rostbrauner Raubvogel zwischen den Bäumen in das Zwielicht unterhalb des Blätterdachs. Ich spürte, dass er es gewohnt war, diesen Ort für sich allein zu haben. Arrangier dich mit mir, dachte ich.
Oben an der Zufahrt bog ich, Luciens Wegbeschreibung folgend, links ab. Hier gab es eine Reihe von hohen Pappeln, spitz zulaufend wie Federn. Ich mag Pappeln. Wenn sie in einer geraden Reihe stehen, denke ich ans Fahren, an schnelles Fahren in eine niedrige westliche Sonne hinein, deren Strahlen die leicht bewegten Blätter erleuchten. Pappeln erinnern mich an das Priest Valley, einen wunderschönen Nicht-Ort, durch den ich mal mit jenem Jungen gekommen war, der später den Kopf für Nancy hinhielt. Es sind Bäume, die mich an eine Zeit erinnern, als ich mich unbesiegbar fühlte.
Ich fuhr an den Pappeln entlang und hielt mich weiterhin links, durchquerte einen wilden, uralten Walnusshain, der sich zu beiden Seiten des kleinen Schotterwegs erstreckte, genau wie von Lucien beschrieben.
Ich parkte jenseits des Hains vor der Familienvilla der Dubois, erbaut aus großen gelben Sandsteinblöcken, von denen die Hitze des Tages abstrahlte, obwohl es Abend war, als ich ankam, und kühl.
In dem Garten hinter dem Tor, der jetzt voller Unkraut war, hatte Lucien als Junge Messer geworfen. Hatte die Erde nach prähistorischen Werkzeugen durchsiebt, während die Erwachsenen Eau de Vie tranken, einen klaren, aus den Sommerpflaumen und Herbstbirnen dieses Grundstücks destillierten Schnaps. (Eau de Vie schmeckt immer gleich – wie Benzin –, egal, aus welchem Obst es gemacht wird, sagte ich nicht zu Lucien.)
Ich hatte mir seine gesammelten Kindheitserinnerungen anhören müssen:
«Unsere Zeugnisse hatten fünf Farben: Rosa für sehr gut, Blau für gut, Grün für befriedigend, Gelb für ausreichend, Rot für mangelhaft.»
«Meine Erzieherin im Kindergarten hatte wunderschönes langes, braunes Haar und eine sanfte Stimme, und sie trug weiße Sandalen mit kleinen Absätzen. Sie hieß Pauline.»
«Wenn ich in allem Rosa hatte, konnten wir eine zusätzliche Woche auf dem Land bleiben.»
Es ist immer das Gleiche, egal, ob du fest mit einem Mann liiert bist oder nur so tust. Sie wollen, dass du ihnen zuhörst, wenn sie dir von ihrer kostbaren Jugend erzählen. Und wenn sie so alt sind wie ich, und das ist Lucien – wir sind beide vierunddreißig –, dann sind die Jahre ihrer Kindheit, die unschuldigen Jahre, die 1980er; und ihre Teenagerzeit, der Abschied von der Unschuld, sind die 1990er; und ob in Europa oder in den USA, sie reden alle von ähnlicher Musik und kommen dir mit ihrer Schwärmerei für mehr oder weniger die gleichen Filme, während ich persönlich da nichts als kulturelle Stagnation erkennen kann.
Ich höre lieber von der Prägung der ältesten Generation europäischer Männer, derjenigen, die in ihrer Jugend mit Krieg, Töten und Tod konfrontiert waren und Verräter, Faschisten, Huren, Kollaboration und nationale Schande kennengelernt haben: Initiationsriten, einen echten und realen Verlust der Unschuld. Jeder hat so seinen Typ. Und die Generation gleich darunter finde ich auch ganz in Ordnung, jene Männer, die jetzt in den Sechzigern sind, denn die kennen zumindest noch die Wehrpflicht oder die fakultative, außerrechtliche Zuflucht in der französischen Fremdenlegion.
Im Leben von Lucien und Jungs wie ihm – die für immer bloße Jungs bleiben werden – gibt es weder Krieg noch Leid oder Tapferkeit. Da gibt es nur irgendein langweiliges Mädchen, irgendeinen banalen Popsong, irgendeine romantische Komödie und Ferien im August.
Der August stand vor der Tür, aber niemand aus der Familie würde kommen. Lucien war erwachsen, die Zeit der Ferienaufenthalte längst vorbei. Die Bäume, aus deren Früchten Schnaps gemacht wurde, standen nach wie vor im Garten, knorrig, unbeschnitten, mit schweren Ästen, die sich ins brusthohe Unkraut bogen.
Hier hatte Lucien sein erstes Rendezvous gehabt, mit einem wesentlich älteren Mädchen, einer Studentin aus Toulouse, deren Familie in der Gegend ein Haus besaß. Sie trug Kaschmirpullover und benutzte ein schweres Guerlain-Parfüm. Im leeren Schweinestall eines verlassenen Bauernhofs habe sie ihm die Unschuld genommen, sagte Lucien. Ich unterdrückte das Lachen, lachte nur innerlich, während ich mir seine Jugenderinnerungen anhörte, als wären sie nicht klischeehaft, sondern voller Bedeutung.
Agathe hatte das Schlüsselbund hinter einer toten Geranie in einer Mauernische beim Haupteingang versteckt. Einer der Schlüssel passte ins Schloss des schweren Eisenriegels. Der Riegel ließ sich zur Seite schieben. Ich öffnete beide Türen. Die Luft drinnen war feucht und kalt wie in einer Höhle.
Meine Schritte auf den breiten, unebenen Holzbohlen knarzten laut, als weckte mein Gewicht den Boden aus einem langen Winterschlaf. Ich spähte in Zimmer voll verhüllter Möbel. In den Fluren wehten Spinnweben, weich und schmutzig. Ich ging in den ersten Stock hinauf und inspizierte die Schlafzimmer, öffnete Fensterläden, um besser sehen zu können und den Schimmelgeruch zu vertreiben.
In der Hälfte der Zimmer war der Deckenputz unter dem undichten Dach voller Blasen und Flecken. Hier und da hingen Tapetenstreifen herunter wie alte, an einer Reißzwecke baumelnde Filmplakate. In einem Zimmer lag eine Rattenfalle auf dem Boden, mit der hölzernen Unterseite nach oben; ein Stück Schwanz lugte darunter hervor. Ich hob die Falle auf, die der Ratte auf den Rücken geschnallt war wie ein Rucksack, und warf sie aus dem Fenster.
Ein Zimmer sah weniger einladend aus als das andere, alle waren gerammelt voll mit Kisten und Stapeln alter Zeitschriften, Paris Match, die jungen Gesichter auf den Covern vom Wasser ruiniert. Im größten Schlafzimmer fanden sich weder Lecks noch Gerümpel, dafür war es von Kinderstickern entstellt, Comicbabys mit dem Logo «Les Babies», die an Möbeln und Wänden klebten.
Ich suchte mir mein Zimmer nach dem strategisch günstigsten Blick auf die Straße, funktionierender Elektrizität, fehlenden Wasserflecken und einem Minimum an «Les Babies»-Stickern aus. (Auf meinem Nachttisch klebte einer, aber den konnte ich abdecken.) Die Sonne war untergegangen, und durch die Fenster beim Bett sah ich ein paar Sterne, die hinter dem Schleier der Abenddämmerung ihre Nachtwache antraten.
In der Küche im Erdgeschoss gab es eine alte Steinspüle. Der Herd war anscheinend mit Holz oder Kohle zu heizen. Daneben stand ein Elektrokocher aus den 1970ern, dessen verzogene Platten vom vielen Gebrauch weiß waren. Die Dubois hatten die alten Traditionen offenbar aufgegeben und diesen Kocher benutzt. Egal. Mir genügte ein Kocher vollkommen.
Nachdem ich mir die Zimmer angesehen hatte, aß ich ein Schinken-Butter-Baguette, das ich mir in Boulière gekauft hatte, wenig Schinken, viel Butter und überwiegend schlechtes Baguette, so eins, das zu Pulver zerkrümelt, wenn es alt wird. Ich merkte, dass ich keinen Hunger hatte, und überließ den Rest den Ratten.
Es gab ein paar Striche Handyempfang über Orange.fr, also schrieb ich Lucien, ich sei angekommen. Dass das geliebte angestammte manoir der Familie aussah wie der Schauplatz eines Horrorfilms, ließ ich unerwähnt. Ich schrieb, es sei sehr schön hier, wenn auch rustikal, und morgen würde ich mich mit Pascal Balmy treffen.
Lucien hatte dieses Treffen arrangiert.
Er machte sich Sorgen, weil ich keinen Beruf hatte. Er glaubte, ich sei eine vom Weg abgekommene Ex-Studentin. (Ich war eine Ex-Studentin, hatte meinen Weg aber gefunden, statt von ihm abgekommen zu sein.)
Und so brachte er mich mit Paul in Verbindung (er hielt es für seine Idee), weil er meinte, ich könne doch das Buch, das Pascal und seine Genossen von Le Moulin anonym geschrieben hatten, ins Englische übersetzen, schließlich sei ich sprachbegabt und hätte viel freie Zeit.
– ich meine, ich treffe mich mit pascal, falls er auftaucht, schrieb ich.
– Der taucht schon auf, textete Lucien zurück. Deinetwegen. Er ist neugierig auf dich. Und scharf darauf, mit dir zu arbeiten. Ich habe mit ihm gesprochen. Aber ich sollte dich warnen … er ist charismatisch.
Charisma hat seinen Ursprung nicht in der Person, die «charismatisch» genannt wird. Es entspringt dem Bedürfnis anderer zu glauben, dass es besondere Menschen gibt.
Auch ohne ihn schon kennengelernt zu haben, war ich mir sicher, dass Pascal Balmys Charisma, wie das jedes beliebigen Menschen – Jeanne d’Arcs zum Beispiel –, allein auf dem Willen anderer beruhte, daran zu glauben. Charismatische Menschen verstehen diesen Glauben am besten. Sie nutzen ihn aus. Darin besteht ihr sogenanntes Charisma.
– bist du eifersüchtig?, antwortete ich.
Pascal war ein alter Freund von Lucien, und ich würde ihn ohne Lucien als Vermittler treffen.
– Darum geht’s nicht. Er gewinnt schnell die Oberhand. Denk an all die Leute, die ihm aus Paris gefolgt sind. Ziemlich seltsam. Aber so ist er. Ich meine, ich kenne ihn schon ewig, und er versucht immer noch, mich zu beeindrucken. Es ist lächerlich.
(Für das, was für Lucien lächerlich war, hatte ich inzwischen ein Gefühl.)
– bei mir gewinnt er nicht die Oberhand, schrieb ich zurück, und ausnahmsweise war ich da ganz und gar ehrlich.
Bruno Lacombe bekam nur von einem einzigen Absender E-Mails, einem Account, den, wie ich wusste, diverse Leute von Le Moulin nutzten, darunter Pascal Balmy, sicher der Hauptkorrespondierende, obwohl die Mails an Bruno nie unterzeichnet waren. Sie bestanden immer nur aus einer kurzen ergebnisoffenen Frage, die Bruno ausführlich beantwortete.
So wie die, die sie Bruno als Reaktion auf seine Ausführungen zu den Depressionen und Rauchgewohnheiten der Neandertaler schickten. Ihre Frage bezog sich auf Pflanzenherkünfte und Tabak: Sei Tabak nicht eine Pflanze der Neuen Welt?, wollten sie wissen.
«Angesichts dessen, wie stringent wir unsere eigenen landwirtschaftlichen Methoden anwenden», schrieben sie, «und bei unserem Ansatz bleiben, Pflanzen, die in diesem Teil Frankreichs heimisch sind, zu renaturieren, verwundert uns die Idee, dass Tabak, den wir für invasiv halten, immer schon hier gewesen sein könnte.»
In seiner Antwort schrieb Bruno, auch wenn er niemanden, der eine solche Frage stelle, direkt angreifen wolle, könne er doch die Konditionierung dieser Person und die äußeren Kräfte, die ihre Einstellungen geprägt hätten, aufs Korn nehmen, denn sie hätten zu einem tiefgreifenden Missverständnis von Migrationsmustern und einer missbräuchlichen Verwendung der Begriffe «heimisch» und «neu» geführt.
Nein, schrieb er, Tabak ist keine Pflanze der Neuen Welt.
Und im Übrigen sei der amerikanische Doppelkontinent seit Zehntausenden von Jahren von Menschen bevölkert.
Die Ausbreitung der Menschen über die Erde habe keine schlichte Drei-Akt-Struktur, also Aufbruch aus Afrika (1), Ankunft in Europa (2) und Überquerung einer Landbrücke (3). Die Art und Weise, wie die Menschen die diversen Ecken der Welt besiedelt hätten, sei wesentlich diffuser und mysteriöser. Die Idee etwa, dass sie in eine einzige Richtung geströmt seien, könne ja nur falsch sein. Gehe man jemals nur in eine Richtung?, fragte er rhetorisch. Natürlich nicht. Im Lauf eines Tages, einer Jahreszeit, eines Jahres, eines Lebens bewegten sich Menschen in viele Richtungen, als Ortspunkte mit eigenem freien Willen, wenngleich er «frei» in Anführungszeichen setzte.
Je gebildeter die Leute sind, desto mehr Anführungszeichen scheinen sie zu setzen, und Bruno machte da keine Ausnahme (ich auch nicht, obwohl ich diese Angewohnheit bei anderen moniere). Je weniger Bildung, desto mehr fälschliche Anführungszeichen, deren Zweck das Gegenteil jener anderen ist und schlicht bekundet, dass ein Ding einen Namen hat, den ihm jemand ohne akademischen Hintergrund gegeben hat: «Maisküchlein» auf einem Schild im Schaufenster einer Bäckerei, handgeschrieben von einem Mindestlohnmitarbeiter. «Schlussverkauf», ebenfalls handgeschrieben. Beide, die Nicht-so-Gebildeten wie die Hypergebildeten, lieben Anführungszeichen, während die meisten Menschen sie nur schriftlich verwenden, um anzuzeigen, dass jemand spricht. In meinem Leben vor diesem, als Studentin, gab es Alleswisserinnen in meinem Fach, die beide Hände hoben und Zeige- und Mittelfinger krümmten, um ein Wort oder eine Wendung als ironisch oder kritisch gemeint zu kennzeichnen. Das waren pseudo-toughe Mädchen, in Wahrheit überhaupt nicht tough, deren Modepräferenzen zu klobigen Schuhen und einer Lederjacke aus dem Kaufhaus tendierten. Sie promovierten an der Universität von Berkeley in Rhetorik, so wie auch ich es vorgehabt hatte, bevor ich den Plan fallen ließ (und mir ihr Schicksal ersparte, nämlich sich den Unijob-Interviews in DoubleTree-Hotelzimmern bei einer Konferenz der Modern Language Association auszusetzen). Wenn ich sie so schwafeln hörte und die Finger krümmen sah, um Luftgänsefüßchen zu machen, ein feiger Ersatz von Zynismus für Wissen, stellte ich mir manchmal eine scharfe Klinge vor, die in einer bestimmten Höhe durch den Raum sauste und diesen Gänsefüßchenfrauen die Finger absäbelte.
Die Reise von Marseille zur Dubois’schen Villa war lang und anstrengend gewesen. Acht Stunden. Ich hatte unterwegs oft haltgemacht, damit es interessant blieb. Womöglich hatte die Reise auch deshalb acht Stunden gedauert.
Ich war auf Mautstraßen unterwegs gewesen und ab und zu rausgefahren, um an konzessionierten, stereotypen Raststätten, wo Essen unter orangefarbenen Wärmelampen dampfte, regionale Weine zu trinken. In jeder dieser Raststätten wurden lokale Produkte angeboten, Lavendelöl zum Beispiel, immer in Klöstern hergestellt, als beteten die Mönche Lavendel an und nicht Gott. Oder getrocknete Trüffel, Senf und Gläser mit Fleisch in Aspik, das aussah wie Katzenfutter und das die Franzosen terrine nennen und essen, als wäre es kein Katzenfutter.
Im Magen kommt sowieso alles zusammen, hörte ich niemanden sagen, wenn die Leute sich anstellten, um das Zeug zu kaufen.
Ich probierte diese Weine auf Plastikgestühl sitzend, mit Blick auf Zapfsäulen und Autobahn. In einem kaltfeucht klimatisierten Monop’ an der A55, einem chaotischen Ort, wo Kinder kreischten und eine hagere Frau einen dreckigen Mopp über den Boden zog, trank ich Rosé aus dem Luberon. Der Rosé war delikat und fruchtig, knackfrisch wie gebügeltes Leinen.
In der L’Arche Cafeteria an der A7 fand ich einen Pécharmant vom ältesten Winzer in Bergerac, einen Wein mit Holznoten von Amber und Lorbeer und vielleicht einer Spur getrockneter Aprikose.
Ich genoss einen weißen Bordeaux de Médoc an einer Tankstelle am Straßenrand, unter freiem Himmel, wo ein Lkw-Fahrer laut furzte, während er an der automatischen Zapfsäule für seinen Diesel bezahlte und die lockeren Ventile seines Lkws, wie seine eigenen lockeren Ventile, vor sich hin knatterten. Dieser Bordeaux aus dem Médoc war so weich wie ein Seidengewand aus der Brautgabe einer Jungfer. Möglich, dass ich inzwischen, nach etwa fünfstündiger Reise, ein wenig beschwipst war. Dieser kalte, trockene Wein brachte mich zum Träumen von einer Welt, in der meine gesamte Kleidung weiß war und ich auf weißen Laken schlief und nie gegen eine Mitgift getauscht oder von groben, wertlosen Männern missbraucht oder gezwungen werden würde, billigere als die allerfeinsten französischen Weine aus den kleinsten, ältesten und angesehensten Anbaugebieten zu trinken, und irgendwie konnte ich sagen, dass ich dieses Leben tatsächlich führte, genau hier an dieser Tankstelle. Zumindest im Geiste.
Guter Wein ist mir wichtig, Essen nicht, und da die terrine praktisch ist – sie hat einen eigenen Behälter und muss nicht warm gemacht werden –, stahl ich in einer dieser Raststätten zwei Gläser davon, deren Gewicht den Lederriemen meiner Handtasche einen neuen Zug gab, als ich meinen Wein bezahlte.
Es war nicht so, dass ich glaubte, der Wein, den ich kaufte, sei Bezahlung genug für meine Gläser menschlichen Katzenfutters. Stehlen ist eine Möglichkeit, die Zeit anzuhalten. Außerdem fokussiert es Geist und Sinne neu, falls sie, zum Beispiel durch Trinken, abgestumpft sind. Stehlen verleiht der Wirklichkeit schärfere Konturen.
Du bist in einer Autobahnraststätte, Handel und Wandel, Menschen in Strömen, die kommen und gehen und schlendern und wählen, Kassierer und Kassiererinnen in einem Fugue-ähnlichen Zustand des ewigen Nächster-Nächster-Nächster. Und um den präzisen Moment zu bestimmen, in dem du unbeobachtet stehlen kannst, verlangsamst du das alles. Du bringst die Zeit zum Stillstand. Du fügst in die Wirklichkeit ein, was Komponisten eine «Fermate» nennen, und während die Zeit stillsteht, steckst du etwas in die Tasche.
So teste ich meine Fitness. Teste meine Sehfähigkeit. Prüfe, was andere sehen, und auch, was sie nicht sehen.
Durch Trekken und Vagabundieren, fuhr Bruno fort, ihre Frage zur Alten und Neuen Welt analysierend, hätten die Menschen die Erde nicht besiedelt. Die falsche Vorstellung jener Drei-Akt-Struktur, nach der die Menschen Afrika oder sonst einen Ort verließen, um irgendwo anders hinzugehen, vermittele den Eindruck, sie hätten beschwerliche und lange Strecken hinter sich gebracht wie Flüchtlinge oder gläubige Pilger auf der Suche nach einer Mahlzeit und einem Platz zum Schlafen. Wo sie mit einem Seufzer ihren schweren Rucksack ablegen konnten.
Tatsächlich, schrieb Bruno, gehe Migration ganz langsam vonstatten und bilde erst nach und nach Muster aus: nicht durch Trekken. Einfach durch Leben. Die Menschen blieben dann vielleicht eine Zeit lang in einer Gegend, und wenn die Jahreszeiten wechselten oder der Jagdbestand erschöpft sei oder das Wasser in eine Schwemmebene oder einen Sumpf zurückkehre, die zuvor reichliche Nahrung geliefert hätten, oder wenn sie zufällig auf einen Ort stießen, dessen Eigenschaften annehmlicher erschienen, oder auch eine Jahreszeit lang einer Herde Tiere folgten, ließen sie sich vielleicht in einer neuen Gegend nieder, und diese neue Gegend könne von ihrer alten eine kurze Wanderung entfernt sein, einen Tag oder eine Woche weit. Multipliziert diese Migrationsbewegungen über etliche Zehntausende von Jahren, schrieb Bruno, und ihr habt die Geschichte der Besiedelung der Erde.
Wie Menschen im Lauf der letzten halben Million Jahre von einer Landmasse zur anderen gelangt seien, verstehe man allerdings noch nicht. Polynesier hätten den Ozean überquert, lange bevor Europäer auch nur davon träumten, vom Ufer abzustoßen. Er werde dieses Thema bei anderer Gelegenheit wieder aufgreifen, doch fürs Erste bitte er sie zu erkennen, dass nichts so sei, wie sie womöglich angenommen hätten, und dazu gehöre auch dies: Neandertaler in Europa und Asien hätten – ohne Zweifel – Tabak geraucht.
Und sie seien nicht mal die Ersten gewesen, fügte er hinzu. Diese Errungenschaft komme ihrem Vorfahren zu, dem Homo erectus (Rectus, bei Bruno), nominell bekannt für die eher geringfügige Leistung des aufrechten Stehens – das stecke schon im Namen: Aufrechter Mensch. Aber die eigentliche Errungenschaft des Homo erectus sei es, dass er als erster Mensch mit Feuer gespielt habe. Und wir müssen annehmen, so Bruno weiter, dass der erste Mensch, der mit Feuer spielte, auchder erste Mensch war, der rauchte.
Nur, woher nahm Rectus das Feuer? Wir kennen alle den Mythos von Prometheus, in dem die Vorstellung geboren wurde, der Mensch sei ein Individuum, das anstelle einer besonderen Eigenschaft die Fähigkeit verliehen bekommen habe, Wärme zu erzeugen.
Prometheus und seinem bekanntermaßen dummen Bruder Epimetheus, so die Geschichte, war die wichtige Aufgabe übertragen worden, jedem Geschöpf im Königreich auf Erden eine positive Eigenschaft zu geben. Epimetheus stürzte sich in diese Arbeit und verteilte Eigenschaften – den Bienen die Fähigkeit, Honig zu machen, den Rehen die Gabe des Laufens und Springens, den Eulen einen Kopf, der sich um 270 Grad drehen konnte, und so weiter. Doch als Epimetheus zu den Menschen gelangte, waren ihm die positiven Eigenschaften in seinem Eigenschaftensack ausgegangen.
Das war der Moment – als der Sack leer war und Epimetheus nichts mehr zu vergeben hatte –, in dem sein Bruder Prometheus einschritt, den Göttern das Feuer stahl und es dem Menschen gab, als dessen positive Eigenschaft.
Aber hier ist der Haken, schrieb Bruno. Feuer ist nicht immer positiv. Und entscheidender noch: Feuer ist keine Eigenschaft. Es ist kein Merkmal, das einer Lebensform zuzuschreiben ist.
Feuer ist nicht wie Nachtsicht oder leise Schwungfedern, ein gelenkiger Kiefer oder Sprungkraft. Der Mensch, in diesem Mythos farb- und eigenschaftslos und ohne besondere Merkmale, wird stattdessen zur Raffinesse verdammt, dazu, ein hinterhältiger kleiner Bastard zu sein.
In seiner ontologischen Eigenschaftslosigkeit musste der Mensch, anders als die übrigen Geschöpfe des Königreichs, herausfinden, was er mit Feuer anstellen konnte, um den Mangel auszugleichen. Und so stützte er sich auf das Feuer wie auf eine Krücke. Dessen Verwendung wurde zum Ersatz für das, was dem Menschen verwehrt worden war, eine positive Eigenschaft, wie sie alle anderen Lebewesen bekommen hatten.
Dieser Mythos von den Brüdern, schrieb Bruno ihnen, der eine dumm, der andere schlau, und dem Ersatz von Eigenschaften durch Technologie ist, geben wir’s zu, nicht vollkommen fantastisch. Er erklärt vielmehr zutreffend, warum Elend und Verheerungen auf der Welt existieren und weshalb Feuer in böser und nicht in guter Absicht verwendet wird, nämlich zum Hamstern, Stehlen und Verwüsten, zu Plünderung und Unterdrückung.
Die Verwendung des Feuers zu schädlichen statt guten Zwecken scheint sich verdächtiger- und unheilvollerweise durchgesetzt zu haben, als der Neandertaler nach und nach verschwand und der Homo sapiens die Bühne betrat, ein zwischeneiszeitlicher Rabauke, der die Welt geformt hat, mit der wir jetzt zurechtkommen müssen.
Der Übeltäter scheine ausgemacht, schrieb Bruno, aber die Geschichte der Menschheit, unsere Geschichte, bleibe trotzdem ein großes Rätsel. Untersuchungen der Vergangenheit, von Erde und DNA, könnten uns neue Aufschlüsse darüber geben, wohin das gesamte Projekt auf der Erde hätte steuern können. Aktuell, schrieb er, steuern wir in einem funkelnden, führerlosen Wagen auf die Auslöschung zu, und die Frage ist: Wie steigen wir da aus?
Ich stellte mir vor, wie ein behelmter Fahrer aus einem Fuel Dragster fliegt, der Wagen in Flammen, sein Körper in einem feuerfesten Anzug, und sich in den endlosen Sekunden, bevor die Rettungsmannschaft angerannt kommt, überschlägt und überschlägt, während knallrote Flaggen TRACK HAZARD signalisieren und Streckenarbeiter aufschäumendes Feuerschutzmittel versprühen.
Aber wenn wir auf dem Planeten Erde allesamt in diesem funkelnden, führerlosen Wagen sitzen, woraus würden wir dann aussteigen, abgesehen von der Wirklichkeit? Wohin würden wir fliegen, wenn nicht in eine Leere hinein?
Nach ein paar Drinks fahre ich besser, konzentrierter.
Anstatt zu versuchen, irgendetwas auf dem Telefon zu lesen oder Lippenstift aufzutragen, schaute ich nach mehreren Gläsern dieser regionalen Weine strikt geradeaus und lenkte mit beiden Händen. Der Alkohol hatte mich so eingelullt, dass ich nur noch tat, was ich sollte: Auto fahren.
Allerdings entschied ich mich, da die Mautstraßen mich einzuschläfern drohten, für eine landschaftlich schönere Strecke und irrte durchs Zentralmassiv mit seinen vielen die Gänge schindenden Kurven.
Klar ging ich beim Kuppeln nicht zimperlich vor. Aber es fällt mir schwer zu glauben, dass Mietwagen etwas wert sind. Dieser, ein kleiner Fließheck-Škoda, kostete acht Euro am Tag. (Ich hatte eine Pauschalsumme als Reisebudget bekommen und mich deshalb fürs Sparen entschieden.) Womit verdienten diese Autovermietungen eigentlich Geld? Sie hatten brandneue Fahrzeuge. Man musste kaum etwas für sie zahlen. Und niemand kontrollierte den Wagen, bevor man damit aus dem Parkhaus fuhr.
Der Škoda war ein «sauberer Diesel», ein Oxymoron, das als Metapher für irgendetwas stand, ich wusste nur nicht, wofür.
Sauberer Diesel, saubere Kohle. Man füge das Wort «sauber» hinzu, und bäm – die Sache ist sauber.
Mein Navi funktionierte nicht, und die landschaftlich schönere Strecke führte mich landschaftlich viel zu schön über einen Gipfel. «Ach, komm», sagte ich laut, wenn links und rechts von mir nutzlose Ausblicke, roséfarbene römische Ruinen und auf zerklüfteten Felsen thronende Burgen auftauchten.
Ich kam an einem Turm auf einer Klippe vorbei, dessen oberer Rand angefressen aussah wie eine Eiswaffel, wenn das Eis weg ist und das Kind vertraglich verpflichtet, vom geschmacklosen Behältnis abzubeißen. «Zur Hölle damit», sagte ich.
Die atemberaubenden Ausblicke waren unattraktiv, weil sie mir bestätigten, dass ich mich verfahren hatte. Inzwischen wünschte ich mir nur noch einen Hinweis darauf, dass ich in nordwestlicher Richtung unterwegs war, zum Städtchen Boulière, das Lucien mir als Ansammlung krummer, schmutziger Straßen beschrieben hatte, bewohnt von hässlichen Menschen mit schäbigen Autos, aber gut geeignet, um mich im Carrefour oder Leader Price einzudecken, bevor ich zum Dubois’schen Familienanwesen fuhr. Ich befand mich mitten in einsamem, bewaldetem Hochland, nirgends ein Schild nach Boulière. Auf einem Gipfel fuhr ich an den Straßenrand und parkte auf einem ungepflasterten Platz bei einer Art Berggaststätte, in der Hoffnung, dort könne mir jemand den Weg beschreiben.
Die Gaststätte hatte zu. Es wirkte, als sei sie schon seit einer Weile nicht mehr geöffnet gewesen. Die Außenmauern waren mit Graffiti besprüht, verzerrte Namen und Symbole, die keinerlei Können verrieten, nichts Schönes schufen. Diese Art Graffiti, die in Europa häufig genug zu sehen ist, scheint vor allem entstellend. Manche Verbrechen, selbst schwere, sind durchaus natürliche Vorgänge. Sogar Mord ist nachvollziehbar, wenn man mal darüber nachdenkt. Es ist menschlich, seinen Feind auslöschen zu wollen oder der Welt zu demonstrieren: So wütend bin ich gerade, selbst wenn man später bereut, jemanden umgebracht zu haben. Aber ein unleserliches, schludriges Symbol auf ein Gebäude sprühen? Warum?
Es hatte hier oben gerade geregnet. Die Luft war feucht, warm und stickig, wie menschlicher Atem. Der Parkplatz war mit gemusterten Spuren von Lkw-Reifen schraffiert. Der Regen hatte gewaltige Pfützen hinterlassen, milchschokoladenbraun, die Oberfläche ein Himmelssiebdruck. Keine Lkws. Nur ihre Spuren. In den Ästen der niedrigen Bäume jenseits des Parkplatzes hing Nebel, als wäre eine Wolke auf diesen Berg heruntergekommen und hätte ihre ausgefransten Teile zwischen den Bäumen gelassen.
Das Ganze wirkte auf mich wie ein Ort, an dem irgendetwas Schlimmes passiert war.
Ich ging im waldigen Bereich hinter dem Parkplatz pinkeln. Während ich da hockte, fiel mein Blick auf eine neon-orangefarbene Frauenunterhose, die sich auf Augenhöhe im Gebüsch verfangen hatte.
Das fand ich nicht weiter seltsam. Lkw-Spuren und ein im Gebüsch hängen gebliebener Slip: Das ist «Europa». Das wahre Europa ist kein schickes Café an der Rue der Rivoli mit vergoldeten Fresken, kleinen Tässchen der berühmten chocolat chaud, hellrosafarbenen und mintgrünen Baby-Macarons und nach zu viel Shopping völlig überdrehten Kindern, die sich auf ihre Kekse freuen, rituelle Belohnung eines Samstagsausflugs mit maman. Das ist eine Vorstellung von Europa, wie gewisse Pariser sie hegen, und sie ist genauso unwirklich wie die idyllischen Szenen der Fresken in den schicken Cafés.
Das wahre Europa ist ein grenzenloses Liefer- und Transportnetzwerk. Das wahre Europa sind eingeschweißte Paletten mit ultrahocherhitzter Milch, Nesquikpulver oder Halbleitern; Autobahnen und Kernkraftwerke; fensterlose Verteilungslager, vor denen unsichtbare Männer, Polen, Moldawier, Mazedonier, mit ihren leeren Lkws zurücksetzen und Waren einladen, um sie durch ein gigantisches Netzwerk namens «Europa» zu befördern, von dem ein texasgroßes Stück «Frankreich» heißt. Diese Männer werden Gewichtsvorschriften ihrer Ladungen ebenso ignorieren wie Sicherheitsüberprüfungen ihrer Bremsen. Sie werden jemandem zu Hause in ihrer jeweiligen Nationalsprache texten, englischsprachige Popmusik hören und ihre Bedürfnisse vor Ort befriedigen, an leeren Parkplätzen auf Gebirgspässen.
Das einzige Rätsel ist, wo sie die Frauen für diese Gelegenheiten finden, aber selbst das ist nicht allzu schwer vorstellbar. Eine Frau in schwieriger Lage, keine Französin, ohne EU-Dokumente, die in irgendeiner abgelegenen Siedlung festsitzt und sich mit unpraktischen hochhackigen Schuhen aus ins Fleisch schneidendem Lederimitat auf die Hauptstraße wagt, in der Handtasche Aloe Vera, um irgendwem schnellfeuerartig einen runterzuholen. Sie hatte ihren Slip in diesem Wald gelassen. Und wenn schon. Ihre Welt ist voller Wegwerfdinge. Die Unterhose, die in einem Gebüsch vor meiner Nase hängt, stammt aus einem Paket mit drei Stück für fünf Euro bei Carrefour. Sie sind wie Kleenex. Man schwitzt, tropft oder blutet in sie hinein und wirft sie dann ins Gebüsch oder in den Müll oder spült sie im Klo runter und verstopft die Rohrleitung, idealerweise die von jemand anderem.
Ich hatte getrunken, wie gesagt. Und ich musste weiter. Ich «machte Bier», wie ein unrasierter moldawischer Lkw-Fahrer es vielleicht ausdrücken würde. Ein schäumender Stausee entstand unter mir, überschwemmte dann seine provisorischen Dämme und strömte weiter wie Voraustruppen, die zu einer Aufklärungsmission den Berg hinuntergeschickt werden. Ich pinkelte immer noch und beobachtete, wie mein Urin bergab floss, als ich Schritte hörte.
Ich erschrak. War hier jemand?
Mich berührt eure Frage, schrieb Bruno, warum wir hier auf der Erde allein sind, die einzig verbliebene menschliche Gattung. Wie konnte es passieren, dass von mehreren blühenden Zweigen nur noch der mickrige H. sapiens übrig ist, ohne Rivalen, ein einsamer Läufer auf einer existenziellen Rennbahn, der Runde um Runde um Runde dreht, seit er irgendwie die Konkurrenz ausgeschaltet hat und das Gattungsmonopol besitzt?
Es ist, gelinde gesagt, doktrinär, unbesehen zu glauben, nur wir allein bewohnten die Erde, wir Läufer auf unserer einsamen Bahn, die wir uns mit keinen anderen Überlebenden all der sie einst bevölkernden Menschenstämme teilen.
Auch ich habe mich der Fortschreibung der Doktrin, wir seien allein auf der Welt und es gäbe hier außer uns niemanden, schuldig gemacht. Aber, schrieb ihnen Bruno, gerade wenn wir uns dessen so sicher sind, dass wir uns die Frage stellen – wie ihr es jetzt getan habt –, wie es dazu kommen konnte, müssen wir uns klarmachen, dass jede Kultur der Welt ihre eigenen Legenden über die fortdauernde Existenz anderer Menschenstämme besitzt, Geschichten, die verschiedene Versionen jener anderen universellen Fantasie stützen: dass wir nicht allein sind.
Da gibt es zum Beispiel in den pazifischen nordwestlichen Bergregionen der Vereinigten Staaten und British Columbias die Legende vom Sasquatch, mitunter auch Bigfoot genannt.
Da gibt es den «sowjetischen» Sasquatch des Himalaya, auch bekannt als der Abscheuliche Schneemensch oder Yeti.
Da gibt es den hochgewachsenen, haarigen Humanoiden namens «Mungo» in den Bergen Nepals, der über die Jahrhunderte, wenngleich selten, immer wieder gesichtet wurde. In Gansu haben sie den Bärenmenschen. In Nanshan das Mensch-Biest mit ansprechenden Zügen und behändem Gang.
In der Gobi gibt es den Almas oder «Mongolischen Bigfoot», eine langbeinige, pelzige Kreatur, erbitterter Kämpfer und schnell wie der Wind, dessen Habitat sich mit dem entlegenen Gebiet deckt, in dem das Przewalski-Pferd umherstreift.
Dann ließ Bruno sich über sowjetische Kryptozoologen der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts aus, die ohne Ruhm oder Lohn jahrzehntelang an diesem Thema gearbeitet hatten, indem sie mündlich überlieferte Geschichten über «wilde Männer» zusammentrugen. Der sowjetische Anthropologe Boris Nevsky, spezialisiert auf Revolten des französischen Mittelalters, habe vermutet, die Bauernaufstände seien von Volksgruppen gesteuert worden, die von den Neandertalern abstammten, und gehofft, noch existierende Verbände dieses Volkes in den Pyrenäen erforschen zu können; man habe ihm jedoch kein Reisevisum gewährt. In der Sowjetunion festsitzend, sei er zum Leiter der Kommission zur Erforschung von Relikt-Hominiden ernannt worden und habe seine Feldforschung nach Zentralasien verlegt, insbesondere in das Pamir-Gebirge und den Himalaya, wo er dreißig Jahre lang umhergereist sei und Sichtungen dokumentiert habe.
Während Dr. Nevsky es zunächst für möglich hielt, schrieb Bruno weiter, dass die Geschichten über wilde Männer (und wilde Frauen), die er auf seinen Reisen zu hören bekam, reine Mythen waren, konnte er doch nicht leugnen, dass die Details der Sichtungen – die ausgeprägte, schwer gefurchte Stirn, Zähne so groß wie die von Kamelen, Geräusche, die diese Kreaturen machten und die wie das Quieken eines Kaninchens im Moment der Schlachtung klangen – von einer Region zur anderen nahezu identisch waren.
Und je weiter Dr. Nevsky reiste, desto mehr wuchs seine Überzeugung, dass diese Geschichten nicht bloß durch Zufall alle die gleichen Details aufweisen könnten. Im Lauf seiner Feldforschung verlor er zunehmend die Fähigkeit, die Geschichten von wilden Menschen im Revier der Kultur, des Mythos, zu belassen. Die Geschichten brachen aus ihrem Gehege aus, und der Wilde Mann wurde für Dr. Nevsky real.
Soweit ich weiß, schrieb Bruno, befinden sich Nevskys Schriften in den Archiven der Staatlichen Universität Moskau, und dank Vladimir Kreshnev, der sie katalogisiert hat, sowie der Forschung, die nachfolgende Kryptozoologen betrieben haben, sind wir verpflichtet, uns nicht auf unseren Lorbeeren auszuruhen, indem wir weiter von unserem Monopol auf menschliches Leben ausgehen.
Ja, seufzt ruhig, schrieb er. Bigfoot?, fragte er rhetorisch. Real??? Aus seinen wiederholten Fragezeichen sprach der blanke Hohn.
Ich spüre eure Skepsis. Meine ist gigantisch, das versichere ich euch. Wer weiß denn, ob diese sowjetischen Kryptozoologen, von denen ich rede, nicht geisteskrank sind. Wer kann sich sicher sein, dass ihre «Forschung» nicht halluzinatorisch ist, dummes Zeug oder gefälscht?
Aber ob in Zentralasien, auf den dunklen, wilden Höhen der Pyrenäen oder hier, in den geheimen Felsenhöhlen des Guyenne-Tals, und ob es der atavistische Neandertaler ist oder ein anderer Homininistamm, der irgendwie unentdeckt an den Rändern der modernen Welt lebt – solche wilden Menschen existieren ja durchaus. Sie sind quicklebendig. Nämlich wo? Genau. In unseren Köpfen und unserer Kultur, aufgrund jener unendlichen Legenden vom Sasquatch oder Schneemenschen, die wir ausspinnen und erträumen, für wahr halten möchten und fürchten.
Niemand kommt durch seine Kindheit, schrieb Bruno weiter, ohne auf einen haarigen, einsam umherlaufenden Mann zu stoßen, oder halb Mann, halb Tier, eine Kreatur, von der es in der Legende heißt, sie könne in jedem Wald lauern, in dem man sich aufhalte.
Jede Kultur hat ihre wilden Regionen, ihre wilden Gegenden, ob Wald, Wüste oder Steppe. Und in jeder wilden Gegend gibt es auch irgendeine wilde Gestalt, menschlich oder menschenähnlich, von unbekannter Abstammung, die abseits der anderen lebt, abseits der errichteten Welt, der sozialen Welt. Ich habe noch keine Kultur ohne eine solche Legende von einem Menschen kennengelernt, der in der Natur lebt und dessen Leben von Heimlichkeit bestimmt ist, von dem Schwur, sich uns niemals anzuschließen.
Vielleicht, mutmaßte Bruno, sind diese Legenden dazu da zu demonstrieren, was möglich ist. Zu beweisen, dass es irgendjemand – nicht wir – geschafft hat, der herrschenden Realität auszuweichen (was uns selbst nicht gelungen ist).
Vielleicht tröstet es uns, dass es Geschichten gibt – selbst wenn wir nicht an sie glauben –, denen zufolge wir H. sapiens nicht allein sind. Die Brotkrumenspur der Kryptozoologie wird zu einem Pfad des Widerstands gegen die Großwissenschaft und gegen den erdrückenden Pessimismus; diese Form der Überlieferung ist ein Ort, an dem die Menschen sagen können, aber … aber … aber seid ihr sicher?
Der Jemand, den ich im Wald gehört hatte, war ich selbst. Ich war auf eine zerknitterte Verpackung getreten.
Ich habe schnelle Reflexe.
Der Nachteil meiner Reflexe kann eine Überreaktion sein. (Ich hatte mir auf die Sandale und den Fuß gepinkelt.)
Irgendwann an diesem Tag fand ich schließlich Boulière, die größte Stadt in diesem Teil der Guyenne, wo es eine Ringstraße mit Autohäusern, Traktorhändlern und ein paar Supermärkten gab. Ich deckte mich mit Grundnahrungsmitteln und ungekühlten Sixpacks ein und fuhr weiter Richtung Westen in ein abgeschiedenes Flusstal. Das Dubois’sche Familienanwesen war nicht weit von Vantôme und Pascal Balmys radikaler landwirtschaftlicher Genossenschaft Le Moulin entfernt.
Vantôme lag nicht direkt auf meinem Weg, aber ich fuhr trotzdem dort vorbei, um mich mal umzusehen.
Das Ortsbild war von tristen kleinen Häusern aus grauem Schlackenbeton bestimmt. Es gab keine Gärten, kein Anzeichen von Pflege. Viele Gebäude schienen verwaist, kaputte Fenster, umgestürzte Mauern, Bäume, die durch eingebrochene Scheunendächer wuchsen.
Nach allem, was ich herausgefunden hatte, war der Hauptwirtschaftszweig in den höheren Lagen die Holzgewinnung gewesen. Die Hügel oberhalb von Vantôme hatten etliche kahle Stellen, wie der Schädel eines Menschen mit einer Autoimmunerkrankung. Das Ansprechendste war ein See gleich hinter der Ortsgrenze, künstlich vielleicht, aber schön, mit einer großen Spiel- und Liegewiese davor. Am Ufer hatten sich, still wie Statuen, ein paar alte Männer verteilt und hielten ihre Angeln übers Wasser.
Ich nahm eine Straße, die an Le Moulin vorbeiführte, und sah die von der Sonne versengten Kürbisse der Kommune, die zottigen Salate. Ihr Land grenzte an keinen Bach oder Zufluss und musste schwer zu bewässern sein. Der Boden hier war steinig. Nur Aktivisten aus Paris würden sich in einer solchen Gegend an Subsistenzwirtschaft versuchen.
Viele Einwohner waren aus dieser Region geflohen, weil sie kaum Jobs zu bieten hatte, stagnierte und vom modernen Leben abgeschnitten war. Es gab hier keine Zukunft, und so waren die jungen Leute in die Städte gezogen, nach Toulouse oder Bordeaux oder noch weiter weg, um sich Arbeit in Fabriken oder im Dienstleistungssektor zu suchen, eine Ausbildung zu machen, einen Weg ins Mittelschichtsleben zu finden. Ein paar kleine Milchwirtschaftsbetriebe gab es noch, aber die meisten Einheimischen, die hiergeblieben waren, hatten die Landwirtschaft aufgegeben und sich Satellitenfernsehen besorgt und tranken den ganzen Tag. Da Schlachter und Bäcker in ihren Dörfern längst dichtgemacht hatten, mussten die Leute in diesem Tal nach Boulière fahren, um bei Leader Price einzukaufen.
Unternehmen von außerhalb der Region kauften Land auf, um in großem Stil Mais anzubauen, als Teil einer staatlich lancierten Initiative, die Guyenne mittels einer Monokultur wiederzubeleben – Mais, Mais und noch mehr Mais. Diese Betriebe brauchten Wasser. Die «Megabassins», die der Staat plante, würden das Wasser der Region den Megalandwirten vorbehalten. Ich hatte all den Mais zwischen Boulière und Tayssac gesehen, weite grüne Felder, steril wie ein Monsanto-Horizont in Nebraska. Ich war an dem neuen Megabassin vorbeigefahren, wo die Geräte zerstört worden waren. Bauzäune versperrten den Blick, aber auf dem Gelände herrschte Aktivität, ich konnte Maschinenlärm hören, sah Staubwolken aufwirbeln. Einige Wohnwagen einer Sicherheitsfirma standen da, und vor der Einfahrt zum Gelände parkte Gendarmerie. An der Umzäunung hingen Transparente mit diffusen Slogans: «Kein Wasser ohne Management», «Keine Zukunft ohne Wasser» und «Arbeiten wir zusammen».
In anderen Teilen Frankreichs war es wegen dieser Megabassins zu Aufständen und Gewalt gekommen, mit ernsthaften Folgen – es gab Leute, die dabei ein Auge verloren hatten oder eine Hand, und etliche Polizeiwagen waren in Brand gesetzt worden. Was als friedliche Demonstration begann, endete nicht selten damit, dass maskierte Aktivisten Molotow-Cocktails auf eine Phalanx bewaffneter Bereitschaftspolizisten warfen, und die Antwort bestand aus heftigen Pfefferspraysalven, Prügeln und Verhaftungen.
Nachdem die Bagger in Tayssac in Brand gesetzt worden waren, hatte man Pascal Balmy verdächtigt. Die Menschen rund um Vantôme und Tayssac zeigten sich unkooperativ. Sie schienen die Anarchisten von Le Moulin als Freunde zu betrachten oder zumindest nicht als Feinde.
Als ihre Feinde betrachteten die Einheimischen vielmehr die großen Landwirtschaftsbetriebe, die Unternehmen, die das Megabassin bauten, die Polizei und die Vertreter aus den Ministerien für Landwirtschaft und Ländliche Geschlossenheit.
II
Das Priest Valley
Mein Erstkontakt mit Lucien Dubois war ein sogenannter Kaltaufriss gewesen. Ich hatte mich ihm in der Öffentlichkeit genähert, in Paris, als Fremde.
Das war sechs Monate her. Er stand in einer Bar in der Nähe der Place des Vosges und spielte Flipper, einen Fedora auf dem Kopf, als wähnte er sich in einem Nouvelle-Vague-Film von 1963.
Ich wusste viel über ihn, auch dass er eine gewisse manierierte Liebe zum alten Paris hegte und die Realität als Inszenierung in Schwarz-Weiß betrachtete. Die Wahrheit ist, dass diese Schwarz-Weiß-Filme selbst damals, als Jean-Luc Godard und Leute wie er sie drehten, mit den Fedora tragenden und wie Gangster sprechenden Schauspielern, schon artifiziell waren.
Ich ging also in diese Bar unweit der Place des Vosges, setzte mich und bestellte einen Pastis. Ich trug enge Jeans mit Hosenträgern. Mein weißes T-Shirt war fadenscheinig, dünn und durchsichtig, die Hosenträger rahmten meine großen Brüste ein, die keinen BH nötig haben.
Sind meine Brüste echt?
Spielt das eine Rolle?
Ich nippte an meinem Drink. Lucien bekam ein Freispiel. Ich spürte, dass er für mich so gut spielte, sein ganzes Körpergewicht einsetzte, um die Flipperhebel zu beherrschen und die kleine Silberkugel die Rampen hochschnellen zu lassen, und ihr mit den Augen folgte, wenn sie zu ihm zurückkam wie ein treues Haustier, bevor sie erneut von Bumper zu Target prallte.
Er spielte weiter. Ich bestellte einen zweiten Pastis.
Während ich Lucien dabei beobachtete, wie er die Flipperhebel bediente, das Gerät an beiden Seiten seines schmalen Endes gepackt hielt, um das Spiel zu kontrollieren, begann mich diese Pose von Mann und Maschine an eine uralte Form zu erinnern: ein Mann hinter dem Kasten, den er lenkt – einen Pflug vielleicht oder einen Wagen. Jungs, die mit ihrem Flipperspiel eine Pantomime der alten Welt aufführten, als Männer Pflüge über Felder trieben oder mit Heu oder Pferdemist gefüllte Wagen führten. In dieser alten Welt schoben die glücklosen Männer, die kein Land zum Bewirtschaften hatten, kein Heu zu mähen, keine Tiere zu züchten und zu misshandeln, Karren mit Trödel zum Verkaufen vor sich her. «Landstreicher» wurden diese Männer genannt, der gefürchtete und elende Landstreicher – Ausgestoßener und Dieb, der übers Land wanderte, seinen Karren schob, seine Glocke läutete und seine kaputten und gestohlenen Waren verkaufte.
Der Flipper kam mir vor wie ein stationärer und atavistischer Pferdewagen, die alte Arbeit jetzt zum Spiel umgedeutet. Kein Pflug mehr und kein Wagen, stand dieser alte Kasten nun als Spielzeug für Jungs und Männer in einer Pariser Bar. Seine pulsierenden Lichter forderten sie auf: aktiviert mich.
Ich verschwende meine Zeit nicht auf Spiele. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich kein Mann bin, oder daran, dass ich nicht gern spiele.
Lucien hatte keine Münzen mehr.
Der Barkeeper, der gerade Gläser abtrocknete, fragte: «War’s das für heute, Boss?»
«Kommt drauf an», sagte er. Er musterte mich eingehend.
Ich lächelte schüchtern und schaute zu den Flaschen, die hinter der Bar aufgereiht waren, und im Barspiegel zu Lucien.
Er kam und setzte sich neben mich.
«Hi.»
«Hallo.»
«Ich bin Lucien», sagte er.
«Ich bin Sadie», sagte ich.
Ich besaß sogar einen amerikanischen Pass auf diesen Namen.
Was Prometheus betrifft, könnten wir fragen, schrieb Bruno ihnen, ob frühe Menschen wie die Taler vielleicht doch besondere Eigenschaften verliehen bekommen hatten. Und ob es nur der moderne Mensch war, H. sapiens, dem sie fehlten.
Der kräftige Kiefer, das große Gehirn, die schweren Knochen und das breitflächige Gesicht, das seien positive Merkmale. Vielleicht, so Bruno, sei der Taler ein mit guten Eigenschaften gesegneter Mensch gewesen und H. sapiens, auf seinem Raubzug und Vorstoß zur verheerenden Morgendämmerung der Landwirtschaft, ein Mensch ohne solche Segnungen, ein Mensch ohne Eigenschaften, der das Loch in der Mitte seines Herzens durch Gewalt ersetzt habe.