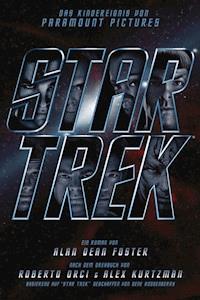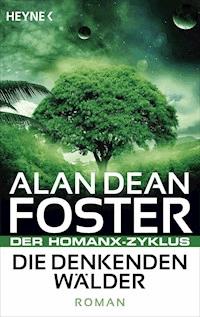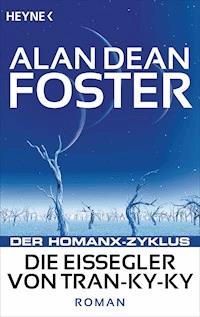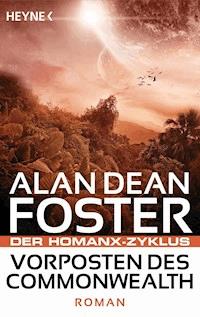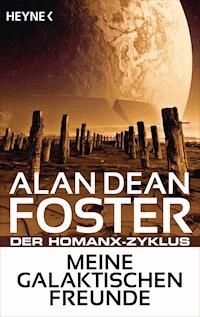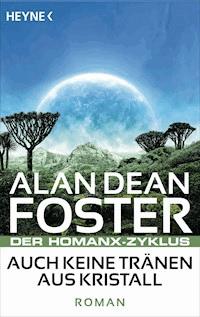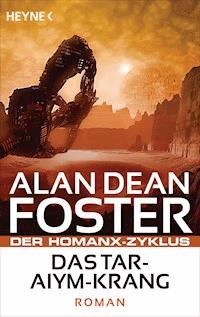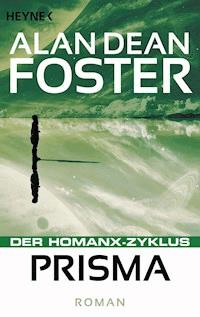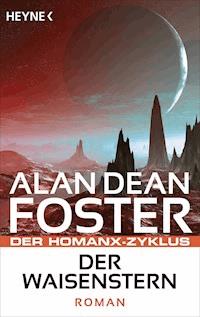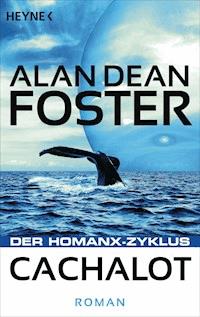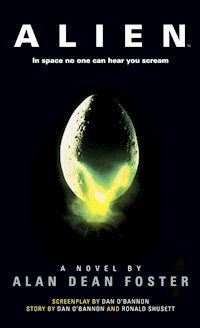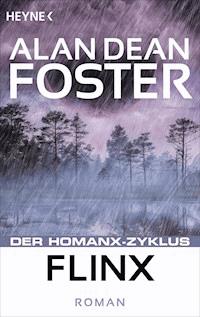
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Homanx-Reihe
- Sprache: Deutsch
Wer ist Flinx?
Weshalb ein hübscher, netter und liebenswerter Junge wie Flinx auf dem Sklavenmarkt von Drallar landete, war Mutter Mastiff ein Rätsel. Ebenso, weshalb sie dieses Kind kaufte, das sicherlich aus einem guten Elternhaus stammte. Doch genau damit musste es etwas Besonderes auf sich haben, denn kaum ist Flinx in ihrem Haus, beginnen die Schwierigkeiten. Sie wird bedroht und verschleppt. Flinx setzt alles daran, Mutter Mastiff aus der Hand der unbekannten Täter zu befreien, nichts ahnend, dass er das eigentliche Ziel der dunklen Machenschaften ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ALAN DEAN FOSTER
FLINX
Roman
Für Michael
und Audrey und Alexa Whelan;
weil sie
1. Kapitel
Das ist vielleicht ein zerschundener, wertloser, kleiner Knirps, dachte Mutter Mastiff. Sie presste den Beutel mit Schnitzereien etwas fester an sich und vergewisserte sich, dass ihr Slicker ihn vor dem Regen schützte. Der ewige für den Herbst auf Drallar so typische Nieselregen perlte von dem wasserfesten Material.
Außenweltler hatten es schwer, zwischen den Jahreszeiten der Stadt irgendwelche Unterschiede festzustellen. Im Sommer war der Regen warm, im Herbst und Winter etwas kühler, im Frühjahr wich er einem beständig lastenden Nebel. Dass die Sonne einmal durch die fast ewige Wolkendecke schielte, war eine solche Seltenheit, dass die Behörden dann gewöhnlich einen öffentlichen Feiertag verfügten.
Eigentlich konnte man das, woran Mutter Mastiff jetzt vorbeitrottete, nicht gerade einen Sklavenmarkt nennen. Das war ein archaischer Begriff, wie ihn nur Zyniker benutzten. Es war einfach der Ort, wo Arbeit und Einkommen auf formelle Art aufeinander abgestimmt wurden.
Drallar war die größte Stadt der Welt, die sich Moth nannte, die einzige echte Metropole, die sie besaß, und zwar keine besonders wohlhabende. Die Behörden hielten die Steuern niedrig und hatten es dadurch geschafft, eine ganze Anzahl Gewerbetreibender und Handelsunternehmen auf einen günstig gelegenen, aber im wesentlichen unwirtlichen Planeten zu ziehen. Den Ausgleich dafür schafften sie, indem sie kommerzielle Lästigkeiten wie Zölle oder einengende Vorschriften weitgehend abgeschafft hatten. Das führte zwar zu beträchtlichem Wohlstand für einige, brachte aber der Stadtregierung praktisch keine Einnahmen.
Zu den zahlreichen Bereichen des öffentlichen Lebens, die darunter litten, gehörte auch die Fürsorge für die Armen. In Fällen von Bedürftigkeit, wenn das betreffende Individuum noch dazu durch die Umstände isoliert war, hielt man es daher für vernünftig, es wohlhabenderen Bürgern zu überlassen, der Regierung die Verantwortung abzunehmen.
Das reduzierte die Ansprüche an den Wohlfahrtsetat und sorgte dafür, dass die Bürokratie zufrieden blieb und verschaffte gleichzeitig dem betreffenden Individuum ein höheres Maß an Fürsorge – so behaupteten die Beamten wenigstens – als er oder sie von mit zu knappen Mitteln ausgestatteten Regierungsbehörden je erwarten konnten.
Die Vereinigte Kirche, der geistliche Arm des Commonwealth{1}, war von solch einseitiger Wirtschaftspolitik nicht gerade begeistert. Aber das Commonwealth hielt nicht viel davon, sich in die inneren Angelegenheiten einzelner Welten einzumischen, und die Beamten von Drallar beeilten sich, gelegentlich zu Besuch erscheinende Padres oder Ratsherren davon zu überzeugen, dass es genügend gesetzliche Sicherheitsvorkehrungen gab, die den Missbrauch von auf diese Weise ›adoptierten‹ Individuen verhinderten.
So kam es, dass Mutter Mastiff sich auf ihren Stock stützte und ihren Beutel mit den kunstgewerblichen Gegenständen an sich drückte und etwas verschnaufte, während sie die zugedeckte Plattform musterte. Ein neugieriger Zuschauer drängte sich zu nahe an sie heran und blickte böse, als sie ihn mit dem Stock anstieß, trat aber zur Seite, da er die Auseinandersetzung mit ihr scheute.
Auf der Plattform, innerhalb des Kompensationskreises, stand ein hagerer, ernst blickender Knabe von acht oder neun Jahren. Der Regen hatte ihm das rote Haar, das in scharfem Kontrast zu seiner ziemlich dunklen Haut stand, an den Kopf geklebt. Weite, unschuldige Augen, so groß, dass sie sein ganzes Gesicht zu erfüllen schienen, starrten über die vom Regen eingeweichte Zuschauergruppe. Er hielt die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Das einzige, was sich an ihm bewegte, waren seine Augen, und ihr Blick huschte wie ein Insekt über die nach oben gerichteten Gesichter der Menge. Die Mehrzahl der Kauflustigen schien seine Anwesenheit überhaupt nicht zur Kenntnis zu nehmen.
Rechts von dem Jungen stand eine großgewachsene, schlanke Vertreterin der Regierung, die im Auftrag der Wohlfahrtsbehörde den offiziellen Verkauf – man bezeichnete ihn hier als ›Zuteilung von Verantwortung‹ – durchführte. Auf der anderen Seite konnte man von einem großen Bildschirm die wesentlichen Daten des Jungen ablesen, und diesen Bildschirm studierte Mutter Mastiff gerade.
Größe und Gewicht entsprachen dem, was sie sehen konnte. Haar-, Augen- und Hautfarbe hatte sie bereits wahrgenommen. Lebende Verwandte, zugeteilt oder sonst – keine Angabe. Persönliche Vorgeschichte – wieder keine Angabe. Ein Zufallskind, dachte sie, das man, wie so viele andere, der gleichgültigen Barmherzigkeit der Regierung zugeschoben hatte. Ja, so wie er aussah, würde es tatsächlich besser für ihn sein, wenn er unter die Fittiche eines privaten Individuums käme. Zumindest würde er dann vielleicht ordentlich zu essen bekommen.
Und doch war da noch etwas Besonderes an ihm, etwas, das ihn irgendwie von der teilnahmslosen Schar von Waisen abhob, die Jahr für Jahr in gleichmäßiger Prozession über die vom Regen durchnässte Plattform zogen. Mutter Mastiff spürte etwas, das hinter jenen weiten, traurigen Augen lauerte – eine Reife, über seine Jahre hinaus, mehr Intensität in seinem Blick, als man von einem Kind in seiner Lage erwarten durfte. Und dieser Blick schweifte immer noch über die Menge, suchte, tastete. Der Junge wirkte eher wie ein Jäger als wie ein Gejagter.
Und der Regen fiel ohne Unterlass. Die Aufmerksamkeit der Zuschauer konzentrierte sich in erster Linie auf die rechte hintere Ecke der Plattform, wo ein einigermaßen attraktives sechzehnjähriges Mädchen als nächstes an der Reihe war. Mutter Mastiff rümpfte geringschätzig die Nase. Was auch immer die Regierungsbeamten behaupteten, ihr würde keiner weismachen, dass diese drängelnden Schnösel in der vordersten Reihe nicht noch etwas anderes im Sinn hatten als unschuldig altruistische Sorge um die Zukunft des Mädchens. O nein!
Die Schar potentieller Wohltäter bildete eine Insel, um die der Rest der Bevölkerung des Marktplatzes strömte. Der Markt selbst konzentrierte sich in einem Ring aus Buden und Läden und Restaurants und Kneipen, die das ganze Stadtzentrum umgaben. Das Ergebnis des Ganzen war gerade modern genug, um zu funktionieren, und hinreichend ungeregelt, um auch jene anzuziehen, die das Geheimnis lockte.
Für Mutter Mastiff gab es auf diesem Markt nichts Geheimnisvolles. Der Marktplatz von Drallar war ihr Zuhause. Neunzig Jahre hatte sie im endlosen Kampf in jenem endlosen Strom aus Menschen und Aliens verbracht, manchmal nach unten gesogen und manchmal sich über die Flut erhebend, aber nie in Gefahr zu ertrinken.
Jetzt besaß sie einen Laden – klein, aber nur ihr gehörend. Sie handelte und feilschte um Kunstgegenstände, trieb Handel mit Elektronikgegenständen, kunstgewerblichen Arbeiten und vielerlei Schnickschnack, und verdiente daran gerade genug, um sich solchen Orten wie der Plattform fernzuhalten, auf der der Junge jetzt stand. Sie versetzte sich in seine Lage und schauderte. Eine neunzigjährige Frau würde keinen besonders hohen Preis einbringen.
Am Hals ihres Slicker gab es einen schlecht geflickten Riss, und der Regen fand inzwischen durch diesen Riss seinen Weg. Der Beutel mit Ware, den sie an sich drückte, wurde auch nicht leichter. Mutter Mastiff hatte noch andere Geschäfte zu erledigen und wollte zu Hause sein, ehe es dunkel wurde. Wenn die Sonne von Moth unterging, würde das düstere Tageslicht von Drallar zu schleimiger Dunkelheit verblassen, und dann würden aus den Slums etwas weniger höfliche Geschöpfe hervorkommen und den Markt verunsichern. Man musste schon sehr unvorsichtig sein, oder auf Händel aus, wenn man sich zu solcher Zeit noch draußen blicken ließ, und Mutter Mastiff war keines von beiden.
Die Augen des Jungen schweiften immer noch über die Zuschauerschar und erreichten schließlich die ihren – und hielten an. Plötzlich empfand Mutter Mastiff eine Art Schwindelgefühl. Ihre Hand griff an ihren Leib. Zu fett gefrühstückt, dachte sie. Die Augen waren bereits weitergewandert. Seit sie fünfundachtzig geworden war, musste sie sehr aufpassen, was sie zu sich nahm. Aber dann hatte sie auch einer Freundin einmal gesagt, »lieber sterbe ich an Verdauungsschwierigkeiten und mit vollem Bauch, als mich mit Pillen und Konzentraten dahinzuquälen.«
»Zur Seite!«, hörte sie sich plötzlich sagen, ohne selbst recht zu wissen, was sie tat oder warum. »Zur Seite!« Sie bahnte sich ihren Weg durch die Menge, stieß einem der Zuschauer mit dem Stock in die Seite, brachte das prunkvolle Arrangement von Schwanzfedern eines Ornithorpen in Unordnung und veranlasste eine übergewichtige Matrone zu einem erregten Schnattern. Sie arbeitete sich bis zu der freien Fläche unmittelbar vor der Plattform durch. Der Junge achtete nicht auf sie; seine Augen fuhren fort, die gleichgültige Menge abzusuchen.
»Bitte meine Damen und Herren und sonstige Geschöpfe«, bat die Beamtin auf der Plattform, »ist denn niemand von Ihnen bereit, diesem gesunden Jungen ein Zuhause zu bieten? Ihre Regierung bittet Sie darum; die Zivilisation fordert es von Ihnen. Heute haben Sie die Chance, gleich zwei gute Taten auf einmal zu begehen; eine für Ihren König und die andere für diesen unglücklichen Jungen.«
»Ich würde für den König schon gern eine gute Tat verrichten«, sagte eine Stimme aus der Menge, »und zwar dort, wo sie ihm am meisten gut tun würde.«
Die Beamtin warf dem Zwischenrufer einen zornigen Blick zu, sagte aber nichts.
»Was ist denn das niedrigste Gebot?« Ist das meine Stimme?, dachte Mutter Mastiff verblüfft.
»Bloße fünfzig Credits, Madam, um für die Verpflichtungen der Abteilung aufzukommen, und der Junge gehört Ihnen. Dann können Sie für ihn sorgen.« Sie zögerte und fügte dann hinzu: »Wenn Sie glauben, dass Sie mit einem so aktiven Jungen wie diesem zurande kommen.«
»Ich bin zu meiner Zeit mit genügend Jungs zurande gekommen«, erwiderte Mutter Mastiff knapp. Die amüsierte Menge reagierte mit ein paar zustimmenden Rufen. Sie studierte den Jungen, der jetzt wieder auf sie herunterblickte. Das Gefühl der Übelkeit, das sie kurzzeitig empfunden hatte, als ihre Blicke sich zum ersten Mal begegnet waren, stellte sich nicht wieder ein. Das war schon das fette Essen, dachte sie, ich muss besser aufpassen, was ich brate.
»Fünfzig Credits also«, sagte sie.
»Sechzig.« Die tiefe Stimme, die irgendwo hinten aus der Menge dröhnte, riss sie aus ihren Gedanken.
»Siebzig«, reagierte Mutter Mastiff automatisch. Die Beamtin auf der Plattform warf einen schnellen Blick in die Menge.
»Achtzig«, tönte der unsichtbare Konkurrent.
Mit Konkurrenz hatte sie nicht gerechnet. Es war eine Sache, um einen vernünftigen Preis einem Kind etwas Gutes zu tun. Sich unvernünftige Kosten aufzuladen, war da etwas ganz anderes.
»Neunzig – verflucht sollen Sie sein«, sagte sie. Sie drehte sich um und versuchte, ihren Widersacher auszumachen, konnte aber nicht über die Köpfe der Menge hinwegsehen. Die Stimme, die gegen sie bot, war männlich, kräftig und durchdringend. Was, zum Teufel, konnte der Besitzer einer solchen Stimme mit einem solchen Kind schon vorhaben?, dachte sie.
»Fünfundneunzig«, konterte die Stimme.
»Danke, danke. Die Regierung dankt Ihnen beiden.« Tonfall und Ausdruck der Beamtin waren sichtlich freundlicher geworden. Die lebhaften und völlig unerwarteten Gebote für den rotschöpfigen Knirps hatten ihre Langeweile und ihre Besorgnis gelindert. Wenn das so weiterging, würde sie ihrem Vorgesetzten eine bessere Abrechnung als üblich vorlegen können. »Gegen Sie ist geboten, Madam.«
»Der Teufel soll das Gebot holen«, murmelte Mutter Mastiff. Sie schickte sich schon an wegzugehen, aber da war etwas, das sie zurückhielt. Sie verstand sich ebenso gut auf Menschen wie auf die Ware, die sie an sie verkaufte, und an diesem Jungen war irgend etwas Besonderes – wenn sie auch nicht genau sagen konnte, was, was ihr wiederum als ungewöhnlich vorkam. Aber am Ungewöhnlichen war auch immer Profit zu machen. Und außerdem rührte dieser traurige Blick an einen Teil ihres Wesens, den sie gewöhnlich verborgen hielt.
»Oh, zur Hölle, dann eben hundert, und zum Teufel damit!« Sie brachte es kaum fertig, die Zahl auszusprechen. Ihre Gedanken kreisten wie wild. Was machte sie da bloß, warum vernachlässigte sie ihr gewöhnliches Geschäft, ließ sich hier vom Regen aufweichen und bot für ein Waisenkind? Ihre mütterlichen Instinkte waren es doch ganz bestimmt nicht, die hier angeregt wurden. Gott sei Dank hatte sie ihr ganzes Leben lang niemals auch nur den Hauch von mütterlichen Instinkten verspürt.
Sie wartete auf ein dröhnendes »Einhundertfünf«, hörte statt dessen aber, wie sich hinten in der Menge etwas regte. Sie reckte den Hals, versuchte, etwas zu sehen, und verfluchte ihre Gene, die dafür gesorgt hatten, dass sie so klein geblieben war. Schreie waren zu hören, dann wütende Rufe und laute Flüche aus einem Dutzend verschiedener Kehlen. Jetzt konnte sie zu ihrer Linken hinter dem Ornithorpen, der hinter ihr stand, die purpurne Uniform von Gendarmen sehen, deren Slickers im schwachen Licht glänzten. Die Gruppe schien sich mit größerem Tempo zu bewegen, als sie das von Gendarmen gewöhnt war.
Sie drehte sich um und versuchte, sich ein Stück nach rechts zu schieben, wo ein paar Stufen zur Plattform hinaufführten. Als sie die Hälfte des Weges zurückgelegt hatte, drehte sie sich um und spähte in die Menge. Die purpurfarbenen Slickers hatten jetzt die erste Wand aus Büros und Läden erreicht, und vor ihnen war eine hünenhafte menschliche Gestalt zu erkennen, die offenbar vor den Polizisten floh.
Mutter Mastiff gestattete sich ein wissendes Kopfnicken. Es gab immer Leute, die sich aus anderen als humanitären Gründen für einen jungen Knaben interessierten. Manche davon hatten Vorstrafenregister, die es an Länge mit ihrem Leben aufnehmen konnten. Offenbar hatte irgend jemand in der Menge, vielleicht sogar ein bezahlter Informant, das Individuum erkannt, das gegen sie geboten hatte, und hatte die Behörden verständigt, die mit lobenswerter Eile reagiert hatten.
»Hundert Credits also«, verkündete die Beamtin enttäuscht von der Plattform. »Höre ich mehr?« Natürlich rechnete sie nicht damit, trieb das Spiel aber weiter. Ein Augenblick verstrich in Schweigen. Sie zuckte die Achseln und blickte zu Mutter Mastiff hinüber, die immer noch auf der Treppe stand. »Er gehört Ihnen, Frau.« Aha, nicht mehr ›Madam‹, dachte Mutter Mastiff sarkastisch. »Zahlen Sie und beachten Sie die Vorschriften!«
»Ich kenne die Vorschriften dieser Regierung schon viel länger als Sie auf der Welt sind, Frau.« Sie stieg die letzten paar Stufen hinauf und ging, die Beamtin ebenso wie den Jungen ignorierend, auf das Büro zu.
Drinnen blickte ein gelangweilter Schreiber zu ihr auf, warf einen Blick auf die Akte, die auf dem Bildschirm seines Computers erschienen war, und fragte geschäftsmäßig: »Name?«
»Mastiff«, antwortete seine Besucherin und stützte sich auf ihren Stock.
»Ist das Ihr Familienname?«
»Vorname und Familienname.«
»Mastiff Mastiff?« Der Schreiber musterte sie.
»Nur Mastiff«, sagte die alte Frau.
»Die Regierung zieht mehrfache Namen vor.«
»Hören Sie! Was die Regierung vorzieht, ist mir piepegal!«
Der Schreiber seufzte und rührte ein paar Tastenfelder. »Alter?«
»Geht Sie nichts an.« Sie überlegte einen Augenblick lang und fügte dann hinzu: »Geben Sie alt ein.«
Das tat der Schreiber und schüttelte dabei mürrisch den Kopf. »Einkommen?«
»Ausreichend.«
»Jetzt hören Sie mir mal zu!«, begann der Schreiber. »Wenn es um die Übernahme von Verantwortung für Wohlfahrtsindividuen geht, benötigt die Stadtregierung einige Einzelheiten.«
»Die Stadtregierung kann mir mit ihren Einzelheiten ebenso den Buckel runterrutschen wie mit ihren Doppelnamen!« Mutter Mastiff gestikulierte mit ihrem Stock in Richtung auf die Plattform. Eine weite, ausholende Bewegung, der der Schreiber nur dadurch entging, dass er sich geistesgegenwärtig duckte. »Die Gebote sind abgeschlossen. Der Bursche, der gegen mich geboten hat, ist verschwunden. Recht hastig sogar. Jetzt kann ich entweder mein Geld nehmen und nach Hause gehen oder meinen Betrag zur Zahlungsbilanz der Regierung und zu Ihrem Gehalt leisten. Wie hätten Sie’s denn gern?«
»Ach, schon gut!«, meinte der Schreiber verdrießlich. Er beendete seine Eintragungen und drückte einen Knopf. Ein scheinbar endloses Formular schob sich aus dem Ausdruckschlitz. Zusammengefaltet war es immer noch einen halben Zentimeter dick. »Lesen Sie das!«
Mutter Mastiff nahm sich das Bündel Papiere. »Was soll das alles?«
»Vorschriften bezüglich Ihres neuen Schützlings. Sie können den Jungen aufziehen, dürfen ihn aber nicht misshandeln. Sollte man je feststellen, dass Sie die hierin angegebenen Anweisungen und Gesetze verletzen …« – er deutete auf das Bündel Papier –, »kann er Ihnen weggenommen werden, und der von Ihnen geleistete Betrag ist verfallen. Außerdem müssen Sie sich vertraut machen …« – er unterbrach seinen Vortrag, als der in Rede stehende Junge von einem anderen Beamten in den Raum geführt wurde.
Der Junge sah zuerst den Schreiber und dann Mutter Mastiff an. Dann ging er, gerade als hätte er früher schon ähnliche Rituale vollzogen, ruhig auf sie zu, nahm ihre linke Hand und legte seine rechte Hand hinein. Die weiten, scheinbar arglosen Augen eines Kindes blickten in die ihren. Seine Augen waren hellgrün, stellte sie abwesend fest.
Der Schreiber wollte fortfahren, stellte dann aber fest, dass ihm etwas in der Kehle saß, und wandte sich statt dessen seinem Schreibtisch zu. »Das wäre alles. Sie können gehen.«
Mutter Mastiff räusperte sich lautstark, als hätte sie einen Sieg errungen und führte den Jungen auf die Straßen von Drallar hinaus. Das eine wichtige Kleidungsstück, das auf Moth wesentlich war, hatten sie ihm gegeben: einen kleinen blauen Slicker. Er zog sich das billige Plastikmaterial über den Kopf, als sie die erste Querstraße erreichten.
»So Junge, das wär’s. Der Teufel soll mich holen, wenn ich weiß, warum ich das getan habe. Aber anscheinend habe ich dich jetzt am Hals. Und du mich natürlich. Hast du irgend etwas im Schlafsaal gelassen, das wir holen sollten?«
Er schüttelte langsam den Kopf. Ein stiller Typ, dachte sie. Das war ganz gut so. Vielleicht würde er sich nicht gleich als Heulsuse erweisen. Sie fragte sich immer noch, was sie zu ihrem plötzlichen und für sie völlig uncharakteristischen Ausbrach von Großzügigkeit veranlasst hatte. Die Hand des Jungen lag warm in ihrer knorrigen, alten Pranke. Gewöhnlich pflegte diese Hand eine Credcard zu halten, um das Geld anderer Leute auf ihr Konto zu übertragen, oder irgendwelche Kunstgegenstände, um ihren Wert abzuschätzen, oder gelegentlich sogar ein Messer, das für radikalere Zwecke als die Zubereitung von Nahrung benutzt wurde. Aber die Hand eines kleinen Kindes hatte sie noch nie gehalten. Es war ein ganz eigenartiges Gefühl.
Sie bahnten sich ihren Weg durch die Menschenmassen, die noch vor Einbruch der Nacht nachhause wollten, und wichen dabei den Abflusskanälen aus, die in der Mitte einer jeden Straße verliefen. Ein unbeschreibliches Gemisch von Düften schlug ihnen aus den Dutzenden von Garküchen und Restaurants entgegen, die die Straße säumten, auf der sie gingen. Aber der Junge sagte kein Wort. Schließlich war Mutter Mastiff es leid, dass sich sein Gesicht jedem Ort zuwandte, von dem solche einladenden Düfte kamen, und sie blieb vor einem Etablissement stehen, das ihr vertraut war. Sie waren ohnehin fast zu Hause angelangt.
»Bist du hungrig Junge?«
Er nickte langsam, ein einziges Mal.
»Dumm von mir. Ich komme den ganzen Tag ohne Essen aus und denke nicht einmal daran. Manchmal vergesse ich, dass andere ihre Bäuche nicht so gut unter Kontrolle haben.« Sie deutete mit einer Kopfbewegung auf die Tür des Lokals. »Nun, worauf wartest du?«
Sie folgte ihm ins Innere des Restaurants und ging zu einer stillen Nische an einer der Wände. Aus der Mitte des Tisches erhob sich eine kreisförmige Konsole. Sie studierte die Speisekarte, die auf die Konsole aufgedruckt war, warf einen prüfenden Blick auf das Kind, das erwartungsvoll neben ihr saß, und berührte dann ein paar Tasten, die neben der Speisekarte angebracht waren.
Es dauerte nicht lange, und die Konsole versank im Tisch und erschien im nächsten Augenblick wieder mit Essen beladen; ein dicker, würzig duftender Eintopf mit Gemüse und ein großer Berg Brot.
»Nur zu«, sagte sie, als der Junge zögerte, und bewunderte dabei seine Zurückhaltung und seine Tischmanieren. »Ich habe keinen besonderen Hunger und esse ohnehin nie sehr viel.«
Sie sah ihm zu, während er das Essen verschlang, brach sich gelegentlich ein Stückchen von dem farbenfreudigen Brot ab, um ihren bescheidenen Hunger zu stillen, und achtete kaum auf die gelegentlichen Grüße vorübergehender Bekannter oder Freunde. Als der Junge seine Schüssel spiegelblank ausgeleckt hatte und das letzte Stück Brot in seinem Mund verschwunden war, fragte sie: »Hast du noch Hunger?«
Er zögerte, sah sie prüfend an und nickte dann. »Das überrascht mich nicht«, antwortete sie. »Aber ich möchte nicht, dass du heute Abend noch mehr isst. Du hast gerade genug für einen erwachsenen Mann in dich hineingeschlungen. Noch mehr, und du kannst es vielleicht nicht bei dir halten. Morgen früh, okay?«
Er nickte langsam, schien zu verstehen.
»Und nun eins, Junge. Kannst du reden?«
»Ja.« Seine Stimme war leiser, als sie erwartet hatte, aber ohne Angst, und klang wie sie fand, irgendwie dankbar.
»Ich kann recht gut reden«, fügte er hinzu, ohne dass sie ihm weiter zuzureden brauchte, und überraschte sie damit. »Man hat mir gesagt, dass ich für mein Alter recht gut reden kann.«
»Das ist hübsch. Ich hab schon angefangen, mir Sorgen zu machen.« Sie erhob sich von ihrem Sitz, stützte sich auf ihren Stock und griff wieder nach seiner Hand. »Jetzt ist es nicht mehr weit.«
»Nicht mehr weit wohin?«
»Dorthin, wo ich wohne. Wo du von nun an auch wohnen wirst.« Sie verließen das Restaurant, und die feuchte Nacht hüllte sie ein.
»Wie heißt du?« Er sprach, ohne zu ihr aufzublicken und zog es statt dessen vor, die schwach beleuchteten Ladenfassaden und Geschäfte zu studieren. Die Intensität, mit der er sie betrachtete, schien ihr unnatürlich.
»Mastiff«, sagte sie und grinste dann. »Das ist nicht mein richtiger Name, Junge. Aber jemand hat ihn mit vor vielen Jahren angehängt. Ob er mir nun passt oder nicht, er ist länger an mir haften geblieben als irgendein Mann. Es ist der Name eines Hundes von außergewöhnlicher Wildheit und Hässlichkeit.«
»Ich finde nicht, dass du hässlich bist«, erwiderte der Junge. »Ich finde, du bist schön.«
Sie studierte seinen offenen, jungenhaften Gesichtsausdruck. Schwachsinnig, kurzsichtig oder einfach nur sehr schlau, dachte sie.
»Darf ich Mutter zu dir sagen?«, fragte er hoffnungsvoll und verwirrte sie damit noch mehr. »Du bist doch jetzt meine Mutter, oder?«
»Irgendwie schon, denke ich. Frag mich bloß nicht warum!«
»Ich werd’ dir keinen Ärger machen.« Seine Stimme klang plötzlich besorgt, fast verängstigt. »Ich hab noch nie jemandem Ärger gemacht, ehrlich. Ich will bloß, dass man mich in Frieden lässt.«
Was mochte ihn wohl zu einem solch verzweifelten Geständnis veranlasst haben?, fragte sie sich. Sie beschloss, nicht näher auf die Sache einzugehen. »Ich verlange gar nichts von dir«, versicherte sie. »Ich bin eine einfache alte Frau und lebe ein einfaches Leben. So gefällt es mir. Hoffentlich gefällt es dir auch.«
»Klingt nett«, meinte er freundlich. »Ich werd’ mir Mühe geben, dir so gut zu helfen, wie ich kann.«
»Weiß der Teufel, im Laden ist genug zu tun. Ich bin nicht mehr so gelenkig wie ich einmal war.« Sie lachte laut und glucksend. »Ich werd jetzt immer schon vor Mitternacht müde. Kannst du dir vorstellen, dass ich tatsächlich volle vier Stunden Schlaf brauche? Ja, ich denke schon, dass du nützlich sein kannst. Hoffentlich bist du das. Hast genug gekostet.«
»Das tut mir leid«, sagte er, plötzlich niedergeschlagen.
»Hör damit auf! Davon will ich in meinem Haus nichts hören!«
»Ich meine, es tut mir leid, dass ich dich geärgert habe.«
Sie gab ein undefinierbares Stöhnen von sich, kniete nieder und stützte sich mit beiden Händen auf ihren Stock. Jetzt hatte sie ihr Gesicht vor seinen Augen. Er stand da und musterte sie mit ernstem Blick.
»Jetzt hör mir gut zu, Junge! Ich bin keine Agentin der Regierung und hab nicht die leiseste Vorstellung welcher Teufel mich geritten hat, die Verantwortung für dich zu übernehmen. Aber jetzt ist es nun einmal geschehen. Ich werde dich nicht schlagen, es sei denn, du verdienst es. Ich werde dafür sorgen, dass du ordentlich zu essen bekommst und nie zu frieren brauchst. Als Gegenleistung verlange ich, dass du nicht rumläufst und blödes Zeug herumblökst, wie ›es tut mir leid‹. Geht das klar?«
Darüber brauchte er nicht lange nachzudenken. »Das geht klar – Mutter.«
»Dann wäre das erledigt.« Sie schüttelte seine Hand. Das führte zu einem neuen Phänomen. Seinem ersten Lächeln. Sein kleines, leicht mit Sommersprossen übersätes Gesicht schien dabei zu leuchten, und plötzlich wirkte die Nacht weniger kühl.
»Beeilen wir uns jetzt«, sagte sie und richtete sich wieder auf. »Ich bin nicht gern so spät draußen, und du bist als Leibwächter auch nicht gerade eindrucksvoll. Wirst es wahrscheinlich auch nie sein, wenn man dich so ansieht. Aber das ist nicht deine Schuld.«
»Warum ist es so wichtig, zu Hause zu sein, wenn es dunkel ist?«, fragte er und fügte dann etwas unsicher hinzu: »Ist das eine dumme Frage?«
»Nein, Junge.« Sie lächelte auf ihn herab, während er die Straße entlanghopste. »Es ist eine sehr kluge Frage. Es ist wichtig, nach Einbruch der Dunkelheit zu Hause und in Sicherheit zu sein, weil die Toten sich nämlich in unmittelbarer Proportion zum Fehlen von Licht vermehren. Aber wenn du vorsichtig bist und lernst, mit der Dunkelheit zu leben, dann wirst du herausfinden, dass die Dunkelheit ebenso dein Freund wie dein Feind sein kann.«
»Das habe ich mir gedacht«, sagte er entschieden. »Das habe ich mir schon so lange gedacht« – sein Gesicht verzog sich etwas, so als müsste er sich konzentrieren –, »so lange ich mich erinnern kann.«
»Oh?« Sie lächelte ihm immer noch zu. »Und warum glaubst du das – ich meine, abgesehen davon, dass ich es dir gerade gesagt habe?«
»Weil«, antwortete er, »die meiste Zeit, wo ich mich erinnere, dass ich glücklich war, das immer im Dunkeln war.«
Sie dachte darüber nach, während sie um die Ecke bog. Der Regen hatte inzwischen nachgelassen und war dem Nebel gewichen, der in der Stadt als normale Luft galt. Ihren Lungen machte er nichts aus, aber sie war um den Jungen besorgt. Was sie ganz bestimmt nicht brauchen konnte, war ein krankes Kind. Er hatte sie schon genug gekostet.
Ihre Laden-Wohnung war eine von vielen, die den scheinbar endlosen Marktplatz übersäten. Massive Jalousien schützten die unauffällige Fassade, die am Ende einer Nebenstraße zehn Meter ausmachte. Sie drückte die Handfläche gegen das Türschloss. Der sensibilisierte Kunststoff leuchtete einen Augenblick lang hell auf, gab zwei piepende Töne von sich, und dann öffnete sich die Tür.
Drinnen angelangt, schob sie die Tür hinter ihnen zu und drehte sich dann automatisch im Kreis, um ihr Inventar zu inspizieren und sich zu vergewissern, dass in ihrer Abwesenheit nichts verschwunden war. Es gab Regale mit Waren aus Kupfer und Silber, und seltene Hartholzschnitzereien, für die Moth zurecht berühmt war, sauber geschnitzte Ess- und Trinkutensilien, darunter viele, die offensichtlich für Nichtmenschen bestimmt waren, billige Modelle von Moth selbst, mit seinen unterbrochenen Ringen aus blitzendem Glitzerzeug, und verschiedene Gegenstände, deren Sinn und Zweck nicht gleich zu erkennen war.
Der Junge schlenderte durch dieses Gewirr aus Farben und Formen. Seine Augen tranken alles in sich hinein, aber er stellte keine Fragen, und das kam ihr ungewöhnlich vor.
Es lag im Wesen von Kindern, nach allem Fragen zu stellen. Aber dann war dies auch kein gewöhnliches Kind.
Ganz hinten im Laden stand eine silberne Kassette auf einem kleinen Podest. Ihre Sensorschalter verbanden den Laden unmittelbar mit der Zentralbank von Drallar und erlaubten es Mutter Mastiff, finanzielle Transaktionen für alle Kunden durchzuführen, gleichgültig, ob sie von jenseits der Straße oder der anderen Seite des Commonwealth kamen. Eine universelle Credcard gestattete den Zugang zur gesamten Habe ihres Besitzers. Banken speicherten Informationen; alle harten Währungen waren in allgemeinem Umlauf.
Hinter dem Podest und der Tür, die es halb verdeckte, waren vier Räume: ein kleiner Lagerraum, ein Badezimmer, eine Küche mit Essplatz und ein Schlafzimmer. Mutter Mastiff stand ein paar Minuten lang mit prüfendem Blick da und machte sich dann daran, den Lagerraum zu räumen. Uralte, seit langer Zeit nicht verkaufte Gegenstände flogen zusammen mit Reinigungsutensilien, Kleidung, Konserven und anderen Gegenständen auf den Boden. Irgendwie würde sie schon woanders dafür Platz finden.
Eine kräftige alte Pritsche lehnte an der Wand. Sie berührte einen Knopf an ihrer Seite, und der Gegenstand erwachte zum Leben, rutschte herum, während seine Beine sich streckten. Weiteres Wühlen brachte einen Beutel mit Trageöl zum Vorschein, den sie in die Matratze steckte. Nach wenigen Minuten war der Beutel voll und warm. Schließlich deckte sie die Pritsche mit einer dünnen, thermosensitiven Decke zu.
»Das ist jetzt dein Zimmer«, sagte sie. »Es ist kein Palast, aber es gehört dir. Ich weiß, wie wichtig es ist, dass man etwas hat, das einem selbst gehört. Du kannst dir diese Laube herrichten, wie es dir gefällt.«
Der Junge sah sie an, als hätte sie ihm gerade sämtliche Schätze Terras übereignet. »Danke, Mutter«, sagte er leise. »Das ist herrlich.«
»Ich verkaufe Sachen«, sagte sie und wandte sich von seinem strahlenden Gesicht ab. Sie deutete auf den Lagerraum vorne. »Die Dinge, die du beim Hereinkommen gesehen hast.«
»Das habe ich mir gedacht. Verdienst du viel Geld?«
»Jetzt klingst du wie der Typ von der Regierung.« Sie lächelte, um ihm zu zeigen, dass sie es nicht ernst meinte. »Ich komme so zurecht. Lieber hätte ich ein größeres Geschäft als das hier, aber in meinem Alter …« – sie lehnte den Stock an ihr Bett, während sie in den größeren Raum schlenderte – »ist es recht unwahrscheinlich, dass ich je eines bekomme. Mich stört das nicht. Ich hatte ein gutes, erfülltes Leben und bin es zufrieden. Du wirst bald herauskriegen, dass mein Knurren und Schimpfen größtenteils Show ist. Aber nicht immer.« Sie tätschelte ihm den Kopf und wies auf die Küche.
»Möchtest du gerne was Heißes zu trinken, ehe wir uns schlafen legen?«
»Ja, sehr.« Er nahm vorsichtig seinen Slicker ab, der inzwischen getrocknet war, und hängte ihn an einen Wandhaken in seinem Schlafzimmer.
»Wir werden dir neue Kleider besorgen müssen«, meinte sie aus der Küche.
»Die sind schon in Ordnung.«
»Für dich vielleicht, aber nicht für mich.« Sie rümpfte die Nase, um ihm zu erklären, was sie meinte.
»Oh, ich verstehe.«
»Und was würdest du gern trinken?«
Sein Gesicht hellte sich sofort wieder auf. »Tee. Was für Tee hast du denn?«
»Was für Tee magst du denn?«
»Allen möglichen.«
»Dann such ich dir einen aus.« Sie fand den Zylinder und berührte den Hauptschalter an der Seite, während sie ihn mit Wasser aus der Leitung füllte. Dann sah sie sich unter ihren Lebensmittelvorräten um.
»Das ist hier schwarzer Anar«, erklärte sie, »der kommt von Rhyinpine. Eine hübsch weite Reise für tote Blätter. Ich finde, er ist milder als weißer Anar, der von derselben Welt kommt, aber etwas weiter unten am Berg wächst. Wenn du deinen Tee gern süß trinkst, habe ich hiesigen Honig. Er ist teuer. Blumen sind auf Moth rar, außer wenn sie in Gewächshäusern wachsen. Diese Welt gehört den Pilzen und Bäumen; die Bienen, die armen Dinger, haben es hier schwer, selbst die, die sich einen wolligen Pelz wachsen lassen, der ihnen die Feuchtigkeit und die Kälte fernhält. Wenn dir Honig zu dick ist, habe ich anderen Süßstoff.«
Als sie keine Antwort hörte, drehte sie sich um und sah ihn reglos auf dem Boden liegen, ein dunkler Knirps mit roten Locken und schmutzigen, alten Kleidern. Er hatte die Hände unter der Wange zusammengeschoben, um ihm als Kissen zu dienen.
Sie schüttelte den Kopf und schaltete den Zylinder wieder ab. Der Topf seufzte und hörte zu kochen auf. Sie beugte sich vor, schob die knorrigen Arme unter ihn und hob ihn hoch. Irgendwie schaffte sie es, ihn auf die Pritsche zu legen, ohne ihn dabei aufzuwecken. Dann zog sie ihm die Thermodecke bis ans Kinn. Sie war programmiert und würde ihn schnell wärmen.
Dann stand sie eine Weile da und staunte darüber, wie viel Freude es einem doch machte, etwas so Einfaches zu tun, wie einem Kind beim Schlafen zuzusehen. Dann ging sie hinaus, weil sie sich immer noch darüber wunderte, was über sie gekommen war, ging in ihr eigenes Zimmer und zog sich beim Gehen langsam aus. Bald war das letzte Licht hinten in dem kleinen Laden ausgegangen, und die Nacht brach herein. Nur der leichte Wind und das Zischen der Feuchtigkeit, die aus den warmen Wänden verdunstete, durchbrach die Stille der vom Nebel verhangenen Finsternis.
2. Kapitel
Der Junge aß, als hätte die reichliche Mahlzeit vom vergangenen Abend nicht mehr Substanz gehabt als ein Traum. Sie bereitete ihm Frühstück zwei reichliche Portionen und sah ihm dabei zu, wie er es bis auf den letzten Bissen verspeiste. Als er den letzten Tropfen Pachnack getrunken und das letzte Stück Brot hinuntergeschlungen hatte, nahm sie ihn mit in den Laden.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!