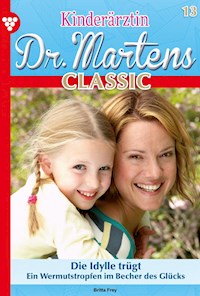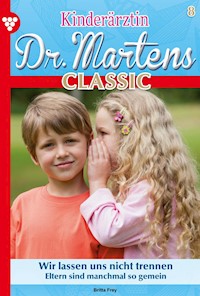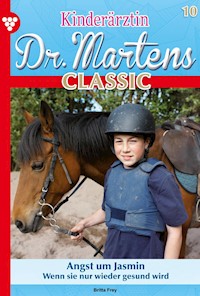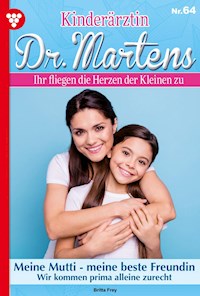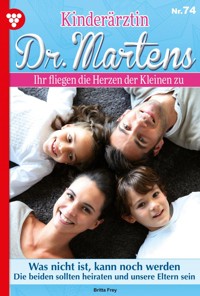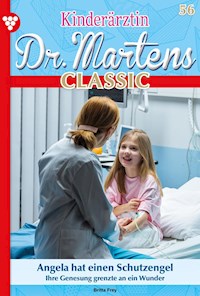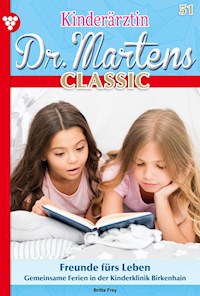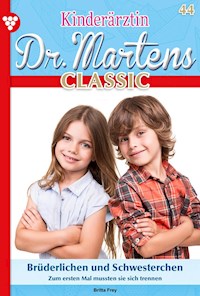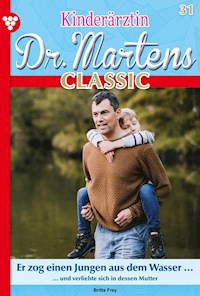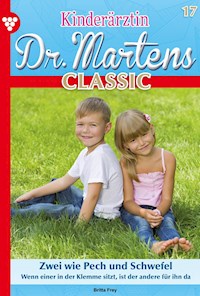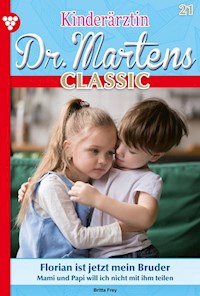
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kinderärztin Dr. Martens Classic
- Sprache: Deutsch
Die Kinderärztin Dr. Martens ist eine großartige Ärztin aus Berufung, sie hat ein Herz für ihre kleinen Patienten, und mit ihrem besonderen psychologischen Feingefühl geht sie auf deren Sorgen und Wünsche ein. Die Kinderklinik, die sie leitet, hat sie zu einem ausgezeichneten Ansehen verholfen. Kinderärztin Dr. Martens ist eine weibliche Identifikationsfigur von Format. Sie ist ein einzigartiger, ein unbestechlicher Charakter – und sie verfügt über einen liebenswerten Charme. Alle Leserinnen von Arztromanen und Familienromanen sind begeistert! Wenn man Jörg Markmann kennenlernte, hätte man ihn für jünger gehalten, als er in Wirklichkeit war. Der Elfjährige haßte es geradezu, wenn man erstaunte Augen machte, nachdem man erfuhr, daß er schon elf und nicht etwa erst acht Jahre alt war. Dabei konnte man keineswegs behaupten, daß Jörg mädchenhaft wirkte – beileibe nicht. Er war nur eben ein bißchen kleiner und schmaler als die anderen. Daß er noch wuchs und bestimmt noch ordentlich zulegen würde, bis er erwachsen war, konnte ihn nicht über seinen heimlichen Kummer hinwegtrösten. Wenn er seinen Vater betrachtete, kam er sich noch winziger vor. Achim Markmann war äußerlich das, was man sich unter einem »richtigen« Mann vorstellte – groß, beinahe vierschrötig, mit unheimlicher Kraft, die man ihm schon anmerkte, wenn man ihm nur die Hand gab. Seine Stimme war tief und veränderte sich, wenn er ärgerlich oder gar wütend wurde. Alle seine Mitschüler in Ögela bewunderten Jörgs Vater. Hinzu kam, daß er auch noch einen außergewöhnlichen Beruf ausübte, der auf Kinder mit Phantasie auch noch ganz besonders wirkte. Achim Markmann war nämlich in der Strafanstalt des nahen Städtchens Celle Gefängnisaufseher! Jörg fand es manchmal gar nicht spaßig, wenn er auf den Beruf seines Vaters angesprochen wurde. Er konnte die Auskünfte, die die anderen von ihm erwarteten, gar nicht geben, weil sein Vater daheim eben nur Vater war und kaum über seine Arbeit sprach. Mit einem Wort gesagt, er war ein ganz normaler Vater, und Jörg wünschte ihn sich gar nicht anders. Er wünschte sich einfach nur, einmal so groß und stark wie er zu sein, das war alles. Jörg Markmann war kein Streber, aber er war ein guter Schüler, der wunderbar mitkam und seinen Kameraden dann und wann auch helfen und erklären konnte, was sie nicht verstanden hatten. Alles in allem – er war ein Kind, das seinen Eltern kaum Sorgen bereitete. Und gerade das sollte mit einem Schlag anders werden. Achim Markmann war heute pünktlich heimgekommen, ganz so, wie er es Jörg versprochen hatte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kinderärztin Dr. Martens Classic – 21 –Florian ist jetzt mein Bruder
Mami und Papi will ich mit ihm teilen
Britta Frey
Wenn man Jörg Markmann kennenlernte, hätte man ihn für jünger gehalten, als er in Wirklichkeit war. Der Elfjährige haßte es geradezu, wenn man erstaunte Augen machte, nachdem man erfuhr, daß er schon elf und nicht etwa erst acht Jahre alt war. Dabei konnte man keineswegs behaupten, daß Jörg mädchenhaft wirkte – beileibe nicht. Er war nur eben ein bißchen kleiner und schmaler als die anderen. Daß er noch wuchs und bestimmt noch ordentlich zulegen würde, bis er erwachsen war, konnte ihn nicht über seinen heimlichen Kummer hinwegtrösten.
Wenn er seinen Vater betrachtete, kam er sich noch winziger vor. Achim Markmann war äußerlich das, was man sich unter einem »richtigen« Mann vorstellte – groß, beinahe vierschrötig, mit unheimlicher Kraft, die man ihm schon anmerkte, wenn man ihm nur die Hand gab. Seine Stimme war tief und veränderte sich, wenn er ärgerlich oder gar wütend wurde.
Alle seine Mitschüler in Ögela bewunderten Jörgs Vater. Hinzu kam, daß er auch noch einen außergewöhnlichen Beruf ausübte, der auf Kinder mit Phantasie auch noch ganz besonders wirkte. Achim Markmann war nämlich in der Strafanstalt des nahen Städtchens Celle Gefängnisaufseher!
Jörg fand es manchmal gar nicht spaßig, wenn er auf den Beruf seines Vaters angesprochen wurde. Er konnte die Auskünfte, die die anderen von ihm erwarteten, gar nicht geben, weil sein Vater daheim eben nur Vater war und kaum über seine Arbeit sprach. Mit einem Wort gesagt, er war ein ganz normaler Vater, und Jörg wünschte ihn sich gar nicht anders. Er wünschte sich einfach nur, einmal so groß und stark wie er zu sein, das war alles.
Jörg Markmann war kein Streber, aber er war ein guter Schüler, der wunderbar mitkam und seinen Kameraden dann und wann auch helfen und erklären konnte, was sie nicht verstanden hatten. Alles in allem – er war ein Kind, das seinen Eltern kaum Sorgen bereitete.
Und gerade das sollte mit einem Schlag anders werden.
Achim Markmann war heute pünktlich heimgekommen, ganz so, wie er es Jörg versprochen hatte. Sie wollten endlich den neuen Hasenstall bauen, denn einer der Nachbarn hatte Jörg einen Stallhasen versprochen, den er sich abholen wollte, sobald der Stall fertig war.
Daß Jörg seinem Vater dabei helfen wollte, war ebenso klar.
Achim Markmann saß noch in der hübschen Wohnküche und trank seinen Kaffee, während Jörg schon hinab in den Keller ging, wo Achim sich einen geräumigen Hobbyraum eingerichtet hatte. Jörg hatte seinem Vater schon viel abgeschaut und wußte genau mit den einzelnen Werkzeugen umzugehen. Nur die elektrische Kreissäge, die hatte er bisher noch nicht allein benutzt.
Und gerade das hatte er sich für heute vorgenommen. Er wollte beweisen, daß er so etwas Einfaches wie einen Hasenstall auch allein fertig bekommen konnte.
Als der Junge den Motor einschaltete, hob Achim Markmann droben in der Küche den Kopf und sagte hastig:
»Und dabei habe ich ihm doch verboten, allein mit der Kreissäge herumzuhantieren. Das ist viel zu gefährlich. Na, warte, ich werde wohl mal ein paar ernsthafte Worte mit dir reden müssen, Bürschchen!«
Damit erhob er sich, nickte seiner Frau Thea noch einmal zu und machte sich auf den Weg in den Keller, aus dem immer noch das Geräusch der elektrischen Kreissäge zu hören war.
Als Achim Markmann den Hobbyraum betrat, sah er Jörg erst gar nicht. Also schaltete er erst einmal die Kreissäge ab und fragte ungeduldig:
»Wo bist du? Brauchst dich gar nicht erst zu verstecken. Dein Donnerwetter kriegst du so oder so. Also? Wo steckst du?«
»Vati«, kam da die schwache Stimme Jörgs, und Achim sah ihn auf dem Boden sitzen. »Ich glaube, ich habe etwas falsch gemacht. Auf einmal ist es passiert. Ich weiß auch nicht, wieso.«
Achim Markmann sah mit einem Blick, was geschehen war. Zuerst, für Sekundenbruchteile nur, hatte er das Gefühl, jemand reiße ihm bei lebendigem Leib das Herz aus der Brust. Aber dann hatte er sich auch sofort wieder unter Kontrolle.
»Jörg, mein Bengelchen!« keuchte er und riß das Kind an sich, drückte den kleinen Körper fest an sich und rannte die Treppe empor, während er brüllte, so daß man es noch mehrere Häuser weiter hören konnte:
»Thea! Den Verbandskasten! Und ruf sofort den Notwagen an. Jörg hat sich – er hat sich…« Seine Stimme brach, als er den Jungen auf den Küchenstuhl sinken ließ.
Die erschreckte Thea Markmann brachte den Erste-Hilfe-Kasten und fiel beinahe in Ohnmacht, als sie auf die linke Hand ihres Buben sah. Jörg hatte sich zwei Finger, den Zeige- und den Mittelfinger, abgeschnitten!
»Den Notarztwagen, Thea! Schnell!« stieß Achim Markmann hervor. Er sah nur aus den Augenwinkeln, daß eine der Nachbarinnen durch die Außentür der Küche hereinkam und blaß wurde, als sie erkannte, was los war. Beherzt drückte sie die kopflose, weinende Thea auf einen Stuhl und ging hinaus in die kleine Diele, wo das Telefon stand. Dann kehrte sie in die Küche zurück und sah noch, wie Achim seinem Jörg, der nun sonderbar apathisch wirkte, die Hand verband, die kaum blutete.
Da wandte sich die energische Frau um, ging an den Kühlschrank und nickte zufrieden, als sie die Flasche mit Korn dastehen sah. Es war ganz normal, daß man dann und wann einen Klaren trank, und der mußte natürlich eiskalt sein, sonst schmeckte er nicht.
Die Nachbarin, Maria Wichert, holte die Flasche heraus, suchte im Küchenschrank nach Gläsern und schenkte ein. Dann hielt sie Thea Markmann ein Glas hin.
»Hier«, sagte sie ruhig und gleichzeitig auch befehlend, »das ist jetzt wie Medizin.« Sie reichte auch Achim, der noch vor seinem Jungen kniete, ein Glas, das er mechanisch nahm und leertrank.
Maria Wichert fand, daß sie auch ruhig einen Schluck vertragen konnte, und versorgte sich selbst. Die Kornflasche verschwand wieder im Kühlschrank, denn Maria fand, es sei genug, wenn man einen Korn als Medizin trank. Mehr konnte da nur schaden. Dann sah sie auf Jörg und fühlte sich unsicher und unfrei. Es kam nicht oft vor, daß Maria Wichert keine Worte fand. Aber eben jetzt war es so. Sie wußte nicht, was sie sagen sollte…
*
Dr. Hanna Martens strich sich das blonde Haar nach hinten und pustete die Wangen auf. Sie lachte, als sie sich Schwester Barbara zuwandte und aufatmend sagte:
»Das war wieder mal ein turbulenter Tag heute, was? Jetzt eine ordentliche Tasse Kaffee, und dann mache ich, daß ich in meine Wohnung komme. Ich spüre meine Füße schon gar nicht mehr.«
»Kunststück, wenn man den ganzen Tag am Operationstisch gestanden hat.« Schwester Barbara sah Hanna vorwurfsvoll an.
»Sie etwa nicht?« fragte Hanna und lachte leise. »Kommen Sie mit, einen Kaffee trinken? Oberschwester Elli hat mit Abstand den besten Kaffee in der ganzen Umgebung. Weiß der Himmel, wie sie es anfängt – ihr Kaffee ist immer etwas Besonderes. Ich habe mir die Kaffeedose schon mitgenommen, Wasser aus demselben Hahn, den sie benutzt, ja, ich habe mir schon ihre Kaffeemaschine ausgeliehen – aber der Kaffee, den ich gebraut habe, war nur ganz annehmbar, nicht aber im entferntesten das, was Oberschwester Elli fertigbringt.«
»Liegt wahrscheinlich an der Hingabe. Sie kocht ja keinen Kaffee, sie zelebriert ihn.« Schwester Barbara kicherte. Sie wollten gerade eben die jetzt menschenleere Operationsabteilung verlassen, in der in wenigen Minuten alles geputzt und wieder für neue Operationen bereitgemacht würde, als Dr. Frerichs kam.
Sein meist offenstehender Kittel flatterte, so eilig hatte er es.
»Gut, daß ich Sie noch antreffe, Frau Chefärztin. Wir müssen sofort los. Ein Junge hat sich zwei Finger abgeschnitten, mit der elektrischen Kreissäge seines Vaters.«
»Allmächtiger!« stieß Hanna hervor. »Wer ist es?«
»Jörg Markmann.«
»Also los!« sagte Hanna und lief schon davon. Frerichs folgte ihr, aber er war nicht schnell genug, ihr die Türen zu öffnen. Sie saß schon im Notarztwagen, den Martin Schriewers meistens fuhr, als Dr. Frerichs sich neben sie setzte.
»Wissen Sie schon Genaueres?« wollte Hanna aufmerksam wissen. Ihre schmerzenden Füße waren vergessen. Und auch ihr Kaffeedurst.
Martin Schriewers schaltete Blaulicht und Martinshorn ein, sobald sie das Klinikgelände verlassen hatten. Es war zwar nicht notwendig, weil in Ögela, das nur an einer
Nebenstraße lag, kaum Verkehr herrschte, aber für Martin schien das nun eben mal mit dazuzugehören. Ein Unfallwagen ohne Blaulicht und Martinshorn war in seinen Augen wie eine Suppe ohne Salz.
Sie erreichten das Haus der Markmanns, vor dem nun schon einige Frauen und Männer standen und aufgeregt miteinander diskutierten. Jetzt machten sie Hanna und Dr. Frerichs schweigend Platz, als sie den Wagen verließen und auf die offenstehende Haustür zueilten, unter der die tränenüberströmte Thea Markmann stand und zitternd und zusammenhanglos hervorstieß:
»Jörg! Frau Doktor – seine Finger!«
Hanna schob die Frau, die außer sich war, beiseite und betrat das Haus. Dr. Frerichs folgte ihr auf dem Fuße. Er trug die schwere Bereitschaftstasche. Martin Schriewers blieb hinter dem Steuer sitzen. Es ging niemanden etwas an, daß er zarter besaitet war, als alle glaubten. Genauer ausgedrückt – Martin Schriewers war immer einer Ohnmacht nahe, wenn er Blut sah. Das brauchte aber niemand zu wissen. Man denke – ein Krankenwagenfahrer, der kein Blut sehen konnte! Dabei war er, wenn man es genau betrachtete, gar kein Krankenwagenfahrer, sondern der Hausmeister der Kinderklinik Birkenhain. Aber es hatte sich so eingebürgert, daß Martin den Krankenwagen fuhr, und kein Mensch dachte daran, eigens dafür einen Fahrer einzustellen. Martin hatte seine Sache bisher sehr gut gemacht, und das würde er auch in Zukunft tun, punktum.
Jörg war immer noch bei Bewußtsein, aber leichenblaß. Er wirkte apathisch. Als erfahrene Ärztin wußte Hanna, daß dies das typische Stadium eines Vorschocks war.
»Tut gar nicht weh!« sagte Jörg und streckte Hanna seine verbundene Hand hin. Dabei sah er sie in einer Weise an, die rührend wirkte. Thea Markmanns Schluchzen wurde noch stärker.
Hanna nahm Jörgs Hand, legte sie auf das Polster, das Dr. Frerichs Jörg auf die Oberschenkel geschoben hatte und wickelte den Mullverband, den Achim Markmann angelegt hatte, ab. Obwohl Hanna vorbereitet war, erschrak sie doch zutiefst. Zeige- und Mittelfinger waren glatt abgeschnitten. Die Stümpfe bluteten kaum. Die Arterien hatten sich schon kurz nach dem Unfall zusammengezogen. Geronnenes Blut hatte die Wunden verstopft. Hanna fand, daß das eine segensreiche Selbstschutzaktion des menschlichen Körpers war, die sie schon oft hatte beobachten können.
Sie prüfte den Puls des Jungen. Er war matt und beschleunigt.
»Wie fühlst du dich?«
»Geht so«, erwiderte Jörg.
Nun schluchzte auch die sonst beherzte Maria Wichert leise auf. »Wie tapfer das Kerlchen doch ist!« stieß sie hervor.
Hanna wußte, daß das nicht so war. Sie hatte das schon oft bei sogar Schwerstverletzten beobachten können. Mit geradezu gespenstischer Gelassenheit und Tapferkeit standen sie durch und schienen kaum Angst oder Schmerzen zu empfinden. Es war, als sende das geschockte Nervensystem so etwas wie eine körpereigene Wunderdroge aus, die eine Art Schutzwall errichtete.
Hanna und Dr. Frerichs nickten einander zu. Sie waren gut aufeinander eingespielt, denn sie hatten schon mehrere Einsätze zusammen durchgeführt.
Dr. Frerichs legte eine Infusion an, um den Kreislauf zu stabilisieren, und injizierte ein Mittel zur Stärkung der Herztätigkeit, während Hanna einen Druckverband anlegte.
Und Thea Markmann erging sich in Erklärungen und Selbstanklagen.
»Oh, diese Kreissäge! Ich war ja gleich dagegen, daß Achim, mein Mann, sie anschaffte. Und Jörg! Ich weiß nicht, wie oft wir dem Jungen verboten haben, diese Säge in Betrieb zu setzen. Achim!« Sie fuhr herum und sah ihren Mann anklagend an. »Warum nur mußtest du erst deinen Kaffee trinken, wo du doch wußtest, wie eilig der Junge es hatte.«
Achim Markmann, der große starke Mann, vor dem heimlich viele zitterten, sagte nichts. Er stand nur ganz erschüttert da und hatte Tränen in den Augen, die jetzt langsam über seine Wangen rannen.
»Wo sind die Finger?« fragte Hanna mit heller Stimme, der man anhörte, daß sie voll konzentriert war.
Keine Antwort, nur ängstliches Schweigen. Genau das hatte Hanna befürchtet. Vor lauter Panik war niemand auf den Gedanken gekommen, die Finger zu suchen.
Hanna sprang auf. Gemeinsam mit Dr. Frerichs hastete sie in den Keller. Martin Schriewers, der sich nun doch endlich entschlossen hatte, den sicheren Krankenwagen zu verlassen, blieb neben Jörg stehen.
Die blutige Kreissäge lag am Boden. Fieberhaft suchten Hanna und Dr. Frerichs den Raum ab. Sie wühlten im Sägemehl, krochen unter die Werkbank und suchten aufgeregt und fieberhaft nach den abgeschnittenen Fingern. Endlich fand Frerichs den Zeigefinger neben der Fußleiste, und Hanna entdeckte den Mittelfinger hinter einer Farbdose.
»Endlich!« stieß Hanna hervor. Beinahe hätte sie vor lauter Erleichterung geschluchzt. Der erste Schritt war getan, den kleinen Jörg Markmann davor zu bewahren, für den Rest seines Lebens mit einer verkrüppelten linken Hand herumlaufen zu müssen.
Sie eilten nach oben. Dort wickelte Hanna die abgeschnittenen Finger in ein keimfreies Tuch, gab es in einen Plastikbeutel und verschloß alles in einem Spezialbehälter, der mit Eiswürfeln gefüllt war. Auf diese Weise blieben die abgeschnittenen Finger bis zu vierundzwanzig Stunden replantierbar.
»Martin!« wandte sich Hanna an diesen. »Funken Sie nach dem Rettungshubschrauber. Jörg muß in eine Spezialklinik, damit man die Finger wieder annähen kann.«
»Nein!«
Nach diesem Einwurf blieb es sekundenlang mucksmäuschenstill in der Küche der Markmanns. Dann fragte Hanna, während sie sich umwandte und Achim Markmann fest in die Augen sah:
»Was soll das?«
»Ich sagte – nein, Frau Dr. Martens. Sie werden meinen Jungen operieren, Sie und Ihr Bruder. Hier in Ögela, wo wir unseren Jungen nahe bei uns haben können.«
»Seien Sie vernünftig, Herr Markmann.« Hanna sah ihn ruhig an. Er stand wohl auch unter Schock, dachte sie. Aber schon die nächsten Worte zeigten ihr ganz deutlich, daß Achim Markmann genau wußte, was er sagte und wollte.
»Sie werden Jörg die Finger in Ihrer Klinik annähen, Frau Dr. Martens.«
»Aber die Spezialklinik liegt
nur fünfzehn Hubschrauberminuten entfernt. Dort ist man auf so etwas eingerichtet, Herr Markmann, dort ist das Routine. Es sind alles Unfallärzte dort.«
»Ist Ihr Bruder nicht Unfallarzt?« fragte Markmann unbeirrt.
»Ja, schon, aber deshalb kann er nicht so ohne weiteres…«
»Er kann. Und er wird!« unterbrach Achim Markmann und machte dabei ein so entschlossenes Gesicht, daß Hanna unwillkürlich wütend wurde.
Warum machten einem die Leute alles nur so unendlich schwer?
»Bitte, Herr Markmann, verlassen Sie sich darauf, daß ich das besser beurteilen kann als Sie«, begann sie, wußte aber, nachdem sie ihn noch einmal angeschaut hatte, daß er sich nicht beirren lassen würde.
»Sie werden sich nicht drücken und meinen Jungen nicht in irgendeine Klinik abschieben, die wir nicht kennen. Hier, hier sind wir zu Hause. Und hier ist die Kinderklinik Birkenhain, von der es heißt, daß auch schwierigste Fälle dort erfolgreich behandelt worden sind. Sie werden Jörgs Finger also wieder annähen und…«
»Das werden wir ganz gewiß nicht tun, Herr Markmann. Wir werden Jörg mit dem Hubschrauber in die Spezialklinik fliegen lassen und…«
»Ich sagte nein. Und dabei bleibt es auch.«
Markmann verließ die Küche. Hanna wandte sich an Martin Schriewers, nickte ihm zu und sagte beherrscht:
»Funken Sie, Martin. Wir müssen endlich zum Zuge kommen.«
»Wird gemacht, Frau Doktor.« Martin öffnete die Küchentür, die sich hinter Markmann geschlossen hatte und prallte entsetzt zurück.
Da stand Achim Markmann. Er hatte seine Dienstpistole in der Hand. Es knackte leise, als er sie jetzt entsicherte.
»Sie haben den Jungen, und Sie haben die abgeschnittenen Finger. Mehr brauchen Sie nicht. Sie haben angeblich einen der modernsten Operationsräume in der Kinderklinik. Also werden Sie meinem Jungen auch dort helfen. Sie brauchen nichts zu sagen. Ich bin zu allem entschlossen, wenn Sie nicht das tun, was ich von Ihnen verlange.«
Hannas Augen blitzten. Sie wäre am liebsten dazwischengefahren, aber sie wußte, daß sie damit nichts erreichen, daß sie vielleicht nur eine Katastrophe heraufbeschwören würde. Deshalb sagte sie beherrscht:
»Also los, Martin. Tun wir, was er sagt. Jörg muß in jedem Fall in eine Klinik, also dann nach Birkenhain.«
Markmann folgte Martin Schriewers nach draußen, holte mit ihm gemeinsam die Trage herein und sah zu, wie Hanna und Dr. Frerichs den Jungen auf die Trage legten und zudeckten. Dann nahmen Martin Schriewers und Dr. Frerichs die Trage und trugen sie mit dem Jungen darauf nach draußen.
Und jetzt schrie Maria Wichert auf, laut, entsetzt und auch erleichtert. Thea Markmann weinte laut auf, und die Leute draußen sprangen beiseite, als sie sahen, daß Achim Markmann mit grimmigem Gesicht und der im Anschlag haltenden Pistole folgte. Dann kam Hanna, und ihrem Gesicht konnte man nicht entnehmen, was sie dachte.
Sie zuckte nur zusammen, als Achim Markmann Dr. Frerichs, der hinten einsteigen wollte, zur Seite schob und knurrte:
»Gehen Sie nach vorn, Doktor. Frau Dr. Martens und ich bleiben bei Jörg. So weit ist die Fahrt ja auch nicht.«
»Bist du wahnsinnig, Mann?« fragte einer der Umstehenden und sah Markmann ärgerlich an. »Hast du keine Angst, daß das ein Nachspiel haben könnte? Immerhin ist das deine Dienstwaffe, Achim.«