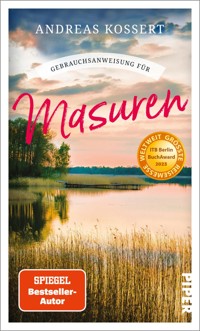5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ausgezeichnet mit dem NDR Kultur Sachbuchpreis als bestes Sachbuch des Jahres 2020, nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis 2021, prämiert mit dem Preis für „Das politische Buch“ 2021 der Friedrich-Ebert-Stiftung
Andreas Kossert, renommierter Experte zum Thema Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert und Autor des Bestsellers »Kalte Heimat«, stellt in diesem Buch die Flüchtlingsbewegung des frühen 21. Jahrhunderts in einen großen geschichtlichen Zusammenhang. Immer nah an den Einzelschicksalen und auf bewegende Weise zeigt Kossert, welche existenziellen Erfahrungen von Entwurzelung und Anfeindung mit dem Verlust der Heimat einhergehen - und warum es für Flüchtlinge und Vertriebene zu allen Zeiten so schwer ist, in der Fremde neue Wurzeln zu schlagen. Ob sie aus Ostpreußen, Syrien oder Indien flohen: Flüchtlinge sind Akteure der Weltgeschichte - Andreas Kossert gibt ihnen mit diesem Buch eine Stimme.
»Flucht« wurde mit dem NDR Kultur Sachbuchpreis 2020 und mit dem Preis für »Das politische Buch« 2021 der Friedrich-Ebert-Stiftung ausgezeichnet.
»Kossert zeigt auf, dass Flucht und Vertreibung nicht das Problem der anderen ist, sondern gerade auch in Deutschland tief verwoben ist mit der eigenen Familiengeschichte.« (Aus der Begründung der NDR-Sachbuchpreis-Jury)
- »In diesem wichtigen, brillant erzählten Buch zeichnet Andreas Kossert das bedrückende Panorama eines jahrhundertealten und zugleich höchst aktuellen Menschheitsdramas. Er beleuchtet die Anatomie eines Massenphänomens. Doch im Zentrum stehen die einzelnen Flüchtlinge, ihre Schicksale und Zeugnisse. Das Buch für unsere Zeit!« (Christopher Clark)
- »Ein Buch, das einen nicht kalt lässt...Ebenso brillant geschrieben wie komponiert.« (rbb kulturradio)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 628
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Ausgezeichnet mit dem NDR Kultur Sachbuchpreis als bestes Sachbuch des Jahres 2020, nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis 2021, prämiert mit dem Preis für „Das politische Buch“ 2021 der Friedrich-Ebert-Stiftung
Ob sie aus Ostpreußen, Syrien oder Indien flohen: Flüchtlinge sind Akteure der Weltgeschichte. Andreas Kossert, renommierter Historiker und Autor des Bestsellers »Kalte Heimat«, gibt ihnen mit diesem Buch eine Stimme. Anhand bewegender Einzelschicksale und im großen geschichtlichen Zusammenhang zeigt er die existenziellen Erfahrungen, die mit Flucht und Vertreibung einhergehen – von der Entwurzelung durch den Verlust der alten Heimat bis zu den Anfeindungen, denen Flüchtlinge in den Ankunftsländern häufig ausgesetzt sind. Unser Umgang mit ihnen spiegelt dabei oft auch die Ängste der Sesshaften wider, selber entwurzelt zu werden.
»Ein Buch, das einen nicht kalt lässt... Ebenso brillant geschrieben wie komponiert.«
RBB Kulturradio
»Man kann Andreas Kosserts Buch nicht genug loben. Einfühlsam, klug und mit deutlich erkennbarer Haltung geschrieben, lässt es doch nie die Distanz des Historikers zu seinem Stoff vermissen. Man wünscht ihm sehr viele Leser, gerade in einem Land wie Deutschland.«
Süddeutsche Zeitung
ANDREAS KOSSERT, geboren 1970, studierte Geschichte, Slawistik und Politik. Der promovierte Historiker arbeitete am Deutschen Historischen Institut in Warschau und lebt seit 2010 als Historiker und Autor in Berlin. Auf seine historischen Darstellungen Masurens (2001) und Ostpreußens (2005) erhielt er begeisterte Reaktionen. Zuletzt erschienen von ihm der Bestseller »Kalte Heimat. Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945« (2008), »Ostpreußen. Geschichte einer historischen Landschaft« (2014) sowie »Flucht – Eine Menschheitsgeschichte« (2020). Für seine Arbeit wurden ihm der Georg Dehio-Buchpreis 2008, der NDR Kultur Sachbuchpreis 2020 und der Preis für »Das politische Buch« 2021 der Friedrich-Ebert-Stiftung verliehen.
Andreas Kossert
FLUCHT
Eine Menschheitsgeschichte
Pantheon
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © dieser Ausgabe 2022 by Pantheon Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © 2020 by Siedler Verlag, MünchenUmschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagabbildung: Junge Flüchtlinge aus
osteuropäischen Regionen und ihr Gepäck, 24. Juni 1949
© Theo Scheerer/Vintage Germany
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-20616-1V006www.pantheon-verlag.de
Für meine Mutter Lieselotte (1944–2018)
Inhalt
JEDER KANN MORGEN EIN FLÜCHTLING SEIN
Vom Refugié zum Flüchtling in der Moderne – eine Begriffsklärung
Die endlose Geschichte der Flucht
HEIMAT. VON DEN AMBIVALENZEN EINES GEFÜHLS
Weggehen
Ankommen
Weiterleben
Erinnern
Wann ist man angekommen?
WAS WAR, ENDET NICHT
ANHANG
Dank
Anmerkungen
Literatur
Personenregister
FremdenfeindlichAls Millionen Vertriebenemit wenig Gepäckund lastender Erinnerungim restlichen Vaterlandzwangseinquartiert wurden,riefen viele Heimische,die sich durch Zuzug beengt sahen:Geht hin, wo ihr hergekommen seid!
Aber sie blieben, und eingeübtblieb der Ruf: Haut endlich ab!bald galt er Fremden,die später, noch spätervon weither gereist kamenund unverständlich sprachen;sie blieben gleichfallsund vermehrten sich seßhaft.
Erst als die immer schon Heimischensich fremd genug waren,begannen auch siein all den Fremden,die mühsam gelernt hatten,ihr Fremdsein zu ertragen,sich selbst zu erkennenund mit ihnen zu leben.
GÜNTER GRASS, Vonne Endlichkait
»21.1.45 Befehl zum Verlassen meines Hofes«, mit diesem Eintrag beginnt der Bericht, den der Bauer Friedrich Biella während der Flucht aus Masuren verfasst. Es ist das Dokument eines Abschieds von allem, was sein Leben bis dahin ausgemacht hatte.
© Kossert, Andreas
Am frühen Morgen des 21. Januar 1945 bricht Friedrich Biella mit seiner Familie und zwei Pferdewagen aus einem kleinen Dorf in Masuren auf. In seinem Notizbuch steht für diesen Tag der knappe Eintrag »Befehl zum Verlassen meines Hofes«. Ungelenk formuliert, kündigt der Bauer in diesem Moment den ungeschriebenen Generationenvertrag mit seinen Vorfahren. Er muss alles zurücklassen, was gestern noch wichtig war, Land und Hof, Einrichtung und Erinnerungen – und auch die Tiere. »Unsere Hündin ›Senta‹ hat uns ein Stück Weges begleitet. Je weiter wir uns vom Dorf entfernten, wurde sie immer unsicherer. Sie ist dann schließlich auf unser Anraten wieder nach Haus gelaufen.«
Weil die Anstrengungen der Flucht alle Kräfte binden, setzen die Aufzeichnungen erst Ende März 1945 wieder ein, als Friedrich Biella nach einer Odyssee durch Ostpreußen und über das vereiste Frische Haff, durch Hinterpommern, über die Oder und schließlich durch Mecklenburg im Herzogtum Lauenburg strandet. Nach Kriegsende fragt er Woche für Woche bei der britischen Militärkommandantur nach, wann er zurückkehren könne. Dort vertröstet man den alten Mann. In seinem Notizbuch verzeichnet er die stets gleichlautende Antwort: »Mit der Rückfahrt noch warten.« Sein Leben in der Britischen Zone, zwangseinquartiert bei fremden Menschen, erträgt der Bauer nur schwer.
Im Dezember 1946 steht das zweite Weihnachtsfest in der Fremde vor der Tür. Seine Frau Luise sorgt sich um die Kinder und Enkelkinder, die verstreut über die Besatzungszonen leben. Friedrich Biella schreibt am 21. Dezember 1946 an seine jüngste Tochter Lotte, die mit ihren vier kleinen Kindern Obdach im Raum Hannover gefunden hat. »Meine lieben Kinder alle! Ich will Euch auch einmal einen kleinen Brief aus unserem Asyl schreiben«, beginnt er. »Wie lange dieser Zustand noch dauern wird, wissen wir alle nicht.« Die große Familie kann nicht zusammenkommen, und das bedrückt den alten Mann. Er selbst und seine Frau sind wenigstens auf dem Land untergekommen, wo sie in der kalten Jahreszeit heizen können. »Wir machen uns viele Sorgen um Euch alle, jetzt vor allen Dingen wegen des Brennmaterials, wir auf dem Lande können noch etwas besorgen, aber die in den Städten sind sehr schlimm dran.« Da er aus der Ferne nicht helfen kann, muss er sich auf Weihnachtsgrüße an die Tochter und die Enkelkinder beschränken. »Weihnachten verlebt dieses Jahr, wie es uns die Verhältnisse gestatten, und Dir, mein Lottchen, schicke ich als Weihnachtsmann diese Kleinigkeit, mög es Dir gut zu statten kommen. Wenn Eure Zeit es gestattet, so laßt von Euch hören, denn jedes Briefchen von Euch erfreut uns beide sehr. Und nun lebt recht herzlich wohl, alle meine lieben Kinder, und seid alle geherzt und geküßt von Euren alten Eltern.«
Im folgenden Jahr schwinden Friedrich Biellas Kräfte. Es weiß nun, dass es sinnlos ist, bei der Kommandantur nachzufragen, denn eine Rückkehr in die masurische Heimat ist unmöglich. Im Winter stirbt er mit 73 Jahren an Heimweh.1 Für Friedrich Biella aus Masuren erfüllt sich sein größter Wunsch, die Rückkehr in die Heimat, nicht mehr. In der Weltchronik über das Fliehen steht seine Geschichte für Abermillionen ähnlicher Schicksale.
Flüchtlinge, ganz gleich, ob es sich um Fremde oder Landsleute handelt, sind gewöhnlich nicht willkommen. Daran hat sich im Laufe der Jahrhunderte nichts geändert. Im August 2019 ist an der Eingangstür des Mayhill Convenience Store im US-Bundesstaat New Mexico ein Schild angebracht mit der Aufschrift »Illegal Immigrants NOT Welcome Here«. 2014 fordern Dresdener Demonstranten auf Plakaten »Bitte weiterflüchten«, und britische Rechtsextreme halten Banner mit der Aufschrift »Refugees go home« in die Höhe. Noch deutlicher lassen sich das Unverständnis und die Ignoranz in den Aufnahmegesellschaften nicht zum Ausdruck bringen. Flüchtlinge können nicht einfach weiterflüchten, und sie würden nichts lieber tun, als nach Hause zurückkehren, aber genau das können sie nicht. Wo auch immer sie stranden, sie stören. Auf die Sesshaften wirken sie wie Heuschreckenschwärme, die über ihre geordnete Welt herfallen und abgewehrt werden müssen. Nicht selten werden sie als Illegale und Asoziale beschimpft.
»Wie müde sie aussehen, wie erhitzt sie sind«, wiederholten die Leute, aber keiner kam auf den Gedanken, seine Tür zu öffnen, einen dieser Unglücklichen zu sich einzuladen, ihn in eines jener kleinen schattigen Paradiese zu bitten, die hinter dem Haus zu erahnen waren, mit einer Holzbank unter einer Laube, Johannisbeersträuchern und Rosen. Es gab zu viele Flüchtlinge … Das schreckte die Nächstenliebe ab. Diese jammervolle Menge hatte nichts Menschliches mehr; sie ähnelte einer fliehenden Herde.2
Es ist kein Zufall, dass diesen Zeilen nicht zu entnehmen ist, um welches Land, welche Zeit und welche Flüchtlinge es sich handelt. Die unzähligen Geschichten von Flucht vor Gewalt und Krieg ähneln sich so sehr, dass sie zu einer einzigen großen zu verschmelzen scheinen. In diesem Fall beschreibt Irène Némirovsky in ihrem Roman Suite française, wie französische Flüchtlinge im Sommer 1940 vor der deutschen Wehrmacht fliehen. Ihnen ergeht es nicht viel anders als dem ostpreußischen Jungen Olaf, der 1945 im bayerischen Chiemgau um Lebensmittel bettelt. »Verschwind’s, damisches Gesindel!«, rufen Bauern hinter ihm her und lassen die Hunde von der Kette. »Hinaus mit den Flüchtlingen aus unserem Dorf! Gebt ihnen die Peitsche statt Unterkunft – dem Sudetengesindel! Es lebe unser Bayernland!«, fordern Bayern auf einem anonymen Plakat. Im Raum Hannover schimpfen Einheimische: »Die Zigeuner aus dem Osten verpesten unser Land.« Und auf einem Bauernhof im Münsterland muss eine junge westpreußische Vertriebene mit anhören, was man über sie sagt: »Dieses dämliche Stückchen Polackenscheiße dachte, wir würden die alten Polacken aufnehmen.«3 Die Millionen deutschen Landsleute aus Ostpreußen, Böhmen oder Schlesien sind jenseits von Oder und Neiße einfach nur die Flüchtlinge, und sie sind keineswegs willkommen, sondern werden als bedrohliche Störung empfunden.
Ebenso ergeht es den Menschen aus Syrien, aus Afghanistan oder den Staaten Afrikas, die heute nach Europa kommen. Wer sich für sie einsetzt, läuft Gefahr, als »Gutmensch« verhöhnt zu werden. Zynische Politiker scheuen sich nicht, die Schutzsuchenden herabzusetzen. Matteo Salvini etwa bezeichnete 2018, als er noch italienischer Innenminister war, aus Seenot gerettete Flüchtlinge und Migranten als »Ladung Menschenfleisch«, und US-Präsident Donald Trump schmäht Immigranten ohne Papiere als »Tiere«, als »Mörder und Diebe«, die »unser Land infizieren«.4 Solchen Worten, das lehrt die Geschichte, drohen mörderische Taten zu folgen. Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke appelliert auf dem Höhepunkt der »Flüchtlingskrise« 2015 an das Mitgefühl seiner Landsleute und wird vier Jahre später von Rechtsextremisten auf der Terrasse seines Hauses hinterhältig ermordet.
Ob aus Syrien, aus Schlesien oder aus Myanmar, die Flüchtlinge sind eine beliebte Projektionsfläche für jene, die Angst haben, ins Hintertreffen zu geraten, die ihre Sicherheit bedroht sehen. Das individuelle Schicksal zählt nicht. Der Flüchtling, der ein Gesicht, einen Namen und eine persönliche Geschichte hat, wird nicht als Individuum wahrgenommen, sondern ausschließlich als Repräsentant eines anonymen Kollektivs. Was die Mitglieder dieses Kollektivs empfinden, hat die Syrerin Vinda Gouma beschrieben:
Versuchen Sie zu erraten, wer ich bin! Ich bin mehr in den Medien als Donald Trump und seine Tweets, Erdogan und seine Demokratie, Putin und seine Politik. Ich war der Hauptgrund für das Scheitern der Regierungsbildung in Deutschland und für das Erstarken der Rechten in Europa. Ich bin die große Sorge vieler Bürger in diesem Land, denn ich bin gefährlicher als Altersarmut, Misshandlungen in den Familien, Umweltverschmutzung, Drogenkonsum, Klimawandel, Mangel an Pflegekräften und Erziehern. Ich bin derjenige, der sich immer schuldig fühlt für die Fehler anderer Menschen. Ich bin derjenige, der sich immer schämt, Nachbarn zu begrüßen, wenn wieder irgendwo etwas passiert. Ich hafte für die Fehler jedes einzelnen und fühle mich bedroht von jedem Bericht in den Medien. Habt ihr mich erkannt? Ich bin die Flüchtlinge! Und es ist kein grammatikalischer Fehler aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse. Ich bin die Flüchtlinge! Und zwar alle Flüchtlinge. Ich bin kein Arzt, kein Jurist, weder Bauer noch Journalist, kein Künstler, kein Verkäufer, weder Taxifahrer noch Lehrer, sondern die Flüchtlinge. Obwohl ich auch aus einer kleinen Stadt in Syrien komme und für mich die Leute in Damaskus schon fremd waren, bin ich, seitdem ich in Europa bin, einer von Hunderttausenden Flüchtlingen aus Syrien, Pakistan, Afghanistan, Irak, Iran und Afrika. Obwohl wir unterschiedliche Sprachen sprechen, verschiedene Religionen und Vergangenheiten haben, geschweige denn Weltansichten und Meinungen. Aber wen interessieren solche Unterschiede, wir sind am Ende alle die Flüchtlinge. Ich habe durch den Krieg Freunde und Verwandte verloren, Wohnung, Job, Auto, meine Vergangenheit und meine Heimat. Aber ein Verlust, den ich erst später gespürt habe, ist meine Individualität, die ich am Schlauchboot an den Grenzen Europas zurückgelassen habe.5
Wie die Juristin aus Syrien empfinden Tausende ihrer Landsleute, die ein friedliches und bürgerliches Leben in ihrer Heimat führten, bis dort nach dem Arabischen Frühling 2011 der Bürgerkrieg ausbrach. Nie hatten sie gedacht, dass sie Syrien einmal verlassen, als mittellose Flüchtlinge irgendwo in der Fremde stranden würden.
Sabria Khalaf ist bereits 107 Jahre alt, als sie 2013 ihre syrische Heimat verlässt. Ihre Muttersprache ist Aramäisch, einst Lingua franca im Nahen Osten und Sprache Jesu. Gemeinsam mit ihrem Sohn Kanal flieht die jesidische Kurdin vor dem Terror des sogenannten Islamischen Staates in die Türkei und weiter in einem Boot über die Ägäis nach Athen. Vier Tage treiben sie auf dem Meer, bis die griechische Küstenwache sie Ende Dezember rettet. Sabria Khalaf möchte nach Deutschland, weil dort bereits die übrige Familie lebt. Sie hofft, es noch »rechtzeitig« zu schaffen. »Zwei Tage bei meiner Familie, und ich kann ruhig sterben.« Doch 2014 gestaltet sich die Einreise schwierig, und so harrt die greise Frau in der Hoffnung, ihre Familie noch einmal wiederzusehen, wie Tausende andere in einem ärmlichen Athener Obdach aus.6
»Wisst ihr denn nicht, dass sich hinter diesen ›Zahlen‹ Menschen verbergen?«, fragt die israelische Premierministerin Golda Meir noch Jahre nach der Konferenz von Évian resigniert, wo auf Initiative des US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt Vertreter von 32 Staaten und 24 Hilfsorganisationen im Sommer 1938 über die Aufnahme jüdischer Flüchtlinge aus Deutschland und dem angeschlossenen Österreich verhandelten. Doch bis auf die USA zeigte sich dort kaum ein Land bereit, jüdische Flüchtlinge aufzunehmen.7Die Flüchtlinge, diese gesichtslose Masse, erweckt kein Mitgefühl, vielmehr strahlt sie etwas Apokalyptisches aus und wird mit entsprechenden Metaphern aus der Natur charakterisiert: Flut, Lawine, Welle oder Strom. Die Flüchtlinge werden so zu einer Art Naturkatastrophe. »Köln versinkt in Flüchtlingsflut«, titelt Deutschlands größte Boulevardzeitung im Frühjahr 2015.8 Gegen eine derartige Flut kann man sich nur schützen, wenn man ausreichend hohe Dämme errichtet.
Als 2015 die »Flüchtlingswelle« über Deutschland hereinbricht, stehen Tausende auf den Bahnhöfen und heißen die Fremden willkommen. Millionen Deutsche kennen das Flüchtlingsschicksal aus der eigenen Familie oder sind sogar selbst Flüchtlinge gewesen. Die kollektive Fluchterfahrung prägt das Land weit mehr als viele andere Staaten und weit mehr, als es auf den ersten Blick sichtbar ist. Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird offenbar: Flüchtlinge verändern Gesellschaften.
Der gebürtige Danziger Rupert Neudeck, Gründer der Hilfsorganisation »Cap Anamur« zur Rettung vietnamesischer Boatpeople, führt sein Engagement ausdrücklich auf eigene Erlebnisse zurück. »Die Bilder von damals«, schreibt Neudeck über seine Flucht 1945 aus Danzig, »blieben in mir gespeichert, prägten mein weiteres Leben – und machten mir etwas sehr Wichtiges klar: Eigentlich haben die meisten Menschen einen Hintergrund, der mit Migration und Flucht zu tun hat. Und auch wer zu wissen meint, dass seine Familie schon immer da war, wo er jetzt lebt, sollte sich nicht so sicher fühlen. Es könnte durchaus sein, dass es ihn oder seine Nachkommen in Zukunft doch noch erwischt. Denn in uns allen steckt ein Flüchtling.«9
Anders als Rupert Neudeck betrachtet der eine oder andere Bundesbürger Flucht und Vertreibung der Deutschen nach 1945 immer noch als exklusives historisches Ereignis, weshalb sich der Vergleich mit anderen Fluchterfahrungen verbiete. Man unterscheidet zwischen »guten« Flüchtlingen, das sind jene, die der eigenen ethnischen Gruppe angehören, und »schlechten«, das sind alle anderen. Obwohl man über diese anderen meist nur sehr wenig weiß, ist man davon überzeugt, dass ein Teil von ihnen gar nichts erlitten habe, sondern nur ein besseres Leben suche. Dann wird Afghanistan schon einmal zum sicheren Herkunftsland erklärt, obwohl man selbst nie in das Land reisen würde, eben weil das Leben dort gefährlich ist.
»Auf die Flucht gehen«, hinter dieser Wendung verbirgt sich ein ungeheuerlicher Vorgang, der das gewöhnliche Vorstellungsvermögen sprengt. Die Fantasie reicht nicht aus, sich vorzustellen, wie es ist, alles zu verlieren. Flucht ist kein Abenteuer. Was zurückgelassen wird, ist für immer verloren. Im Augenblick des Aufbruchs macht sich dennoch kaum jemand klar, dass die Flucht ein Abschied für immer sein könnte. Was fühlt ein Bauer, wenn er sein Vieh zurücklassen muss, das seine Lebensgrundlage war, was bedeutet es für einen alten Menschen, ein letztes Mal sein Haus zu sehen oder gar Nachbarn und Angehörigen Lebewohl sagen zu müssen?
Obwohl Ursachen und Verhältnisse, die Menschen zur Flucht bewegen, sehr unterschiedlich sein können, ähneln sich die konkreten Erfahrungen der Flüchtlinge oft sehr. Jeder muss entscheiden: Was nehme ich mit auf die Flucht? Wie viel kann ich tragen, wenn ich zu Fuß unterwegs bin? Soll ich Wertsachen, Fotos, Schmuck und Dokumente einpacken oder besser Verpflegung für die kommenden Tage? Flucht ist eine Zäsur, die Aufkündigung einer ungeschriebenen und über Generationen gültigen Übereinkunft mit den Vorfahren. Denn alles, was auf Erbrecht fußt, gilt plötzlich nicht mehr. Testamente und Investitionen in die Zukunft, Grund und Boden, Sparbücher – im Moment der Flucht versinkt alles in Bedeutungslosigkeit. Wer flieht, muss seine Immobilien und große Teile seines übrigen materiellen Besitzes zurücklassen – und nicht zuletzt die Toten. Friedhöfe liegen verwaist, die Gräber wachsen zu. Niemand kommt mehr, um sie zu pflegen. Was bedeutet es für Alte, ihre Kinder auf die Flucht zu schicken und alleine zurückzubleiben?
1933 erhebt das nationalsozialistische Deutschland den Terror gegen Minderheiten zur Staatsräson. Deshalb sind Deutsche zunächst vor allem Vertreiber und diejenigen, die millionenfach Flucht, Vertreibung und Massenmord verantworten. Die Maßnahmen treffen alle, die nach rassistischen und politischen Kriterien nicht zur Volksgemeinschaft gehören, an erster Stelle die Juden.
Judith Kerr beschreibt in ihrem autobiographischen Roman Als Hitler das rosa Kaninchen stahl die Flucht aus der Perspektive eines neunjährigen Mädchens. Die kleine Anna muss mit ihren Eltern kurz vor der sogenannten Machtergreifung Anfang 1933 aus Berlin in die Schweiz flüchten. Zurück bleibt – die Chiffre für Flucht im Kinderbuch überhaupt – ihr rosafarbenes Kaninchen, das mit dem Familienbesitz von den NS-Machthabern beschlagnahmt wird.10 Judith Kerrs Stofftier und ihre Geschichte gehören zur Erzählung von Entwurzelung und Heimatverlust, denn das »Wort Heimatvertreibung bekommt einen anderen, besseren Sinn«, so der Schriftsteller Heinrich Böll über die deutsche Erzählung, »wenn man deren Beginn auf 1933 festsetzt«.11
Diese Sichtweise auf die Ereignisse nach 1933 ist für viele Deutsche allerdings nur schwer zu akzeptieren. Sie trennt auch den Verleger Kurt Wolff und seine Tochter. Maria und ihr Bruder Niko sind Wolffs Kinder aus erster Ehe, die im nationalsozialistischen Deutschland bei ihrer Mutter zurückbleiben, während er, der linksliberale Intellektuelle jüdischer Herkunft, gemeinsam mit seiner zweiten Frau Helen fliehen muss. Zu seinen Autoren gehörten Franz Kafka, Franz Werfel oder Heinrich Mann, deren Werke seit 1933 aus Deutschland verbannt sind. Nach jahrelanger Odyssee trifft das Ehepaar Wolff 1941 in den USA ein. Im März 1946 nehmen Vater und Tochter einen Briefwechsel auf, in dem sich zwei Perspektiven auf die nationalsozialistische Gewaltherrschaft manifestieren und damit auf die Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg. Maria beklagt sich bei ihrem im Exil lebenden Vater über die »Bitternis der letzten 12 Jahre«, wobei sie insbesondere die alliierten Bombenangriffe im Blick hat. Er antwortet in wohl abgewägten Worten, bemüht, seine Tochter nicht zu verletzen und ihr dennoch die Bedrängnisse von Verfolgten aus seiner Sicht klar vor Augen zu führen.
»In Frankreich bin ich vielen Opfern der deutschen Concentrationslager begegnet, Menschen mit zerschlagenen Knochen, Männer, die man entmannt hatte, zu physischen und psychischen Ruinen gemacht. Ich war in Frankreich während des Krieges bis 1941. Und als Euch die lieben deutschen Soldaten aus Paris seidene Strümpfe und Schokolade schickten oder mitbrachten, wurden die flüchtenden französischen Civilisten auf den Landstrassen« von deutschen Tieffliegern beschossen, »und ich, Dein Vater, flüchtete angsterfüllten Herzens zu Fuss in tagelangen Märschen, zerlumpt und gehetzt, um denselben lieben deutschen Soldaten nicht in die Hände zu fallen. (…) O Maria, Du beschreibst die Hölle der Jahre 1944/45. Wo war Euer Gewissen 1939 bis 1943? Warschau, Rotterdam, London, Coventry, Lidice, die Extermination von Hunderttausenden von Polen, Tschechen, Juden, Russen hat Euch nicht den Schlaf geraubt.«12
Kurt Wolff hält seiner Tochter stellvertretend für die Deutschen den Spiegel vor. Doch nicht einmal das Kind eines bereits 1933 geflohenen Mannes vermag sich ohne Hilfestellung in dessen Perspektive und Erfahrungen hineinzuversetzen.
Auch heute fällt es vielen immer noch schwer, sich in eigentlich naheliegende Erfahrungen einzufühlen. Wer heute auf Transparenten »Bitte weiterflüchten« fordert, weiß offensichtlich gar nicht, dass viele in der Generation der Eltern und Großeltern nach 1945 Zuflucht suchen mussten und auf Ablehnung stießen.
Nach Kriegsende, als in der Folge des Zweiten Weltkriegs vierzehn Millionen vertriebene Deutsche bei Deutschen eine Bleibe suchen, herrscht keine Willkommenskultur. Obwohl die Ostpreußen, Pommern, Schlesier, die Flüchtlinge aus der Batschka oder vom Schwarzen Meer eigentlich Landsleute sind, gelten sie im Westen als Fremde. Für die meisten Zeitgenossen kommen mitnichten Deutsche zu Deutschen, denn auch wenn man dieselbe Sprache spricht, gibt es doch große Unterschiede in den kulturellen, konfessionellen und mentalen Prägungen. Diese Unterschiede, die damals zu Spannungen führten, sind längst eingeebnet, was zeigt, wie sehr sich unsere Vorstellungen von Fremdheit im Laufe der Zeit verändert haben.
Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind Menschen mit anderen und doch in vielem sehr ähnlichen Fluchtbiographien in Deutschland eingetroffen – aus Ungarn, Vietnam, aus der Türkei, aus Burundi oder der Sowjetunion. »Die existentielle Erfahrung eines Heimatverlustes ist Flüchtlingen auf der ganzen Welt gemein«, bringt es Bundespräsident Joachim Gauck 2016 auf den Punkt, »die tiefe Prägung durch eine häufig traumatische Flucht, die Trauer um das Verlorene, das Fremdsein im Ankunftsland, die Zerrissenheit zwischen dem Nicht-mehr-dort- und Noch-nicht-hier-Sein.«13
Im Mittelpunkt dieses Buches stehen Flüchtlinge, die aufgrund nationaler, religiöser oder ethnischer Verfolgung ihre Heimat verlieren. Um eine Vielzahl von Stimmen einzufangen, lasse ich sie möglichst oft selbst zu Wort kommen, und zwar nicht gebündelt zu kulturellen oder politischen Gruppen, zwischen denen Hierarchien oder Konkurrenzen konstruiert werden, sondern als Individuen. Auf diese Weise suche ich die bislang dominierende Erzählung sesshafter Gesellschaften zu überwinden, vor allem die der Täter, die Menschen überhaupt erst zu Flüchtlingen machen. Nicht die Verantwortlichen und deren Absichten, nicht ihre Zahlenspiele und Statistiken stehen hier im Zentrum, sondern die Leidtragenden ihrer Entscheidungen.
Es geht um die Frage: Was bedeutet es für einen Menschen, Heimat für immer zu verlieren, unter Zwang und Gewalt fliehen zu müssen und am Ende im Exil zu leben? Wie lange währt nach dem Ankommen der transitorische Zustand im Exil, und ist er überhaupt zu überwinden? Heimatverlust ist für jeden Betroffenen eine fundamentale Zäsur, die das Leben in ein Davor und ein Danach teilt. Aus der Perspektive von Flüchtlingen zu erzählen, bedeutet, die Weltgeschichte anders zu sehen.
Der Schwerpunkt meiner Erzählung liegt auf Europa und dem Nahen Osten. Dabei öffne ich den Blick immer wieder für andere globale Erfahrungen, denn außerhalb Europas ereignen sich gestern wie heute die großen Flüchtlingsdramen der Menschheitsgeschichte. Es wird erzählt von Individuen im Massenphänomen Flucht, von Ängsten, Träumen und Hoffnungen. Es geht nicht um Schuldzuweisungen, weder gegen Staaten und Völker noch gegen Individuen, sondern vielmehr darum, Erfahrungszusammenhänge herauszuarbeiten.
Die Betroffenen erzählen immer nur ihre jeweils eigene Geschichte, jede ist nur ein Fragment vom großen Ganzen, und vielfach haben ihre Darstellungen etwas Unversöhnliches. Sie offenbaren Widersprüche, Ressentiments und innere Konflikte, aber zugleich sind die Identitäten der Erzähler steten Prozessen und im Verlauf der Ereignisse – vor allem durch die Zäsur des Heimatverlusts – Veränderungen unterworfen. Dabei zeigt sich, dass Flüchtlinge in ihrer Bedrängnis und in ihrer Angst geradezu erstaunliche Fähigkeiten entwickeln, sich auf neue Umstände einzustellen. Flüchtlinge auf die Rolle des Opfers zu reduzieren, hieße, ihnen Handlungs- und Entscheidungsspielräume abzusprechen.
Für meine Kernbotschaft greife ich auf unterschiedliche Quellen zurück: Tagebücher, Erinnerungen und Autobiographien von Flüchtlingen und ihren Nachfahren als Zeitzeugen, aber auch auf Reportagen von aktuellen Brennpunkten über Menschen auf der Flucht. Historiker verzichten meist auf Belletristik als Quelle, was bei diesem Thema zu bedauern ist, da die literarische Überlieferung gerade zum Heimatverlust viel zum Erkenntnisgewinn beitragen kann, denn viele Autoren verfügen über biographische Erfahrungen zum Thema Flucht und verarbeiten Erlebtes in ihren Werken. Künstler bleiben in ihrer Identität zwischen Realität und Kunst zerrissen, das ist die Grundlage ihrer kreativen Existenz. Doch gerade deshalb vermag die Literatur als Seismograph der leisen Zwischentöne zu wirken, die bei einem derartig emotionalen Sujet ansonsten kaum gehört werden.
Ich beziehe die Belletristik – wie auch die kraftvolle Stimme der Poesie – daher bewusst in die Erzählung ein. Sämtliche hier verwendeten Quellen von Betroffenen spiegeln jene Vielfalt der Stimmen wider, die alle ihre Version der Wahrheit erzählen. Diese Wahrheit kann aber ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. Vielfach ergreifen Betroffene Partei oder werden zur Verbreitung gewisser Botschaften benutzt. Jede Quelle – ob aus Zeitzeugnissen oder aus der Belletristik – gibt immer nur einen Blick wieder, der niemals allgemeingültig sein kann. Aber viele Perspektiven gemeinsam vermitteln eine Ahnung von dem, was das Gesamtgeschehen ausmacht. Mitunter entstehen auch Ungleichgewichte, weil die Quellen gewöhnlich der Feder gebildeter Protagonisten entstammen, die ihr Schicksal reflektieren. Die meisten – unerzählten – Fluchtgeschichten erleben jedoch Menschen, von denen nicht einmal der Name überliefert ist.
Wenn ich kollektive Zuschreibungen wie Deutsche, Griechen oder Armenier übernehme, muss bedacht werden, dass sich dahinter einerseits individuelle und vor allem in höchstem Maße unterschiedliche Identitäten verbergen können, Individuen andererseits als Teile einer Gemeinschaft aber immer auch über kollektive Identitäten verfügen, die sie mit einer größeren Wir-Gruppe verbinden. Ich danke daher allen, die ihre oft dramatischen Erfahrungen vom Fliehen aufgeschrieben und mir oder anderen Menschen anvertraut haben, denn sie haben dieses Buch überhaupt erst möglich gemacht. Ihre Geschichten sind unschätzbar wertvoll, und ich hoffe, dass ich sie mit dem Respekt wiedergegeben habe, den sie verdienen. Jede von ihnen erzählt von der globalen Katastrophe der Flucht.
Mein Dank gilt überdies den Kolleginnen und Kollegen in aller Welt, deren wichtige und zum Teil bahnbrechende Studien sowohl die Universalität als auch die bestürzende Aktualität des Flüchtlingsthemas unterstreichen. Bei dem umstrittenen Thema bleibt es nicht aus, dass ich Protagonisten heranziehe, deren Meinung ich nicht teile, auf deren Geschichten ich aber nicht verzichten kann, wenn ich der Pluralität der Stimmen und den unterschiedlichsten, auch den unversöhnlichsten Perspektiven gerecht werden will.14Doch selbst wenn vieles erzählt wird, kann es niemals alles sein. Was ich nicht erwähne, ist immer mitgedacht und zumindest in den Kernaussagen enthalten.
Die Heimat für immer zu verlieren, unter Zwang und Gewalt fliehen zu müssen und am Ende im Exil zu leben, was das bedeutet, davon haben manche Gesellschaften nicht einmal die geringste Vorstellung. In Island etwa fehlt der entsprechende Erfahrungshintergrund vollkommen, da seine Bewohner – zu ihrem Glück – nie fliehen mussten. Eine Ostpreußin, die es dorthin verschlug, hat das erfahren, als sie »von der Flucht« erzählte. »Wohl hörte man ihr interessiert zu, aber dann kam die Frage: ›Ja, wurden eure Möbel denn nachgeschickt?‹«15
Auf derartig rührende Ahnungslosigkeit treffen Flüchtlinge in der Regel nicht. Viel weiter verbreitet ist der Verdacht, dass sie irgendetwas auf dem Kerbholz haben, denn »wer eine ehrliche Weste hat, wird nicht vertrieben«. Dass man sie für Diebe oder Kleinkriminelle auf der Flucht vor der Polizei hält, ist gerade für politische Flüchtlinge, die ihren Schergen entkommen sind, schwer zu ertragen. Oft haben sie in ihrer Heimat für bessere Verhältnisse gekämpft und leiden besonders unter dem Exil. Aber ganz gleich, aus welchen Gründen sich jemand auf die Flucht begibt, der Verlust der Heimat wiegt immer schwer.
Der kubanische Schriftsteller Reinaldo Arenas, der als politischer Dissident das Land seiner Geburt verlassen muss, schreibt, »daß es für einen Verbannten keinen Ort auf der Erde gibt, wo er leben kann«. Für die Heimat gebe es keinen Ersatz, »weil der Ort, wo wir geträumt, wo wir eine Landschaft entdeckt, das erste Buch gelesen und das erste Liebesabenteuer gehabt haben, immer das Land unserer Träume bleiben wird«. Im Exil sei er nur noch ein Gespenst, nicht mehr als ein Schatten, der vor sich selbst flieht.16 Und André Aciman, der aus einer jüdischen Familie in Alexandria stammt und seine ägyptische Heimat als Kind verlassen musste, meint, was das Exil zu einer derartig tückischen Angelegenheit mache, sei »weniger die Tatsache, weg zu sein, als vielmehr die Unmöglichkeit, jemals nicht weg zu sein – nicht allein abwesend zu sein, sondern sich niemals von dieser Abwesenheit befreien zu können«.17 Die verlorene Heimat ist stets da, ob Flüchtlinge das wollen oder nicht. »Im Verschwinden kleiner Dinge las ich Zeichen meiner eigenen Entwurzelung, meiner eigenen Vergänglichkeit«, so André Aciman weiter. »Ein Exilant liest Veränderung ebenso wie Zeit, Erinnerung, Liebe, Angst, Schönheit stets im Zeichen des Verlusts.«18 Nichts fürchte er mehr, als dass der Boden des Exils ihm verweigert, wieder Wurzeln zu schlagen.
Im Ankunftsland haben die, die schon da sind, die Deutungshoheit, sie allein definieren die kulturellen und sozialen Normen. Die Flüchtlinge begreifen sie nur zu oft als Bedrohung, denn sie stellen diese Besitzstände und Hierarchien infrage, und zwar nicht aus Überzeugung, sondern weil sie häufig mit der Kultur, der Sprache und der Religion der Aufnahmegesellschaft nicht vertraut sind. Zuweilen wird schon ihre bloße Anwesenheit als bedrohlich wahrgenommen. Flüchtlinge stehen am Rand und müssen um Einlass bitten, und dennoch sind sie nicht nur Spielball politischer Entscheidungen, die von Sesshaften getroffen werden, sondern als globales und Gesellschaften herausforderndes Phänomen zentraler Akteur der Moderne – heute mehr denn je.
Das Uneindeutige endet nicht mit der Flucht. Opfer können zuvor Täter gewesen sein und ebenso umgekehrt. Bei Vertreibungen zeigt sich nicht selten das Wechselspiel von Gewalt.19 Vertriebene bemühen sich energisch um die Anerkennung ihres Verlusts, insbesondere wenn sie als Interessenvertretung organisiert sind, und pochen auf ihren Opferstatus. Sie sind hilflose, manchmal ungelenke Versehrte und treten zugleich kraftmeierisch auf. Deutsche Vertriebene fordern von Polen und der Tschechischen Republik, die Vertreibung der Deutschen als Unrecht anzuerkennen, das Gleiche fordern Italiener von Slowenen und Kroaten, Polen von Ukrainern, Griechen von Türken, Krimtataren von Russen. Die Liste reicht bis in die jüngste Gegenwart, wie die juristischen Auseinandersetzungen in Myanmar zeigen, wo die muslimischen Rohingya von ihren buddhistischen Landsleuten vertrieben wurden. Flucht und Vertreibung sind oft das Ergebnis von Verstrickungen, von Fragen nach Schuld und Verantwortung, von Instrumentalisierungen oder einer Politik der Revanche, die Gesellschaften und Staaten spalten können. Es gilt, solchen Versuchungen möglichst souverän die Stirn zu bieten und vor allem die Spannungen und Widersprüche auszuhalten.
Geschichten vom erzwungenen Fortgehen, von den gefährlichen Fluchtrouten, vom Ankommen, von Heimweh, Anpassung, Schweigen, von Tabus und Traumata gibt es in allen Sprachen, Kulturen, Religionen und Weltanschauungen. Fremd zu sein ist eine Erfahrung, die Menschen auf der ganzen Welt und zu allen Zeiten gemacht haben und machen. Es ist ein Schicksal, das ihnen von anderen aufgezwungen wird. Der Flüchtling ist ein Entwurzelter, den der Schatten der Erinnerung niemals verlässt, der ihn manchmal sogar über den Tod hinaus begleitet, wie die Schriftstellerin Olga Tokarczuk aus der eigenen Familie zu berichten weiß: »In privaten Erinnerungen, in Familienerzählungen kehrt das Drama mit der Hartnäckigkeit eines Albtraums wieder – zerrissene Familienbande, verschollene Familienmitglieder, verbrannte Dokumente, eine unbestimmte Nostalgie nach den Geburtsorten, die Faszination von Gegenständen, die im Chaos dauerhafter zu sein scheinen als die Menschen und die Erinnerung an sie; das Gefühl der Fremdheit in einer Welt, die man sich erst und immer wieder zu Eigen machen muss, ihre Undurchschaubarkeit, und das Empfinden, Unrecht erlitten zu haben.«20
Was bedeutet es für einen Menschen, die Heimat für immer zu verlieren, unter Zwang und Gewalt fliehen zu müssen und am Ende im Exil zu leben? Dem polnischen Dichter Zbigniew Herbert erscheint seine verlorene Heimat Lemberg – das heutige ukrainische Lwiw und einst polnische Lwów – in dem Gedicht »Kraj« (Das Land) wie eine Traumwelt, die ihm durch Krieg und Nachkrieg genommen wird:
Im äußersten winkel der alten karte liegt das land, nach dem ich mich sehne. Es ist die heimat der äpfel, hügel, der trägen flüsse, des herben weines und der liebe. Leider hat eine riesige spinne darüber ihr netz gesponnen und mit klebrigem speichel die schranken der träume geschlossen. So ist es immer: der engel mit dem feuerschwert, die spinne, das gewissen.21
Das Heimweh von Zbigniew Herbert ist so unermesslich wie das jedes einzelnen Kareliers, Ukrainers, Darfuri, irakischen Juden, Inders oder Syrers im Exil. Indem sie ihre Geschichten erzählen, entsteht eine »Pluralität von Wahrheiten« über die erzwungene Entwurzelung. Trecks, Abschiebe- und Auffanglager, Massengräber, die Toten am Straßenrand sind keineswegs nur Erscheinungen aus dem Europa der Weltkriegsepoche,22 sondern universale Erfahrungen.
Sabria Khalaf und Vinda Gouma aus Syrien, Judith Kerr aus Berlin und Zbigniew Herbert aus Lemberg, Friedrich Biella aus Masuren, Rupert Neudeck aus Danzig, Reinaldo Arenas aus Havanna und André Aciman aus Alexandria – sie alle erzählen eine Geschichte, verleihen den Flüchtlingen eine Stimme. »Viele der Stimmlosen erzählen eigentlich die ganze Zeit. Sie sind laut, wenn du ihnen nur nah genug kommst, um sie zu hören, wenn du fähig bist zuzuhören und wenn du das spürst, was du nicht hören kannst«,23 sagt der Schriftsteller Viet Thanh Nguyen über die Flüchtlinge, zu denen auch er gehört. Es kann jeden treffen, deshalb gehen die Geschichten von Flucht und Vertreibung alle an.
Leider sahen wir noch genug der Armen vorbeiziehn,Konnten einzeln erfahren, wie bitter die schmerzliche Flucht sei,Und wie froh das Gefühl des eilig geretteten Lebens.Traurig war es zu sehn, die mannigfaltige Habe,Die ein Haus nur verbirgt, das wohlversehne, und die einGuter Wirt umher an die rechten Stellen gesetzt hat,Immer bereit zum Gebrauche, denn alles ist nötig und nützlich;Nun zu sehen das alles, auf mancherlei Wagen und KarrenDurch einander geladen, mit Übereilung geflüchtet.
JOHANN WOLFGANG GOETHE, Hermann und Dorothea
Vom Refugié zum Flüchtling in der Moderne – eine Begriffsklärung
Kaum hatte die Gesellschaft für deutsche Sprache und Dichtung »Flüchtling« zum Wort des Jahres 2015 gekürt, hagelte es Kritik. Manche plädieren dafür, »Flüchtling« durch »Geflüchtete« zu ersetzen, da »Flüchtling« zu niedlich, zu negativ, zu abwertend oder auch zu männlich wirke.1 Aus historischer Perspektive ist gegen »Geflüchtete« wiederum einzuwenden, dass der Begriff verharmlost und die Erfahrungen von Gewalt, Willkür und Schutzlosigkeit kaum zu erfassen vermag. Zudem suggeriert das Partizip Perfekt »Geflüchtete«, dass der Prozess des Fliehens und der Flucht mit der Ankunft abgeschlossen ist und somit vollendete Tatsachen geschaffen sind. Genau das ist der Trugschluss, dem vor allem Nichtbetroffene häufig erliegen. Flüchtlinge dagegen müssen erfahren, dass sich das Thema für sie nie erledigt.
Flüchtlinge verlieren ihre Heimat meistens für immer. Sofern sie die Strapazen der Flucht überleben, retten sie sehr oft kaum mehr als das nackte Leben. Dass Überleben möglich ist, ist der entscheidende Unterschied zwischen Vertreibung und Genozid. Vertreibungen können dennoch genozidale Dimensionen annehmen, wie das Schicksal der Armenier und der orientalischen Christen 1915 gezeigt hat.2 Auf jeden Fall gilt: Vertriebene und Flüchtlinge fliehen vor Gewalt, Krieg und Terror, um ihr Leben zu retten, oder werden gezielt – häufig von staatlichen, aber auch gesellschaftlichen Akteuren – aus dem Land getrieben.3
Nach der Definition der Genfer Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951 gilt als Flüchtling jede Person, die »aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt«.4
Es ist nötig – und längst überfällig –, diese Definition auf Menschen auszudehnen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden. Neuerdings wird auch erwogen, die Opfer von Naturkatastrophen und von dauerhaften klimatischen Veränderungen zu berücksichtigen. Überhaupt scheint eine Aktualisierung der Genfer Konvention, der eine noch weitgehend eurozentrische und vor allem weiße Weltsicht zugrunde liegt, dringend erforderlich.
Schon die Frage, wer ein Flüchtling ist und was ein Flüchtlingsschicksal ausmacht, ist nicht leicht zu beantworten. Für den Philosophen David Miller »sind Flüchtlinge am ehesten als Menschen aufzufassen, deren Menschenrechte unweigerlich in Gefahr gerieten, wenn sie an ihrem gegenwärtigen Aufenthaltsort bleiben würden«.5
Betroffene fühlen sich aus unterschiedlichen Gründen stigmatisiert. Die Philosophin Hannah Arendt etwa will nicht als Flüchtling gelten, weil sie das gleich in zweifacher Hinsicht als diskriminierend empfindet. »Vor allem mögen wir es nicht, wenn man uns ›Flüchtlinge‹ nennt«, schreibt sie 1943, nachdem sie in den USA Aufnahme gefunden hat.
Als Flüchtling hatte bislang gegolten, wer aufgrund seiner Taten oder seiner Weltanschauungen gezwungen war, Zuflucht zu suchen. Es stimmt, auch wir mussten Zuflucht suchen, aber wir hatten vorher nichts begangen, und die meisten unter uns hegten nicht einmal im Traum irgendwelche radikalen politischen Auffassungen. Mit uns hat sich die Bedeutung des Begriffs »Flüchtling« gewandelt. »Flüchtlinge« sind heutzutage jene unter uns, die das Pech hatten, mittellos in einem neuen Land anzukommen und auf die Hilfe der Flüchtlingskomitees angewiesen waren.6
Der Schriftsteller Bertolt Brecht, der ebenfalls in die Vereinigten Staaten floh, legt hingegen Wert darauf, dass er seine Heimat wegen seiner politischen Überzeugungen verlassen musste. Er reibt sich an dem Begriff »Emigrant«, da damit das Schicksal der vor den Nationalsozialisten vertriebenen Deutschen verharmlost werde.
Immer fand ich den Namen falsch, den man uns gab:
Emigranten.
Das heißt doch Auswanderer. Aber wir
Wanderten doch nicht aus, nach freiem Entschluss
Wählend ein anderes Land. Wanderten wir doch auch nicht
Ein in ein Land, dort zu bleiben, womöglich für immer.
Sondern wir flohen. Vertriebene sind wir, Verbannte.
Und kein Heim, kein Exil soll das Land sein, das uns da aufnahm.7
Flüchtling, Vertriebener, Emigrant? Hannah Arendt und Bertolt Brecht, beide Opfer der nationalsozialistischen Diktatur, können sich nicht auf einen Begriff einigen, der ihr Schicksal treffend beschreibt. Ihr Dissens offenbart, wie schwierig eindeutige Zuordnungen, ob nun Selbst- oder Fremdzuschreibungen, sind. Der »Flüchtling« im ethnisch-religiösen Sinn repräsentiert letztlich nur eine Teilgruppe. Welchen Personenkreis er umfassen soll und welchen nicht, unterliegt einem ständigen Wandel. So müssen Flüchtlinge heute etwa den Verdacht entkräften, sogenannte Scheinasylanten zu sein, worunter man jene versteht, die weder aus religiösen noch aus politischen Gründen Verfolgte sind, sondern Menschen, die sich aus wirtschaftlichen Erwägungen auf den Weg gemacht haben.
Der Begriff »Flüchtling« in seiner aktuellen Bedeutung ist eine Schöpfung des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, doch die Wörter »Flucht« und »Flüchtlinge« sowie »Vertreibung« und »Vertriebene« sind viel älter.
Nach dem Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm stammt »Flucht« ab vom Althochdeutschen fluht, dänisch flugt, schwedisch flykt, niederländisch vlugt, englisch flight. »Vertreibung« wird historisch-etymologisch auf das althochdeutsche firdribunga zurückgeführt. In seiner ursprünglichen Bedeutung meint das Wort Austreibung, Verstoßung, Verbannung, Verweisung – wie etwa die Vertreibung aus dem Paradies –, bleibt zunächst aber auf religiöse und familiäre Motive begrenzt.
Die deutsche Klassik verwendet den Begriff häufig metaphorisch, manchmal gar als »Weltflucht« im Sinne von Eskapismus. Bei Goethe sagt Faust zu Mephisto:
Was ist die Himmelsfreud in ihren Armen?
Laß mich an ihrer Brust erwarmen!
Fühl ich nicht immer ihre Not?
Bin ich der Flüchtling nicht? der Unbehauste?
Der Unmensch ohne Zweck und Ruh?
Der wie ein Wassersturz von Fels zu Felsen brauste,
Begierig wütend nach dem Abgrund zu?8
In dem 1796/97 entstandenen Epos Hermann und Dorothea schreibt Goethe dagegen über die »armen Vertrieb’nen« und »die schmerzliche Flucht« in ihrer aktuellen Bedeutung. In einem Städtchen am rechten Rheinufer treffen Flüchtlinge ein, die vor den Truppen der Französischen Revolution – wahrscheinlich aus dem Elsass – fliehen. Hermann, der Sohn wohlhabender Wirtsleute, verliebt sich in das Flüchtlingsmädchen Dorothea, das mit einem Flüchtlingstreck die Stadt passiert. Teils mitleidig, teils hämisch betrachten die örtlichen Honoratioren wie auch die anderen saturierten Einheimischen den Elendszug. »Ist doch die Stadt wie gekehrt! Wie ausgestorben! Nicht funfzig, / Deucht mir, blieben zurück von allen unsern Bewohnern. / Was die Neugier nicht tut! So rennt und läuft nun ein Jeder, / Um den traurigen Zug der armen Vertrieb’nen zu sehen.«9
Dem modernen Verständnis des Begriffs »Flüchtling« kommt die Bezeichnung am nächsten, die aus dem Französischen stammt und bald auch im Englischen Aufnahme fand. Bis ins 19. Jahrhundert spricht man im Englischen von refugees und im Französischen von réfugiés, wenn es sich um aus Frankreich vertriebene Protestanten (Hugenotten) handelt. Die Encyclopedia Britannica vermerkt in ihrer ersten Ausgabe von 1771 unter refugees: »Französische Protestanten, die durch die Aufhebung des Edikt von Nantes gezwungen wurden, vor Verfolgung zu fliehen und Schutz in anderen Ländern zu suchen.«10 Die vierte Auflage von 1810 fasst den Begriff bereits weiter und schließt alle ein, die ihre Heimat »in Zeiten von Bedrängnis« verlassen mussten.11 Bereits in die Ausgabe von 1771 ist überdies der Begriff expulsion – Vertreibung – aufgenommen. Er bezeichnet jemanden, der »gewaltsam aus seiner Stadt, Gesellschaft etc. gejagt wird«.12 In der Ausgabe von 1810 geht es in erster Linie um eine juristische Erklärung für den Ausschluss aus dem Parlament oder aus einer Vereinigung, es wird aber auch eine expulsion of aliens erwähnt, also die Abschiebung von Ausländern, deren Aufenthalt unerwünscht ist.
In Deutschland übernimmt man häufig das französische Wort réfugiés und versteht darunter französische Protestanten. In Zedlers Universal-Lexicon von 1733 wird zwar »Flucht« aufgenommen, aber es gibt noch keinen »Flüchtling«. Flucht wird hier vor allem rechtlich bewertet als Flucht vor Straftaten oder Flucht aus einem landesherrlichen Territorium etwa in der Absicht, sich dem Militärdienst zu entziehen. Flucht kann jedoch auch erforderlich sein, wenn der Betreffende sich zwar nichts hat zuschulden kommen lassen, aber »ein grösseres Uebel« vermieden werden soll.13 Letztere Definition kommt dem heutigen Verständnis bereits sehr nah.
Unter »Flucht« versteht Meyers Konversations=Lexikon von 1875 den »Rückzug einer Truppe vor dem Feind ohne Ordnung und geregelte Verbindung der einzelnen Abtheilungen, welche sich vielmehr auflösen und davonlaufen«. Ein zweiter Eintrag beschreibt die »Flucht eines Verbrechers«.14 Als das Deutsch-amerikanische Conversations-Lexicon mit dem Untertitel Mit specieller Rücksicht auf das Bedürfnisz der in Amerika lebenden Deutschen … 1871 in New York erscheint, wird »Flucht« dort erstmals im modernen Sinn aufgeführt – als Verlassen eines Ortes, »um einer Gefahr, namentlich einer Lebensgefahr, zu entgehen«.15
Für das Brockhaus Conversations=Lexikon von 1883 bedeutet »Flucht« wiederum »das eigenmächtige, widerrechtliche Verlassen eines angewiesenen Aufenthaltsortes«, wird also allein strafrechtlich gedeutet. Der »Flüchtling« existiert nicht.16 Als Flucht und Flüchtlinge längst zu einem Massenphänomen der Moderne geworden sind, kennt jener Brockhaus in seiner fünfzehnten Auflage nach dem Ersten Weltkrieg immer noch keine »Flucht«. Für die deutschsprachigen Leser hält er nur zwei Erklärungen bereit: die Flucht in der Architektur als »Bauflucht« sowie die Flucht in der Jägersprache als »schnelles Davonstürmen des Wildes nach Beunruhigung (Schuß usw.); auch der einzelne Sprung dabei«. Den »Flüchtling« gibt es ebenso wenig wie die »Vertreibung« oder den »Vertriebenen«.17
Der Begriff »Flüchtling« in seiner für dieses Buch maßgeblichen Bedeutung setzt sich erst nach dem Ersten Weltkrieg durch, als Millionen Menschen in Europa zu Staatenlosen wurden, weil die Imperien, deren Staatsbürger sie bis dahin gewesen waren, zu existieren aufhörten. In den neuen oder konsolidierten Staaten finden sie keine neue Heimat. Auf Initiative des Völkerbunds lenkt der norwegische Polarforscher Fridtjof Nansen als Hoher Flüchtlingskommissar (High Commissioner for Refugees) das Augenmerk auf dieses internationale Flüchtlingsproblem und sucht es mittels einer multilateralen Einrichtung zu lösen. Am 5. Juli 1922 beschließt der Völkerbund dann, die Staatenlosen – meist Flüchtlinge – mit einem besonderen Dokument auszustatten, dem sogenannten Nansen-Pass.
In Deutschland bleibt der Begriff »Flüchtling« zunächst für Deutsche reserviert. Der Leiter der Flüchtlingsfürsorge des Deutschen Roten Kreuzes, Wolfram Freiherr von Rotenhan, erklärt 1922, unter diesem Begriff habe man während des Krieges »aus dem feindlichen Auslande verdrängte Reichsdeutsche oder deutschstämmige Auslandsdeutsche« verstanden. »Heute sind ›Flüchtlinge‹ vor allem die aus den abgetretenen und besetzten Gebieten des Reiches verdrängten Deutschen.«18 Gelegentlich heißen diese auch »Grenzlandvertriebene« oder »vertriebene Auslandsdeutsche«. Im deutsch-polnischen Grenzgebiet bezeichnet die Flatower Zeitung ebendiese Personengruppe von 1920 an nüchtern als »Abwanderer«,19 und auch der führende Vertreter der jüdischen Gemeinde in Posen, Max Kollenscher, der 1921 seine Heimat infolge der Bestimmungen des Versailler Vertrags verlassen muss, benutzt den Begriff »Abwanderung«.20
Das Büro für armenische Flüchtlinge (office des réfugiés arméniens) in Paris bescheinigt der Armenierin Zaghig Babikian, dass sie eine Staatenlose ist, ein Schicksal, das nach dem Ersten Weltkrieg Millionen Menschen trifft. Die Armenierin aus der anatolischen Provinz Harput hat im Zuge des Völkermords ihren Ehemann und fast alle ihre Kinder verloren. 1920 heiratet sie in Istanbul Kasbar Babikian, dessen Ehefrau und Kinder gleichfalls Opfer der Aghet wurden. Die beiden machen sich auf die Suche nach Zaghigs überlebenden Kindern und finden schließlich als Einzige die Tochter Serpouhi in einem libanesischen Waisenhaus. Gemeinsam verlassen sie die Türkei 1922 in Richtung Frankreich. Zaghigs Tochter heiratet später einen Neffen ihres Stiefvaters, der in den USA lebt. Nach dem Tod ihres zweiten Mannes zieht es Zaghig Babikian 1936 zu ihrer Tochter nach Amerika, wo sie 1946 verstirbt.
© houshamadyan.org (Babigian Sammlung)
Während gängige Standardlexika »Vertreibung« nicht kennen, verwenden jüdische Enzyklopädien den Begriff häufig. Hier spiegeln sich die spezifisch jüdischen Erfahrungen, die von der nichtjüdischen Gesellschaft kaum rezipiert werden. Das Jüdische Lexikon von 1929 enthält einen Artikel zu »Judenverfolgungen und -vertreibungen«, in dem eingangs festgestellt wird, das Leben der Juden in Europa sei »eine fast ununterbrochene Kette von Leiden und Verfolgungen«. Im Folgenden wird dann auf die Vertreibung sämtlicher Juden aus Spanien, Portugal, Deutschland, England und Frankreich eingegangen.21 Der Historiker Simon Dubnow verwendet ganz selbstverständlich in seiner in den 1920er Jahren publizierten Weltgeschichte des jüdischen Volkes die Begriffe »Vertreibung« und »Vertriebene« für das Mittelalter etwa in dem Titel »Eduard I. und die Vertreibung der Juden aus England«.22
Nach dem Zweiten Weltkrieg entsteht im Deutschen das Begriffspaar »Flucht und Vertreibung«, das lange Zeit allein für deutsche »Vertriebene« bei Kriegsende und in der unmittelbaren Nachkriegszeit reserviert ist. Darüber hinaus kursieren unterschiedliche Bezeichnungen wie »Flüchtling«, »Vertriebener«, »Ostumsiedler« und »Ostflüchtling«.
Die Genfer Flüchtlingskonvention definiert 1951 die bis heute international gebräuchlichen Begriffe, die jedoch einem steten Wandel unterliegen. Im Englischen spricht der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) meist von »Flüchtlingen«, meint aber stets alle, die zwangsweise entwurzelt werden (forcibly displaced – durch Zwang disloziert) und damit das, was im Deutschen unter den Begriffen »Flüchtling« oder »Vertriebener« verstanden wird. In Reaktion auf die Weltkriege und Diktaturen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verpflichten sich die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen in ihrer »Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte« vom 10. Dezember 1948, ein Recht auf Asyl zu schaffen. Die Bundesrepublik Deutschland hat 1949 den Schutz von politisch Verfolgten in Artikel 16 des Grundgesetzes verankert. Der Artikel gehört seit 1990 zu den verfassungsmäßig geschützten Grundrechten des vereinten Landes.
Das Bundesvertriebenengesetz vom 19. Mai 1953 legt erstmals einheitliche Rechtsbegriffe zu »Vertreibung« und »Vertriebene« fest, die bis heute gültig sind. In der DDR gibt es dagegen weder Flüchtlinge noch Vertriebene. Sie sind dem Arbeiter-und-Bauern-Staat aus politisch-ideologischen Motiven abhanden gekommen.23 Stattdessen ist verharmlosend von »Umsiedlern« die Rede.
Wie eng die Begriffe auf den deutschen Nachkriegsfall beschränkt bleiben, zeigt ein Blick in Lexika aus den frühen Jahren der Bundesrepublik. Der Volks-Brockhaus von 1958 versteht unter Vertriebenen »dt. Staatsangehörige, die ihren Wohnsitz in den unter fremder Verwaltung stehenden dt. Ostgebieten oder in den Gebieten außerhalb der Reichsgrenzen vom 31.12.1937 hatten und den Wohnsitz im Zusammenhang mit den Ereignissen des 2. Weltkrieges infolge Vertreibung, insbes. Ausweisung oder Flucht, verloren haben«. Im Eintrag zu den Flüchtlingen werden dort neben Deutschen »aus der Sowjetzone und Berlin (Ost)« in einem Unterpunkt Displaced Persons zumindest erwähnt, doch die Vertreibung bleibt nach dieser Sichtweise im Wesentlichen ein deutsches Nachkriegsschicksal. Nichtdeutsche Personengruppen sowie die von 1933 an aus dem Reich vertriebenen deutschen Juden und politischen Flüchtlinge werden in die Definition nicht einbezogen. Das spiegelt die zu jener Zeit in der Bundesrepublik vorherrschende Stimmung wider. Viele Deutsche fühlen sich als die wahren Opfer der NS-Herrschaft, für sie stehen Stalingrad und Dresden als Chiffren des Leids, nicht Dachau, Leningrad oder Auschwitz.
Das muss auch der 1933 vor den Nationalsozialisten ins Exil geflohene Willy Brandt erfahren, der in Wahlkämpfen als »Emigrant« gebrandmarkt wird, weil er anders als die meisten Deutschen die schweren Stunden des Krieges im sicheren Schweden verbracht habe. Konservative Kräfte schelten ihn sogar einen »Vaterlandsverräter«. Franz Josef Strauß erklärt im Wahlkampf 1961 – sechzehn Jahre nach der Befreiung von Auschwitz – suggestiv, man werde Herrn Brandt »doch fragen dürfen: Was haben Sie zwölf Jahre lang draußen gemacht? Wir wissen, was wir drinnen gemacht haben.«24 Der Wehrmachtsoffizier Strauß diffamiert damit den politischen Flüchtling Brandt als jemanden, der sich der deutschen Schicksalsgemeinschaft und seiner patriotischen Pflicht gegenüber dem Vaterland durch Flucht entzogen habe. Da das Misstrauen gegen die Emigranten bei den meisten Deutschen tief verankert ist, zeigen die Anwürfe die gewünschte Wirkung. Die traumatischen Erfahrungen von Flucht und Entwurzelung der vom NS-Regime Verfolgten zählen bei der Mehrheit der Deutschen weniger als das Leid, das sie selbst – etwa in den Bombennächten – erlebt haben. Überdies können Mitläufer und selbst Täter im Zuge solcher Kampagnen behaupten, in der umkämpften Heimat tapfer ihren Mann oder ihre Frau gestanden zu haben.
Die Schriftstellerin Herta Müller erklärt in ihrem Plädoyer für einen Gedenkort an das deutsche Exil, »diese von Hitler Vertriebenen werden unter dem Begriff Exil oder Emigration verbucht«, und nimmt damit gewissermaßen den Disput von Arendt und Brecht wieder auf. »Das Wort Vertreibung gehört nur den Vertriebenen aus den ehemaligen Ostgebieten. Sie heißen ›Heimatvertriebene‹. Und die von Hitler Vertriebenen heißen ›Emigranten‹. Es ist ein sehr unterschiedliches Wortpaar: Das Wort ›Heimatvertriebener‹ hat einen warmen Hauch, das Wort ›Emigrant‹ hat nur sich selbst. Man könnte sagen, einem Herzwort steht ein Kopfwort gegenüber. Man muss sich doch fragen, wurden die ›Emigranten‹ nicht aus der Heimat vertrieben?«25
Im Kalten Krieg sind Vertriebene und Vertreibung immer wieder Themen ideologischer Grabenkämpfe. Der einseitige Opferdiskurs der deutschen Vertriebenenverbände und der westdeutschen Politik gerät in den 1970er Jahren allmählich in die Defensive und wird im linken Spektrum mit dem Vorwurf des Revanchismus belegt.
In Bezug auf die Kriege im ehemaligen Jugoslawien spricht man während der 1990er Jahre von »ethnischen Säuberungen«. Der ursprünglich aus dem Serbokroatischen stammende Begriff soll eine Vorstellung von gründlichem Auskehren vermitteln.26 Es ist ein Begriff der Tätersprache, der das Schicksal der Opfer ausblendet und auf frühe Konzepte von ethnischer Reinheit zurückgeht. Bezeichnenderweise gibt es keine Entsprechung für Betroffene, keine »Ausgekehrten«.
Norman Naimark plädiert für die Verwendung des Begriffs »Zwangsdeportationen«, weil damit das »Gewalthafte dieser Maßnahmen sowie das Engagement des Staates in diesem genuin politischen und inhumanen Akt« unterstrichen werde.27 Jochen Oltmer prägt den Begriff »Gewaltmigration«.28 Letztlich hat die komplexe Geschichte eine allumfassende Definition bisher verhindert, weshalb in diesem Buch ohne Wertung und vor allem ohne Hierarchisierung von Flüchtlingen wie von Vertriebenen die Rede sein wird. Gemeint sind damit Menschen, die ihre Heimat unter den Einwirkungen von Krieg und Gewalt aufgrund ethnischer, politischer und religiöser Motive verlassen müssen.29
Schwierig wird die Begrifflichkeit erst recht, wenn etwa in Europa Nachbarländer mit unterschiedlichen sprachlich-kulturellen Traditionen identische Vorgänge anders bezeichnen. Deutsche mögen es als verharmlosend empfinden, wenn etwa in Polen oder der Tschechischen Republik das Wort »Vertreibung« nicht verwendet wird, ignorieren dabei aber, dass dieser Begriff und viele andere in nichtdeutschen Erinnerungskulturen einen anderen Klang haben. Im Polnischen etwa lösen die Wörter przesiedlenie – Umsiedlung – und wysiedlenie – Aussiedlung – schreckliche Assoziationen aus, denn so haben die Deutschen während des Zweiten Weltkriegs die Vertreibung und Deportation von Polen und Juden bezeichnet. In Polen verwendet man vielfach wygnanie – Verjagung, Herausjagung, Austreibung, im übertragenen Sinn auch Exil –, wenn man von den Vorgängen spricht, die man im Deutschen unter Vertreibung versteht. Ein wygnaniec – Verjagter – ist danach ein Mensch, »der verurteilt wurde zur Verjagung, vertrieben aus der Heimat, ein Verbannter«.30 Polens Vertriebene aus den polnischen Ostgebieten – den Kresy – werden dagegen nach kommunistischer Terminologie verharmlosend als »Repatriierte« bezeichnet, obwohl auch sie ihre Heimat unwiderruflich verloren haben.
Seit 2001 erinnert der von den Vereinten Nationen eingeführte Weltflüchtlingstag am 20. Juni an diese von Menschen gemachten Katastrophen. Zu allem, was mit Flucht und Vertreibung sowie Flüchtlingen und Vertriebenen zusammenhängt, gehen die Meinungen weit auseinander, und die politische Stimmungslage in diesem Themenfeld unterliegt extremen Schwankungen. Daher ist eine Differenzierung unerlässlich und der Flüchtling im Zuge globaler Migration vor drohender terminologischer Beliebigkeit zu schützen. Nicht alle, die unter Lebensgefahr über das Mittelmeer kommen, sind Flüchtlinge, wobei die Übergänge zwischen Flüchtlingen und Migranten fließend sein können. Weil das so ist, muss hier klar unterschieden werden. Auch wenn Flüchtlinge als »Zwangsmigranten« unbestreitbar ein Teil der globalen Migrationsprozesse sind, liegen Flucht und Migration auf ganz unterschiedlichen Erfahrungsebenen.31 Wenn in diesem Buch ausschließlich Flüchtlinge im Mittelpunkt stehen, ist damit keine Rangordnung oder eine Abwertung der ebenfalls dramatischen Biographien von Migranten verbunden, sondern es wird lediglich eine Einschränkung vorgenommen. Hier geht es ausschließlich um Flüchtlinge und Vertriebene, die ihre Heimat verlassen müssen, weil ihr Leben bedroht ist, und nicht um Migranten, die ihre Heimat aus vielfältigen Motiven, aber immer aus eigenem Entschluss verlassen, vor allem weil sie auf ein besseres Leben an einem anderen Ort hoffen.
Auf der Flucht vor meinen LandsleutenBin ich nun nach Finnland gelangt. FreundeDie ich gestern nicht kannte, stellten ein paar BettenIn saubere Zimmer. Im LautsprecherHöre ich die Siegesmeldungen des Abschaums.NeugierigBetrachte ich die Karte des Erdteils. Hoch oben inLapplandNach dem Nördlichen Eismeer zuSehe ich noch eine kleine Tür.
BERTOLT BRECHT, Steffinische Sammlung, 1940
Ein Verrückter war durch dieses Hin und Her zwischen Pakistan und Indien und Indien und Pakistan derartig in einen Teufelskreis geraten, daß er noch verrückter wurde. Schließlich fand er während des täglichen Fegens im Anstaltshofe einen Ausweg aus dem »Indien-oder-Pakistan«-Dilemma, indem er sich auf einen hohen Baum flüchtete. Hier hielt er von einem großen Aste aus über zwei Stunden lang eine ununterbrochene Rede über das brennende Problem. Schließlich baten ihn die Wächter freundlich herunterzukommen, daraufhin kletterte er noch höher. Als man versuchte, ihn einzuschüchtern und ihn gar bedrohte, rief er hinunter: »Ich will weder nach Indien noch nach Pakistan, ich bleibe auf diesem Baum hier!«
SAADAT HASSAN MANTO, Schwarze Notizen: Geschichten der Teilung
Die endlose Geschichte der Flucht
Von Fremdheit und Flucht in der Bibel
Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der HERR, euer Gott (3. Mose 19, 34).1
Geschichten von Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, sind so alt wie die Menschheit selbst.2 In allen Weltreligionen und Kulturen wird von diesem Kernthema der Menschheit erzählt, selbstverständlich auch in der Bibel. Das Alte Testament berichtet von Flucht, Fremdheit und Exil: Hier beginnt die »Weltgeschichte der Heimatlosigkeit«, wie der Theologe Johann Hinrich Claussen gesagt hat. Letztlich sei die Bibel »ein Buch von Flüchtlingen für Flüchtlinge. Heimatverlust und Heimatsuche sind seine Kernthemen«.3
Es beginnt mit der Vertreibung der ersten Menschen aus dem Paradies: »Da wies ihn Gott der HERR aus dem Garten Eden, daß er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens« (1. Mose 3, 23–24). Adam und Eva haben sich nicht an Gottes Gebot gehalten, haben gesündigt und werden hart bestraft – eine Mahnung an alle Nachkommen. Diese biblische Vertreibung unterscheidet sich wesentlich von anderen historisch überlieferten Vertreibungen, weil sie in erster Linie metaphorisch gemeint ist.
Mit dem Auszug der Israeliten aus Ägypten beschreibt die Bibel im zweiten Buch Mose – auch Exodus genannt – erstmals ein Ereignis, das möglicherweise einen tatsächlichen historischen Hintergrund hat, allerdings ist dieser Exodus eine Rückkehr in die Heimat.4 Beim babylonischen Exil handelt es sich nachweislich um eine Epoche in der jüdischen Geschichte. Das wird konkret, als der babylonische König Nebukadnezar II. Jerusalem, die Hauptstadt von Juda, erobert. Alles liegt am Boden, ist im Buch der Könige zu lesen.
»Und er führte weg das ganze Jerusalem, alle Obersten, alle Kriegsleute, zehntausend Gefangene und alle Zimmerleute und alle Schmiede und ließ nichts übrig als geringes Volk des Landes. Und er führte weg nach Babel Jojachin und die Mutter des Königs, die Frauen des Königs und seine Kämmerer; dazu die Mächtigen im Lande führte er auch gefangen von Jerusalem nach Babel« (2. Könige 24, 14–15).
Viele Bewohner des Königreichs Juda werden zu Vertriebenen und Verbannten. Im fernen Babylon halten sie jedoch die Erinnerung an die Heimat wach. Bei Hesekiel und in den Klageliedern Jeremias offenbart sich allerdings, dass die babylonische Gefangenschaft bei den Israeliten eine tiefe Verstörung hinterlässt. Der zweite Exodus ist dann die Rückkehr aus dem babylonischen Exil in das Land der Vorfahren. »Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, daß man nicht mehr sagen wird: ›So wahr der HERR lebt, der die Kinder Israel aus Ägyptenland geführt hat‹«, heißt es beim Propheten Jeremia, »sondern: ›So wahr der HERR lebt, der die Kinder Israel geführt hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte.‹ Denn ich will sie zurückbringen, in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe« (Jeremia 16, 14–15).
Die Exilerfahrung steht im Mittelpunkt der jüdischen Überlieferung. Die Erinnerung an das Exil, an das, was in der Diaspora geschehen ist, wird von Generation zu Generation weitergegeben. »Die entschwundene Heimat lebte in der Erinnerung der Verbannten fort. Ihre heiße Sehnsucht nach dem Vaterlande ergoß sich in rührenden Hymnen oder Psalmen, von denen einer für alle Zeiten zum Hymnus der nationalen Trauer geworden ist«,5 schreibt Simon Dubnow in seiner Weltgeschichte des jüdischen Volkes. Psalm 137 bringt sowohl den Wunsch nach Vergeltung als auch unstillbares Heimweh zum Ausdruck:
An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten,
wenn wir an Zion dachten,
Unsere Harfen hängten wir
an die Weiden dort im Lande.
Denn die uns gefangen hielten,
hießen uns dort singen
und in unserm Heulen fröhlich sein:
›Singet uns ein Lied von Zion!‹
Wie könnten wir des HERRN Lied singen
in fremdem Lande?
Vergesse ich dich, Jerusalem,
so verdorre meine Rechte.
Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben,
wenn ich deiner nicht gedenke,
wenn ich nicht lasse Jerusalem,
meine höchste Freude sein.
HERR, vergiß den Söhnen Edoms nicht,
was sie sagten am Tage Jerusalems:
»Reißt nieder, reißt nieder bis auf den Grund!«
Tochter Babel, du Verwüsterin,
wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast!
Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt
und sie am Felsen zerschmettert!
Der Zerrissenheit und dem tiefen Schmerz über das Leben in der Diaspora verleiht der jüdische Gelehrte Jehuda Halevi in seinen Zionsliedern unvergleichlichen Ausdruck. Von Halevi, der 1075 im spanischen Toledo geboren wird, sind etwa achthundert Gedichte in hebräischer Sprache überliefert. Heinrich Heine verehrte ihn als einen der größten Dichter der Menschheit. Aus den Zionsliedern stammt die bekannte Elegie »Zwischen Ost und West«, die der Historiker und Philosoph Franz Rosenzweig ins Deutsche übertragen hat:
Mein Herz im Osten, und ich selber am westlichsten Rand.
Wie schmeckte der Trank mir und Speis? wie? dran Gefalln je ich fand?
Weh, wie vollend ich Gelübd’? wie meine Weihung? da noch
Zion in römischer Haft, ich in arabischem Band.
Spreu meinem Aug alles Gut spanischen Bodens, indes
Gold meinem Auge der Staub drauf einst das Heiligtum stand!6
Als Jehuda Halevi diese Zeilen verfasst, dauert die Zerstreuung der Juden, die mit dem babylonischen Exil begann, bereits mehr als anderthalb Jahrtausende an, aber die Sehnsucht nach Eretz Israel brennt nach wie vor in seinem Herzen, und die Hoffnung auf eine Rückkehr lässt nicht nach.7 Erst knapp ein Jahrtausend später soll mit der Gründung des Staates Israel die beispiellose Fluchtgeschichte der Juden ein Ende finden.8 Die ursprünglich religiöse Bedeutung von Exil (hebräisch galut) erfährt im Zionismus eine neue, diesmal politisch-nationale Aufladung, und auch aus der einst religiösen Aliya – der Rückkehr nach Eretz Israel – wird ein weltliches Projekt.9
Das Neue Testament setzt die Erzählung von Flucht und Exil fort. Nach christlicher Auslegung überwindet Jesus Christus die alttestamentarische Bedeutung, wie sie in der jüdischen Überlieferung bestimmend bleibt. Jesus, der neue Mose, wird bereits kurz nach seiner Geburt zum Flüchtling. Gott warnt Josef durch einen Engel vor der Gefahr, die ihm und seiner Familie durch König Herodes droht. »Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir’s sage; denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht (Hosea 11, 1): ›Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen‹« (Mt 2, 13–15). Damit wird die Geschichte Jesu und des Neuen Testaments in die große Erzählung des Volkes Israel eingereiht, das Mose aus Ägypten geführt hat. Die biblische Botschaft ist unmissverständlich: Der Mensch soll nicht übermütig auf vermeintlich angestammte Rechte pochen, denn alle Existenz auf Erden ist nur vorläufig. Gott habe »die Fremdlinge lieb, daß er ihnen Speise und Kleider gibt. Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben; denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland« (5. Mose 10, 18–19).