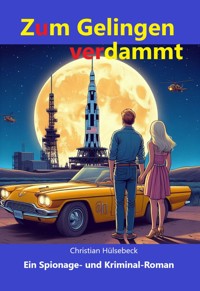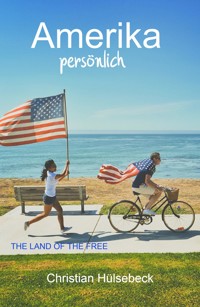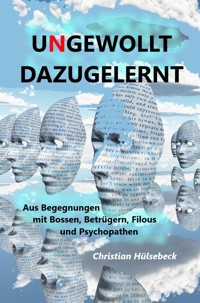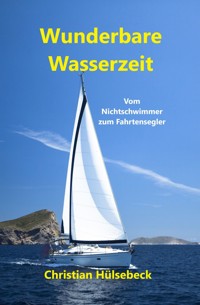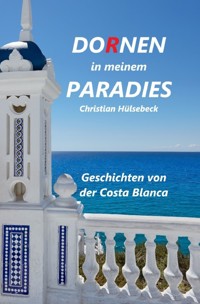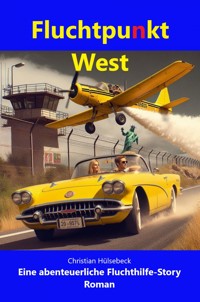
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der Fortsetzung einer Familiengeschichte gerät der junge Protagonist in den Dunstkreis der Geheimdienste und wird mehr oder weniger freiwillig helfer zweier spektakulärer Fluchten. - Es hätte zum dritten Weltkrieg kommen können. Doch der Zufall, kaltblütiges Kalkül und eine große Portion Glück verhindern ein "Kuba 2.0" im Herzen Europas im Jahr 1963. Mittendrin der Student Paul Hirsch, der ungewollt zum Helfer der deutschen und amerikanischen Dienste wird und eine spektakuläre Flucht aus der DDR ermöglicht. Gleichzeitig profitiert er aus dieser Verbindung mit den "Schlapphüten", die ihm eine sprudelnde Einnahmequelle bei den G.I.s der US Army in Deutschland erschließt. Seiner großen Liebe und sich selbst ermöglicht er damit eine Reise quer durch die USA, die fast tödlich endet. Doch seine Erfahrung im Kick-Boxen kann das Blatt gerade noch so eben wenden. Da erreicht sie ein Hilferuf aus Vietnam. Der Bruder von Pauls Freundin, Mitarbeiter in der US-Botschaft, wurde entführt. – Ob hier Pauls Verbindungen zu den Diensten helfen können, und wer am Ende die Profiteure sind, enthüllt das Buch zum Schluss. Die Handlung dieses Romans ist fiktiv, bewegt sich aber im Geflecht historischer Fakten und realer geografischer Orte. – Tauchen Sie ein in die Zeit des Ost-West-Konfliktes der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts und der US-Amerikanischen Präsens im Rhein-Main-Gebiet, genauso wie in das Berlin und das Ruhrgebiet jener Tage.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Fluchtpunkt
West
Christian Hülsebeck
Copyright Christian Hülsebeck
Inhalt
Vorwort
1 Im Glanz der „Ruhr-Barone“
2 Ein Flieger in Not
3 Ein Koffer in Berlin
4 Balkan-Route
5 Der Wochen-Einkauf
6 Reisevorbereitung
7 Fehlender Beweis
8 Die Konstruktion
9 Chuzpe vor der Schlangengrube
10 Geliefert
11 Briefwechsel
12 Vorbereitung
13 Reisezeit
14 Logistik im Westen
15 Die Flucht
16 Stunk im Staatsrat
17 Washington Airport
18 Beweise
19 Ausgeflogen
20 Infarkt
21 Berlin – Zwei Welten
22 Windfall Profit
23 Upgrade
24 Paris
25 Kick mit Drehung
26 Endspurt in Darmstadt
27 Welcome to the USA
28 Ungewollte Begegnung
29 Rundreise
30 Saigon
31 Saguaro
32 Hoffnung
33 Ein riskanter Plan
34 Fluchtpunkt
35 Angekommen
36 Stockholm – Ramstein – Washington
Tonkin Zwischenfall
Vorwort
Dieses Buch erzählt die fiktive Geschichte eines Studenten, der in der Mitte seines Studiums ein Stipendium in Boston, am Massachusetts Institute of Tecnology, erhält. Vorangegangen sind Kontakte zu den deutschen und amerikanischen Diensten, weniger konform auch als „Schlapphüte“ betitelt, die ihn in zwei abenteuerliche Fluchten verwickeln. Eine aus der DDR und eine andere aus den Fängen des Vietkongs in Vietnam.
Trotz der geographischen Distanz hängt aber alles mit allem zusammen. Genauso wie eine lange Reise durch nahezu die gesamten USA, die der Protagonist zusammen mit seiner amerikanischen Freundin unternimmt. Diese kennt er von einem früheren Besuch auf dem Flugzeugträger USS Sarratoga, wo ihr Vater als Air-Boss tätig war. Ihre Familie wird unfreiwillig in Flucht und Spionage verwickelt.
Die Handlung spielt im Jahre 1963, zwei Jahre nach dem Mauerbau der DDR und ein Jahr bevor die Interzonenzüge Rentnern aus dem Arbeiter- und Bauernstaat „generös“ einen vierwöchigen Besuch in der Bundesrepublik erlaubten. – In derselben Zeit unterstützten die USA Südvietnam und versuchten, sich aus einer aktiven Kriegsbeteiligung der beiden verfeindeten vietnamesischen Staaten herauszuhalten.
Die Orte der Handlungen und die historischen Ereignisse sind möglichst genau beschrieben und wiedergegeben. Alle Namen sind fiktiv. Ähnlichkeiten zu realen historischen Personen sind rein zufällig.
Der fiktive Teil der Handlung beruht zum Teil auf Grundlagen, die sich so oder ähnlich an vergleichbaren Orten ereignet haben, wobei die tatsächlich handelnden Personen oder Institutionen als Vorbild bzw. Vorlage für den Rahmen der Handlung gedient haben.
Wer nicht aufgrund seines jungen Alters bereits in den sechziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts seinen Fußabdruck auf dieser Erde hinterlassen hat, der kann mit diesem Buch in eine Welt vergangener Tage eintauchen. – Auch, wenn sich manches nur so ähnlich ereignet hat.
1 Im Glanz der „Ruhr-Barone“
So mächtig und kraftstrotzend sich die Hüttenwerke und Stahlkonzerne des Ruhrgebietes zu Beginn der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts auch präsentierten, so sehr mussten sie sich auch um die wichtigste Ressource für ihr erfolgreiches Fortbestehen bemühen. Die Ressource Mensch. Diese war im Zeichen der Vollbeschäftigung in den 1950er Jahren arg knapp geworden, insbesondere, da der unsinnige und mörderische Zweite Weltkrieg ganze Jahrgänge derart dezimiert hatte, dass nun allerorten Arbeitskräfte fehlten.
Im Bereich der Arbeiterschaft suchte man das mit Anwerbungen von Gastarbeitern im Ausland zu kompensieren, war doch dort die Wirtschaft mangels eines nötigen riesigen Wiederaufbaus weniger zügig angesprungen. Ingenieure, Kaufleute, aber auch Juristen, also Führungskräfte, ließen sich auf diese Weise allerdings nicht rekrutieren. Die musste man im eigenen Land suchen, und diejenigen, die man hatte, mussten gepflegt, also mit Vergünstigungen bei Laune gehalten werden, damit die böse Konkurrenz einem diese nicht abwarb.
Was lag da näher, als diesem Personenkreis ein wenig vom Glanz und Glamour der „Ruhr-Barone“ abzugeben und sie in ein gehobenes gesellschaftliches Licht zu rücken. Frei nach dem Motto: Kostest ja nichts, macht stolz und stärkt den Rücken. Alles verbunden mit dem Hintergedanken, ist der Job weg, ist auch die gesellschaftliche Reputation weg. Oder frei nach dem Motto: das Hüttenwerk hat´s gegeben, das Hüttenwerk hat´s genommen.
Ganze Siedlungen für die Arbeiter, manchmal waren es aber auch Villenviertel, errichteten die Werke in ihrer unmittelbaren Nähe, wo das mittlere oder gehobene Management zu vergünstigten Konditionen sein Unterkommen fand. Dazu gesellten sich gerne subventionierte Sportanlagen, wobei Tennis ganz oben auf der Beliebtheitsskala rangierte.
Hatten die „Großkopferten“ Anfang des 1900er Jahre ihre Werke noch im Stil eines Feudalherrn führen können, zu deren Insignien der Macht auch exklusive Werks-Casinos gehörten, öffneten sie diese nun auch für die Nutzung durch die höheren Angestellten. So eine Einrichtung verfügte nicht selten über einen bis zu knapp tausend Personen fassenden Saal, der vornehmlich für Versammlungen, zum Beispiel die der Aktionäre, gedacht war. Dazu gehörte ferner ein gehobenes Restaurant für Geschäftsessen, und nicht selten verfügte so ein Casino über einen kleinen Hotelbetrieb für geschäftlichen Besuch und abgeschirmte Sitzungszimmer.
Was lag da näher, als dem Führungspersonal diese Annehmlichkeiten zu mehreren Anlässen im Jahr zur Verfügung zu stellen. Voraussetzung war jedoch, dass sich vorher ein sozialer Werks-Club oder Werks-Verein aus dem Kreis der Begünstigten gebildet hatte, was als obligatorisch anzusehen war, denn solche Sachleistungen galten als ein begehrtes Gut. Kaum ein Berechtigter, der nicht dabei sein wollte. Diese Clubs waren nicht unbedingt elitär, aber durchaus von der gehobenen Art, und ihren Festen mit rauschenden Ballnächten ging ein legendärer Ruf voraus.
Den Anfang im Jahr machte ein mehrtägiges Karnevalsfest, gefolgt von einem ebenso langen Kirmesfest im Mai, dem dann wenig später ein aufwändiges Sommerfest folgte. Zeigten sich die Bäume bereits im Herbstlaub, wurde auch diese Jahreszeit gerne mit einem entsprechenden Fest begangen, bei dem die Herren mindestens im Dinner-Jackett erschienen, so sie keinen Smoking in ihrer Garderobe ihr Eigen nannten. Weihnachten stellte mit seinem Fest ähnliche Ansprüche an den Kleiderschrank, ebenso die folgende Silvester-Paty. Wobei die Damen dieser Gesellschaft es peinlichst vermieden, sich in einem Kleid zu präsentieren, in dem sie schon einmal bei einem anderen Event gesehen worden waren.
All diese Vergünstigungen, vom Wohnen über den Sport bis hin zum gehobenen Gesellschaftsleben, trugen dazu bei, die Führungskräfte im Werk zu halten. Gleichzeitig galten sie als ein Pfund, womit bei der Personalanwerbung gewuchert werden konnte. Kleinere oder mittlere Firmen hatten da kaum eine Chance mitzuhalten.
Auch Direktor Siegfried Hirsch genoss als Chef der Werks-Eisenbahnen gerne diese Annehmlichkeiten, insbesondere, wenn er damit seiner hübschen Frau Alma die Gelegenheit bot, ihre elegante Garderobe mit Affinität zum italienischen Stil, zu präsentieren. Selbige kaufte sie zwar gerne von der Stange, aber mit allerlei Raffinesse und handwerklichem Geschick wusste sie diese in wahre Designer-Roben zu verwandeln.
Am Tisch von Siegfried Hirsch, den seine Vertrauten nur Siggi nannten, fand sich fast immer auch das Ehepaar Rudolf und Luise Schnittmacher ein, die als externe Gäste geladen waren. Die Herren hatten geschäftlich viel miteinander zu tun und kannten sich bereits aus den dunklen Tagen der letzten Kriegsjahre, wo beide, das war ihr Geheimnis, ihre persönliche „Resistance“ gegen das Naziregime kämpften, allerdings in unterschiedlichen Bereichen. Siggi Hirsch auf der zivilen Seite und Rudolf Schnittmacher beim Militär. Beide unter hohem Einsatz.
Heute, an einem schon warmen Maitag im Jahr 1963, anlässlich des Balls zur großen Volkskirmes, hatte Rudolf Schnittmacher noch einen Freund mit Gattin im Gefolge, den Siggi auf die Liste der Gäste hatte setzen lassen. Petra und Wolfgang Severin. Schnittmacher und Severin kannten sich ebenfalls aus besagten düsteren Tagen, hatten dann anschließend einige Zeit in Bonn beim Aufbau der jungen BRD bei der Gründung der Bundeswehr und anderer Sicherheitsorgane mitgewirkt und eng zusammengearbeitet. Severin war anschließend nach Pullach gegangen, zur Organisation Gehlen, woraus später der BND hervorging, der Geheimdienst, der eng mit den amerikanischen Diensten verbandelt war.
Nein, ein klassischer „Schlapphut“, wie die Geheimdienstler allenthalben bezeichnet wurden, das war er nicht. Er hatte mehr organisatorische Aufgaben und beteiligte sich an echten „Fronteinsätzen“ nur, wenn es brenzlig oder eilig war. Bekannt war er intern für seine Spürnase und unfehlbare Menschenkenntnis, wenn es darum, ging Leute mit Spezialkenntnissen und Talenten zu gewinnen. Solche, die seine Gegner nicht auf dem Schirm hatten, die also „weit unter deren Radar flogen“. Diejenigen, die plötzlich aus dem sprichwörtlichen Nichts auftauchten und auch dahin wieder verschwanden oder solche, die ein harmloses bürgerliches Profil hatten, was sie außerhalb jeden Verdachts geheimdienstlicher Aktivitäten stellte.
Spät in dieser gesellschaftlichen Runde, als das Dinner und der Rundgang über den Rummel, die große Kirmes, bereits absolviert waren, stieß Paul, der Sohn von Alma und Siggi Hirsch zur Tischgemeinschaft hinzu. Er hatte erst kürzlich in Darmstadt das Studium des Luftfahrt-Ingenieurswesens aufgenommen. Severin sah ihn hier zum ersten Mal, doch von seinen Abenteuern hatte er schon einiges gehört.
Schließlich war Paul derjenige, der als Jugendlicher, nahe Hünxe, den letzten vermissten US-Soldaten bei verbotenen Waffen-Grabungen auf dem ehemaligen Schlachtfeld gefunden hatte. Das hatte ihm nicht nur verschiedene Ehrungen eingebracht, sondern war auch der Anlass für den Besuch des Flugzeugträgers MSS Saratoga in Barcelona anlässlich seiner verwegenen Abitur-Reise mit einem alten Motorrad durch die Beneluxstaaten, Frankreich und Nordspanien. Auf dem Träger hatte er das Glück, Susan Brookdale, die Tochter des Air-Bosses, also des Kommandanten für den Flugbetrieb, kennenzulernen. Sie waren sich ab da in Liebe verbunden und schrieben sich regelmäßig. Sie mit rosa Briefpapier, während er seine Gedanken und Gefühle auf solchem in hellblau zu Papier brachte.
Als Paul seine Geschichte in kurzen Zügen erzählt hatte, während der Rest der Tischgemeinschaft das Tanzbein lockerte, sprach er von seiner Befürchtung, das Studium unterbrechen zu müssen, da zu Hause auf dem Tisch ein Brief von der Kreis-Wehr-Ersatzbehörde lag, in dem von seiner baldigen Musterung die Rede war.
Sein Vater hatte im Krieg sein Leben für den Widerstand riskiert, und somit war ihm, Paul Hirsch, alles Militärische äußerst suspekt, also keine Option Doch noch sah er keinen Ausweg, sich dem Tragen einer Uniform zu entziehen.
Jetzt erkannte Severin die Gunst der Stunde, seiner Liste im Notizbuch einen weiteren potentiellen Helfer mit viel Talent fürs Unkonventionelle hinzufügen zu können. Einen Joker, den noch niemand auf dem Schirm hatte. Frei nach dem Motto: jeder zu seiner Zeit und jeder an seinem Platz. Die Bekanntschaft mit Paul könnte sich für ihn als Volltreffer erweisen, das ahnte er sofort. Da war er ganz „Schlapphut“. Deshalb erwähnte er fast schon in beiläufigem Tonfall, er kenne da einen Weg, wie Paul elegant der Uniform entgehen könne. – Der war sofort wie elektrisiert und wollte mehr wissen, was Severin so formulierte:
„Paul, schauen sie, ich denke, meine Tätigkeit bei der Organisation Gehlen, bzw. deren Nachfolgebehörde ist ihnen sicherlich bekannt. Da trifft man auf so manche interessante und nützliche Leute. Ich denke da an West-Berlin. Offiziell ist mein „Verein“ da ja nicht tätig. Sie wissen ja, Vier-Mächte Status. Aber meine Kontakte dahin sind exzellent. Da gibt es einen, nennen wir ihn mal einen guten Bekannten, der betreibt einen Zeitungsladen und Tabakverkauf in seinem Haus, in dem er auch Zimmer vermietet und sonst auch noch einiges Nützliches für uns bereithält. Nicht, dass man da auch wohnen müsste. Eher pro Forma. Er ist mir noch die eine oder andere kleine Gefälligkeit schuldig. Einen Mietvertrag für sie und ein Klingelschild mit ihrem Namen wäre das Mindeste, was er sicher liebend gerne für mich tun würde. Und damit hätten Sie in Berlin eine nachprüfbare Meldeadresse. Und wer in Berlin seinen Wohnsitz hat, der kann ja nicht gemustert oder gar zur Bundeswehr eingezogen werden.
Das wussten sie doch sicher, oder?“
Ja, gehört habe er schon mal davon, aber Details, wie so etwas geht, die kenne er nicht, ließ Paul Hirsch ihn wissen. Und noch ehe die Tänzer wieder zurück am Tisch waren, hatte Paul eine Visitenkarte in seiner Tasche, auf der nur die Initialen W.S. und eine Telefonnummer standen. Diese hatte Severin Paul diskret mit den Worten herübergeschoben:
2 Ein Flieger in großer Not
Eckhard Flieger hieß nicht nur so, sondern hatte seinen Namen auch zum Beruf gemacht. Er war Pilot. Genauer gesagt war er Agrarflieger im Arbeiter- und Bauernstaat des seit gut einem Jahr durch eine Mauer und einen Zaun geteilten Deutschlands. Also in der DDR. Ursprünglich wollte Eckhard Flieger Pilot bei der NVA, der Nationalen Volksarmee, werden. Dort hatte er auch seine Ausbildung begonnen, und die Sichtflugberechtigung hatte er bereits erworben.
Doch seine flapsige „Berliner Schnauze“ und seine manchmal eher lockere Art, manche nannten es schnodderig, hatte die Stasi, also die Staatssicherheit, auf den Plan gerufen. Es waren wohl ein paar seiner Witze oder Äußerungen zu viel gewesen, die man ihm in böser Absicht als systemkritisch hätte ankreiden können, weshalb man sein Weiterkommen als NVA-Pilot bremste.
Der letzte Witz, der es in seine Stasi Akte schaffte, lautete so:
Sitzen zwei NVA-Soldaten in Berlin auf der neuen Mauer, die Beine gen Westen baumelnd. Sagt der eine, wenn icke dir jetzt schubse, watt machste denn danne. Sagt der andere, dann schicke ich dir jeden Monat ein Paket aus dem Westen mit Kaffee und Schokolade.
Daraufhin fand sich kurz darauf in seiner Akte der Vermerk: Nicht charakterstark, nicht systemtreu. Würde nach versehentlichem Betreten westlichen Territoriums nicht zur DRR zurückkommen. Würde westliche Konsumware zur Belohnung an denjenigen senden, der ihm das Verlassen des Staatsgebietes ermöglicht hat. Das war ein absoluter K.O. Vermerk.
Eckhard Flieger wurde aus der NVA gedrängt und den Agrarpiloten zugeteilt. Diese hatten die Felder und Äcker der LPGs, also der riesengroßen Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften aus der Luft mit Pestiziden und Herbiziden zu bearbeiten. Die beachtliche Größe der zu besprühenden Ländereien war durch die Zusammenlegung der aus Privatbesitz enteigneten Betriebe entstanden. Die Nutzung eines Treckers wäre für diese Flächen eher dilettantisch gewesen.
Aber auch bei der Agrar-Luftfahrt galten hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit der Piloten und des Bodenpersonals. Die aus Tschechien stammenden Maschinen hatten ohne Nutzlast, vollbetankt, durchaus eine Reichweite von 500 Kilometern. Und damit war eine Außengrenze der DDR immer in Reichweite. Die Maschinen waren allesamt vom Typ Brigadyr, einem Hochdecker, der im Ostblock hergestellt wurde. Dieser ähnelte der im Westen bekannten und wegen ihrer Zuverlässigkeit sehr beliebten Cessna, aus amerikanischer Produktion. Die Brigadyr konnte vierhundert Kilo Sprüh-Chemikalen tanken und war für diesen Zweck als Einsitzer mit einem zusätzlichen Notsitz hinter dem Piloten ausgestattet.
Dieser zweite Sitz diente in der Regel dazu, einen als Agraringenieur getarnten Stasi Mann mitzunehmen, der dafür zu sorgen hatte, dass der Pilot nicht plötzlich Richtung Westen über die Grenze fliegen konnte. Dazu führte er ein Werkzeug, ähnlich einer übergroßen Klempnerzange mit. Da die Seilzüge der Steuerruder alle offen und sichtbar vor den Seitenwänden des Flugzeuges verliefen, reichte ein Griff mit dieser Zange, und schon war ein Ruder blockiert.
Musste auf dem zweiten Sitz ein Flugmechaniker mitfliegen, um irgendeine Unregelmäßigkeit im Flug festzustellen, wurde Sprit abgelassen. Soviel, dass der im Tank verbleibende Rest auf keinen Fall zur Republikflucht ausreichend war. Darüber wachte der Agraringenieur, also der Stasi-Aufpasser, mit Argusaugen. Gefährlich war das nicht, denn die Brigadyr hatte eine sehr niedrige Mindestgeschwindigkeit und somit auch gute Segeleigenschaften. Sogenannte trockene Landungen, also ohne Sprit, übten die Piloten regelmäßig, besonders aus niedriger Höhe.
Nahte der Winter und waren die Maschinen komplett gewartet für den Einsatz im nächsten Frühjahr, wurden die Piloten zumeist dem nächsten russischen Fliegerhorst zugeteilt, wo sie als gern gesehene Gäste Bodendienste und Beladungs-Service leisteten. Für die oberen Dienstgrade waren sie das heimliche Tor zur Außenwelt, konnten sie, die externen deutschen Helfer, doch Dinge besorgen, die es in der tristen und elenden Sphäre der russischen Kasernen schlichtweg nicht gab. War das Leben in der DDR schon grau, so war es innerhalb der Kasernenmauern eher dunkelgrau und düster. Da half nur der Wodka, um sich in eine andere Welt zu beamen. Und Kaviar, Kaffee und Bananen, die den Offizieren reichlich zur Verfügung standen, machten deren Welt auch nicht eben bunter.
Eckhard Flieger verrichtete diesen Dienst am Militärflugplatz von Jüterbog, knapp eine halbe Autostunde südlich von Berlin, wo die Russen einen Militärflugplatz betrieben, der über eine derart lange Start- und Landebahn verfügte, dass auch die riesige Antonow, das größte Frachtflugzeug der Welt, dort landen konnte. Selbst wohnte er im eine Stunde westlich gelegen Bochow, genauso weit von Magdeburg entfernt wie von Berlin. Er fuhr die Strecke lieber täglich mit seinem alten Vorkriegs-Skoda, als in dem ärmlichen Zimmer der Kaserne gegenüber dem Flugplatz Jüterbog zu übernachten.
Es war kurz vor Weihnachten im Jahr 1963, und die Berliner erwarteten den Abschluss eines Passierscheinabkommens, dass den Westberlinern ermöglichen sollte, Verwandte in Ostteil der Stadt zu besuchen. Das wurde auch realisiert, jedoch war das Zeitfenster sehr klein. Lediglich vom 18. Dezember bis zum 5. Januar war die vor 18 Monaten durch die Mauer geschlossene Grenze nun wieder in einer Richtung offen, nämlich von West nach Ost. Also für knapp drei Wochen.
Vor dem Bau der Berliner Mauer traf sich Eckhard Flieger regelmäßig mit seinem Cousin Erwin Huber aus München, der auch einen Wohnsitz in Berlin hatte. Deswegen konnte er am Passierscheinabkommen teilnehmen. Erwin war für eine Münchner Firma für Eisenbahnen, Signalbau, und Elektroanlagen tätig, die früher in Berlin ihren Hauptsitz hatte, jetzt hier aber nur eine Dépendance betrieb. Das Passierscheinabkommen nutzten sie, um sich über die Weihnachtstage in Ost-Berlin zu treffen, denn seit dem Mauerbau konnten sie sich nur noch schriftlich austauschen. Per Postkarten, aus Sicherheitsgründen, denn die Post eines Agrar-Piloten unterlag der besonderen Überwachung. Wenn Erwin Huber eine solche Postkarte auf den Weg bringen wollte, schickte er sie einfach an einen Freund bei der US-Army in Berlin, der dann den Gang nach Osten bis zum nächsten Briefkasten erledigte, wenn er Patrouille im Osten fuhr. Schließlich konnten die Militärs der Siegermächte in allen Teilen der Stadt unterwegs sein. So sah es das Vier-Mächte-Abkommen vor.
Fuhren die Russen mit ihren Militärfahrzeugen in den Westteil, hefteten sich umgehend die „Schlapphüte“ an ihre Fersen, während umgekehrt in Ost-Berlin die Amerikaner, Engländer oder Franzosen von der Stasi, also den Schergen der DDR-Staatssicherheit, verfolgt wurden.
Eckhard antwortete stets mit einer Ansichtskarte aus Ost-Berlin, die er mit „Deine Erika“ unterschrieb und direkt nach München schickte. Postkarten dieser Art, die ja jeder lesen konnte, erregten keinen Verdacht. Ein Brief mit seinem Absender wäre als verräterisch aufgefallen, denn, wie gesagt, seine Post unterlag der Überwachung. Und Briefe ohne Absender erregten gleich höchsten Verdacht bei der Staatssicherheit. Die Texte mussten absolut unverfänglich sein, weil jeder sie lesen konnte. Und weil es in Berlin so viele Briefkästen gab, wo Eckhard Flieger seine Karte einwerfen konnte, waren Rückschlüsse auf den Absender praktisch unmöglich.
Seine West-Verwandtschaft hatte Eckhard Flieger zu Beginn seiner Ausbildung tunlichst verschwiegen. Denn die wäre ein Ausschlusskriterium für seine Berufswahl gewesen.
Die beiden Cousins trafen sich jetzt, wo sie sich immer im Osten Berlins vor dem Mauerbau getroffen hatten, wenn sie ungestört reden wollten, nämlich am Eingang eines großen Parks. Auf ihrem langen Spaziergang auf dessen Wegen unterhielten sie sich über die Familie, die sie verband, die kleinen und größeren Sorgen ihres Alltags und die neue Undurchlässigkeit der Grenze, die sie trennte. Seit nunmehr achtzehn Monaten gab es bereits diese unsägliche Mauer, einen Schandfleck, der die Stadt zerriss, wie sie übereinstimmend meinten.
Hatte Eckhard Flieger früher an seine Karriere in der NVA geglaubt, und damit auch an den Staat, in dem er lebte, war ihm dieser Glaube mit dem Zwangswechsel zu den Agrarpiloten jäh und gründlich abhanden gekommen. Hier im Park konnte er solche Gedanken frei äußern. In seiner Wohnung wäre das gar nicht möglich gewesen, hatte er doch kürzlich bei der Renovierung seines Schlafzimmers hinter der Tapete in der Raumecke ein sehr dünnes Kabel gefunden, was dort nichts zu suchen hatte.
Erwin, sein Cousin, kommentierte das so: „Sind die bei der Stasi eigentlich noch ganz dicht im Kopf. Glauben die, du redest im Schlaf von Dingen, die sie interessieren könnten. Oder denken die wirklich, du hättest im Bett nichts anderes zu tun, als mit deiner Geliebten Geheimnisse zu teilen, die du eh nicht hast. Oder ist deine Ex nach der Scheidung jetzt zur Stasi gewechselt und will wissen, was du Schlingel so treibst?“ – Bei diesem Gedanken konnte Erwin ein leises Lachen einfach nicht unterdrücken.
Was Eckhard seinem Cousin allerdings verschwieg, war die Tatsache, dass er sich bei den Russen in Jüterbog eine kleine Nebenerwerbsquelle erschlossen hatte, von deren Gefährlichkeit er jetzt noch nichts ahnte. Denn bisher hatte es damit keine Probleme gegeben.
Eckhard Flieger hatte während dieses Gesprächs mal wieder eine seiner grandiosen Ideen. Dieses Mal, wie sie mit ihrer Postkartenkorrespondenz brisante Dinge schreiben könnten, ohne gleich den Verdacht der Stasi zu erregen.
Er formulierte es so: „Also Erwin, wenn ich dir was mitteilen will, was keinen etwas angeht, dann schreibe ich dir genau das Gegenteil. Allerdings schreibe ich alles mit grüner Tinte oder mit grünem Kugelschreiber. Also wenn ich schreibe, ich denke, wir haben alles gesagt, dann heißt das, wir müssen uns dringend austauschen. Oder wenn ich schreibe, mir geht es sehr gut, dann geht es mir gerade sauschlecht. Schreibe ich, hier geht alles in Ruhe seinen Gang, will ich sagen, hier brennt die Hütte.“
Auch unterschrieb er alle seine Karten stets mit „Erika“, damit jeder Rückschluss auf seine Person ausgeschlossen war. Erwin lachte und klopfte seinem Cousin auf die Schulter, denn er fand die Idee einfach und genial zugleich. „Ja, so machen wir das“, stimmte er zu und gab Eckhard noch einhundert D-Mark West in Zehner-Bank-Noten, ehe sich ihre Wege wieder trennten. Kleine Zehner konnte man nämlich besser einsetzen, und Westgeld machte in der DDR aus einem Bettler einen König, weil man da auf dem Schwarzmarkt eins zu zehn in Ostmark tauschen konnte.
Zurück in seinem alten Skoda, ließ Eckhard Flieger die Geldscheine unter der Einlegesohle seines Schuhs verschwinden, wohl wissend, dass deren Besitz ihm Möglichkeiten eröffnen würde, die er ohne „Valuta“ nicht hätte. Aber dieser Besitz barg auch ein Risiko, denn ein Pilot mit Westwährung war immer verdächtig, und Eckhard Flieger wollte sich auf keinen Fall einer Befragung nach der Herkunft des Geldes aussetzen.
Ein Gedanke hob merklich Eckhards Laune, als er zurück in Jüterbog wieder seinen Dienst auf dem Flugplatz der Russen aufnahm. Nämlich der, dass das Frühjahr bald nahte und er dann wieder hinter dem Steuer der Brigadyr sitzen würde.
Er war gerade damit beschäftigt das Gewicht von Frachtgut für den Transport in einer Tupolew Maschine zu überprüfen, als Oberstleutnant Sokorow, sein russischer Dienstgrad lautete Podpolkownik, das sind zwei Grade unter einem General, ihn zur Seite nahm. Dazu sprach er ihn in seinem gebrochenen Deutsch an, wohl wissend, dass Eckhard Flieger leidlich der russischen Sprache mächtig war. Aber man konnte ja nie wissen, wer wo etwas aufschnappte, und Deutsch verstanden die anderen hier sowieso nicht.
„Gospodin Flieger, ich habe da wieder mal einen Spezialauftrag für sie. Für das nächste Wochenende. Sie wissen ja, worum es geht. Wie letztes Mal. Aber ganz so dünn und mager muss sie nicht wieder sein.“
Eckhard schaute Sokorow, der zwei Schritte näher gekommen war, kurz an und nickte zustimmend während er dessen Wodkafahne roch. Wobei er sich schon fragte, wieso dieser Kerl dermaßen nach Alkohol stank, wo doch geschmacks- und geruchsneutraler Wodka ausschließlich aus Wasser und Alkohol gebraut wurde, ganz ohne Fuselöle und Aromen. Vermutlich war es die Mischung aus saurem Brot und Kaviar mit dem Schnaps, die dazu führte. Dann verließ er das Flughafengelände, stieg in seinen betagten Skoda und machte sich auf den Weg, um das Bestellte zu organisieren
Prostitution war in der DDR offiziell untersagt, doch in Berlin konnte man sie allenthalben finden, wenn man wollte. Und zu Messezeiten saßen in Leipzig oder Berlin die für DDR-Verhältnisse gut gekleideten leichten Damen an den Hotelbars wie die Hühner auf der Stange. Ein Blick, ein kurzes Kopfnicken und schon folgte eine von ihnen wortlos einem West-Herren in Richtung seines Zimmers, wo eine Bezahlung in West-Valuta winkte.
Aber so etwas wollte Sokorow nicht. Er wünschte sich den Kontrast zu den Landpomeranzen aus seiner Oblast, aus der er stammte. Er wollte etwas jugendlich Sportliches, vielleicht gerade über zwanzig, möglichst hellblond und vor allem willig. Billig brauchte er nicht, denn er verfügte über eine Währung, die kaum jemand hatte und deren Wert in der DDR fast so gut wie DM oder US-Dollar waren, vorausgesetzt man wusste diese Währung richtig zu nutzen.
Das Fraternisierungsverbot setzte Sokorow enge Grenzen, was die Erfüllung seiner Wünsche betraf. So war er froh und dankbar, dass Eckhard Flieger immer wieder auf junge Frauen auf dem Land zurückgreifen konnte, die gerne ihre karge Kasse aufbessern wollten und keinen Verdacht erregten, wenn sie an einer Bushaltestelle zu ihm in den alten Skoda stiegen. Und junge Landfrauen traf er bei seiner Arbeit ja täglich. Was erleichternd für ihn bei der Anwerbung der Mädchen hinzukam, war die Lockerheit der DDR-Bürger, für die Fremdgehen eher ein Breitensport war. Nicht umsonst war die Scheidungsrate im Arbeiter- und Bauernstaat die höchste in Europa.
Schon am nächsten Tag hatte er das Gewünschte gefunden. Dort wo weder die Dienste der Russen oder die der DDR stärker präsent waren. Sie, die schon mal angedeutet hatte, für Geld so einiges zu machen, lebte weit genug entfernt, östlich von Magdeburg, und sie würde Sokorow gefallen, dachte er und steckte ihr schon mal zwanzig Westmark zu, damit sie es sich ja nicht mehr anders bis zum Samstag überlegen würde. Er sagte nur das eine Wort: „Vorschuss“. Den Rest ihres Liebes-Lohnes erhielte sie am Ende, wenn er sie wieder abhole, und das sei reichlich. Ach ja, und sie solle sich einfach Monika nennen. Mehr sei nicht nötig.
Am nächsten Tag hatte er Sokorow bei einer flüchtigen Begegnung nur zugeraunt: „Samstag 17.00 Uhr am Tor.“
Doch heute blieb es nicht bei dieser einen Begegnung mit ihm. Eckhard Flieger war der Abfertigung der riesigen Antonow-Maschine zugeteilt, die gerade eingeschwebt war und dabei fast den Himmel zu verdunkeln schien. Die Techniker hatten bereits die Rampe unter der geöffneten hochgeschwenkten Flugzeugnase montiert, so dass der Gabelstapler hineinfahren konnte. Aber er sah keinerlei Fracht.
Als er die Rampe ein Stück weit hochgegangen war, konnte er so eben noch einige kleine Frachtstücke auf mehrfach gesicherten Paletten erkennen. Viel zu klein für dieses riesige Fluggerät dachte er noch, als er von einer Wache mit der Kalaschnikow im Anschlag weggescheucht wurde. Er ging langsam um die Maschine, tat als prüfe er die Bremsklötze und täuschte Geschäftigkeit vor, um nach einer Weile wieder am Bug zu erscheinen.
Da standen nun die ersten zwei der Paletten im kalten Aprilwetter, von denen er im Frachtraum etwa zehn bis zwölf gesehen zu haben glaubte. Jede Palette trug offensichtlich eine Kiste, etwa 200 cm lang und 70 cm breit und ebenso hoch. Und jede steckte in einem olivgrünen Jutesack, der verplombt war. Die Plombe trug einen Anhänger, mit Text, den er auf die Schnelle nicht lesen konnte. Nur die Worte streng geheim blieben in seiner Erinnerung hängen, genauso wie der ovale Stempel in lila Farbe, dessen Gebrauch nur allerhöchsten Militärs vorbehalten war.
Die Wodkafahne konnte er schon riechen, noch ehe Sokorow, der von hinten an ihn herangetreten war, den Mund aufmachte und in anzischte: „Gospodin Flieger, verschwinde hier. Du hast nichts gesehen. Überhaupt nichts. Vergiss das niemals, wirklich niemals“.
Eckhard Flieger machte sich bis zum Ende der Woche so gut wie unsichtbar, wobei er weiter nicht auffiel, denn die meisten der Soldaten schoben hier so eine Art Gammeldienst, wenn sie mit der Herrichtung irgendwelcher Gerätschaften beschäftigt waren.
Erst am Samstag traf er wieder auf Sokorow, als er „Monika“ brachte. Punkt 17 Uhr hielt er neben dem blau gestrichenen Tor der Kaserne, die sich gegenüber dem Flugplatz an der Landstraße befand, die Flugfeld und Kaserne voneinander trennte. Sokorow wartete bereits dort mit seiner Limousine.
Einen Tag später, am Sonntag, es war 16 Uhr, und es dämmerte bereits, da wartete schon die Limousine vom Typ Wolga neben dem blauen Kasernentor, neben der Eckhard Flieger seinen Skoda zum Stehen brachte. Monika verließ den Beifahrersitz, stieg zu ihm in den alten Skoda, während Sokorow ihm bedeutete, Monikas Platz in seiner Limousine einzunehmen. Sie sollte in Eckhard Fliegers Auto warten. Er hatte schon wieder reichlich „geladen“ und sagte: „Heute musst du Lohn selber tragen“, um gleichzeitig auf seine verbundene und offensichtlich verletzte rechte Hand zu zeigen, wobei er fröhlich grinste.
Der betrunkene Oberstleutnant fuhr ohne jegliche Spur von Fahruntüchtigkeit zum Flugfeld auf der anderen Seite der Straße, wo die Wachen zackig salutierten und den Schlagbaum öffneten, als sie ihn erkannt hatten. Dort hielt er vor einer Halle, die zu Fliegers Verwunderung von allen Seiten bewacht wurde.
„Gospodin, hier ist Lager nur für Offiziere,“ ließ der betrunkene Sokorow wissen, wobei er wieder lachen musste, ehe die Wachen, die offensichtlich auch nicht nüchtern waren, die beiden einließen. Innen strebte der Oberstleutnant auf eine Metalltür zu, deren Schlösser er so schnell nicht aufbekam. Während dieses kurzen Momentes sah Eckhard Flieger etwas, was er besser nie gesehen hätte. Es waren die zwölf Kisten aus der Antonow. Bei einer war der sackartige Schutz entfernt und die darunter verborgene Kiste war so weit geöffnet, dass er eine Bombe oder Rakete erkennen konnte, wie sie unter den Mig Jagdfliegern montiert wurden. Allerdings trug die Kiste, in der sie lagerte, das bekannte Warnzeichen für Atom in leuchtendem Gelb.
Er ließ sich nicht anmerken, was er gerade im fahlen Licht der Halle gesehen hatte, als ihm Sokorow bedeute, zwei Kartons mit je zwanzig Dosen, zu je 50 Gramm Kaviar, aus dem Regal zu nehmen, das in dem Raum stand, den er eben mühsam geöffnet hatte. Dann griff er mit der linken Hand in ein weiteres Regal und stopfte Gospodin Flieger zwei Flaschen griechischen Metaxa in die Hosentaschen. Rechts eine und links eine, so dass dieser fast auf dem Weg zurück die Hose verloren hätte. So, wie der drauf ist, säuft der nicht nur, der muss dazu auch noch was rauchen, ging es Eckhard Flieger durch den Kopf, als sie auf dem kurzen Weg zurück waren.
Über das Gesehene weiter nachzudenken, dazu war jetzt keine Zeit. Erst einmal musste er die Show mit „Monika“ hinter sich bringen. Als er wieder im Wagen saß, legte er ihr einen Karton mit den zwanzig Dosen Kaviar auf den Schoß und obendrauf noch eine Flasche Metaxa. „Dein Lohn“, sagte er nur trocken.
Erst sagte sie lange nichts, dann stieg ihr die Zornesröte ins Gesicht und dann fauchte sie ihn an:
„Bist du bescheuert? Hältst Du mich für doof? Glaubst du etwa, ich reiße mir eine Nacht und einen Tag den Allerwertesten auf, und nicht nur den, um dann mit zwanzig Dosen Kaviar und ner Flasche Metaxa nach Hause zu gehen? Spinnst du? Was soll ich auf dem Dorf mit so einem Scheiß? Die letzten 24 Stunden hat der mich ständig mit seinen Kaviarhäppchen gefüttert. Butterbrot hat er das genannt. Schmeckt überhaupt nicht, finde ich. Er hat es mit jeder Menge Wodka runtergespült. Und dann hat der immer wieder irgend so ein Zeug geraucht. Musste ich auch mal probieren. Danach war ich ganz benebelt. Außerdem ist der wohl reichlich abartig. Als es mir zu toll wurde, da habe ich ihm in die Hand gebissen. Der hat nicht geschrien, der hat vor Glück geweint und wurde ganz ruhig. Und jetzt willst du mich mit so einem Scheiß abspeisen. Nee, Eckhard das hätte ich nicht von dir gedacht.“
Eckhard Flieger war ganz ruhig geblieben. Er kannte diese Nummer, denn keine der Mädels, die er bisher Sokorow zugeführt hatte, wollte die Art der Belohnung, deshalb sprach er jetzt ganz friedvoll:
„Schau mal, ich mach dir einen Vorschlag. Ich kaufe dir den Kaviar ab. Zehn Mark West die Dose, und für den Metaxa zwanzig. Das sind zweihundertzwanzig, minus den Vorschuss von zwanzig. Also noch zweihundert. Aber wir fahren auf dem Weg nach Hause noch über Berlin. Da kenne ich jemanden, der ist da ganz scharf drauf, Kaviar zu kaufen. Ich setze dich am Gendarmenmarkt ab und nach einer Stunde bin ich wieder da. Achtzig bekommst du jetzt, den Rest, wenn ich dich wieder abhole.“
Jetzt leuchteten ihre Augen. Das waren mehr als zwei Monatsgehälter Ost, wenn sie zweihundertzwanzig DM West zum Schwarzmarkt-Kurs umrechnete. Das war wie ein Lottogewinn. Damit hatte sie nun wirklich nicht gerechnet. „Das machen wir so,“ sagte sie ganz aufgekratzt und gab Eckhard einen Kuss auf die Wange, der sofort losfuhr in Richtung Berlin.
Dort hatte er einen Abnehmer, der Militärs aus dem französischen Sektor kannte, die ganz heiß auf billigen Kaviar waren, den er ihnen zum halben Preis verkaufte, wie sie ihn im Luxuskaufhaus KADEWE hätten erwerben können. Er zahlte ihm fünfzehn DM West je Dose. Zusammen mit seinen eigenen zwanzig Dosen und dem Metaxa hatte Eckhard Flieger an diesem Wochenende demnach ganze vierhundert Mark West verdient. Doch wie er sie ausgeben sollte oder konnte, da hatte er im Moment keine Ahnung, denn die Regale der Läden in seiner Umgebung waren eher leer als voll. Allerdings sollte ihm der Verwendungszweck des West-Geldes schon sehr bald klar werden.
Es war schon weit nach 21 Uhr, als er Monika wieder an der Bushaltestelle an der Landstraße absetzte, und erst jetzt begann er darüber nachzudenken, was er heute gesehen hatte. Wenn das wirklich Atomsprengköpfe waren, die er da gesehen hatte, dann kannte er das wohl wichtigste Geheimnis im Ost-West-Konflikt. Ob es auch der Staatsrat der DDR kannte, das fragte er sich. Was, wenn Sokorow den Nebel in seinem Kopf mal beiseite schob. Würde er sich dann daran erinnern, dass er, Eckhard Flieger, etwas Ungeheuerliches gesehen hatte. Müsste er dann beseitigt werden. Und wenn ja, wie würde das geschehen können? Unter Mithilfe der Stasi? Aber wenn die Führung der DDR eventuell selber gar nichts wusste? Nein, dachte er, das müssten dann die Russen selber erledigen. Könnte er vielleicht einem Unfall auf dem Flugfeld der Russen zum Opfer fallen? Schon gut möglich, dachte er. Könnte er einfach mit einer der Frachtmaschinen nach Russland entführt werden, um dort für ewig in einem der grausamen Gulags zu verschwinden? Für immer? Auch das wäre durchaus möglich. Alles Fragen, die ihn quälten und fortan auf seiner Seele brannten.
Nach diesem inneren Dialog war ihm nun einiges klarer geworden. Nach Jüterbog zu den Russen, dahin durfte er auf keinen Fall zurück. Morgen würde er sich krank melden, und die Krankheit würde dauern. Dafür würde sein Arzt schon sorgen. Denn der brauchte gerade Baumaterial, was es unter der Hand nur für Westgeld gab.
Wieder hatte er just in diesem Augenblick einen seiner genialen Einfälle. Er musste raus aus diesem Staat, und er hatte schon eine Idee, wie das gelingen könnte. Ein richtiger Plan war das zwar noch nicht, aber ein paar Ansätze, die hatte er im Geiste schon einige Male durchgespielt. Hatte ihm Cousin Erwin Huber nicht irgendwann einmal erwähnt, er kenne da jemanden, der einen kenne, der wiederum jemanden in Pullach kennt? Einen bei der ehemaligen Organisation Gehlen, die jetzt BND heißt? Einen von diesen Schlapphüten?
Als er am Vormittag aus der Poliklinik kam, wo der Arzt ihn anstandslos krankgeschrieben hatte, mit guter Aussicht auf Verlängerung, setzte er sich zu Hause an den Tisch und schrieb eine Postkarte mit blauem Kuli an seinen Cousin Erwin Huber in München.
„Lieber Erwin
Schön, dich über Weihnachten gesehen zu haben, aber so bald müssen wir nicht wieder sprechen. Hier gibt es überhaupt nichts Neues. Alles ist langweilig auf dem Land bei Berlin. Ein absolut biederes Leben, das ich führe. Meine Arbeit ist eintönig und ich hoffe, der Winter mit seiner melancholischen Stimmung hält noch ein wenig an. Mir mangelt es an nichts. Nur grüne Tinte konnte ich gestern nirgendwo auftreiben. Deine Erika“
3 Ein Koffer in Berlin
Paul Hirsch hatte nach dem Tischgespräch mit Wolfgang Severin beim Ball zur großen Volkskirmes erst einmal eine unruhige Nacht. Wenn er dessen Angebot annehmen wollte, seinen Wohnsitz in Berlin zu registrieren, dann müsste er es bald machen. Doch er war sich nicht im Klaren, ob er die Uniform wirklich ablehnen wollte. Den Staat zu schützen, in dem er lebte, erschien ihm gleichzeitig auch als staatsbürgerliche Pflicht. Wenn er nach Osten schaute und sah, mit welchen Entbehrungen und Zwängen die Bürger in jenen Staaten leben mussten, die unter der Hegemonie der UdSSR litten und sich nicht freiheitlich entwickeln konnten, nagten arge Zweifel an seiner Entscheidung.
Noch ehe ihn die Müdigkeit ins Reich der Träume mitnahm, kam ihm dann aber doch noch ein beruhigender Gedanke. Wenn er nach dem Studium des Flugzeug-Ingenieurwesens, das er an der TH Darmstadt absolvierte, die Uniform anzöge, dann könnte er seinem Land doch viel besser dienen. Sein gerade begonnenes Studium dafür zu unterbrechen, um achtzehn Monate als Wehrpflichtiger durchs Gelände zu robben, das erschien ihm dagegen weniger sinnvoll.
Am Morgen stand sein Entschluss fest, und der hieß Berlin. Mit siebzehneinhalb Jahren hatte er das Abitur gemacht. Jetzt war er neunzehn und noch zwei Jahre von der Volljährigkeit entfernt. Am Frühstückstisch erklärte er seinen Eltern das Vorhaben. Alma und Siggi Hirsch wiegten erst in bedenklicher Unentschlossenheit ihre Köpfe, ehe sie schließlich zustimmten. „Gut, mach das so, mein Junge“ sagte Siggi nach kurzem Schweigen. „Aber wenn du durch die DDR fahren musst, mit dem Interzonenzug, dann halte dich an alle Regeln. Die warten nur darauf, Westbürger abzukassieren und Scherereien zu machen. – Am besten du kaufst dir ein Ticket für die verbilligten Flüge nach West-Berlin“
Um die Telefonnummer von Severin, die auf der Visitenkarte stand, anzurufen, dazu war es bereits zu spät. Das würde Paul sofort am nächsten Morgen erledigen. Am besten von einer Telefonzelle aus, denn sein Zimmervermieter in Darmstadt musste davon nichts mitbekommen.
Jetzt, am Sonntagmittag, stieg Paul in den fast 20 Jahre alten VW Käfer, den er von seiner Mutter übernommen hatte. Gut erhalten und wenig auf dem Tacho. Sie fuhr inzwischen das neue und beliebte Exportmodell, das zu ihrer Freude in einem pastelligen Hellblau lackiert war und reichlich mit Chrom glänzte.