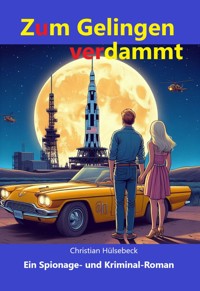Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Eine autobiographische Erzählung, die mit der anfänglichen Wasserscheu des Autors beginnt und mit dem Kopfsprung vom Turm, anstatt der Flucht ins Kinderbecken überwunden wird. Ein sächsischer Scherz in St. Tropez nach der "Wende"mit Reisenden aus den neuen Bundesländern. Die "Sixtinische Kapelle" auf einer Segelyacht mit "Papstwahl" auf einer Rentneryacht der anderen Art. Brötchen - Navigation für besonders verpeilte Skipper in der Ostsee. Das alles sind amüsante Erlebnisse eines Skippers, genauso wie eine Walbegegnung im Mittelmeer vor Korsika. Wieder lässt uns der Autor auf eine Fülle von Episoden aus seinem Leben blicken, die oft zum Schmunzeln und manchmal auch zum Staunen sind, dabei lassen sie gleichzeitig erkennen, dass man aus der geschilderten Situationskomik auch Erkenntnisse gewinnen kann. Vom Erlernen des Schwimmens über das Fahrtensegeln bis hin zur Begegnung mit der Geldwäsche Mafia ist alles dabei, was des Seglers Herz erfreut oder belustigt, und auch der "Landratte" wird reichlich Lesestoff geboten. Trockener Humor im nassen Element. – Tauchen Sie ein!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wunderbare
Wasserzeit
Vom Nichtschwimmer
zum
Fahrtensegler
Was den Leser in diesem Buch erwartet:
Eine autobiographische Erzählung, die mit der anfänglichen Wasserscheu des Autors beginnt und mit dem Kopfsprung vom Turm, anstatt der Flucht ins Kinderbecken überwunden wird.
Sächsischer Scherz in St. Tropez nach der „Wende“. Die Sixtinische Kapelle auf einer Segelyacht mit „Papstwahl“ und Brötchen - Navigation für besonders verpeilte Skipper. Alles amüsante Erlebnisse eines Skippers.
Wieder lässt uns der Autor auf eine Fülle von Episoden aus seinem Leben blicken, die oft zum Schmunzeln und manchmal auch zum Staunen sind, dabei lassen sie gleichzeitig erkennen, dass man aus der geschilderten Situationskomik auch Erkenntnisse gewinnen kann.
Vom Erlernen des Schwimmens über das Fahrtensegeln bis hin zur Begegnung mit der Geldwäsche Mafia ist alles dabei, was des Seglers Herz erfreut oder belustigt, und auch der „Landratte“ wird reichlich Lesestoff geboten.
Trockener Humor im nassen Element. – Tauchen Sie ein!
Inhalt
Vorwort
Weißensee
Freischwimmer
Der flying Dutchmann
Erste Versuche auf eigenem Kiel
Hatteras
Spagat
Ferien auf eigenem Kiel
Fairline und das preiswerte Pfund Sterling
Binnen und Buten
Clubgeflüster
Zur Ostsee
Martin Yachts
Lanzarote
Brokat Stinnes
…und was machen wir jetzt?
Und immer wieder Holland
Bornholm
Winterlager
Lust auf Segeln
Jollen segeln im Club Med
Jakob
König
Pandarea
Die Baltic in St. Tropez
Blue Sky
Take Bora in der Türkei
„Tomollow“
Das war knapp
American Water
Nana und Latina
Zwei vor, drei zurück
Schwanger
Taufe
Hafensuche
Segeln in Friesland
Heimathafen Cogolin
Zoll – und bevor das Licht ausgeht
Und immer wieder Mistral
Heute lebst du – morgen bist du tot
Wal querab
„weißde was?“
Auf nach Spanien
Barcelona
Sind die vom Mars?
Die Freudenspenderin
Puerto Campomanes
Winter in ALTEA
Mallorca
Altea Hills
Marsmenschen
Schraubst du noch, oder segelst du schon?
Betrügereien
Poseidonia, Delphine und das Universum
Der letzte Törn
Die Mafia
Sea Cloud, ein Windjammer
Royal Clipper
Kreuzfahrt auf der Oasis of the Seas
Dank und Nachwort
Vorwort
Auch wenn es eine Binsenweisheit ist, wiederhole ich sie doch gerne: Das Leben ist vielschichtig und mannigfaltig und entsprechend voller Facetten, von denen sich etliche natürlich auch überschneiden. So werde ich in diesem Buch Dinge schildern, von denen ich bisher noch niemandem berichtet habe, geschmückt mit Anekdoten und Erlebnissen, die den meisten Menschen, die dem Wassersport weniger als ich verbunden sind, in der Regel verborgen bleiben.
Wer zum Beispiel glaubt, auf dem Wasser ginge es, was die Sportschiffart oder das Segeln angeht, mit ebenso strengen Regeln und Bauvorschriften einher wie im Straßenverkehr oder in der Luftfahrt, der irrt gewaltig. Hier gilt eher die russische Philosophie, nach der alles erlaubt, was nicht explizit verboten ist. Kein Wunder, dass jedes Land dazu ein paar Sondervorschriften hat. So wird in Deutschland beispielsweise vorgeschrieben, dass die Positionslaternen zertifiziert sein müssen. Wer also ein Boot im Ausland kauft, muss diese dann auswechseln, auch wenn die vorhandenen international anerkannt sind und sogar um einiges besser sichtbar leuchten.
Bei uns gibt es in der Sportschiffart keinen TÜV, und so bewegt sich auf dem Wasser so einiges, was nur dem Verständnis der guten Seemannschaft seine Verantwortung schuldig ist. Pleiten, Pech und Pannen sind dann keine Seltenheit. Zum Glück geht dann alles doch gut aus, da Wasser im Gegensatz zur Fliegerei eine statische Komponente hat und das Schiff nicht gleich sinkt, wenn der Vortrieb fehlt. Mein Vater pflegte zu sagen: „Luft hat keine Balken, Wasser schon“, wobei er offensichtlich jene meinte, an denen man sich nach einer Havarie festklammern konnte.
All diese Erlebnisse mal kleiner, mal größerer Widrigkeiten auf, im oder unter Wasser tauchen in diesem Buch wortwörtlich auf. Angefangen bei der Scheu vor dem Wasser, die dem Erlernen des Schwimmens im Wege stand, bis hin zur veritablen Seemannschaft eines Fahrtenseglers.
Der Inhalt ist zwar chronologisch aufbereitet, aber jedes Kapitel für sich eine abgeschlossene Episode.
Personen nenne ich zum Schutz ihrer Identität nur mit ihren Vornamen, hat es doch keinen Einfluss auf die Handlung.
Auf geht´s, ab jetzt wird es nass.
Weißensee
Als Kind hatte ich vor dem Wasser einfach Angst, denn schwimmen lernte ich erst sehr spät, etwa mit elf Jahren. Auch sind mir meine ersten Versuche, mich selbstständig über Wasser zu halten, noch in peinlicher Erinnerung, hatten sie doch etwas äußerst Bedrohliches an sich. Für mein kindliches Gemüt sogar lebensbedrohliches. So erinnere ich mich an einen Ferienaufenthalt in Österreich, ich denke, es war am Weißensee, und ich war vielleicht acht Jahre alt. Als Herberge diente uns eine kleine Gästewohnung auf einem Bauernhof, allerdings ohne fließendes Wasser.
Große und kleine Geschäfte hatte man in dem etwas abgelegeneren Holzhäuschen mit dem Herzen in der Tür zu erledigen. Der Sitzplatz war ein abgewetztes Brett mit einem Loch in der Mitte, und darunter plätscherte munter ein kleines Bächlein Richtung See, das die Hinterlassenschaften der Benutzer sogleich fortspülte. Damals, also Mitte der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, kannte man das Wort Umwelt noch gar nicht. Hätte man das als Umweltverschmutzung gebrandmarkt, auch dieses Wort war unbekannt, hätte der Bauer einem den Vogel gezeigt und gesagt: „Wenn die Viecher auf d´Wiesen machen, können mir däs scho lang.“ Sicher wäre die Wortwahl noch drastischer ausgefallen.
Gewaschen hat man sich mit einem Waschlappen in einer etwa fünf Liter fassenden Schüssel, neben der eine ebenso große Kanne mit Wasser zum Nachfüllen stand. Wen wundert es dann, wenn die Zimmermaid selbige Seifenbrühe einfach zur Entsorgung auf den Boden des Hofes kippte oder, wenn ihr der Gang der Stiege nach unten zu lästig erschien und sie sich unbeobachtet fühlte, das Waschwasser zum Fenster hinaus in die angrenzende Wiese schüttete. Die Mädels waren kräftig gebaut, denn die Schüssel selbst wog sicher genauso viel wie ihre fünf Liter Inhalt.
Gefrühstückt wurde in der Küche des Bauern. Wurst von eigener Schlachtung, selbst gebackenes und frisch duftendes Brot, das noch fern jeder modernen Backchemie den Ofen verlassen hatte, waren genauso selbstverständlich wie die Mich von der eignen Kuh oder die Eier der eigenen Hühner. Letzte durfte ich selber einsammeln, nachdem mir eine Magd gezeigt hatte, wo die Hühner diese gerne ablegten. So kroch ich durch manche Hecke und schaute hinter viele Heuhaufen, um zu einer erklecklichen Ausbeute zu kommen.
Gewöhnungsbedürftig waren auch die vielen Fliegenfänger, die im Dutzend von der Küchendecke hingen. Spiralförmige, mit süßem Leim bestrichene Papierstreifen, an denen die dicken Brummer kleben blieben, sobald sie vom süßen Leim naschen wollten. War der Fliegenfänger voll mit Fliegenleichen, sodass man vom braunen Leim-Papier nichts mehr sehen konnte, wurde er erneuert. Mich störte es nicht, denn den Kampf mit diesen Plagegeistern um mein duftendes Frühstücks-Brot mit selbstgemachter Marmelade hätte ich sicher gegen sie verloren. Auch meine Eltern waren da eher resistent, während andere Gäste des Hofes schon mal ein Ekelgesicht beim Anblick dieser Fliegenfriedhöfe aufsetzten. Doch auf einem Bauernhof gehörte das einfach dazu, und in unserer Schlafbehausung, nicht unweit des Kuhstalls, hingen auch einige Exemplare.
Was macht man in den Ferien auf einem Dorf in Österreich, heute möchte ich sagen, nicht unweit „of the middle of nowhere“? Die Familie geht wandern, Pilze suchen oder besucht das Schwimmbad des Dorfes, was meinem Vater den Ehrgeiz entlockte, seinem wasserscheuen Söhnchen endlich das Schwimmen beizubringen. War er doch an der Mecklenburger Seen-Platte groß geworden und hätte es zur Olympiade beinahe in eine Auswahl zum Ruder-Achter geschafft. Tja, knapp daneben ist eben auch vorbei. Lange Zeit erinnerte in unserem Haushalt noch ein silbernes Zigarettenetui mit Wappen und Widmung an dieses verfehlte Ziel, bis es irgendwann nicht mehr auffindbar war.
Also redete mein Vater mir gut zu, mich ins Wasser dieses Dorfschwimmbades zu trauen. Er garantiere dafür, dass er mich über Wasser halten werde. Also traute ich mich die Stufen der Treppe hinunter in dieses einfache Betonbecken, dessen Wasser eher eine fiese Brühe war, denn Umwälzanlagen und Filter waren hier noch Fremdworte. Da stand nun dieser einmeterneunzig große Mann ein seiner „Bleyle“ Badehose, also einer Art Strick-Trikot-Hose, die eher einem nassen Feudel glich und von einem quer über die Brust laufenden Hosenträger gehalten wurde, und lockte sein Söhnchen ins gefährliche Wasser, während die Mutter von hinten Mut zusprach.
Er hielt seinen starken Arm unter meinen Bauch, während ich unkontrolliert zappelte, prustete und nach Luft rang. Den nassen Tod vor meinen kindlichen Augen wollte ich nur noch wieder festen Boden unter die Füße bekommen. Irgendwann begriff er, dass seine Bemühungen nicht verfingen. Hätte es damals bereits Handys gegeben, hätten die Umstehenden mit Sicherheit einen Video Clip gemacht, um diese urkomische Szene in alle Welt per WhatsApp & Co. hinauszutragen. Mr. Bean wäre nie zu Ruhm und Ehre gekommen, weil ich schon lange vor ihm alle Lacher abgeräumt hätte. Wer weiß, ob Luis de Funès, von Otto ganz zu schweigen, je ihre großen Erfolge eingefahren hätten.
Die Wanderungen durch die nahen Wälder bekamen für mich alsbald eine Wendung von der gähnenden Langeweile hin zum Jagdinstinkt eines Trüffelschweins, als meine Mutter die Parole ausgab, das Geld wüchse förmlich auf dem Boden des Waldes. Sie meinte damit das reichhaltige Angebot an Pilzen, die bei uns zu Hause nur vom immer knappen Geld der Haushaltskasse zu erwerben waren. Vater verdiente zwar als Abteilungs-leitender Ingenieur eines großen Bergbau-Ausrüsters und Stahl-Verarbeiters nicht schlecht, doch die abenteuerliche Flucht aus der DDR hatte uns im Westen mit Null anfangen lassen, sodass „Pilze for free“ ein Leuchten in das Gesicht meiner Mutter zauberte, die eh aus sehr begüterten Verhältnissen in Dresden nun auf dem Boden einer neuen Realität angekommen war. So nahm ich begeistert die Jagd auf die neu entdeckte Begehrlichkeit auf, was mir das eine oder andere zusätzliche Eis am Stiel einbrachte.
Mutter kannte sich mit Pilzen gut aus, ließ, wenn sie unsicher war, ob essbar oder giftig, lieber ein Beutestück stehen oder prüfte mit dem Schnitt des Messers am Stamm oder Schirm, ob sich bestimmte Verfärbungen einstellten, die Auskunft über Leben, Tod und Überleben gaben konnten. Nach der Heimkehr wurden die Pilze auf einen extra starken Zwirnsfaden aufgezogen, der im Zimmer zwischen Möbelstücken oder von Wand zu Wand über eine Ecke mittels Heftzwecken gespannt wurde. Das war Luft-Trocknung nach Familienart und nach ein paar Tagen hatten wir bereits einen stattlichen Beutel zusammen, der bis zum Ende der Ferien auf die Größe eines normalen Kopfkissenbezuges anwuchs.
Was aus dem vielen gesparten Geld wurde, ist mir heute nicht mehr gegenwärtig, nur noch, dass es lange, gefühlte Jahrzehnte lang, nur noch Essen mit Pilzen gab. Omelett mit Pilzen, Bratwurst Jäger Art, Schnitzel Weissensee oder alles weissnichmehr mit Pilzen. Geschadet hat es nicht und ist mir heute eine liebe Erinnerung.
Nur wenn sich der Gang zum Betonbecken-Schwimmbad des Dorfes mit dem taubenkotgrauen Wasser ankündigte, regte sich in mir ein Instinkt, vergleichbar dem eines Hundes, der mitbekommen hat, dass es bald zum verhassten Tierarzt geht. Wo er fast paralysiert auf einen Edelstahltisch gehoben werden soll, um dann in einem Trancezustand über sich ergehen zu lassen, was normalerweise einen wilden Beißreflex in ihm ausgelöst hätte.
So war es eine glückliche Fügung für mich, dass der Bauer ein Bub in etwa meinem Alter hatte, mit dem ich mich flugs für den Badetag verabredete. Und welche Mutter möchte ihrem Kleinen schon eine böse Spielverderberin sein. So konnten wir an diesen Tagen durch alle Winkel des Gehöfts kriechen sowie die nahen Büsche, wo mir der Bub ein Versteck zeigte.
Er habe echte Kunewitten dort. Kune-was? Ich verstand rein gar nichts. Es stellte sich heraus, es waren entrindete kleine Aststücke in der Größe einer Zigarette, innen etwa 2 mm hohl, der Rest ähnlich porös wie Balsaholz. Man könne die rauchen, wie Zigaretten, und das machten wir auch. Doch das Kratzen und Brennen im Hals ließ mich schnell innehalten, während mein Bauernkumpel fleißig weiter qualmte. Ich denke für Lunge, Bronchien und Hirn war es nicht unbedingt zuträglich und ob er je zu höherer Schulbildung kam oder noch immer den doppelten Salto rückwärts vom Heuboden in den Heuhaufen übt, entzieht sich meiner Kenntnis. Sicher wird er eine der strammen Zimmermaids oder die Froni vom Nachbarhof geehelicht, vielleicht auch den Bauernhof zum „Schwarzen Rössl am Weissensee“, dem führenden Hotel der Region, umfunktioniert haben. Ein jeder halt gemäß seinen Anlagen. Spricht man doch den Landwirten besondere mentale Kapazitäten zu.
Die Heimfahrt in unserer Isabella der Marke Borgward, die schon in den sechziger Jahren in die ewigen Jagdgründe der deutschen Automobilwirtschaft eingegangen ist, obwohl es damals ein gutes und fortschrittliches Auto war und nur an der eigenen Firmenleitung scheiterte, gestaltete sich jetzt ob der gesammelten Pilze noch anspruchsvoller. Musste Vater zum Entsetzen meiner ängstlich schreckhaften Mutter auf den engen Pass-Straßen doch jedes Mal als zu Berg Fahrender bis zur nächsten Ausweichstelle zurücksetzen, wenn der Postbus mit seiner laut tönenden Fanfare seine Begegnung ankündigte, oder es ein LKW ihm gleichtat, um passieren zu können. Denn nun versperrte ein auf der rückseitigen Fensterablage platzierter dicker Pilze-Sack den Blick nach hinten. Manchmal standen wir so dicht am Abgrund, dass uns diese Pilze wohl doch noch nach dem Leben trachteten., Nicht, etwa ob ihres Gilftgehaltes, sondern weil sie uns die Sicht versperrend, rücklinks in die Tiefe des Alpentales gerissen hätten.
So landete der Sack schnell auf den Knien meines Bruders oder bei mir, denn im Kofferraum wären die edlen getrockneten Beutestücke zu Krümeln zerdrückt worden, was vermutlich zu einer längeren Wein-Attacke meiner Mutter geführt hätte. Und so ertrugen wir die lange Fahrt mit einem stetigen Duft in der Nase, der uns bereits vor der Heimkehr die Zukunft unserer täglichen Mahlzeiten erahnen ließ.
Mein Bruder, gut fünf Jahre älter als ich, hatte sich in diesen Ferien schon ein wenig von der Familie abgesondert, ging er doch schon damals gemeinschaftlichem Familienglück eher aus dem Weg. Da im Bauernhof auch eine kleine Tischlerei war, hatte er sich in seinem künstlerischen und handwerklichen Geschick richtig austoben können, was das eine oder andere gekonnt gemachte Werkstück hervorbrachte, das nun auch noch unsere volle Fuhre beglückte.
Mit den Eltern erforschte ich nicht nur den Wald, auch der See und die Uferpromenade boten allerlei Abwechslung. Ich erinnere mich, dass man dort auch Wasserski laufen konnte. Zum Entsetzen meiner Ernährer stellten diese allerdings ernüchternd fest, dass eine Runde dieses Vergnügens genauso viel kostete, wie eine Übernachtung für vier Personen in unserem Bauernhof. So blieb alles bei der Betrachtung der für mich spektakulären Szene mit sitzendem Start vom Steg.
Dort saß eine junge Frau auf den Holzbrettern des selbigen, die Zugleine fest in der Hand und wartete auf den Start. Eigentlich hätte ihre attraktive Erscheinung besser nach Hollywood als in dieses Dorf gepasst, doch hier brachte sie sich in Pose. Die Leine zog an, die Arme wurden länger, der Po rutsche vom Holzsteg, und anstatt auf den Skiern davon zu rauschen machte sie mit einem spitzen Schrei einen fetten Bauchklatscher. Ob der Schrei nur ihrem Schrecken galt oder einem dicken Holzsplitter, den sie sich dabei in den Allerwertesten hätte ziehen können, entzog sich meiner Betrachtung.
Die Attraktion des Wasserskifahrens hatte mich schon beeindruckt, sah ich doch manchen Adonis auf dem See hinter dem Boot seine Kunststücke fahren. Und so begann in mir der Zweifel zu nagen, ob ich nicht doch einen etwas mutigeren Umgang mit dem Wasser wagen sollte.
Freischwimmer
Groß gewachsen für mein Alter war ich und noch schlank und rank dazu, sodass man leicht die Rippen zählen konnte, betrachte ich heute am Abend meines Lebens die Bilder von damals. Das brachte mir so manchen Vorteil im Sport ein, der bereits in der Grundschule zu einmal wöchentlich stattfindenden Ausflügen der Klasse in die unweit gelegene Turnhalle führte. Machte mir Geräteturnen ob meiner Körperlänge eher Freude, die mich leicht, z.B. beim Bockspringen, alle Hürden überwinden ließ, sah es bei den kürzer gewachsenen Kameraden schon anders aus. Besonders benachteiligt waren die kurzen Pummelchen, die allen Mut in einem kräftigen Anlauf zum überspringenden Bock zusammennahmen, den Allerwertesten dann aber doch nicht hoch bekamen, um schließlich mit der Brust krachend gegen die belederte Front des Bocks zu prallen, vor dem sie dann mutlos zu Boden gingen. Danach verweigerten einige dieser bedauernswerten Zeitgenossen, teils unter Tränen, die weitere Teilnahme an solchen Übungen, zumindest so lange, bis die Leistungsanforderungen auf ihr Niveau abgesenkt wurden.
Auch im Laufen reichten später meine Sprints zu so mancher Siegerurkunde, blieb ich doch locker um mehrere Zehntel oder gar ganze Sekunden unter den vorgegebenen Zeiten. Laufen war meine wichtigste Disziplin, denn die schnellen Beine waren meine Versicherung gegen so manche Ausfälle der Größeren, wenn ich es mit meinem lockeren Mundwerk, dem gerne freche Sprüche entwichen, mal wieder zu weit getrieben hatte.
Vor dem Wechsel zum Gymnasium erfuhr ich, dass dort zum Sport auch der Besuch des nahe gelegenen Hallenbades gehörte und man die Klasse in Schwimmer und Nichtschwimmer einteilte. Freche Sprüche absondern und dann wie ein Feigling im Nichtschwimmerbecken zu planschen, entsprach so gar nicht meinen Vorstellungen. Malte ich mir doch schon die Sprüche der anderen Schüler im besten Ruhrgebiets O-Ton aus, wie „Äh, große Fresse, aber im Pissbecken planschen“ wie das Nichtschwimmerbecken despektierlich genannt wurde.
So begab ich mich zur abgrundtiefen Verwunderung meiner Mutter eines Nachmittags per Fahrrad zum fünf Minuten entfernten Hallenbad, um mich dort Meter für Meter ins tiefere Wasser zu trauen, wobei ich mehrmals von einem Rand zum anderem schwamm, wohl wissend, dass meine Füße in jeder bedrohlichen Situation den gekachelten Grund finden würden. An der tiefsten Stelle, ich konnte kaum dort stehen, schwamm ich fünfzehn Minuten Bahn für Bahn, die Zeit, die man für die bademeisterliche Bescheinigung des Freischwimmers brauchte. Anschließend fragte ich den Mann mit der roten Trillerpfeife, wann ich dieses Zeugnis erwerben könnte. Gleich morgen um dieselbe Zeit wäre gut, dann müsse er ohnehin mal eine Trillerpause machen. Oder so ähnlich.
Tags darauf fand ich mich im großen Becken wieder, erst zögerlich am Rand bleibend, die Überlaufrinne in Griffweite, bis mich der Trillermann mit der roten Pfeife ermunterte in der Mitte des Beckens zu schwimmen, wobei mir das Überschwimmen der etwa vier Meter tiefen Sprunggrube doch etwas gruselig vorkam.
Doch nun war es geschafft, und zu Hause konnte ich mit Stolz den erstaunten Eltern mein Freischwimmerzeugnis präsentieren. Ein paar Monate später wurde dieses Zeugnis dann noch auf „Fahrtenschwimmer“ erweitert, was eine halbe Stunde Schwimmzeit ohne Berührung von Boden oder Beckenrand erforderte.
Auf dem Gymnasium merkte ich jedoch recht bald, dass das nur die halbe Miete war, wie man Defizite gerne umschreibt. In der ersten Sportstunde im Bad jagte der Sportlehrer uns alle zum Abschluss über das Ein-Meter- Brett, dass fast alle Klassenkameraden zu einem Fußsprung oder der berüchtigten „Arsch-Bombe“ animierte. Doch mich ergriff mal wieder die pure Angst, und so blieb ich vor dem mit einem Sisal-Teppich belegten Brett wie ein scheuendes Pferd vor dem Oxer stehen, um kleinlaut zuzugeben, dass ich mich nicht traue.
Ich war der letzte in der Reihe, sodass mein Versagen kaum jemanden aufgefallen war. Doch die Schmach nagte tief in mir und trieb mich die nächsten Nachmittage wieder ins Hallenbad. Ich wollte nur Kopfsprung üben, den die meisten meiner Klasse scheuten. Alles andere war für mich „Lilipuparilli“.
Also stand ich am Beckenrand, etwa eine Leiterstufe über dem Wasserspiegel und begann zu üben, was auch ganz gut funktionierte. Bis mich der Trillermann in seiner roten Badehose und mit seiner ebenso roten Pfeife erst einmal richtig anpfiff. Sprünge vom seitlichen Beckenrand seien verboten! Was mir auch später schmerzlich klar wurde als ich jemandem bei meinem Sprung die Kniescheibe aufs Schädeldach gerammt hatte. Meinem Opfer brummte der Kopf, und mich schmerzte das Knie. Der Trillermann, der ansonsten alles sah, hatte den Vorfall zum Glück nicht bemerkt und mein Mitschwimmer mir den Fauxpas großzügig vergeben.
Also begab ich mich erst zwischen die Startblöcke, um dann auch später von selbigen, aus etwa dreißig cm höherer Position, zu springen. Zögerlich folgte das Ein- Meter-Brett, doch schon bald nahm ich dieses mit Anlauf, um noch ein Stück höher zu springen. Ich war begeistert, mein Sportlehrer erstaunt, und meine Mitschüler enthielten sich respektvoll jeden Kommentars, denn ich sprang höher und weiter als alle anderen. Wenn das mit Mathe und den anderen Fächern auch so geklappt hätte, wären auch meine Eltern glücklich gewesen. Doch auf dieser Baustelle klappten bei mir nur die Fensterläden, wie der Berliner gesagt hätte. So oder ganz ähnlich.
Mit meinem Freund Klaus, dem Spross eines Arztes aus der Nachbarschaft, besuchte ich nun täglich das Hallenbad und bald waren wir die Könige auf dem Drei- Meter-Brett. Ein falsch gestarteter Sprung konnte einem schon mal beim Eintauchen die Arme verreißen, sodass man noch einen ordentlichen Schlag auf den Kopf bekam, denn springt man mit Schwung, kann der Aufprall aus dieser Höhe aufs Wasser ziemlich hart sein.
Irgendwann nahmen wir auch das Fünf-Meter-Brett in Angriff. Da standen wir nun und ließen erst einmal alle Sprungwilligen passieren, bis der rotbehoste Trillermann, der die Aktion akribisch überwachte, uns zu verstehen gab, entweder springen oder auf der Leiter runterkommen. Klaus wagte einen Fußsprung mit zugehaltener Nase, doch ich wollte entweder einen Kopfsprung oder gar nichts. So entschied ich mich für letzteres - und dabei ist es bis heute geblieben.
Ich denke, da war auch ein Stück Höhenangst dabei, die mich auch später im Beruf quälte, wenn ich etwa im fünften Stock außen auf einem wackeligen Baugerüst mit Aktenkoffer in der Hand herumturnen musste, weil das im Rohbau fertige Treppenhaus gerade an diesem Tag unpassierbar war.
Aber auch diese Höhenangst habe ich in Eigentherapie zu überwinden gelernt, und zwar bei einem Besuch auf dem Düsseldorfer Fernsehturm, dessen Scheiben der Besucherebene schräg von unten nach oben verlaufen. Wenn man mit den Füßen dicht an der Scheibe steht, ist der Kopf noch ein gutes Stück davon entfernt. So habe ich mich vorsichtig, quasi in Absturzstellung auf die schräge Scheibe gelegt, bis mein noch vorhandenes Resthirn gelernt hat, was passiert. Nämlich nichts. Rein gar nichts, nur dass man fast meint, in der Luft zu stehen. Seit dem geht es wesentlich besser. Nicht, dass ich nun ein Höhen-Junkie wäre, aber es macht mir nicht mehr so viel aus, und ich nehme es gelassen.
Bei einem Flug von Rhodos nach Düsseldorf traf es sich, dass der Kapitän ein guter Bekannter von uns war. So konnte ich den Jungens im Cockpit ein wenig die Zeit vertreiben, denn auch Mittelstrecke kann langweilig werden, ist man erst einmal auf Reisehöhe. Es war ein Tri Star der LTU, ich setzte mich auf den Rand des seitlich auslaufenden Panels, den Po direkt an der Scheibe, und 12.000 Meter unter mir zog die Landschaft vorbei. Das hat mir ob der Fernsehturmübung rein gar nichts ausgemacht. Gleiches konnte ich einige Jahre später auf dem Hin- und Rückflug zu den Kanaren wiederholen.
Aber zurück zu den Badefreuden. Im Sommer gingen wir auch gerne in ein etwas weiter gelegenes Freibad im Norden der Stadt, einer großen Anlage, bei der sich unser Wohlgefühl nicht so recht einstellen wollte. Meine Heimatstadt hieß damals Oberhausen, und die Mehrheit der Bevölkerung wurde von hart arbeitenden Menschen auf den Zechen, in den Kokereien und den Hütten gestellt. Das Jungvolk, das es im Hotel Mama nicht ausgehalten hat oder spätestens mit 21 Jahren dort „angelüftet“ wurde, verbrachte gerne die gesamten Sommerferien mangels pekuniärer Reisemöglichkeit mehr oder weniger in den umliegenden Freibädern. Auch ein Aufenthalt zu Hause war eher die Ausnahme, wohnte man doch erst einmal in einem Heim der Kolping Stiftung oder im Heim lediger Männer oder Frauen in sehr bescheidenen Verhältnissen.
So war uns der Aufenthalt im Freibad durch stetige Rangeleien und Schubsereien schnell verhagelt, ebenso wenn der Handtuch-Nachbar grundlos einen Streit vom Zaun brach. Die Männer mit der roten Trillerpfeife waren reichlich überfordert und hatten den Laden nicht im Griff, obwohl ständig irgendwelche Störenfriede hinausgeworfen wurden.
Meine erste Reise ans Mittelmeer, an die Costa Brava, eingeladen von meiner französischen Gastfamilie, mit deren Kindern wir zwecks gegenseitigem Erlernen der jeweils anderen Sprache ein privates Intercambio betrieben, lehrte mich diesen Teil der „Bounded Waters“ lieben zu lernen. Täglich hielten wir uns vom späten Vormittag bis zum frühen Nachmittag am Strand auf und schwammen soweit hinaus, wie wir uns das zutrauten. Das Wasser wurde langsam zu meinem geliebten Element.
Zwei Jahre später, ich zählte gerade 18 Lenze, wiederholte ich diese Reise zusammen mit meinen Freunden Rainer und Klaus, dessen Vater uns für diese Reise den Zweitwagen der Familie, einen Renault R4 zur Verfügung gestellt hatte. Ich konnte ein schönes Vier-Personen-Zelt mit Gummiboden beisteuern, und so kamen wir uns wie Könige vor, die je über eine Reisekasse von DM 400 verfügen konnten. Der Strand in La Escala an der Costa Brava war damals noch wenig besucht, auch fanden wir einen kleinen vorgelagerten Felsen direkt vor unserer Strandbasis, von dem wir wie die Teufel Sprünge aus bis zu drei Metern Höhe ins kühle Nass machen konnten. Erst der einbrechende Abend wie der aufkommende Hunger trieb uns aus dem Wasser. Später ging es in die Disco, wo wir uns für fünfzig Pfennige den ganzen Abend an einer Cola mit einem für unsere Verhältnisse riesigem Glas Bacardi festhalten konnten.
Das Getränk hieß „Cuba Libre“. Und so schmeckte es auch: wie endlose Freiheit.
The Flying Dutchman
Die Möglichkeiten in irgendeiner Weise in Oberhausen Wassersport zu betreiben, beschränkten sich aufs Schwimmen, auf Wasserball oder den Eintritt in den Ruderclub, dessen Anwesen an den Rhein-Herne-Kanal grenzte. Auf diesem verkehrten Frachtschiffe und zum Teil noch Schleppverbände, die beide gerne von jungen Männern in Ihrer Freizeit angeschwommen wurden, um auf diese zu klettern, lagen sie nur tief genug im Wasser. Der anschließende Kopfsprung ins Wasser, möglichst weit weg vom Schiff, war auch eine Mutprobe, die so mancher Halbstarke mit heftigen Blessuren oder gar mit dem Leben bezahlte. Die Kapitäne nahmen es mit stoischer Ruhe, konnten sie doch eh nichts dagegen unternehmen. Meines Erachtens waren es dieselben Typen, die gerne von den Bademeistern der Freibäder hinausgeworfen wurden, wie bereits erwähnt.
Also beschränkte sich die sportliche Freizeitbeschäftigung meiner Clique auf das Tennisspiel und den Gang zum Hallenbad. Tennis spielte ich im Werksclub meines Vaters, der für uns Jugendliche beitragsfrei und für mich gut mit dem Rad in zwei Minuten zu erreichen war. Die Trainerstunden, die uns ein Spieler der A-Mannschaft geben sollte, verkamen zur Farce, und so spielten wir die Nachmittage mehr schlecht als recht, bis wir am späten Nachmittag die Plätze für die wirklichen Tennisspieler frei machen mussten. Das Clubhaus wurde uns zur zweiten Heimat, heute würde man sagen, hier konnten wir bei guter Musik richtig abhängen und chillen.
Mein Freund Klaus kam aus einem kurzen Urlaub am Wörthersee zurück und hinterließ durch seine Erzählungen in meinem abhängenden und chillenden Hirn einen Gedanken, der dort wie ein Floh hin und her sprang, um sich dann irgendwann richtig einzunisten.
Er hatte in diesen Ferien einen Segelkurs belegt und auf einem „Flying Dutchman“ gesegelt, einer damals olympischen Klasse, einer etwa 150 Kilo schweren Zwei-Mann Jolle. Sorry, korrekterweise müsste ich sagen, einer Zwei-Segler_innen tragenden Jolle, aber ich lasse mir von niemandem jener Sprachtyrannen beziehungsweise Gendergemeinde - egal welchen angeborenen oder frei gewählten Geschlechtes - unsere so schöne und präzise deutsche Sprache verdrehen.
Jedenfalls nannte Klaus nun einen Binnen-Segelschein sein eigen, und was er über die zwei Wochen berichtete, weckte meine Neugier, um nicht zu sagen mein Begehren. Er erzählte vom Segeln an sich und den Seglern, die zwar nicht elitär, aber auch nicht mehr ganz bodenständig waren, jedoch sicher meinen Spähern schon weit entrückt. Stand dieser Sport doch jenseits der finanziellen Möglichkeiten meiner Familie, auch räumlich war der Baldeneysee in Essen als nächstes Binnengewässer für mich verkehrstechnisch kaum erreichbar.
So vermischten sich in meinem jugendlichen Kopf die Erinnerungen an die Wasserski übende „Lady“ am Weissensee und die Erzählungen von Segel-Regatten und rauschender Fahrt unter weißem Tuch sowie geselligen Abenden an der Club-Bar in angemessenem Outfit.
Seinerzeit war all das für mich keine Option, aber der Floh im Ohr hatte seinen Platz in meinem Hirn in einer der hinteren Ecken gefunden, wo er sich von da ab versteckt halten sollte.
Erste Versuche auf gemietetem Kiel
Viel Wasser ist inzwischen den Rhein heruntergeflossen, will heißen eine lange Zeit vergangen. Meine Schulausbildung ist abgeschlossen, das Studium der Betriebswirtschaft hatte ich zugunsten der Selbstständigkeit im zarten Alter von neunzehneinhalb Jahren vorerst verschoben, um es irgendwann ganz aufzugeben, denn das Geschäft, das ich zusammen mit meinem Bruder angefangen hatte, entfaltete ungeahnte Dynamik. Unser gemeinsamer Job war es, Apotheken einzurichten, später auch Krankenhäuser und Arztpraxen.
1973 lerne ich erst als Kundin, dann als die große Liebe meines Lebens, meine Frau bei der Einrichtung ihrer Apotheke in Düsseldorf kennen. Wir schreiben inzwischen das Jahr 1974, etwa sieben Jahre, nachdem sich dieser Floh in meinem Kopf eingenistet hat, und machen unseren ersten gemeinsamen Urlaub. Unser Ziel heißt Hotel Maritim in Timmendorf an der Ostsee.
Für mich der erste richtige Sommerurlaub mit Erholungscharakter seit etwa fünf Jahren, für meine „Verlobte“ ein mittlerer Schock, hatte sie doch die letzten Sommer in Dorfanlagen des Club Med verbracht, wo es nach damaligen Maßstäben äußerst locker und unkonventionell zuging. Und nun dieses stocksteife Hotel, zum Teil von „Grufties“ bevölkert, vom Krawattenzwang zum Dinner eingezwängt, zudem von Personal bewirtschaftet, dem man zum ersten Platz bei der Wahl „Deutschland sucht die Super Spaßbremse“ gratuliert hätte.
Sie ließ sich nichts anmerken, aber manchmal hatte sie schon das Gefühl, sie sei eine Katze an meiner Seite, die man am Schwanz festhält. Deshalb lockerten wir den ganzen „Zinnober“ mit einer mehrtägigen Fahrt nach Kopenhagen auf, was uns vom Kurlaub zum Urlaub verhalf. Dazu trug auch Käp`n Störtebeker bei, den wir nach unserer Rückkehr aus Kopenhagen kennen lernten.
Er machte jeden Tag mit seinem gleichnamigen Kutter an der Seebrücke vor dem Hotel fest, im Schlepptau zehn oder gar mehr Segeljollen, die er zur Miete feilbot. Als wir uns seinem alten Kutter näherten, drangen aus seinem weißen Vollbart Worte die so ähnlich klangen wie: „Nuh ihr alten Seehunde, wollt ihr seeeegln or seeeegln läääärn“?
Eher letzteres, denn wir hätten Null Ahnung. „Moit nix, ich giv euch da nen Piefke met, der zeicht euch dät.“ Und schon sprang ein etwa zehn- oder elfjähriger Junge in das letzte Boot, manövrierte es geschickt an den Steg und ließ uns einsteigen. In weniger als einer halben Stunde erklärte er uns Segeln am Wind, mit halbem Wind oder raumschots, wie eine Wende und eine Halse zu fahren seien. Wir hatten noch gar nichts so wirklich kapiert, da manövrierte er die schwere Kieljolle schon am Kutter vorbei und sprang behände auf denselben, um uns unserem Schicksal genüsslich grinsend zu überlassen.
Es klappte besser als wir erwartet hatten, und so entfernten wir uns ein Stück weit am Wind von der Küste, um diese nach einer Wende wieder anzusteuern. Nur dass wir nicht dahin kamen, wohin wir wollten. Damals wussten wir noch nichts davon, dass man mit halbem Wind grundsätzlich immer hin und zurück kommt ohne zusätzliches Manöver. Und ein raumschoter Kurs, den wir hätten anlegen müssen, war als Möglichkeit noch nicht in unser „Landratten-Hirn“ vorgedrungen.
So kamen wir, als unsere Zeit um war, wohl einige hundert Meter vor dem Kutter und der Seebrücke in flaches Wasser in Strandnähe, wo mir nichts besseres einfiel, als die „Plünn“ runterzunehmen, will heißen die Segel einzuholen und das Boot gegen den Wind im brusttiefen Wasser seinem Ziel entgegen zu schieben. Alles natürlich sehr zur Belustigung der Menschen auf der Promenade und am Strand, die das urkomisch fanden. Käpt`n Störtebeker und sein Piefke feixten über alle Backen, doch uns war es egal, spürten wir doch etwas in uns, das gerade das Fundament für eine lange Boots- und Segelkarriere gelegt haben könnte.
Der spaßbremsende Kravattenkontrolleur am Restauranteingang des Hotels bekam unsere gute Laune an diesem Abend auch zu spüren. Als er uns wegen meines fehlenden Halsbinders am Eintritt hindern wollte, sagte ich ihm, er könne mir ja die seine geben, schob ihn beiseite und wir gingen zu unserem Tisch, während er mit offenem Mund und rollenden Augen wie angewurzelt im Rahmen der Großen Doppeltür stehen blieb.
Manchmal gibt es eben doch die Duplizität der Ereignisse. Zurück zu Hause erfahren wir, dass sich mein Bruder und seine Frau bei einer Tour durch das holländische Friesland auch mit dem Thema Boot beschäftigt hatten. Nicht dass sie es ausprobiert hätten, aber sie brachten die Prospekte von einigen Motorboot Vercharterern mit. Diese in Zeiten ohne Internet aufzuspüren, wäre sicher keine leichte Aufgabe geworden und mit Recherchen in verschiedenen Fachzeitschriften verbunden gewesen, deren Existenz uns zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt war. Auch fiel mir auf, dass man keinen Führerschein benötigte.
Oh, da schießt es mir heiß durch den Kopf: Darf man heute im Konsens mit der Political Correctness überhaupt noch Führerschein sagen? Sind die ersten beiden Silben dieses Wortes nicht hoch verdächtig? – Nein, rufe ich den
Sprach-Terroristen zu! Ich spreche, wie ich es gelernt habe …und sage nicht Fahrerlaubnis.
Also zurück nach Holland. Schnell wurden wir uns am Telefon mit einem Vermieter über die Anmietung eines etwa 9 Meter langen Stahl-Motorbootes vom Typ Wadden-Kreuzer für das kommende Wochenende einig. Bei der Führerscheinfrage wurden wir wie folgt belehrt: So wie der Texaner von Geburt an das Recht hat, sein Schießeisen nicht nur auf dem Klo oder im Bett zu tragen, so ist es dem Holländer qua Geburt in die Wiege gelegt, wahlweise sein Leben auf dem Land oder auf dem Wasser zu führen, wozu er zwangsläufig auch ein Boot bewegen muss. So oder ganz ähnlich lautete die uns befriedigende Antwort.
Am folgenden Wochenende bestiegen wir vier (wir beiden Brüder samt unseren Frauen) das behäbig schwankende Gefährt und erhielten eine kurze Einweisung im besten Holland-Deutsch: „Schau nach die Welle, dass der immer genug Fett hat und wenn da was piept, dann ist die Kühlwasser zu. Und jetzt könne sie losfahre.“ Was wir dann auch vorsichtig taten.
Es war herrlich, durch die stillen Kanäle zu gleiten und dabei zu lernen, wie ein Boot reagiert, wie man es zum Aufstoppen bringt, wie es in Kurven auf dem Ruder liegt oder wie man Anlegemanöver fährt und auch wie sich zwei Boote an engen Stellen am besten passieren. In den ruhigen Gewässern rund um das Ijsselmeer ließ sich unser „Holländisches Bügeleisen“, wie dieser metallene Bootstyp spöttisch von echten Yachties bezeichnet wird, bestens manövrieren.
Ich denke, an dieser Stelle bin ich dem eher landverbundenen Leser, vom Yachtie gern „Landratte“ genannt, einige Erklärungen zu den verschiedenen Motor-Bootstypen schuldig, die sich grob gesagt in drei Kategorien unterteilen.
Da sind als erstes die Verdränger, zu dem auch unser Wadden-Kreuzer gehörte, die einen kleinen Wasserberg vor sich herschieben, je schneller sie sind. Doch sie können nie schneller fahren als ihre theoretische Rumpfgeschwindigkeit, ab der sich das Heck beginnt festzusaugen und abzutauchen. Dann geht es Richtung Neptun und die Reise ist zu Ende. Nicht anders verhält es sich, wenn man mit einem solchen Boot, dass für ruhiges Wetter gebaut ist, in schwere See gerät. Es gibt aber auch hochseetaugliche Verdränger. Mit diesem hier das flache Ijsselmeer bei Windstärke fünf zu queren, würde ich auch heute noch als nautische Herausforderung bezeichnen. Der Schmähbegriff „Bügeleisen“ kommt daher, dass diese Boote trotz einer Achterkabine recht flach gebaut sind, um die vielen Brücken im Land der Kanäle unterfahren zu können und ihre Silhouette ein wenig diesem Haushaltsgerät ähnelt.
Die zweite Kategorie sind die sogenannten Halbgleiter, meist aus GFK, also Kunststoff gebaut, und somit wesentlich leichter. Der Vorfuß des Kiels wird nach hinten flacher bis eben noch ein leicht V-förmiges Rumpfende erkennbar ist. Diese Boote sind meist hoch motorisiert, steigen bei schneller Fahrt mit dem Bug ein Stück weit aus dem Wasser und liegen mit den letzten zwei Dritteln ähnlich einem Surfbrett auf der Oberfläche des Wassers. Still liegend reicht hier schon ein wenig Seitenwind, um das Boot auf Drift zu bringen, während der sichere Verdränger mit langem Kiel sich nur wenig und dann auch sehr behäbig auf den ungewünschten Weg machen würde.
Die dritte Kategorie bilden die Gleiter, meist kleinere Boote unter acht Metern, mit noch flacherem Rumpf, die bei schneller Fahrt fast nur noch mit dem letzten Drittel des Hecks aufliegen. Dazu zählen auch die Rennboote, die fast nur noch mit der Schraube, also dem Propeller im Wasser liegen. Diese, ihrer Form wegen so genannten Dreikantfeilen, können sich bei schnellen Rennen auch schon mal in die Luft erheben und dem Steuermann bei einem Überschlag das Genick brechen.
Soweit die kleine Motorboot-Kunde, die uns aber selbst am ersten Tag unseres Charterglücks noch unbekannt war. Das im Übrigen ein jähes Ende zu nehmen schien, als wir auf dem Heimweg zum Bootsanleger plötzlich eine Hand aus dem trüben Wasser des Kanals ragen sahen. Bitte jetzt keine Wasserleiche war unser erster Gedanke, doch ignorieren konnten wir das nicht, und so stoppten wir das Boot neben der wie nach Hilfe greifenden Hand auf. Mit dem Enterhaken bekamen wir die Extremität des vermeintlich Ertrunkenen zu fassen, um schnell festzustellen, dass sich ein Witzbold einen Schabernack erlaubt hatte. Es handelte sich bei diesem „Leichenteil“ lediglich um einen schwach aufgeblasenen, hautfarbenen Gummihandschuh mit einem kleinen Gewicht am Ende.
Unseren Liegeplatz für die Nacht fanden wir am Anleger eines Hotels, in dem wir auch nächtigten. Obwohl es auf dem Boot auch entsprechenden Platz gegeben hätte, so wollten wir uns doch für nur eine Übernachtung nicht „häuslich“ auf ihm einrichten. Das Abendessen auf der Terrasse dieses Hauses entpuppte sich als wenig kundenorientiert. Auf die Frage nach einem abschließenden Dessert wurde uns wieder in bestem Holland-Deutsch beschieden: „Die Koch ist vor 10 Minuten weggegangen. Da hätten Sie früher bestelle müssen. Nee, an die Eis-Truhe kann ich nicht ran, ist abgeschlossen. Nee, Schokolade habe wir nicht, musst Du in die Supermarket kaufen, am Mondtag.“ Danke, gute Nacht, war auch so ein schöner Tag, den wir am Sonntag wiederholten.
Zwei Wochen später buchten wir wieder ein Boot für ein Wochenende, doch leider war unser schöner Wadden Kreuzer nicht verfügbar. Man habe eine knapp 11 Meter lange Swin Patio, die wir zum selben Preis mieten könnten, sie habe sogar Schlafplätze für acht Personen. O.K. gebucht.
Dieses Schiff, in Militärgrau lackiert, baute sehr flach, passte also auch unter niedrigen Brücken hindurch. Nicht gerade eine Schönheit, aber wir wollten ja fahren und üben. Am Nachmittag legten wir in einem kleinen romantischen Hafen an, machten einen Stadtspaziergang bei auffrischendem Wind. Wieder am Boot angekommen, stieg ich über, um schon mal den Motor anzulassen, während mein Bruder und unsere beiden „Holden“ sich um die Leinen kümmern wollten.
Ich starte den Motor, der aber auch beim zigsten Mal nicht anspringen wollte, während meine Begleitung, noch an Land stehend, die Leinen loswarf, was man besser von Bord aus machen sollte. Der aufgefrischte Wind trieb mich nun von der Kaimauer des Hafens fort in Richtung der Boote auf der anderen Hafenseite. Schon fast bei diesen angekommen, also wirklich erst dann, bemerkte ich, dass der Dekompressionshebel zum Abstellen der Maschine nicht in der richtigen Stellung stand und so konnte ich in buchstäblich letzter Sekunde verhindern, den anderen Schiffen die Reling zu verbiegen oder eine Positionslaterne zu zertrümmern. Die flache Bauweise der Swin Patio hatte ein Übriges getan, dass die Drift nicht noch schneller Fahrt aufnahm. Am Kai standen meine drei Mitstreiter und begriffen noch nicht so recht, was da schiefgelaufen war, als ich das Schiff wieder dorthin zurück manövriert hatte. Uns war es eine Lehre, die uns bis ans Ende unserer aktiven Segelzeit begleitete. Erst alles klar zum Ablegen, dann Leinen los.
Der Herbst hatte sich bereits wettermäßig angekündigt, und unsere dritte Charter endete bereits am ersten Tag, also am Samstag unserer Ankunft, und zwar buchstäblich im Wasser. Selbiges kam ab Mittag von oben. Seine Lordschaft hätte zu berichten gehabt: „It rained cats and dogs.“ Ständig waren alle Scheiben so beschlagen, dass man kaum die Betonnung und andere Wegmarken erkennen konnte. Musste man an Deck, kam man in Ermangelung von Ölzeug pitschnass wieder nach innen, was die Scheiben noch mehr beschlagen ließ. Das Boot, ein etwas abgerockter Eista Kreuzer, Typ Bügeleisen, lud auch nicht unbedingt zum Verweilen ein, sodass wir beschlossen, die Bootssaison von jetzt auf gleich bei einem guten Essen in der Heimat ausklingen zu lassen.
Das Fundament für weiterführende Wünsche war nun gelegt, bei meiner späteren Frau und mir vielleicht etwas ausgeprägter als bei meiner Schwägerin und meinem Bruder. So träumten wir uns der ersten Bootsmesse im Januar in Düsseldorf entgegen, die größte ihrer Art, wie wir später im Vergleich mit ausländischen Veranstaltungen feststellen sollten. Dort wollten wir uns auch nach Möglichkeiten umschauen, die Grundzüge des nautischen Handwerks zu erlernen.
Hatteras
Ende Januar waren wir wieder zu viert unterwegs und betraten die erste Messehalle, wobei wir gleich vor einer imposanten Yacht der Hatteras Werft aus den USA stehen blieben. Etwa zwölf Meter lang und mit dem Kiel knapp über dem Hallenboden stehend, maß die Deckshöhe sicher an die vier Meter. Wir wussten nichts über Yachten, schon gar nichts über die solcher Bauweise und Größe. Trotzdem erklommen wir die Treppe, wo uns eine top gestylte Hostess begrüßte und uns wissen ließ, dass es ihr eine Ehre sei, uns das Schiff zu zeigen.
Wir lugten vorsichtig in jede Kabine, die Nasszellen und die Pantry, und waren vom Komfort, ja Luxus, den der Salon ausstrahlte, erst einmal geblendet. Wieder im Cockpit angekommen, fragte die Schöne, ob wir denn an einer Ausführung mit oder ohne Flybridge interessiert seien. Fly-was-bitte? Fragte der Floh des Flying Dutchman in meinem Kopf, der diesen Begriff der Fabelwelt zuordnete. Och, konterte ich noch schnell, da wären wir noch nicht so recht entschieden. Wo denn der pekuniäre Unterschied liege. Nun war die Schöne etwas ratlos ob ihrer fehlenden Lateinkenntnisse, bis wir die Frage dahin präzisierten, was denn den Mehrpreis einer solchen Ausstattung ausmache.
Ja, so ab DM 35.000, je nach der Anzahl der Tochterinstrumente, die verbaut werden müssten. Schnell war uns bewusst, das wir hier im falschen Film waren, denn das gesamte Unterfangen hatte eine Endsumme auf dem geistigen Zettel stehen, der die Gründungkosten der Apotheke meiner zukünftigen Frau, übrigens der allerbesten aller Ehefrauen, wie Ephraim Kishon gesagt hätte, locker um hundert Prozent übersteigen würde.
Zur Enttäuschung der Schönen stiegen wir die Treppe wieder hinab, mit der lakonischen Bemerkung, wir wollten uns erst noch einen Überblick über das Angebot der Messe verschaffen. Jetzt irrten wir zunächst einmal etwas desillusioniert durch die Hallen, hatten wir doch im Hinterkopf, dass die Preise der „holländischen Bügeleisen“ so bei fünfzehn Prozent dessen anfangen, was Hatteras da aufrief. Aber mit jedem Gespräch an welchen Messeständen auch immer lernten wir dazu und wurden keineswegs dümmer.
Auch fanden wir einen Anbieter für nautische Schulungen. Die Navigationsschule West-Josten bot Kurse zum amtlichen Motorbootführerschein in Düsseldorf an. Josten war ein kauziger untersetzter Typ, der auch später stets im blauen Zweireiher mit Goldknöpfen und Kapitänsmütze auftrat, assistiert von einer drallen Blonden, die offensichtlich das reichhaltige Leben mit ihm teilte. Seinen Job machte er gut, hämmerte er uns doch die Regeln zum Teil mittels unvergesslicher Eselsbrücken ein, wie beispielsweise „rot-weiß-rot, das Lotsenboot“ oder „weiß über grün, lass ihn ziehen“, was ein Wegerechts-Schiff meint, wie Kabelleger oder andere „Behinderte“.
Wenn man frisch Vermählte fragen würde, was habt ihr denn so auf eurer Hochzeitsreise gemacht, bekäme man sicher grinsend die Antwort: „Öh, blöde Frage“. Fragt man uns danach, lautete die Antwort: „Für den Bootsführerschein gepaukt“. War aber trotzdem schön, auch wenn ich dem Hotel Oasis auf Gran Canaria an jedem Eingang einen seiner fünf Sterne mit dem Schraubendreher entfernen musste, denn der Laden war grottenschlecht, stand er doch ein halbes Jahr vor der Renovierung. Um mich heute, nach fast fünfzig Jahren, nicht noch der Rufschädigung schuldig zu machen, verzichte ich auf die Beschreibung unschöner Details, die mein handwerkliches Wirken veranlasst hatten.
Zurück zur Bootsmesse. Diese besuchten meine Frau und ich an den nächsten Tagen ein weiteres Mal, um für unser Budget etwas passendes zu finden, gefühlte einhundert Klassen unter einer Hatteras, so im preislichen Bereich eines Mittelklassewagens. Bei einer Firma aus Mann- heim wurden wir fündig und unterschrieben einen Kauf für ein 6 Meter offenes Sportboot amerikanischer Herkunft mit Lieferzeit von drei Monaten. Aber schon bei unserer unqualifizierten Frage der Überführung nach Düsseldorf, ob das auf eigenem Kiel möglich sei, outeten wir uns als absolute Greenhorns, was die Chefin der Firma nur mit den Augen rollen ließ. So etwas macht man per Bootstrailer, aber das wussten wir erst später!
Als wir ein paar Stunden danach nochmals am Stand der Firma vorbeikamen, um noch ein paar weitere Dinge zu regeln, erfuhren wir, dass der Liefertermin doch wohl erst nach dem Sommer sein würde. Wir waren froh, den Vertrag stornieren zu können, um die Sommerferien zu retten. Und ich denke, die Chefin war es auch, uns „Dummbacken“ wieder los zu sein.
In dieser Halle der kleinen Boote trafen wir danach einen Händler, der sowohl amerikanische als auch europäische Firmen im Programm hatte. Er zeigte uns ein Boot der belgischen Firma Ecofiber, etwas länger als sechs Meter, mit kleiner Schlafkabine und einem sinnvollen Cockpit, das mit einer Persenning komplett geschlossen werden konnte. Eigentlich 50 % über dem Budget, aber da er dieses Modell nicht weiter führen wollte, lieferte er zum gleichen Preis wie die Chefin mit den rollenden Augen, und das mit einem190 PS Mercury Motor. Wow, was für ein Deal, und das inklusive Anlieferung in Düsseldorf.
Der Wunsch nach dem noch fehlenden Liegeplatz ließ uns die nächsten Wochenenden alle Düsseldorfer Boots- und Yachtclubs abklappern, aber alle zeigten sich wenig engagiert. Nichts frei, Warteliste, mal sehen wie das Frühjahr wird usw. So ernüchternd lauteten die meisten Antworten. Es war schon desillusionierend, bis wir auf Heinz im Yacht Club Graf Spee trafen, der meinte im späten Frühjahr bekäme er was frei und bis dahin könnte er eine Interimslösung im Nachbarclub arrangieren. In ihm wurden wir Mitglieder, und die schönen Jahre des Clublebens sind uns bis heute in allerschönster Erinnerung. Auch mit dem Liegeplatz hat alles funktioniert.