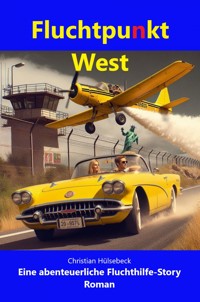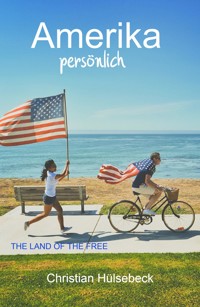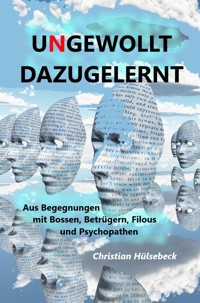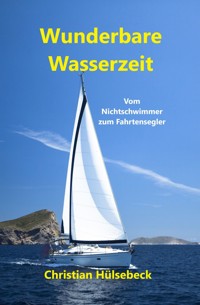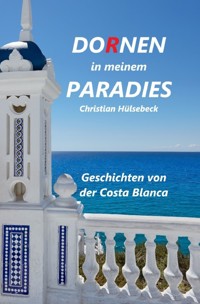Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Autor, Christian Hülsebeck, 1948 in Dresden in der DDR geboren. Mit knapp drei Jahren floh seine Familie in den Westen. Nach dem Krieg der Kampf ums Überleben. Später der Kampf um Anerkennung, Aufstieg, Gerechtigkeit. Dazwischen jede Menge Ecken und Wendungen auf dem Weg nach oben. Doch das Wirtschaftswunder- Gen jener Zeit, sowie ein bereits in jungen Jahren unbändiger Wille, verhalfen zu ungeahntem Auftrieb. Cleverness und Kreativität, gepaart mit Bescheidenheit, Demut und Geduld im Gepäck, auf einem stabilen Fundament von Recht und Ordnung fußend, öffneten immer wieder neue Türen. So blieb für den Jungen von drüben eine beachtliche Karriere unausweichlich. Frech, amüsant, mit trockenem Humor erzählt. Geschmückt mit viel Lokal-Kolorit, nicht nur aus dem Ruhrgebiet, nimmt er den Leser mit auf eine Zeitreise durch ein halbes Jahrhundert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Hülsebeck
GERADEAUS GEHT'S UM DIE ECKE
Die Geschichte eines Babyboomers
aus einem halben Jahrhundert
1948 - 1998
Für meinen Bruder
1943 - 2019
Alle Rechte vorbehalten.
Copyright © Christian Hülsebeck 2021
überarbeitet 2023
Inhalt
Vorwort
Die Flucht
Die Familie
Kriegszeiten
Von Berlin ins Ruhrgebiet
Die ersten Jahre in Oberhausen
Der Umzug
Familie und Gesellschaft
Grundschulzeit
Was meinen Bruder so umtrieb
Gymnasium
Tanzstunde
Das Moped
Abschied von Treu
Wintersport
Die mittlere Reife
Das erste Auto
Schule Oberstufe
Mein Bruder kommt zurück
England
Life must go on
Schon fast ein Bein im Beruf
Ferienjobs
Ein Jahr Unternehmer zur Probe
Weichenstellung
Die eigene Prodiktion
Marketing
Wieder Familie
Weiteres Wachstum
Arbeitsteilung
Messe-Beteiligungen
Erneutes Wachstum
Noch eine Weichenstellung
Durchatmen
Ein neues Konzept
Und zwischendurch mal Ferien
Neue Bundesländer
Besser Wessis
Russland und GUS
Restitution
Nur Fliegen ist schöner
Von EDV bis PR
Königlicher Auftrag
Abschied vom Unternehmen
Dank
VorwortDer Titel dieses Buches Geradeaus geht´s um die Ecke entspricht meinem Lebensweg. Er verlief entgegen anfänglicher Erwartungen und öfters aufkommender Zweifel zwar äußerst erfolgreich, seine Ziele waren allerdings selten auf geradem Wege zu erreichen. Ein Weg, der sich oft unerwartet verzweigte und dessen Windungen und Ecken erst zu dem führten, was ich daraus machen wollte und letztlich auch konnte.
„Niemand hat die Absicht, ein Buch zu schreiben.“ Das hätte ich vor kurzem noch jedem gesagt, in Anlehnung an Walter Ulbricht, der einst den bevorstehenden Mauerbau in Berlin mit dem Satz leugnete „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen“. Nicht selten bin ich, sei es im Spaß oder im Ernst, aufgefordert worden, meine Erlebnisse und die Vielzahl von Anekdoten, die ich zum Besten geben konnte, einmal aufzuschreiben. Aber nie war mir wirklich danach.
Die Welt befindet sich seit einem Jahr in der Corona-Pandemie. Viele Menschen sind vom Lockdown geplagt, können ihrem Beruf nicht nachgehen und dürfen allenthalben darüber nachdenken, wie man das Sinnlose mit dem Unnützen verbinden könnte.
Auch ich nutze diese Zeit für eine Retrospektive meines Seins und Schaffens und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es für Außenstehende von amüsant bis horizonterweiternd alles Mögliche sein könnte, an meinen Erfahrungen teilzuhaben.
Die Geschichte meines Lebens beginnt 1948, als Teil der Generation Babyboomer, im Dunkel des damals neuen Deutschen Bauern- und Arbeiterstaates. Und sie endet, was meine berufliche Laufbahn betrifft, vorläufig 1997 im Ruhrgebiet als Aussteiger aus einer erfolgreichen Unternehmerkarriere.
Die Flucht
Die Fahrkarten für die Bahnreise sind gekauft und liegen für die Flucht der ganzen Familie bereit. Diese besteht aus meinen Eltern, meinem gut fünf Jahre älterem Bruder und mir, der ich gerade zwei Jahre alt bin, so dass ich das hier Berichtete nur aus den Erzählungen meiner Eltern und Altvorderen wiedergeben kann.
Wir schreiben das Jahr 1951. Mein Vater war unversehrt und nach kurzer Gefangenschaft bei den Engländern aus dem Krieg zurückgekehrt, um zu seiner jungen Familie nach Dresden zu kommen, wo er als Ingenieur in verschiedenen Konstruktions-büros Arbeit gefunden hatte. Diese Arbeit ernährte die Familie mehr schlecht als recht. Hunger und Mangel waren wohl unsere täglichen Begleiter. Aber das war in jenen dunklen Zeiten das Schicksal der meisten Menschen, besonders in der sowjetisch besetzten Zone, wie die spätere DDR damals genannt wurde.
In Dresden traf Vater auch auf Max, einen Kameraden aus dem Krieg, der meinem Vater sehr verbunden war. Max war Kommunist und den Häschern der Gestapo oder SS mehrfach entkommen, da Vater ihn als sein Vorgesetzter immer dann auf Dienstreise schickte, wenn sich ankündigte, dass nach ihm gesucht wurde, bzw. eine so genannte Säuberungsaktion bevorstand.
Als Offizier war Vater in der Partei. Das ging damals nicht anders. Wie engagiert, warum, weshalb, das habe ich nie hinterfragt. Als ich dafür alt genug war, wollte ich ihn nicht damit behelligen und später hatte ich andere Probleme, die mir wichtiger erschienen. Denn mit kaum 20 Jahren bin ich in die Selbständigkeit gestolpert und hatte schnell Verantwortung für viele Mitarbeiter zu tragen. Aber dazu später.
Besagtem Max also verdanke ich, dass mein Leben so erfolgreich verlaufen konnte. Denn aufgrund seiner Vor- oder sollte ich besser sagen Weitsicht und schnellen Hilfe waren die Fahrkarten für unsere Flucht vorbereitet. Wären die Weichen damals nicht in jene Richtung gestellt worden, hätte ich wohl ein Leben in der DDR führen müssen.
Max, der als Kommunist unter dem Naziregime überlebt hatte, war in seiner Heimatstadt Dresden schnell in die Kader der Stadtpolitik vorgestoßen und hatte Zugang zu internen Informationen. Auch zu denen, die Aufschluss über Listen mit unliebsamen Leuten gaben, wie beispielsweise ehemaligen Partei-Mitgliedern und Klassenfeinden, zu denen auch meine Familie gehörte. Schließlich war meine Mutter die Tochter eines Fabrikanten, der im Krieg auch Rüstungsgüter herstellen musste.
Vater und Max hatten sich zufällig getroffen und standen nun schon ein halbes Jahr in Kontakt. Häufig versuchte Max, meinen Vater zu überreden, in die kommunistische Partei einzutreten, um seinen Zugehörigkeits-Status zum Klassenfeind zu tilgen. Aber nein, so verbiegen wollte sich Vater nicht, und Max blieb nichts anderes übrig, als meinem Vater genauso den Rücken frei zu halten, wie dieser es für ihn im Krieg gemacht hatte. Allerdings war dieses Spiel gewagt und zeitlich begrenzt. So kamen schließlich die Fahrkarten in unseren Besitz, zusammen mit einer ausgeklügelten Fluchtroute und Legende zur Reisebegründung. Dazu zwei gepackte Koffer sowie zwei vorbereitete Rucksäcke mit dem Allernötigsten.
Für meinen Vater wurde der Alltag immer gefährlicher. Zwei Mal bereits wurde er von den Kommunisten inhaftiert und mehrfach lange verhört. Eine Schuld konnte man ihm allerdings nicht nachweisen. Eines Abends im Februar aber war es dann so weit. Es klingelte an der Tür, und Max gab das Zeichen, dass man Vater mit ziemlicher Sicherheit am nächsten Morgen abholen käme. Dann gäbe es kein Zurück mehr für ihn. Nicht auszudenken für unsere kleine Familie.
Nun griff Plan B. Wenn es auch keine Nacht- und Nebelaktion war, so war es an jenem Morgen doch eisig und die bittere Kälte griff den Beteiligten gewiss ans Herz.
Koffer und Kinder kamen auf einen kleinen Schlitten, und der Bahnhof war in einer Stunde erreicht. Nicht ohne einen Brief meiner Großmutter väterlicherseits aus Güstrow in der Tasche zu haben, der von einer schweren Krankheit und ihrem möglichen nahen Tod kündete.
Den Zug konnte die Familie unbehelligt erreichen, für Berlin war der Fluchtplan aber schon etwas riskanter gestrickt. Dort fuhr der Anschlusszug nach Güstrow von einem Bahnsteig, dessen zweites Gleis von den S-Bahnen benutzt wurde, die nach Westberlin fuhren. Deshalb kontrollierten Polizisten der sogenannten Volkspolizei, kurz VOPO genannt, diesen Abschnitt besonders scharf. Doch auf besagtem Bahnsteig hatten wir großes Glück und keinerlei Kontrollen zu überstehen. Und anstelle in den Zug nach Güstrow zu klettern, ging es so schnell wie möglich in die S-Bahn Richtung Westen.Zu dumm nur, dass die VOPOs ebenfalls in diese S-Bahn einstiegen, was die Familie zwang, sich so zu postieren, dass unsere Kontrolle zum spätestmöglichen Zeitpunkt stattfinden würde. Und das hoffentlich schon auf einem Streckenabschnitt, der zum Westen gehörte. Als wir dann an der Reihe waren, hat mein Vater der Überlieferung nach, ein mittelschweres Gerangel mit den VOPOs angefangen. Doch als sich die Lage langsam wieder beruhigte, war wie beabsichtigt, die Haltestelle auf Westgebiet erreicht. So musste man uns unbehelligt ziehen lassen.
Die Familie
Mein Vater hat sich einmal die Mühe gemacht, seinen Stammbaum zu verfolgen und ist dabei bis in die Wirrungen des Dreißigjährigen Krieges vorgedrungen. Dabei stieß er auf einen Feldobristen, so oder ähnlich soll sein Titel gelautet haben, der den Namen Hülsebeck trug. Und wie es damals gern Brauch war, überließ ihm seine Fürstin für seine treuen Dienste in eben diesem 30 Jahre andauernden Krieg einen Flecken Land in Mecklenburg-Vorpommern, der heute noch diesen Namen trägt. Irgendwo zwischen Ludwigslust und Kuhsdorf gelegen. In meinem Besitz ist noch heute eine alte Bibel, deren Widmung einer späteren Regentin zur Hochzeit eines meiner Ur-Ur-Großväter von dieser Vergangenheit zeugt.
Mein Vater, Jahrgang 1914, wuchs als Sohn eines staatlichen Landvermessers bzw. Markscheiders in Güstrow auf, der mit einer jungen Frau aus Hameln vermählt war, also meiner Großmutter von väterlicher Seite. Während der Sommerferien durfte mein Vater meinen Großvater bei seinen ausgedehnten Vermessungsfahrten über Land im einspännigen Pferdewagen begleiten. Eine besondere Vergünstigung, die seiner um ein Jahr älteren Schwester allerdings verwehrt war.
Nach seinem Abitur begann mein Vater das Studium des Ingenieurswesens in Dresden, dem Sitz der Familie meiner Mutter. Die älteren Semester erfreuten sich regelmäßig großzügiger Einladungen zu Hausbällen in die sogenannte bessere Gesellschaft, sofern ihre eigene Herkunft nicht dagegensprach. Einer dieser Bälle fand im Hause der Fabrikantenfamilie Gäbel statt, deren Geschichte auch für mich einmal prägend werden sollte. Allerdings, nicht weil ich diese Firma fortführen oder neu erstehen lassen wollte, sondern weil mir deren Historie wie die sprichwörtliche Möhre an der Angel ständig vor meinem inneren Auge baumeln sollte. Doch zu jener Zeit war ich noch gar nicht auf dieser Welt, geschweige denn geplant.
Mein Ur-Großvater, also der Opa meiner Mutter, besaß eine Maschinenschlosserei in der Dresdner Innenstadt und hatte einige Maschinen für die Schokoladenherstellung sowie Süßwarenverpackung entwickelt. Da sein Unternehmen stark prosperierte, suchte man größere Räume, die bald im Stadtteil Mockritz gefunden wurden. Der Ur-Großvater war Erfinder und Tüftler, dabei aber auch eigenwillig und ein wenig skurril.
In einer der überlieferten Anekdoten verabredete er sich an sonnigen Sommersonntagen mit dem sächsischen König Friedrich August III. zur Fahrradausfahrt im Großen Garten. Als Clou hatte er eine Drehorgel auf sein Rad montiert, die über die Ketten des Fahrrades angetrieben wurde. Der König fuhr belustigt als nächster hinterher sowie ein Teil seines Hofstaates, gefolgt von weiteren Erholung Suchenden, für die jenes Spektakel jedes Mal das Ereignis der Woche gewesen sein soll.
Die Maschinen-Manufaktur des Ur-Großvaters wurde also in den Stadtteil Mockritz verlegt, wo man eine ehemalige Ziegelei mit 32.000 qm Grund und Boden erwerben konnte. Dort blühte die Firma gewaltig auf, hatte in ihrer Glanzzeit mehr als 500 Mitarbeiter und bot im Obergeschoss des Verwaltungsgebäudes den Familien der Kinder des Firmengründers in mehreren Wohnungen reichlich Platz. Zu seinen Kindern zählten zwei Töchter und ein Sohn, der langsam in seine Fußstapfen trat und eigentlich prädestiniert war, das Zepter in der Firma einmal zu übernehmen.
Wo mein Ur-Großvater zu dieser Zeit wohnte, entzieht sich meiner Kenntnis und fragen kann ich auch niemanden mehr. Er soll bei einer Freundin Logis bezogen haben, während seine Frau noch im Firmenanwesen wohnte. Ich erinnere mich, dass in der Familie immer von einer sehr unglücklichen Zeit meiner Urgroßmutter gesprochen wurde und der Begriff Maitresse in aller Munde war.Es kursierten auch etliche Anekdoten über sein ausschweifendes Leben und seine uneinsichtige Art. Eine davon besagt, dass er sich in einem Varieté von einer fest montierten Tischlampe gestört fühlte und diese abmontieren lassen wollte. Als das nicht durchsetzbar war, bot er an, den ganzen Laden zu kaufen.Wie das genau ausgegangen ist, entzieht sich meiner Kenntnis, aber ich glaube, er wurde dort nicht mehr gesichtet.
Seinen beiden Töchtern Elisabeth und Charlotte ließ er damals die bestmögliche Ausbildung angedeihen, indem er sie auf ein Internat für höhereTöchter in Lausanne in der Schweiz schickte. Die Bildung, die aus dieser Ausbildung erwuchs, war meiner Großmutter Elisabeth sowie ihrer Schwester noch bis ins hohe Alter von 90 Jahren anzumerken. Von meinem Cousin Peter weiß ich, dass sich beide Damen in gepflegtem Französisch austauschten, sobald er am Tisch etwas nicht belauschen sollte.
Charlotte heiratete einen Apotheker und blieb kinderlos, Elisabeth ging die Ehe mit einem Gewerbeschullehrer ein und hatte mit ihm zwei Töchter, Ursula und Ingeborg. Eine davon, Inge, war meine Mutter. Ein aufgewecktes Mädchen, das den Freiraum auf dem weitläufigen Firmengelände maximal auskostete. So berichtete sie davon, dass sie aus ihrem Zimmerfenster klettern konnte, um über das angrenzende Dach eines Verwaltungstraktes zu einem Fenster des Musterraumes zu laufen, um, wenn dieses offen stand, dort ihr vernaschtes Unwesen zu treiben.
Eine Besonderheit der Firma war offenbar eine Abfüllmaschine, die Bonbongläser so bestücken konnte, dass die Bonbons hinter dem Glas Bilder oder Ornamente bildeten. Um diese stabil zu halten, musste natürlich in der Mitte der Hohlraum mit weiteren Bonbons gefüllt sein. Und genau das war der springende Punkt. Bei jedem Nasch-Überfall verschwand eine Kinderhand voll Bonbons eben aus dieser Mitte, bis bei der nächsten Präsentation vor einem Kunden das ganze Machwerk in sich zusammenfiel. Ob oder welche Konsequenzen diese Missetaten für meine Mutter hatten, ist mir nicht mehr präsent. Ich habe allerdings in Erinnerung, dass sie sich schnell trösten konnte, wenn ihr der Weg durch besagtes Fenster versperrt war.
Da täglich Maschinen die Firma verließen, mussten diese auch vor der Verpackung getestet werden, egal ob Schokoladen-Gießmaschinen oder solche zum Conchieren der Kakaomasse. Eine Ration Test-Schokolade fand immer irgendwie den Weg zu ihr. Wen wundert es, dass Schokolade ein Leben lang ihre große Versuchung blieb?
Noch ein Wort zu meinem Großvater aus der mütterlichen Linie. Er musste urplötzlich die Leitung der Firma übernehmen, nachdem sich kurz vor Ausbruch des Krieges, also Ende der 1930er Jahre, eine große Tragödie ereignet hatte. Mein Urgroßvater, sein Sohn und einige führende Köpfe des Unternehmens waren allesamt auf einer Reise nach Berlin, wo die Firma auf einer Messe ausstellte, bei einem Unfall ums Leben gekommen.
Mein Großvater war, wie man es heute nennen würde, ein Law and Order Typ, der seine Familie morgens in aller Frühe mit der Trillerpfeife aus der Wohnung pfiff und zum Frühsport verpflichtete. Eine von der Familie ungeliebte Marotte, die aber sicher dem Zeitgeist entsprach. Ob er in der Partei war? Ich weiß es nicht, vermute es aber schon. Ein Foto zeigt ihn mit einem Bärtchen unter der Nase, das seinerzeit groß in Mode war.
Aber zurück zu den Hausbällen. Bei einem solchen lernte meine Mutter im Alter von 19 Jahren auch meinen Vater kennen, der gerade in Dresden in seiner alten Studentenverbindung war und gern einer Einladung in das Haus meiner Großeltern folgte. Arbeitsdienst und Wehrdienst lagen bereits hinter ihm und Deutschland befand sich im ersten Kriegsjahr, was sich auch in den Hochzeitsfotos meiner Eltern widerspiegelt, denn Vater heiratete wie damals allgemein üblich in Uniform.
KriegszeitenDas Licht der Welt habe ich immer noch nicht erblickt. Der Vater ist an verschiedenen Garnison-Standorten tätig. Als junger Offizier der Pioniere muss er regelmäßig nach Berlin zum OKDW, dem Oberkommando der Wehrmacht. Sind die Standorte günstig gelegen, kann meine Mutter auch dort wohnen, doch während der Schwangerschaft mit meinem Bruder im Jahr 1942 bleibt sie mehr oder weniger in Dresden. Dort, wo auch ihre Schwester Ursula ist, die acht Monate später ihren Sohn zur Welt bringen wird, meinen Cousin Peter.
Den Vater führen die Wirren des Krieges erst nach Frankreich, danach auf den Balkan, darauf nach Holland, wo er die berüchtigten Ein-Mann-U-Boote zum Einsatz bringen muss. Schlussendlich geht es mit der Marine nach Norwegen. Und von da bei Kriegsende direkt in Richtung Gefangenschaft. Doch was ein richtiger Seemann ist, der geht nicht zu Fuß. Als man dem Geschwader, oder wie auch immer der Verband benannt war, die Schiffe wegnehmen will, lässt sich Vater eine List einfallen.
Ein Verbindungsmann beim Oberkommando der Marine schickt ihm ein Telegramm, dass er mit einigen Booten im Auftrage der Sieger Mienen räumen müsse. Als der Schwindel auffliegt, ist es nur noch ein Tagesmarsch bis ins Kriegsgefangenenlager der Engländer, wo dann nicht mehr vom Bootsproviant auf gedeckten Tischen gespeist werden kann. Aber seine Mannen hat er gut und bequem nach Hause gebracht. Auch Max, den er so oft vor seinen Häschern bewahren konnte.
Mein Bruder Joachim wächst unter der Obhut der Mutter, der Großmutter und deren Schwester auf. Quasi drei Mütter und ein Kind. Das ist sicher nicht einfach. Weder für meinen Bruder als auch für meine Mutter. Den Vater sieht er nur bei Heimaturlauben, wie so viele Kinder in dieser Zeit. Seinen Hang zum extremen Eigensinn und der Neigung, allem Technischen bis zur Zerstörung desselben auf den Grund zu gehen, hat er sicher vom Urgroßvater, höre ich später meine Verwandten und Eltern öfter sagen.
Eine Begebenheit, die immer gerne im Kreise der Familie kolportiert wurde, ist die sture Negierung von Verboten, wie dieses eine von vielen Beispielen zeigt. Meine Mutter hatte nach dem Krieg angefangen zu malen und benutzte dafür auch Terpentin und ähnliche hochtoxische Substanzen, die in einem verschlossenen Schrank aufbewahrt wurden. Verschlüsse allerdings übten zwangsläufig einen unwiderstehlichen Reiz auf meinen damals etwa vierjährigen Bruder aus, besonders wenn sie durch Ermahnungen und Verbote erst so richtig ins Zentrum des Interesses rückten.
In einem unbewachten Augenblick hatte er einen Hocker vor die verschlossene Schranktür bugsiert und so lange mit dem Po dagegen gebummert, bis diese aufsprang und das Ziel seiner Begierde freigab. Der Schluck Terpentin verwandelte ihn in ein brüllendes Häufchen Elend. Und er hat es wohl nur schadlos überstanden, weil gerade ein erfahrener Schäfer zugegen war, der wusste, dass man solchen Attacken nur mit Milch, also einer fetthaltigen Flüssigkeit zu Leibe rücken kann. Wer die Milch dann so schnell beschaffen konnte, entzieht sich meiner Kenntnis. Als der Spuk vorbei war, berichtete der Kleine mit Stolz, er habe Wein getrunken, genauso wie die Erwachsenen. Ich frage mich heute allerdings, wie der Wein den Krieg wohl überstanden hatte?
Eine andere Anekdote aus dieser Zeit, die ich nimmer wieder erzählt bekommen habe, war, dass man ihn des Abends schon mal vor die Tür gestellt hat, wenn er partout und in boshafter Renitenz nicht folgen wollte, wie man dies damals so nannte. Das einmal gepaart mit der Drohung, die Hexe würde ihn dort holen. Die Beobachtung ihres ungezogenen Söhnchens durch ein Fenster war für meine Eltern wohl eher ernüchternd. Er lief von einer Ecke des Hauses zur anderen und rief jedes Mal. „Böse Hexe kommt nicht“, um diesen Satz dann vor der Haustür ständig zu wiederholen.
Diese Methoden würden heute unter Erziehern mit Sicherheit Unverständnis auslösen. Doch sollte man die damaligen Umstände nicht unberücksichtigt lassen. Es waren verdammt harte Zeiten, die oft nach ungewöhnlichen Maßnahmen verlangten. Der Krieg war gerade zu Ende, Firma und Privaträume waren von den Kadern der Kommunistischen Partei beschlagnahmt. Der von der Partei eingesetzte Verwalter war ein Hilfsarbeiter, den mein Großvater noch aus Mitleid eingestellt hatte, inklusive der Bescheinigung seiner Wichtigkeit im Betrieb, um ihn vor der Front zu retten. Denn dort wäre er ob seiner unterentwickelten mentalen Kapazität sofort beim gefürchteten sogenannten Kanonenfutter gelandet.Jetzt konnte er die Keule schwingen. Als Herr über eine große Firma, die zwar stillstand, aber noch einiges zu bieten hatte. Zum Beispiel die Gemüsebeete, die meine Familie während des Krieges in weiser Voraussicht vor dem Haus angelegt hatte, damit sie während der allzu bitteren Jahre zu unserer Ernährung beitragen konnten. Nun aber waren es seine Beete, die allerdings von unserer Familie gepflegt werden mussten. Wie soll man einem Vierjährigen beibringen, dass das Ausreißen einer Möhre ein Vergehen ist? Für das seine Mutter zur Polizei oder gar eine Nacht in Haft muss. Mit meinem Cousin Peter hatte seine Mutter offenbar weniger Schwierigkeiten. Den konnte man morgens zum Spielen sauber vor die Tür schicken und mittags kam er genauso sauber wieder herein.
In dieser Zeit wurde auch das Inventar der Firma auf Anordnung der russischen Besatzung demontiert, in Kisten verpackt und zum Abtransport nach Russland verladen. Als man meinem Großvater eröffnete, er solle nach Russland deportiert werden, um dort alles wieder aufzubauen und anschließend erwarte ihn Lagerhaft, endete das tragisch. Noch am selben Tag nahm er sich durch Erhängen das Leben, in der Nähe des Löschwasserteiches, der im Sommer einst der Familie als Schwimmbad gedient hatte.
Bald darauf, im bitterkalten November 1948 erblickte ich das Licht der Welt in einem ungeheizten Kreißsaal. Als ich später als vielleicht siebenjähriger Bub zufällig mitgehört habe, dass ich wegen der allgemeinen Mangelernährung und Nahrungsknappheit eher eine Katastrophe für meine Eltern und alles andere als erwünscht oder gar erhofft war, hat mich das tief betroffen gemacht. Ebenso die Äußerung, dass man nicht sehr traurig hätte sein können, wenn ich die ersten Tage in der Kälte nicht überlebt hätte.
Von Berlin ins Ruhrgebiet
Nach knapp einem halben Jahr Gefangenschaft in Schleswig-Holstein bei den Engländern meldete sich unser Vater bei der Lagerkommandantur, als für die britisch besetzte Zone Lokomotivführer gesucht wurden. Mit seinem Entlassungspapier schaffte er es bis nach Minden zur zerstörten Weserbrücke. Dort flog der Schwindel mit dem Lokführer Patent auf, und er musste am Wiederaufbau der Weserbrücke mitarbeiten, konnte aber von dort Kontakt ins nahe gelegene Hameln zur Schwester seiner Mutter aufnehmen. Die sicherte unserer Familie mehr schlecht als recht Unterschlupf für eine Übergangszeit zu, sollten wir von Dresden weg müssen.Nach kurzer Zeit beim Brückenbau schlug sich unser Vater nach Oberhausen im Ruhrgebiet durch, zur Gutenhoffnungshütte, mit der er kurz vor seiner Einberufung noch einen Arbeitsvertrag abgeschlossen hatte. Sobald er könne, solle er kommen, erinnerte er sich. Man habe durch nicht zerstörte Werkswohnungen sicher auch Möglichkeiten, die Familie unterzubringen. Und wenn diese es nach West-Berlin schaffen sollte, würde es auch gelingen, sie in die britische Zone zu bringen. So war Plan B entstanden, der uns nun mitten im kalten Februar 1951 auf einen Westberliner Bahnhof verschlagen hatte.
In Berlin kamen wir irgendwo unter. Ich glaube, das hatte auch die Firma aus Oberhausen organisiert, und bereits nach wenigen Tagen werden wir mit einem Flugzeug der Engländer nach Hannover ausgeflogen. Es muss während des einstündigen Fluges wohl ziemlich gerupft und gerappelt haben, was meine Mutter, die ohnehin unter Flugangst litt, nur mit Mühe mental überstanden hat. Noch heute habe ich ihre Worte im Ohr: „Kind, steige nie in ein Flugzeug!“ Ihre Angst hatte sie auf mich übertragen, aber das hat sich später schnell gelegt.
Mutter, mein Bruder und ich kamen in Hameln bei Vaters Tante erst einmal auf dem nicht isolierten Dachboden unter, eher geduldet als erwünscht. Das besserte sich auch nicht dadurch, dass mein Bruder mit dem Eimer, der unsere nächtliche Notdurft aufnahm, einmal die Stiege vom Dachboden in den polierten Flur des Wohntraktes der Tante hinunterfiel.Vater kam uns mehrfach von Oberhausen aus besuchen und musste mit ansehen, wie ungemütlich, ja geradezu verkrampft unsere Situation in Hameln war. So lag es nahe, dass wir nicht abwarteten, bis seine Firma uns eine adäquate Wohnung anbot und nahmen das Nächstbeste, was gerade verfügbar war. Bestimmt nicht einmal Zweite Wahl, aber immerhin eine eigene Wohnung, die wir mit niemandem teilen mussten.
Das war uns ja schon in Dresden beschieden, wo man innerhalb der Familie im eigenen Haus zusammenrücken musste. Später, nachdem alle Mitglieder der Familie aus dem Haus geworfen waren, hausten wir in einem großen Raum einer in der Nachbarschaft leerstehenden Villa, der nur mit Tüchern und Stoffdecken an Wäscheleinen unterteilt war, damit für jeden wenigstens ein bisschen Privatsphäre entstand. Aber die war eher Wunsch als Wirklichkeit, was zu ständig neu aufkommenden Spannungen führte.
Die ersten Jahre in Oberhausen Nun in Oberhausen, auf der Kirchhellener Straße setzt auch meine eigene Erinnerung ein, sodass ich alles Weitere aus erster Hand berichten kann. Vorher jedoch muss ich noch einmal auf überliefertes Wissen zurückgreifen.In Dresden hatte die Familie einst Hausangestellte, Gärtner, Chauffeure und Boten, die allesamt halfen, das Leben der Herrschaften zu erleichtern. Und dies, obwohl mein Großvater eher als pedantisch beschrieben wird. So wurde unter anderem berichtet, dass seine Frau, meine Großmutter, ein Haushaltsbuch führen musste, das er regelmäßig auf den Pfennig genau kontrollierte. Sie aber schrieb jedes Mal, wenn der eine oder andere Pfennig fehlte, für 5 Pfennige Pfeffer ins Buch. Als es zwischen den beiden Eheleuten einmal richtig fetzte wegen dieser, in meiner Großmutters Augen unsinnigen Buch-führung, warf sie ihm das Haushaltsbuch an den Kopf und fügte mit schneidender Stimme dazu: “Wenn du all den Pfeffer gefressen hättest, der im Haushaltsbuch steht, wärest du schon tot“. Danach sei das Buch nie wieder erwähnt worden. Meine Großmutter war zwar eine liebevolle und ruhige Frau, aber auch patent und emanzipiert. Damals, in den 30er Jahren nannte man das resolut. So hatte sie einen Führerschein und fuhr gern selber im großen offenen Horch zu ihren Verabredungen und Terminen, anstatt sich vom Chauffeur kutschieren zu lassen. Das führte schon mal dazu, dass ihr Straßen-arbeiter in unverfälschtem Sächsisch hinterher brüllten: „Bleeb lieber daheeme und stopp deim Alden de Socken“ Im Großen und Ganzen könnte man das tägliche Leben der Familie in Dresden in jener Zeit aber eher als pragmatisch und nicht unbedingt glamourös bezeichnen. Im totalen Kontrast dazu stand nun unsere neue Situation in Oberhausen, deren Wohnverhältnisse ich 1952 eher als prekär einstufen möchte. Ein Siedlungshaus aus der Jahrhundertwende, vier Kilometer nördlich des Stadtteils Sterkrade, bot der Familie auf der ersten Etage eine kleine 3-Zimmer-Wohnung ohne Bad und WC. Es gab zwar in der Küche einen Kaltwasseranschluss, mehr aber auch nicht. Am oberen Ende der zu unserer Wohnung führenden Treppe verbarg ein Vorhang einen verzinkten Eimer für die schnelle oder nächtliche Notdurft. Dieser musste dann am Tag in eine Grube hinter dem Haus entleert werden. Dort stand auch das Holzhäuschen mit dem herzigen Loch in der Tür und dem kreisrunden in der Sitzbank. Ein echtes Plumpsklo, das wir uns mit der unter uns wohnenden Familie teilen durften. Im Wohnzimmer befeuerten Braunkohle-Briketts einen Bullerofen. Dann zog bei offenen Türen ein wenig Wärme in unser winterkaltes Kinder- sowie das Schlafzimmer. Gekocht wurde auf einem zweiflammigen Gaskocher, der als Multitalent auch dazu diente, das Badewasser zu erwärmen, das man anschließend in einen Zinkzuber goss.Das Niveau der Leute in der Nachbarschaft war ziemlich gemischt. Kollegen von meinem Vater wohnten, teils in neueren Häusern mit mehr Komfort, ebenso dort wie körperlich arbeitende Menschen. Sie gingen ihrer harten Arbeit auf der Zeche oder bei der Hütte nach, doch ihr Leumund stand nicht immer außer Zweifel. Aus jener Zeit datieren auch die damals berühmt-berüchtigten Lohntüten-Bälle im Ruhrgebiet. Die fanden immer freitags statt, wenn der Lohn der Arbeiter in einer Lohntüte ausgezahlt wurde. Gelang es der Familienmutter nicht, ihren Mann am Werkstor abzupassen, um ihm diese Tüte abzunehmen, konnte es passieren, dass der Lohntütenempfänger den Ertrag einer ganzen Woche komplett in der nächsten Kneipe durchbrachte. Dann nagte die Familie am Hungertuch und konnte die Miete nicht bezahlen. Zur Freude der Wirte wurden auch immer wieder großzügig Lokalrunden geschmissen, und selbst das, was die brave Hausfrau dem Ernährer der Familie aus der Tüte zur eigenen Verwendung überlassen hatte, reichte in der Regel für einen Vollrausch. Leute dieses Kalibers wohnten auch in unserer Nachbarschaft, weshalb man solchen Männern freitags besser aus dem Weg ging. Aber auch die angeblich braven und ordentlichen Hausfrauen hatten es oft faustdick hinter den Ohren. Nicht umsonst war die Gegend als „Nacht-jackenviertel“ verpönt. Besuchten sich die Damen und Herren dieser Gesellschaft doch gern gegenseitig in der Nacht, und das praktischer Weise gleich im Pyjama oder Nachthemd, was der Intuition dieses „Wildwechsels“ sicher entgegenkam. Später hörte ich schon mal in der Kneipe einen angetrunkenen gehörnten Familienvater im besten Slang des Kohlenpotts lallen: „Mein Nachbar, datt Schwein, dä hatt bei mich wieder unterm Zaun gegraben.“ Mir kommt auch eine Familie in den Sinn, deren Namensherkunft in Richtung Balkan deutet. Sie wohnte uns direkt gegenüber und hatte mindestens fünf Kinder. Vor denen mussten wir uns in Acht nehmen. Wie im Zirkus konnten diese an der Hausfassade mit ihren Ziegelsimsen und Ornamenten bis in den ersten Stock klettern und turnten dann schon mal durch ein offenstehendes Fenster bis in unsere Wohnung hinein. So mussten wir auf das Wenige, das wir besaßen, auch noch höllisch aufpassen. Jeder Verlust war ein Drama, das zu bitteren Tränen bei meiner Mutter führte. Wir hatten ja nichts außer dem, was in den beiden Koffern und zwei Rucksäcken die Flucht überstanden hatte. Angereichert durch ein bisschen Hausrat und Heimtextilien, die meine Eltern in weiser Voraussicht bereits vor unserer Flucht aus Dresden per Post an Kollegen meines Vaters geschickt hatten. Zudem das, was unsere Großmutter oder die Schwester meiner Mutter aus unseren Hinterlassenschaften in Paketen nach Oberhausen senden konnten. Viel war es sicher nicht.Ich erinnere mich auch an Begebenheiten, die man sich erzählte, aus der Zeit als wir noch in der Firma wohnten. Da kam es schon mal vor, dass abends einer der Russen, die die Firma bewachten, ein Radio oder ein Möbelstück aus den Wohnungen requirieren wollte. So etwas brachte man ihm dann gern bis an die Treppe, wobei man sich so ungeschickt anstellte, dass das Objekt der Begierde eben diese Treppe herabstürzte und sich anschließend nicht mehr gebrauchen ließ. War der Russe angetrunken, damals eigentlich der Normalzustand dieser eher armen und auch entwurzelten Kerle, war besondere Vorsicht geboten. Ja, der Anfang in Oberhausen war von Eingewöhnungs- Schwierigkeiten, Mangel und Entbehrungen geprägt, wobei letztere eher meine Eltern gespürt haben müssen, denn ich kannte es eigentlich nicht anders. Mein Bruder, inzwischen acht Jahre alt, kämpfte damit, in der Schule zurechtzukommen, denn in Dresden war er dem indoktrinären Unterricht kommunistischer Prägung ausgesetzt gewesen, was nun gar nicht mit west-deutscher Grundschulen-Pädagogik vereinbar war. Auch das halbe Schuljahr in Hameln, wo man verbal gern hochdeutsch über den “spitzen Stein stolperte“ war dabei nicht hilfreich, sondern machte ihn eher zum Gespött, als dass er damit hätte punkten können. Und Geschichten, die man Kindern in Dresden beibrachte, wie diese, dass der Kommunist Walter Ulbricht das Taschenmesser erfunden habe, schoben ihn in der Kinder-Hierarchie auf dem Schulhof an einen ungeliebten Platz. Eine frühe Korrektur solchen kommunistischen Blödsinns noch in Dresden hätte die Familie leicht als nicht linientreu in den Fokus der Überwachung gerückt. Aber er lernte damit umzugehen. Und da er nicht der Schwächste war, konnte er sich letztlich doch behaupten. Diese Stärke musste er auch mir beweisen. An einem Sonntagmorgen, an dem meine Eltern noch im Schlafzimmer waren und wir im Wohnzimmer herum kasperten, geschah das Unglück. Ich trug einen Schlafanzug, so eine Art Strampler, der hinten eine Klappe mit zwei Knöpfen hatte, die man nur zu öffnen brauchte, um den besagten Eimer am Ende der Treppe, oder war es bei mir doch noch der Nachttopf, aufzusuchen, ohne sich der ganzen Textilie zu entledigen. Diese Klappe war nach der letzten Benutzung nicht wieder geschlossen worden und baumelte hinten wie ein Lappen herunter, so dass mein blanker Popo hervorblitzte. Das vorausgeschickt, fing nun mein Bruder an, mich kleinen Knirps mit zwei Händen und ausgestreckten Armen vor sich herzutragen und zu behaupten, er sei August der Starke, den ich nun gar nicht kannte und der mir daher auch nichts bedeutete. Als ich so langsam Vertrauen in seine Balancierkünste gefasst hatte, meinte er, er könne das auch mit einer Hand, denn er sei ja August der Starke. Von da an nahm das Unheil seinen Lauf. Wir kamen ins Straucheln und ich landete mit der offenen Popo-Klappe auf meinem Allerwertesten. Aber nicht auf dem Boden, sondern auf einem Heizofen mit rotglühenden Infrarotstäben und dem davor-liegenden Schutzgitter, dass genauso heiß war. Dieser Elektroofen wurde im Winter gern benutzt, wenn der Kohleofen allein die Wohnung nicht warm bekam. Was mein Bruder an Sanktionierung erfahren hat, entzieht sich meiner Erinnerung. Jedenfalls musste ich einige Wochen bäuchlings im Bett verbringen, mein Po wurde mit Brandpuder und Gaze abgedeckt und mit zwei Halbschalen von großen Papp-Ostereiern getoppt, damit die Bettdecke keinen Druck auf die Brandwunden ausüben konnte. Diese Anekdote hat uns beide lebenslang begleitet, auch später noch, als wir über 30 Jahre gemeinsam eine erfolgreiche Firma betrieben. So konnte schon mal, wenn ich seinen Argumenten nicht folgen wollte, der Satz kommen: „Los, wir machen das jetzt so, oder ich setzte dich wieder auf den Grill.“ Umgekehrt habe ich ihm den Grill allerdings auch schon mal angedroht. Gehorsam war nicht unbedingt unsere Stärke, wie Jungens nun mal so sind. Der Unterschied zwischen mir und meinem Bruder war jedoch, dass ich meine Grenzen schneller gesehen habe und deshalb einfach seltener erwischt wurde, wenn ich Verbote in kindlicher Zwangshandlung übertreten musste. So ist auch nie herausgekommen, dass ich auf einem Trümmergelände mit einem zerbombten Haus, gleich zwei Grundstücke weiter, gespielt habe. Diese Ruine übte eine magische Anziehung auf uns Kinder aus der Nachbarschaft aus. Wobei die älteren gern lose Eisenteile an die Seite legten, um diese für ein paar Groschen beim Trödler loszuschlagen, der allenthalben mit Pferd und Wagen, auf einer zierlichen Flöte spielend, vorbeikam. Wer dabei erwischt wurde, bekam Ärger mit den Eltern, es sei denn man hatte das Glück, im Haus gleich gegenüber zu wohnen. Bevor ich lernte, meinen Ungehorsam geschickt zu kaschieren, muss ich wohl ein ziemlich braves Kind gewesen sein. Wenn meine Mutter zum Einkaufen zu einem Lebensmittel-Laden auf unserer Straße ging, den man noch so eben von unserem Wohnzimmerfenster auf der anderen Straßenseite sehen konnte, stellte sie mir eine kleine Schale mit Zucker auf die Fensterbank und eine Fußbank davor, so dass ich gerade noch bis zu besagtem Laden schauen konnte. Dazu sagte sie mir, wenn ich mit angefeuchtetem Finger aus der Schale den Zucker naschte, wäre sie zurück, bevor die Schale leer sei. Das hat immer funktioniert, und wenn ich heute einen Hund sehe, der wehleidig seinem Menschen hinterher schaut, der sich von ihm entfernt, kommt mir dieses Bild in den Kopf. Einen anderen Blick aus dem Fenster hatten wir von unserem Kinderzimmer auf der Rückseite des Hauses, von wo man über das Klohäuschen und die Fäkaliengrube hinweg schauen konnte. Dahinter verlor sich der Blick in einem Brachland auf gut zwei Kilometer Weite. Ein Gebiet das im Volksmund Hühnerheide genannt wurde, und in dem so einiges Getier vom Karnickel bis zum Fasan unterwegs war, was bei manch einem, der noch oder wieder ein Kleinkalibergewehr sein Eigen nennen konnte, den Speiseplan bereicherte. Auch die Fäkaliengrube übte auf mich Vierjährigen eine magische Anziehungskraft aus, obwohl mir die Annäherung an ihren, etwa unter 45 Grad Schrägung verlaufenden Rand, strengstens verboten war. Doch ich musste einfach herauskriegen, wie weit man sich gefahrlos annähern konnte. Bis ich im nassen und glitschigen Randbereich ins Rutschen kam. Es kam also wie es kommen musste und ich lag der Länge nach rücklings in der Scheiße. Ob meine herbeigeeilte Mutter gerufen hat: Quel malheur de merde, oder ob sie gelacht oder geweint hat, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hatte sie bis zur Heimkehr des Vaters alle Spuren beseitigt, so dass ich meiner gerechten Strafe mal wieder entkam. In diesem Spiel „bad cop - good cop“ waren meine Eltern einfach Spitze. Mutter war die Gütige und Vater der Strafende. So konnten die Kräfte schnell wieder egalisiert werden und der Haussegen im Kinderhimmel hing dann auch gleich wieder gerade. Bei der soeben geschilderten Nummer hätte ich allerdings auch mein Leben verlieren können. So habe ich rechtzeitig gelernt, dass es auch reale Gefahren gibt und wie man ihnen begegnet. Ganz im Gegensatz zur heutigen Zeit, wo Helikoptereltern zu gern alle Risiken von ihren Kindern fernhalten möchten, und jene dann im späteren Leben angesichts dessen, was da so alles auf sie zukommt, große Augen machen. Wir waren Kinder und durften es auch sein. Im Gegensatz zu manchen Leuten aus der Nachbarschaft, alteingesessenen Ruhrpöttlern, die ihre Kinder in aller Regel Blagen nannten, abgeleitet von Plage, und wenn es etwas kräftiger kam, waren es eben die Rotzblagen. Für meine Mutter war das alles sicher ein Kulturschock, konnte man doch damals nicht einfach in die DDR telefonieren, sich mit Mutter oder Schwester austauschen, geschweige denn appen. Wer hatte schon ein Telefon. Ein solches zog erst einige Jahre später in unseren Haushalt ein. Und in der DDR war es völlig undenkbar zu telefonieren, auch noch mit dem Klassenfeind. So blieb es bei regelmäßigen Briefen, die hüben und drüben immer sehnsuchtsvoll erwartet wurden. Die Briefe, die uns erreichten, berichteten viel vom Mangel an Nahrungsmitteln, die ein wenig Freude in den tristen und grauen Alltag des Lebens in der DDR gebracht hätten. Und mit der mickrigen Mindest-Rente von 40 Mark, die jeweils meine Großmutter Elisabeth und deren Schwester Charlotte bekamen, hätten sich auch keine großen Sprünge machen lassen. Sie waren ja die Unternehmergattinnen gewesen, und damit Klassen-feinde. Also mussten sie mit dem Minimum zurecht-kommen und teilten sich eine kleine Wohnung. Zu mehr reichte es nicht. Jeder DDR-Bürger durfte monatlich ein Paket von maximal 7 Kilo Gewicht aus dem Westen erhalten, wobei jede Produktgruppe mengenmäßig beschränkt war. So erinnere ich maximal 500 Gramm Kaffee und 100 Gramm Schokolade pro Paket. Keine Konserven, da nicht einsehbar, und alles den DDR-Richtlinien entsprechend verpackt. So waren die Regeln. Bei 400 DM, die Vater anfänglich als technischer Assistent der Direktion im Monat brutto verdiente, fiel es meiner Mutter nicht leicht, alle 14 Tage Geld für ein 7-Kilo-Paket mit Nahrungsmitteln und das Porto dafür vom Haushaltsgeld abzuzweigen. Es ging immer ein Paket an meine Großmutter und nach 14 Tagen ein weiteres an deren Schwester. Im gleichen Rhythmus erreichten uns die Briefe mit der Empfangsbestätigung und der Freude, welche diese Pakete bei den Empfängerinnen ausgelöst hatten. Doch manchmal kochte auch die Wut hoch, wenn ein Paket gestohlen war oder noch viel schlimmer, wenn der Inhalt von einem DDR-Zöllner mutwillig zerstört wurde. Da war schon mal der Lachs-Ersatz aus der Plastikfolie gerissen und mit dem Kaffee vermengt oder eine Tube gezuckerte Kondensmilch über alles verteilt, was aufgerissen worden war. Nach einer Laufzeit von 14 Tagen war dann nichts mehr zum Verzehr geeignet, obwohl die beiden Damen immer zu retten versuchten, was sich an Essbarem noch retten ließ. Später war dem Zoll dieses Vorgehen wohl zu mühsam und man beschränkte sich darauf, mit langen Nadeln oder Ahlen Pakete kreuz und quer zu durchstechen, in der Hoffnung maximalen Schaden anzurichten.