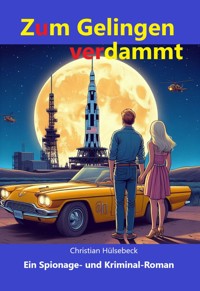Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch erzählt eine Familiengeschichte aus dem Ruhrgebiet Talente können einem den Weg ins Leben spannend und abwechslungsreich gestalten. Und wer, wie der junge Protagonist in diesem Buch, schon früh weiß, wie man pfiffig seine gesteckten Ziele erreichen kann, wittert oft Chancen, die anderen meistens verborgen bleiben. Die teils unglaublichen Erlebnisse, Wendungen und Überraschungen in der vorliegenden Lebens-Story sind in diesem Roman so reizvoll beschrieben, dass sich der Leser einfach mitgenommen fühlt. Auch die Anekdoten aus der leider sehr problematischen Zeit 1943/45, zwischen Pflichterfüllung und Widerstand, sowie dem anschließenden Aufschwung im Wirtschaftswunderland sind derart authentisch, als würde man sie selbst erleben. Viele davon haben einen realen Hintergrund und sind gleichzeitig ein Spiegel dieser Zeit. Am Ende nimmt der Protagonist den Leser mit auf eine abenteuerliche Reise durch die Benelux-Staaten, Frankreich und Spanien, im zusammenwachsenden Europa der fünfziger Jahre. Ein Buch, dessen Akteure man einfach wegen in ihrer Chuzpe, ihrem Mut und ihrem Einfallsreichtum bewundern kann! Tauchen Sie ein - in eine andere Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Einmal Filou,
immer Filou.
Eine Kriegs- & Wirtschaftswunder- Story
Roman
Christian Hülsebeck
© Copyright Christian Hülsebeck
Vorab gesagt:
Dieses Buch erzählt eine Familiengeschichte aus dem Ruhrgebiet
Talente können einem den Weg ins Leben spannend und abwechslungsreich gestalten. Und wer, wie der junge Protagonist in diesem Buch, schon früh weiß, wie man pfiffig seine gesteckten Ziele erreichen kann, wittert oft Chancen, die anderen meistens verborgen bleiben.
Die teils unglaublichen Erlebnisse, Wendungen und Überraschungen in der vorliegenden Lebens-Story sind in diesem Roman so reizvoll beschrieben, dass sich der Leser einfach mitgenommen fühlt.
Auch die Anekdoten aus der leider sehr problematischen Zeit 1943/45, zwischen Pflichterfüllung und Widerstand, sowie dem anschließenden Aufschwung im Wirtschaftswunderland sind derart authentisch, als würde man sie selbst erleben.
Viele davon haben einen realen Hintergrund und sind gleichzeitig ein Spiegel dieser Zeit.
Am Ende nimmt der Protagonist den Leser mit auf eine abenteuerliche Reise durch die Benelux-Staaten, Frankreich und Spanien, im zusammenwachsenden Europa der fünfziger Jahre.
Ein Buch, dessen Akteure man einfach wegen in ihrer Chuzpe, ihrem Mut und ihrem Einfallsreichtum bewundern kann!
Präambel
Die Handlung in diesem Buch ist rein fiktiv, genauso wie die handelnden Personen oder Institutionen frei erfunden sind. Jedoch beinhalten viele Episoden einen wahren Kern und beruhen auf historischen Erkenntnissen, denn die Sachverhalte haben sich, ähnlich wie bei den durch die Protagonisten erlebten bzw. geschilderten, zugetragen. Die Geschichte enthält auch historische Fakten. Etliche Erlebnisse hat der Autor so oder ähnlich durch eigene Wahrnehmung erfahren oder durch Berichte und Erzählungen aus dem Elternhaus, dem Freundeskreis und der Familie aufgenommen. Das alles hat er zu einer schlüssigen Handlung zusammengefügt, welche die Umstände der letzten Kriegsjahre des zweiten Weltkrieges, der Nachkriegszeit und in den fetten Jahren des Wirtschaftswunders realitätsnah reflektieren.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort und Zeit
Eltern
Kai von Tielass
Nachwuchs bei Alma und Siggi
Kindheit
Zivilist wider Willen
Rattenplage
Kontaktpflege
Konsum
König der Ratten
Liebesnacht und Fälschung
Herztod
Kaffeefahrt
Polizei-Rat-Anwärter
Eisblumen
Mittlere Reife
Der Polizist
Alma im Stress
Sommerferien
Zeitung
Oberstufe
Buenos Aires
Grubenfahrt
Die Welt erkunden
Die Winzerinnen
Der Süden ruft, Picasso zahlt
Seife in Marseille
Nur kurz an der Seite von Brigitte
Wer mit dem Stier tanzt
MSS Saratoga
Vorwort und Zeit
Wir schreiben das Jahr 1944. Die Tage führen in einen der härtesten Winter jener Zeit. Im schlimmsten aller Kriege, die je in Europa gewütet haben, zeichnet sich der Untergang des Deutschen Reiches in den Köpfen der Bevölkerung bereits ab, während die Lügen der Parteipropaganda noch von Sieg und Endsieg schwadronieren, obwohl die schlechten Nachrichten von der Front kaum noch zu verbergen sind.
Kriegsversehrte Heimkehrer, denen ein Arm oder Bein fehlen, oder gleich beide, sprechen eine eigene Sprache, weshalb die Wehrmacht penibel darauf achtet, dass keine zerlumpten und abgerissenen Soldaten in der Heimat erscheinen. Das staatliche Lügengebäude würde zu schnell und offensichtlich ad absurdum geführt werden. So wird vor der heimischen Bevölkerung ein Theaterstück aufgeführt, an das immer mehr Menschen immer weniger glauben können und wollen. Aber sie dürfen es nicht aussprechen. Das Druckmittel heißt Wehrzersetzung, und die kann mit dem Tode bestraft werden.
Altgediente, aber eher zweifelnde Parteigänger der Nationalsozialisten tragen ihr Parteiabzeichen jetzt des Öfteren unter dem Revers ihres Jacketts oder des Mantels, um den bohrend fragenden Blicken der ihnen entgegen kommenden Menschen, denen die Entbehrungen der letzten Jahre tief ins Gesicht geschrieben stehen, auszuweichen, wenn diese sie als Parteigänger identifizieren würden. Diese Methode des verdeckten Tragens am Anfang des Herbstes war sehr praktisch und unverfänglich. Nicht selten schlugen die Männer die Krägen hoch, um sich vor den Unbilden des Wetters zu schützen. Und mit einem Griff war das Parteiabzeichen wieder gut sichtbar am Revers oder Kragen. Wer wollte da etwas dagegen haben?
Nur die ganz strammen Nazis stolzieren erhobenen Hauptes wie die Gockel umher und verbreiten weiter Angst und Schrecken mit ihrem Auftreten unter jenen, die wissen, dass sie etwas zu verbergen haben. Und das sind nicht wenige in diesem geschundenen Land. Sei es, weil sie in der Nacht die Nachrichtensendung des Feindes, gerne der BBC aus England gelauscht haben, um an unverfälschte Informationen zu kommen. Wer wollte sich in diesen bangen Tagen nicht gerne ausrechnen können, wie lange das Leid und Elend dieses unsäglichen Krieges noch andauern würde. Wie lange müsste man noch zittern, ob nicht morgens um fünf die Gestapo, also die geheime Staatspolizei, laut an der Tür klopfen würde.
Da ist schon so mancher Nachbar oder Bekannter plötzlich verschwunden und wurde nie wieder gesehen, während ein anderer nach etlichen Tagen mit sichtlichen Spuren der Folterung wieder auftauchte, um seinen fragenden Angehörigen zu berichten, er sei eine Treppe heruntergestürzt. Eine schöne Legende, die aber nur bei den hartgesottensten unter den unbelehrbaren Naivlingen verfing.
Nicht selten waren es aber auch die Frauen, die mal für ein oder zwei Tage und Nächte verschwanden, nachdem sie von den Herren der Gestapo, jene, die man leicht an ihren langen Ledermänteln erkennen konnte, abgeholt worden waren. Oft wurden sie eines Vergehens bezichtigt, das in ihrer kargen Haushaltsführung und deren Aufbesserung lag. Hatten sie mal ein Stück Speck ergattert, blieb dem umtriebigen Blockwart der Geruch des daraus zubereiteten Gerichtes nicht verborgen. Ein Geruch, an den man sich zwar mit Wasser im Mund erinnerte, den man meist aber schon lange nicht mehr wahrgenommen hatte.
Dann musste die arme „Hausfrauenseele“ in einem hochnotpeinlichen Verhör eventuell zugeben, dass ihr das rare Lebensmittel vielleicht von der eigenen Großmutter zugesteckt worden war, und selbiges aus einer „Schwarz-Schlachtung“ stammte, womit die „heimlichen Metzger von eigenen Gnaden“ in höchste Gefahr geraten konnten. Diese Art der Schlachtung wurde mit drakonischen Strafen geahndet, betrachteten doch etliche Nazi-Richter die Eigenverwertung des Haus-Schweins zur Erhaltung des Lebens der eigenen Familie als Alimentationsentzug für die Soldaten. Schließlich nahm sich dieser Staat das Recht, auf jedes private Eigentum zuzugreifen. Die meisten Frauen schwiegen sich über das bei einem Verhör erlebte und erlittene Leid lieber aus.
Blockwarte wie jener, der den Speck gerochen hatte, waren wie eine Seuche und bei den eher kritischen Bewohnern eines Hauses oder Häuserblocks verhasst wie die Pest im Mittelalter. Trugen sie doch in ihr Notizbuch jeden ein, den sie kommen und gehen sahen, oder sie lauschten an den Wänden, ob nichts verräterisches in einer Wohnung gesprochen wurde. Einige übereifrige Berufsdenunzianten und Fieslinge dieser Zunft beobachteten auch gern die Stromzähler zu den Nacht-Stunden, in denen man die Sender der „Feinde“ abhören konnte, obwohl der geringe Stromverbrauch der Volks-Empfänger kaum dazu angetan war, für diese Handlung einen eindeutigen Hinweis zu generieren. Aber man hatte schon mal wieder etwas Verdächtiges in der Hand und den Grundstein für die nächste Denunzierung gelegt.
Abwechslung und Zerstreuung fand man in diesem Winter, der in Holland als schlimmster „Hongerwinter“ in die Geschichte eingehen sollte, eher in den privaten Kreisen, als in öffentlich zugängigen Räumen. Fast alles war ja geschlossen, es herrschten Ausgangssperren, und meist war Verdunklung aus Angst vor den Fliegerangriffen angeordnet. Jeder kleinste Lichtschimmer, der aus der Vorhangritze einer Wohnung drang, wurde sofort vom Blockwart geahndet, wobei die Wohnungsinhaber nicht selten von dieser unsäglichen Kreatur von Parteispitzel aufs Übelste verbal niedergemacht wurden und nicht selten Drohungen erfuhren, die ihnen für die nächsten Nächte den Schlaf rauben würden.
Joseph Goebbels, erst Reichs-Propagandaleiter, später Reichsminister für Propaganda, einer, der ganz dicht am „Führer“ war, also so dicht, dass kein Blatt Papier mehr zwischen diese beiden Protagonisten dieser menschenverachtenden Zeit gewalttätiger Exzesse gepasst hätte, war wegen seiner immer dreisteren Lügen bald zum Spott intellektueller Kreise geworden. Allerdings nicht öffentlich. Denn das wäre lebensgefährlich gewesen.
In der noch nicht durch Bomben beschädigten Villa eines Rechtsanwaltes, der eher pro forma das Parteiabzeichen sein Eigen nannte und trotzdem gute Kontakte „nach oben“ hatte, feierte die Tochter des Hauses ihren zwanzigsten Geburtstag. Alles war vorschriftsmäßig abgedunkelt. Die Gäste, ein paar Freundinnen und einige junge Männer, die aufgrund „kriegswichtiger Tätigkeit“ nicht an der Front sein mussten, diskutierten mehr verklausuliert als offen und nur andeutungsweise, obwohl es hier ja keinen Blockwart gab, und man sich „entre nous“ fühlte. Die eine oder andere Flasche Wein hatte man wohl auch in den Tiefen des Kellers requirieren können, was sich leider beim Bruder des Geburtstagskindes als etwas enthemmend auswirkte.
Den Rauchtisch in einer Ecke des Salons zierte ein großer Aschenbecher, dessen oberes Ende eine verchromt blitzende Halbkugel bildete, deren vordere Hälfte sich an einem kleinen Griff nach hinten klappen ließ. Bewegte man diese Mechanik schnell, sah es aus, als öffne oder schlösse sich ein Mund. Nein, eher ein Schlund, aus dem der stinkende Geruch abgestandener Zigarettenstummel drang.
Der besagte, etwas angeheiterte Bruder stellte sich nun neben diesen Ascher und begann eine der letzten Lügen-Reden des Propaganda-Ministers Goebbels nachzuäffen, wobei er den großen Aschenbecher im Rhythmus des Gesagten auf und zu schnappen ließ und den ihm entweichenden Gestank mit der anderen Hand zu verscheuchen andeutete.
Leider hatte niemand bemerkt, dass sich inzwischen zwei Herren in langen Ledermänteln Zutritt zur weitläufigen Diele durch die nur halbherzig verschlossene Eingangstür verschafft hatten und alles beobachten konnten. Man hatte das Haus vorsorglich observiert, war einem doch ein Tipp wegen einer konspirativen Zusammenkunft aus der Nachbarschaft der Villa zugespielt worden. Galt der Herr Anwalt einigen Menschen seiner Umgebung doch schon lange als verdächtig und nicht wirklich linientreu.
In den Gesichtern der Anwesenden erstarrten die Züge, auf denen sich gerade ein Lachen breit machen wollte. Sie geronnen zu einer erschreckten Grimasse. Der Bruder wurde auf der Stelle verhaftet und im Präsidium in eine unbeheizte Zelle im kalten, feuchten Keller gesperrt, nachdem man ihm Schuhe, Gürtel und Hosenträger abgenommen hatte. Eine offensichtlich mit dem Blut eines anderen Häftlings verschmierte Decke warf man ihm erst Stunden später vor die Füße, als er bereits am ganzen Leib starr vor Kälte zitterte. Das Blut des „Vorgängers“ sollte ihn schon mal weichkochen.
Als er am nächsten Morgen, begleitet von zwei Wachen, dem Verhör zugeführt werden sollte, begegnete ihm auf dem Flur der oberste Staatsanwalt des Hauses. Ein Mann, vordergründig staatsloyal und auf Linie, der aber auch mit dem Vater des Delinquenten dienstlich viel zu tun hatte. Seiner Geistesgegenwart war es zu verdanken, dass diese Episode doch noch eine gute Wendung nehmen konnte.
Zackig und kurz bellte er die beiden Wachen mit „Heil Hitler“ an, obwohl ihm dieser Gruß zuwider war, und befahl den beiden Uniformierten, den Häftling in einer Stunde bei ihm persönlich vorzuführen. Er, als oberster Dienstherr dieser Behörde, nehme sich des Verfahrens persönlich an. „Besondere Wichtigkeit“ fügte er scheinheilig seinen Worten hinzu.
Da saß er nun, der arme Sünder, und beichtete seinen alkoholbedingten Frevel. Der Staatsanwalt hatte ein Einsehen und wollte ihn schonen, musste aber selber das Gesicht wahren. Er ließ den Delinquenten mehrfach in die Zelle zurückbringen und wieder hervorholen und veranstaltete Scheinverhöre, bei welchen er den armen Jungen mehrfach so laut anbrüllte, dass es sowohl im Vorzimmer für seine Sekretärin als auch noch im entfernten Flur zu hören war.
Nach zwei Tagen durfte er wieder nach Hause, und die Akte verschwand irgendwann auf unerklärlichen Wegen. Genauso wie etliche Weinflachen, es waren die besten, die man noch aufbewahrt hatte, aus den unergründlichen Tiefen des Kellers der Anwaltsvilla ihren Weg in den Keller des Staatsanwaltes gefunden hatten.
Bei der Gestapo tuschelte man seit dieser Zeit unter vorgehaltener Hand, mit dem Herrn Anwalt müsse man doch sehr vorsichtig sein. Offensichtlich habe dieser wohlwollende Kontakt in höchste Kreise der Wehrmacht, der Partei oder gar der Staatsführung. Der unsägliche Gruß dieser Zeit wurde ihm von nun an umso lauter und nachhaltiger entboten, wobei die Uniformierten die Hacken dazu noch zackiger knallen ließen, als er es bisher gewohnt war.
Eigentlich war ihm das peinlich, er begriff aber auch, dass damit ein Schutz für ihn einherging, denn seine wirkliche Einstellung zu diesem verbrecherischen Staat hatte er bisher weitestgehend verbergen können. Aber eben nur weitestgehend, wie die Observierung durch die Gestapo zur Geburtstagsfeier seiner Tochter leidvoll gezeigt hatte.
Eltern
Ernst Siegfried Hirsch war sein vollständiger Name. Obwohl zur Zeit seiner Geburt, Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts, die Kinder mit bis zu sieben oder noch mehr Vornamen bedacht wurden, hatte er nur zwei erhalten. Die Eltern jener, die mit so vielen ausgestattet wurden, wollten gern, dass jede noch so entfernte Tante oder auch Onkel sich in der Namensgebung des Nachwuchses verewigt sahen. Das sollte einerseits den Familienverbund stärken, andererseits auch lästigen Querelen und Streitigkeiten in der Familie entgegenwirken. Außerdem konnten die Kleinen mit der großen Anzahl ihrer Vornamen prahlen, wenn sie im Kindergarten oder in der Schule bislang keine anderen „Meriten“ hatten sammeln können.
Ernst Siegfried ließ sich von allen nur Siggi nennen, was auch seinem leicht verschmitzten und etwas lausbubenhaften Naturell trefflich entgegenkam. Eigentlich wollte er Maschinenbautechniker werden und hatte seine Ausbildung gerade abgeschlossen. Nur für das letzte bestandene Examen fehlte ihm noch die Bescheinigung, als er die Einberufung zum Reichs- Arbeitsdienst erhielt. Eine paramilitärische Einheit, in der alle 18 – 25-jährigen Männer sechs Monate lang, mit dem Spaten in der Hand, ihren Dienst abzuleisten hatten. – „Ehrenhafter Dienst am deutschen Volk“ nannte sich das. - Jungen Frauen wurde dieser „Ehrendienst“ erst ab dem Jahr 1939 aufgenötigt. Und so manche holde Maid flüchtete sich damals lieber in eine Ehe, als dieser zweifelhaften Ehre leibhaftig zu werden.
Während viele seiner Freunde zum Trockenlegen der Moore oder zum Kultivieren neuer landwirtschaftlicher Flächen „irgendwo im Nirgendwo“ kaserniert wurden, hatte Siggi es besser. Er blieb heimatnah, wurde im Straßenbau eingesetzt und musste seinen Spaten zur Erschaffung der neuen Reichsautobahn schwingen, die Berlin bald mit dem Ruhrgebiet verbinden würde.
Die Arbeit an der frischen Luft wurde von allen noch leidlich ertragen. Aber die Abkommandierung zum Kartoffelschälen, als Teil des Küchendienstes, in die feuchten Keller der bereits zu dieser Zeit schon recht desolaten Kaserne, war äußerst unbeliebt. Nicht nur bei ihm, auch bei seinen Kameraden. Diese Aufgabe war mehr als Strafe, denn als Arbeit empfunden und schon deshalb äußerst verhasst.
Siggis Truppführer entstammte einer eher bildungsfernen Schicht und kompensierte seine Unwissenheit und Inkompetenz gerne mit lautem Gebrüll und hämischen Bemerkungen wie:
„Na, da kann sich der feine Herr Maschinenbauer Siegfried Hirsch ja mal richtig in Weiberarbeit üben,“
wobei er bewusst heftig gegen den Wassereimer zwischen Siggis Beinen stieß, der bereits zur Hälfte mit geschälten Kartoffeln gefüllt war. Nun war seine Hose von den Knien an abwärts pitschnass, und der Truppführer setze süffisant nach:
„Sie können wohl das Wasser nicht halten, zu kleine Blase, oder was?“
Diese Rechnung hatte der Truppführer allerdings ohne Siggis List und Mutterwitz gemacht. Denn beim nächsten Kellereinsatz warfen alle fünf Kartoffelschäler des Küchen-Hilfstrupps viele faule und nicht verwertbaren Exemplare der Erdknolle auf den Boden im Eingangsbereich ihres verliesartigen Gemäuers, um sie dort zu einem glitschigen Brei zu zertreten.
Das Kommen des Truppführers kündigten bereits seine auf den Betonboden knallenden Stiefel unüberhörbar an. So ging Siggi in Position um die angerichtete „Schweinerei“ in einen Eimer zu schippen, als der Vorgesetzte beherzt den Ort des Geschehens betrat. Dabei machte Siggi bewusst eine so ungeschickte Drehung mit dem Hinterteil, dass der Herr Truppführer rücklings in der Pampe landete. Sich vielmals entschuldigend versuchten nun Siggi und ein anderer vom Kartoffeldienst dem Gestrauchelten aufzuhelfen, wobei der nächste volle Wassereimer ganz zufällig, also wirklich rein zufällig, umkippte, und den derart Gefoppten von oben bis unten einnässte.
Laute Flüche ausstoßend verließ der so Düpierte den Ort des Ungemachs und ward fortan nicht mehr im Kartoffel-Schäl-Keller gesehen.
Siggis Arbeitsdienst neigte sich dem Ende entgegen und es war abzusehen, dass schon bald die Einberufung zur Wehrmacht folgen würde. Schließlich befand sich das Land im dritten Kriegsjahr. Alles Militärische war ihm bisher äußerst suspekt, doch nun, nach dem „Ehrendienst am Volk“ regelrecht verhasst. Er wusste genau, was er nicht wollte. Eine Uniform tragen, und schon gar nicht an die Front geschickt werden. Doch da kam ihm, gerade noch rechtzeitig, die zündende Idee.
Lokomotivführer wurden um diese Zeit geradezu händeringend gesucht, sie verrichteten eine kriegswichtige Aufgabe in der Heimat, und nicht alle Gleise führten zwangsläufig in die umkämpften und besetzten Gebiete. Das war Siggis Chance, der Einberufung zur Wehrmacht zu entgehen und somit unweigerlich an die Front zu müssen. Seine Zusatzausbildung als Lokführer hatte er schnell in der Tasche, und aufgrund seiner maschinenbau-technischen Qualifikation blieben ihm Fernfahrten erspart. Sein Reich wurde der Rangierbetrieb und der Betriebshof eines großen Knotenpunktes der Reichsbahn im westlichen Ruhrgebiet.
Als ihm klar wurde, was mit den vielen Viehwaggons passierte, die im Bereich seiner Gleise zusammengestellt wurden, brach sich seine stets vorhandene Abneigung gegen das Regime der „braunen Pest“, wie er es nannte, endgültig bahn. Als Maschinenbautechniker wusste er nur allzu genau um die sensiblen und neuralgischen Stellen an einer Dampflok, weshalb es ihm nicht schwerfiel, eine unauffällige Methode zu entwickeln, diese zu manipulieren. Eine einfache List. Andererseits ein Spiel mit dem Feuer. Eine riskante Obsession, die ihn, und alles was er liebte, mit ins Verderben reißen könnte.
Bei einem Ölbehälter der Schubstange ließ sich ohne Werkzeug eine Kappe an einem Ventil abdrehen, in die man dann einen Reichspfennig legen konnte. Erhitzte sich das Ventil nach zwanzig oder dreißig Kilometern Fahrt, hatte der kupferne Pfennig sich so sehr ausgedehnt, dass der Öl-Fluss weitestgehend unterbrochen wurde. Die Schubstange überhitzte und im schlechtesten Fall verformte sie sich, was dann meistens einen tagelangen Ausfall der Lokomotive zur Folge hatte.
Seine Sabotage war lebensgefährlich, dessen war er sich bewusst. Aber wer sollte ihm schon etwas beweisen, wenn sich unter den Münzen in seiner Hosentasche auch ein paar Pfennige befanden. Und jede Lok, die er so aus dem „Rennen“ nahm, war für Tage eine Lokomotive weniger, die einen Zug ins Verderben ziehen konnte.
Bisher, bis zum Ende des Jahres 1944, war ihm niemand auf die Schliche gekommen, obwohl er mehrfach harten Verhören unterzogen worden war. Ein Offizier verstieg sich während einer solchen Befragung sogar zu der Mutmaßung, ob die Häufung dieser Pannen nicht vielleicht etwas mit seinem reichlich un-arischen Namen HIRSCH zu tun haben könnte. Doch diese Unterstellung konnte er stets kess mit seinen beiden urdeutschen Vornamen Ernst Siegfried sowie dem Herunterbeten seiner Ahnenreihe kontern.
Almut Amalie lauteten die Vornamen jener Frau, die mit ihm vor den Traualtar getreten war - eine echte Liebesheirat. Doch auch sie hegte den innigen Wunsch, dem Arbeitsdienst für Mädchen und jungen Frauen zu entkommen. Sie wurde von allen nur Alma genannt, was ihr auch lieber war und ihr flotter über die Lippen ging.
Alma arbeitete an sechs Tagen in der Woche im „Fernamt“, der Telefon-Vermittlungsstelle der Post. Drei Tage Voll-, und drei Tage nur in Halbzeit. Sie zeigte großes Geschick darin, die flexiblen Kabel und damit verbundenen Stecker über ihr Paneel fliegen zu lassen, um sie den richtigen Teilnehmern zuzuordnen. Doch ebenso wie den vielen ihrer Kolleginnen konnten auch ihr hin und wieder kleine Missgeschicke passieren. Da wurde dann nicht der gewünschte Zielteilnehmer gestöpselt, sondern aus Versehen ein völlig Unbeteiligter, was den Anrufenden gerne beim erneuten Versuch zu einer Äußerung wie dieser verleitete: „Hallo,Frollein vom Amt, jetzt verbinden se mich dies Mal aber richtig, Wuppertal Elberfeld zwo zwo fünf null zwo. Ham se das jetzt verstanden?“
Andererseits konnte es auch passieren, dass Alma nur ein paar Sekunden zulange in der Leitung blieb und ungewollt Zeugin eines Gespräches wurde. Die Teilnehmer waren vordergründig durch das strenge Postgeheimnis geschützt. Doch wer wusste schon in dieser Zeit allgemeiner Bespitzelung durch die Gestapo und anderer Dienste, wer dem gesprochenen Wort nicht alles im Geheimen lauschte. Verdächtige Knack-Geräusche gab es allenthalben in der Hörmuschel, auch ein befremdliches Rauschen lag nicht selten über dem Gesagten.
Ihr und ihren Kolleginnen war es bei Androhung schärfster Konsequenzen verboten, mit Dritten über das zu sprechen, was sie hin und wieder ungewollt, aber eben auch zwangsläufig, mitbekamen. Selbst zu Hause galt es, absolutes Stillschweigen zu bewahren.
Es war im Sommer 1944. Und Alma war im fünften Monat schwanger. Das Ende ihrer Dienstzeit kündigte sich deshalb an, was ihr nur recht sein konnte, denn immer öfter kämpfte sie im Laufe des Tages mit kleinen Übelkeits- oder Schwächeanfällen. Ein solcher war es wohl auch, der ihr Ohr ein wenig zu lange in der Leitung verweilen ließ. Das Gehörte ließ ihr fast das Blut in den Adern gefrieren.
Sie war in einer Verbindung zwischen einem Major der Wehrmacht oder Sturmbannführer der SS, einem gewissen Schnittmacher, und dem Bereichsleiter der Reichsbahn hängen geblieben, als der Major ganz unverblümt den Reichsbahner anblaffte, dass es in seinem “Saustall“ offensichtlich destruktive Elemente der Wehrzersetzung gäbe. Um echte Sabotage müsse es sich dabei handeln. Denn nicht anders sei es zu erklären, dass immer wieder Lokomotiven mit defekten Schubstangen die Lokschuppen seines Bereiches verließen, um dann nach ein paar lächerlichen Kilometern defekt liegen zu bleiben. Noch eine solche Panne, und er würde dafür sorgen, dass Köpfe rollen, und seine eigenen Leute würden den „Saustall“ dann selber ausmisten.
Das war ja genau der Betriebsteil, in dem ihr Siggi seinen Dienst versah, erkannte sie glasklar. Jetzt war ihr nicht nur übel, ihr schwante, auch nicht mehr genug Kraft in den Beinen zu haben, so elend fühlte sie sich in jenem Augenblick. Doch sie schaffte es, ihre Schicht zu beenden, während sie sich undeutlich erinnerte, dass Siggi schon das eine oder andere Mal andeutungsweise erwähnt hatte, dass es immer wieder unerklärliche Pannen gäbe.
Ihr gemeinsames Abendessen, ohnehin kärglich genug, verlief in einer bedrückten Atmosphäre, und von dem wirklich Wenigen, was auf den Tisch kam, rührte Alma kaum etwas an. Erst als Siggi lange genug seine bohrende Neugier wegen ihrer depressiven Stimmung in Fragen gekleidet hatte, kamen ihr unter Tränen die Antworten. So berichtete sie stockend von dem ungewollt belauschten Gespräch.
Jetzt war es ihr Mann, der vor Schreck ein wenig blasser wurde, was sie aber kaum bemerkte, denn der zu Ende gehende Sommer hatte genügend Farbe in sein Gesicht gebrannt. Siggi schwieg kurz und sagte dann:
„Alles kann Zufall sein, das Material ist auch nicht mehr das, was Krupp einst so berühmt gemacht hat. Aber auch an den Worten des Majors oder Sturmbannführers könnte etwas dran sein. Wir müssen wachsam sein.“
Innerlich seufzte er tief auf und dachte nur: „Glück gehabt, meine Wachsamkeit gilt fortan nur mir selbst“, denn über seine überaus wirksamen Maßnahmen zur Transportbehinderung hatte er mit keinem Menschen, wirklich mit niemandem, nicht einmal mit seiner Frau gesprochen. Auch jetzt nicht.
Pfennige kamen ihm fortan nicht mehr in die Tasche, und die Art der Manipulation war bisher zum Glück unentdeckt geblieben. Es gab auch keine weiteren Aktionen mehr von ihm, so dass weder Gestapo noch Wehrmacht sich veranlasst sahen, in seinem Bereich herumzuschnüffeln.
Bis auf die vielen nächtlichen Bombenalarme, die sie beide immer wieder in Angst und Schrecken versetzten, blieb in ihrem Umfeld alles weitgehend ruhig. Alma hatte schon bald ihre letzte Schicht im Fernamt beendet und bereitete sich voller Vorfreude auf die Geburt ihres ersten Kindes vor.
Ein Mädchen oder ein Junge? Eigentlich war es beiden egal. Hauptsache, gesund sollte das Kind sein. Doch welche Zukunftsperspektive würde es wohl haben? Dass der Krieg bald enden müsse, das lag in diesem Spätherbst bereits für jeden greifbar in der Luft. Nur aussprechen sollte man es besser nicht. Höchstens im Kreise engster Vertrauter, von denen man sicher war, dass sie es nicht weiter trugen.
Ja, welche Zukunft lag vor diesem Kind? Würde es genügend zu essen haben? Hätten sie bei seiner Geburt noch ein Dach über dem Kopf? Wie würden die Sieger mit ihnen allen umgehen? Würden sie zur Zwangsarbeit verschleppt und so elend vegetieren müssen wie die armen Menschen aus den besetzten Gebieten, deren Arbeitskolonnen man allenthalben auf den Straßen nahe den großen Werken begegnen konnte?
Kai von Tielass
Systemtreue und Staatsraison waren die Grundlage seiner Sozialisierung, die Kai von Tielass freiwillig in den aktiven Dienst der Wehrmacht förmlich gedrängt hatten. Seine Obsession war immer die Luftwaffe gewesen, doch aufgrund seiner starken Kurzsichtigkeit hatte man ihn schon früh wissen lassen, dass es mit seinem Wunsch, in der Kanzel eines Flugzeuges seinen Dienst zu tun, mit Sicherheit nichts werden könne.
So verbrachte er die ersten Jahre seiner Laufbahn damit, Flugzeuge, insbesondere die Jagdflieger, die es ihm besonders angetan hatten, zu warten und für die Einsätze vorzubereiten. Das ging so weit, dass er bei jedem Flugzeug, welches er technisch in die Luft brachte, regelrecht Schmerz empfand, wenn es stark beschädigt zum Flugplatz zurückkehrte. Doch besonders schlimm war es, wenn eines gar nicht zurückkehrte. Dabei dachte er weniger an seine fliegenden Kameraden, die womöglich ihr Leben gelassen hatten, denn diese waren ja nun Helden und hatten einen Platz in seiner ideologischen Walhalla gefunden.
Bis zum Unterfeldwebel hatte er es inzwischen gebracht, doch die sich weiter verschlechternde Sehstärke seiner Augen bereitete ihm immer größere Probleme. Seine Brillengläser glichen mittlerweile eher den Deckeln kleiner Einweck-Gläser. Sie ließen die dahinter liegenden blauen Augen wie große Glasmurmeln erscheinen, deren polierte Oberfläche durch zu häufiges Spielen im Sand ihren einstigen Glanz verloren und matt geworden waren.
Nein, eine Versetzung auf die „Schreibstube“ wollte er auf jeden Fall vermeiden, obwohl er einsah, dass bald kein Weg daran vorbeiführen würde. Denn inzwischen kam es immer häufiger vor, dass er einen Untergebenen mit zackigem Hackenschlagen auf förmlich militärische Art begrüßte. Auf zehn Meter Entfernung konnte er einfach nicht mehr erkennen, wer ihm da über den Weg lief und welchen Dienstgrad dieser innehatte. Dazu gesellte sich zunehmend der beißende Spott seiner Kameraden.
Die ihm Untergebenen machten sich hinter vorgehaltener Hand über ihn lustig, fürchteten sie doch die Wutausbrüche des Unterfeldwebels Kai von Tielass, dessen Namen sie stets so gedehnt aussprachen, dass er sich anhörte wie Tiel und Hass. Kameraden gleichen oder gar höheren Ranges konnten ihrem Spott da schon eher freien Lauf lassen, so dass man Sätze hören konnte wie:
„Na, Herr Unterfeldwebel, habe jehört, se sollen zu den Tintenpissern abkommandiert werden. Wüsste da aber auch noch ne jute Stelle bei den Sesselfurzern, sollten se die bevorzugen. Könnte mich da für sie verwenden.“
Da war die Ansage eines ihm Gleichgestellten schon weit weniger verletzend und tatsächlich ernst gemeint:
„Hab da jestern nen Zivilist`n jesprochen, det sind doch och janz nette Leute“ – „Übrigens, ich hab da in Ihrem Heimatbezirk nen Onkel in der Verwaltung, der hat die Genehmigung, noch ein paar Planstellen mit nur bedingt kriegstauglichen Männern zu besetzen. Damit die Verwaltung nicht zusammenbricht.“
Diese Chance, ehrenhaft ins Zivile wechseln zu können, ließ Herr von Tielass sich nicht entgehen, konnte er doch von jetzt ab näher bei seiner Familie im westlichen Ruhrgebiet sein. Seine Cousins, die ihn früher gerne wegen seiner eher unscheinbaren Statur und vor allem seiner Sehschwäche, sehr zu seinem Leidwesen, gehänselt hatten, waren an der Front und nur selten auf Heimaturlaub. So war von dieser Seite kein Stress zu erwarten. Bei seinen Cousinen fand er kaum Beachtung, was ihn allerdings insgeheim wurmte, denn bisher war er Junggeselle geblieben. Er hatte einfach keinen Schlag bei den Frauen, die gleichzeitig seine gehässig impulsive Art fürchteten, die schon mal aus ihm herausbrechen konnte.
Das zu provozieren, dazu reichte schon eine abfällige Bemerkung über die Situation oder die Abstammung derer, die ein „von“ oder „zu“ in ihrem Namen trugen, wozu er ja schließlich auch gehörte. Sprach jemand das Wort „Etagen-Adel“ aus, womit diejenigen gemeint waren, die entledigt von Grundbesitz und Dienstboten, nun ihr Leben auf einer Mietetage, meist trefflich eingerichtet hatten, stieg ihm bereits die Zornesröte ins Gesicht. Witzelte aber jemand in seiner Umgebung gar: „Ja, ja, die Adeligen - die Mutter immer eine Geborene von oder zu, der Vater meist ein auf und davon.“ Dann konnte es schon mal aus ihm herausplatzen und er brüllte den „Spiritus rector“ dieser Worte mit üblen Beschimpfungen an.Er hasste einfach zutiefst diese Respektlosigkeit vor seinem vermeintlich gehobenen gesellschaftlichen Stand.
Seinen neuen Arbeitsplatz fand er im Rathaus seiner Heimatstadt. Hier wurde er Herr über eine Flut von Karteikarten, denen noch keine Reichs-Personalnummer zugeordnet war. Dem Kameraden aus seiner Einheit und dessen Onkel sei Dank, die ihn hier im Zivilen untergebracht hatten, dachte er öfters, ohne es offen auszusprechen.
Alles schien soweit gut, nur vermisste er manchmal seine Uniform, die seiner mehr oder weniger unscheinbaren Gestalt äußeren Halt gegeben hatte. Dafür kompensierte er diesen subjektiv empfundenen Missstand mit einer neuen und unikativen Frisur. Sein mittellang getragenes Haupthaar ließ er mit einer Creme pomadig glänzen und legte einen Mittelscheitel an, so dass die Haarspitzen die kurz geschorenen Seiten ein wenig überdeckten.
Schaute man ihn etwas länger an, als einen Augenblick, beschlich einen unwillkürlich das Gefühl, einem Mensch gewordenen Wasserbüffel mit schwerer Brille zu begegnen, aus deren Gläsern übergroße blaue Augen schauten. Doch er selbst befand seine Erscheinung für gut und dem Amt angemessen und würdig. Den Grundstein für seinen künftigen Spitznamen hatte er damit selber gelegt, nur wusste er das damals noch nicht.
Allerdings war die Unterbringung seiner Abteilung in einem provisorischen Nebengebäude Kai von Tielass ein Dorn im Auge. Leider war ein Flügel des Rathauses nach einem Bombentreffer nicht mehr benutzbar. Dabei liebte er doch die nach Bohnerwachs riechenden dunklen Flure des Haupthauses, die den Hall seiner klackenden Absätze an den kahlen Wänden mehrfach zurückwarfen und verstärkten. Dazu hatte er diese eigens vom Schuster mit kleinen U-förmigen Eisen beschlagen lassen. Offiziell natürlich, um das Material der Laufflächen zu schonen.
Die Versetzung ins Hauptgebäude kam ihm da gerade recht. Nun durfte er die Position des Standesbeamten, der dauerhaft erkrankt war, übernehmen. -Verletzt bei einem feigen nächtlichen Bombenangriff auf die Zivilbevölkerung-, hieß es in der innerbehördlichen Verlautbarung.
Sein neues Büro dekorierte Kai von Tielass ergänzend zu dem obligatorischen Foto des „Gröfaz“, also dem größten Feldherrn aller Zeiten, mit einigen Fotos aus der Fliegerei, unter denen auch einige waren, auf denen er in Uniform geschickt vor einem Jagdflieger posiert, seine unscheinbare Gestalt ins bessere Licht rückend.
Kernstück dieser Fotogalerie aber war die große handkolorierte Abbildung des Drei-Deckers der Fliegerlegende aus dem ersten Weltkrieg, dem Freiherrn Manfred von Richthofen. Mit seiner von keinem anderen Jagdflieger je erreichten Anzahl von Abschüssen und gewonnenen Luftkämpfen war er zu zweifelhaftem Weltruhm gelangt und zum fliegerischen Helden-Idol des Amtmanns Kai von Tielass geworden. Und so zierten auch noch einige größere und kleinere Porträtfotos seiner Helden die ansonsten so kahlen Wände seiner Amtsstube.
Im beschädigten Rathaus war der Raum knapp, weshalb das nicht ganz so kleine Amtszimmer des Standesbeamten sowohl für die Anmeldung von Geburten, für die Registrierung von Sterbefällen und gleichzeitig auch für Eheschließungen als Trauzimmer genutzt wurde. Umso mehr war ein wenig zusätzlicher Schmuck an den Wänden, wenn er denn systemkonform war, gerne willkommen.
Nachwuchs bei Alma und Siggi
Der kleine Weg entlang des Bahndamms war im Grunde genommen nicht mehr als ein Trampelpfad, gut einen Meter tiefer liegend als die Gleise, die zum Rangierbahnhof führten, wo Siggi inzwischen zum Schichtleiter aufgestiegen war. Ein Weg, den eigentlich nur die Reichsbahner kannten, denn er führte durch allerlei Gestrüpp zu einer Signalanlage, die hin und wieder der Wartung bedurfte.
Seinen Weg von zu Hause zur Arbeitsstelle hätte Siggi über die nächste Brücke auf die andere Seite des Bahndamms, also auf die Ostseite, nehmen müssen, lag doch seine Wohnung auf dessen Westseite, nicht unweit der besagten Signalanlage. Ein lästiger Umweg, der ihn gezwungen hätte, das Fahrrad zu benutzen. Und Fahrräder waren in jener Zeit ein rares Gut, das schnell Liebhaber fand, und das man deshalb stets gut im Auge halten sollte.
So kam es ihm gerade recht, dass er als Reichsbahner die Gleise zu Fuß überqueren durfte, was dem normalen Bürger aus Gründen der Sicherheit verwehrt war. Sein Weg von und zur Arbeit verkürzte sich damit erheblich. Von zu Hause, aus einer Seitenstraße kommend, die auf jene traf, die entlang des Bahndamms verlief, brauchte er somit diese nur zu überqueren, um auf den bevorzugten Trampelpfad zu gelangen. Von dort waren es dann nur noch wenige Minuten bis zu seinem Arbeitsplatz.