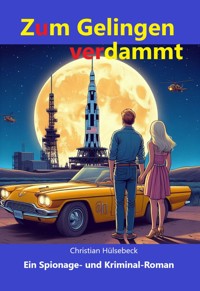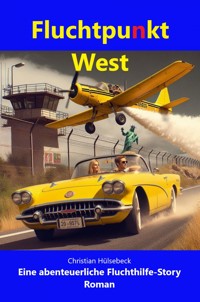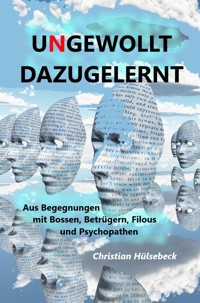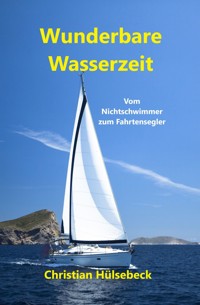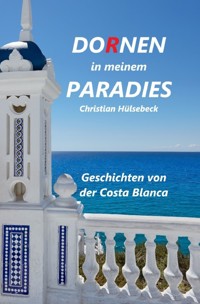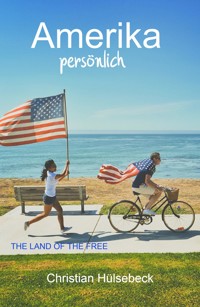
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Rund siebzig Jahre Sicht auf die USA, vom Nachkriegskind bis zum Pensionär. Geprägt von Sehnsüchten nach dem Land der "unbegrenzten Möglichkeiten" und dem, was damals über den Atlantik zu uns kam. Eindrücke aus etlichen Reisen im "Land of the Free" und die Begegnung mit Menschen und deren Art, ihr Leben zu gestalten, sind Teil dieses Buches, genauso wie die Begleitung der Auswanderung des eigenen Bruders dorthin, wo höher – weiter – schneller einen anderen Stellenwert haben, als bei uns in Deutschland. Eine Pflegebetreuung in USA gewährt sowohl Einblicke in das Gesundheitswesen und die Sozialstruktur des Landes, als auch in die Eigenverantwortlichkeit der Bürger. In diesem Buch wird erzählt, was man schwerlich in Reiseführern finden wird. Das Erlebte ist persönlich, und somit ausgesprochen authentisch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AMERIKA
PERSÖNLICH
Christian Hülsebeck
Von der Zukunft
In die Gegenwart
Respekt vor jenen, die den Sprung über den großenTeich wagten,
Was den Leser erwartet
Rund siebzig Jahre Sicht auf die USA, vom Nachkriegskind bis zum Pensionär. Geprägt von Sehnsüchten nach dem Land der “unbegrenzten Möglichkeiten“ und dem, was damals über den Atlantik zu uns kam, ist nur ein Teil dieser Lektüre.
Eindrücke aus etlichen Reisen im „Land of the Free“ und die Begegnung mit Menschen und deren Art, ihr Leben zu gestalten, sind ein anderer Teil dieses Buches, genauso wie die Begleitung der Auswanderung des eigenen Bruders dorthin, wo höher – weiter – schneller einen anderen Stellenwert haben, als bei uns in Deutschland.
Eine Pflegebetreuung in USA gewährt sowohl Einblicke in das Gesundheitswesen und die Sozialstruktur des Landes, als auch in die Eigenverantwortlichkeit der Bürger.
In diesem Buch wird erzählt, was man schwerlich in Reiseführern finden wird. Das Erlebte ist persönlich, und somit ausgesprochen authentisch.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Teil 1 Kindheit und Jugend
Gut und Böse
Höher, größer, weiter, schneller
Vom tapferen Schneiderlein zum Multi-Millionä Keine Indoktrination
Der Schock
Der Wind dreht sich
Teil 2 Reisen in die USA
Erst einmal nach New York
Kleinste Viecher, große Wirkung
Einmal quer durch Kanada
Einmal Kalifornien rauf und runter
Kennedy und Hemingway
Kalifornien, ein neuer Lebensabschnitt
San Diego, immer eine Reise wert
Karibik – Florida – Kalifornien
Das größte Passagierschiff, die größte Rakete
Teil 3 Auswanderung
Immer der Sonne nach
Vom Ferienhaus zur Auswanderung
Die Krankenkasse. Ein schwieriges Thema
Haus-Kauf – anders als bei uns
Die Green Card – Ziel der Begierde
Die Krankenkasse zahlt
Wild West? – klar, gibt´s noch
Alltagsgeschichten
Teil 4 Krank im „Land of the free“
Ein Traum zerplatzt
Pflegeheim und Geld
Eine neue Routine
Was haben wir gelernt
Tele Management
Das Schicksal blufft nicht wie beim Poker
Dazugelernt
Fernsteuerung
Eine harte Zeit in Kalifornien
Vom Desaster zur Lösung
Neuer Akt, alte Dramen
Kurzer Stopp in der Heimat
Unverhofft kommt oft
Ein Ende, Hand in Hand mit „POC“
Aufräumen
Punktlandung
Nachwort und Dank
Vorwort
Mal wieder stelle ich mir die Frage, warum ich dieses Buch eigentlich schreibe. Muss ich mein Ego befriedigen? Oder sind es die positiven Rückmeldungen auf meine Biographie
„Geradeaus geht´s um die Ecke“, die mich antreiben? Oder sitzt alles viel tiefer und ist durch eine Situation getriggert worden, die durch einen uns so zwiespältig erscheinenden US-Präsidenten namens Donald Trump sichtbar geworden ist?
Vielleicht sind es aber auch die vielen negativen Kommentare über die USA, wie Kulturlosigkeit, Hegemonialstreben, Rücksichtslosigkeit und dergleichen, die auch schon mal in dem Satz zusammengefasst werden: „Dieses Land würde ich niemals betreten“. Derartige Äußerungen werden aber auch gerne von Leuten gemacht, die mit Vorliebe in Länder reisen, die zwar den Charme einer gewissen Urwüchsigkeit versprühen, aber alles andere von dem sind, was ich als korrekt bezeichnen würde, jedenfalls unter dem Gesichtspunkt der Menschenrechte, der Freiheit oder der Demokratie.
Diesem, in meinen Augen ungerechtfertigten pauschalen US-Bashing will ich auch mit diesem Buch ein wenig entgegentreten, indem ich einfach meine positiven sowie negativen, also rein subjektiven Erfahrungen, niederschreibe. Auch kommen die Emotionen nicht zu kurz, denn meine Einstellung zu diesem großen und für mich großartigen Land sind geprägt von den Kindheitseindrücken eines 1948 geborenen „Baby-Boomers“, der die Wirren und Nöte der Nachkriegszeit noch zu großen Teilen miterlebt hat.
Dazu gehört die Wahrnehmung der USA als militärische Schutzmacht, demokratische Zielorientierung und als industrieller Superkomplex genauso, wie meine persönlichen Erfahrungen aus Kindheit und Jugend. Ohne den politischen und strategischen Willen der USA, für ein freiheitliches Europa zu mindestens im westlichen Teil dieses Kontinents einzutreten, wäre ich wohl in meiner Geburtsstadt Dresden aufgewachsen. Meine Familie wäre auf Grund kommunistischer Zwänge auseinandergerissen worden und mein Leben hätte in Unfreiheit begonnen, die ich wahrscheinlich im politischen Knast von Bautzen fortgesetzt hätte auskosten dürfen. Denn es fällt mir nach wie vor schwer, mein loses Mundwerk zu halten, wenn mir strategisches Schweigen besser zu Gesicht gestanden hätte. Bei diesen Worten habe ich auch das Schicksal meines Großvaters vor Augen, der als früherer Leiter unseres Familienbetriebes in Dresden lieber den Freitod gewählt hatte, um sich der Deportation nach Russland zu entziehen, die ihm von seinen kommunistischen Widersachern in den düstersten Farben ausgemalt worden ist.
Das Thema USA begleitet mich also bereits in der einen oder anderen Weise von Kindheit an, gefolgt von dem Wunsch, dieses Land auch einmal zu bereisen. Die spätere Auswanderung meines Bruders, der auch mein Geschäftspartner war, zusammen mit seiner Frau in die USA, haben das Verhältnis zu diesem Land, wenn man überhaupt von einem Land als homogene Einheit sprechen kann, nochmals auf ein besonderes Niveau gehoben.
Dass meine Frau und ich die letzten beiden Lebensjahre meines Bruders und seiner Frau in einer dramatischen gesundheitlichen Entwicklung vor Ort begleiten mussten, oder besser gesagt, durften, hat mir Einblicke in die Strukturen der Verwaltung und des Gesundheitswesen eröffnet, die einem Reisenden, aber auch Freund oder Verwandten auf einem normalen Familienbesuch immer verborgen geblieben wären.
Diese Einsichten sind genauso subjektiv, wie alle in diesem Buch geschilderten Vorkommnisse und Begebenheiten. Doch sie zeichnen ein Bild, das weder ein Reiseführer, noch ein politisches Buch, von denen es ja etliche gibt, wiedergeben können. Eher wären da sozialkritische TV-Berichte oder Bücher zu nennen, die sich mit Land, Leuten und sozialen Aspekten auseinandersetzen.
So ist dieses Buch in vier Komplexe geteilt, von denen sich der erste damit beschäftigt, wie meine Affinität zu den USA, die glücklicherweise auch von meiner Frau Helga geteilt wird, überhaupt entstanden ist.
Im zweiten Teil lasse ich Sie, geneigter Leser, an Begebenheiten unserer vielen Reisen auf dem nordamerikanischen Kontinent teilhaben, ohne Sie möglicherweise mit dem zu langweilen, was man üblicherweise in jedem Reiseführer findet.
Der dritte Teil beinhaltet eine Fülle kleinerer und größerer Querelen, welche die Auswanderung meines Bruders in die USA betreffen, die meine Frau und ich in teilweise täglichen Telefonaten begleitet haben, beziehungsweise die uns vor Ort selbst begegnet sind.
Vierter und letzter Komplex ist die Betreuung eines vom Schlaganfall schwer gezeichneten Bruders und seiner dementen Ehefrau. Das aber mit so ziemlich allen Facetten, die auch eine gesetzliche Betreuung in Deutschland ausmachen, wobei in den USA alles auf einer anderen Rechtsgrundlage fußt, die uns oftmals fremd oder gar grotesk erschien.
Teil Eins:
Kindheit und Jugend - Gut und Böse
Fern und unerreichbar ist ein Land, in dem das Gute zu Hause ist, und doch ist es mir so nah.
So könnte ich meine frühen Kindheits- und Jugenderinnerungen und Gefühle in einem kurzen Satz zusammenfassen, bevor ich in der Lage war, etwas differenzierter zu denken und auch Dinge kritisch mit dem Verstand eines pubertären Jugendlichen zu hinterfragen. Gedanken und Gefühle, die mit der Herkunft meiner Familie zusammenhängen, genauso wie mit dem von Deutschland angezettelten Zweiten Weltkrieg.
Väterlicherseits stammt meine Familie aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern, wo der Großvater noch als Landvermesser mit dem Pferdegespann unterwegs war und dessen landwirtschaftliche Prägung im Kampf für die Butter und gegen die Margarine an jedem zweiten Bauernhof durch ein großes Schild manifestiert wurde. Die Aufschrift lautete:
An Butter sparen, grundverkehrt;
der Körper braucht sie: Butter nährt!
Da mein Vater sein Ingenieurs-Studium an der TU Dresden absolviert hat, erschloss sich ihm dort auch ein neues privates Umfeld, in dem er auch seine spätere Ehefrau, meine Mutter, kennenlernte. So ergab es sich, dass der Lebensmittelpunkt unserer jungen Familie das schöne Elbflorenz wurde, wie Dresden auch gerne ob seiner bemerkenswert schönen historischen Bauten genannt wird.
Auch wäre meine Mutter wohl kaum in das ländliche Mecklenburg-Vorpommern, bzw. in das kleinstädtische Güstrow gezogen. Entstammte sie doch einer eher großbürgerlichen Fabrikantenfamilie mit umfangreichen Grundbesitzungen und einem den Umständen angepassten, aber sehr arbeitsamen Lebensstil. Ich kenne das natürlich nur aus den stets wiederholten Erzählungen, insbesondere der Mutter, denn zu dieser Zeit hatte ich noch nicht das Licht der Welt erblickt.
Als Kind war ich zu differenziertem Denken noch nicht in der Lage. Da gab es schwarz und weiß, oder anders ausgedrückt, Gut und Böse. Und die Erzählungen der jüngsten Vergangenheit wurden in meinem kindlichen Kopf in eben diese beiden Kategorien eingeteilt. Die mehr oder weniger unbeschwerten Zeiten vor dem Zweiten Weltkrieg, in denen es der Familie an nichts zu mangeln schien, ließen sich problemlos der Sparte Gut zuordnen, genauso wie die damit verbundene gesellschaftliche Stellung, die eine offene Tür in vielen Situationen bereithielt.
Als mein erinnerbares Denken begann, das bei Kindern etwa zwischen drei oder vier Jahren anfangen soll, fand ich mich allerdings in einer völlig anderen Welt wieder: Im Ruhrgebiet, in einer kleinen Dachgeschosswohnung, die in einer prekären Gegend lag mit einer ebensolchen Nachbarschaft, die man nicht unbedingt zu Freunden haben muss.
Wenn das, was ich aus den Erzählungen der Vergangenheit als gut erkannte, nun nicht mehr da war, dann musste es wohl etwas Böses gegeben haben, was das Gute beseitigt hat. Bald reifte in mir die Erkenntnis, dass es der Krieg war mit seinen negativen Folgen, die uns getroffen hatten. Für mich waren die „Feinde“ die Bösen und wir gehörten unisono zu den „Guten“.
Die Bösen oder deren Stellvertreter in Form der Kommunisten, oder in Persona Walter Ulbricht mit seiner Fistelstimme, hatten sich unseres Besitzes ermächtigt und uns aus dem Paradies vertrieben. So sahen es meine Kinderaugen. Dazu kamen die Schauergeschichten von persönlichen Übergriffen der russischen Besatzungs-Soldaten insbesondere gegen Frauen, aber auch gegen Männer, die gerne von volltrunkenen Soldaten mit der Pistole bedroht wurden, wobei sich so mancher tödliche Schuss löste.
Viele Jahre später berichtete mir mein Schwiegervater, dass er einer solchen brenzligen Situation nur mit Mühe entkommen konnte, weil ein russischer Offizier den Soldaten, der ihm die durchgeladene Waffe an den Kopf hielt, nur mit Mühe vom Abdrücken der Pistole abhalten konnte. Mit anderen Worten in der Sprache des Militärs: Er hat den Kerl „zusammengeschissen“ !
Für mich als Kind waren alle solche Erzählungen Sekundärerlebnisse, die sicher in meiner Psyche etwas bewirkt haben. Ich will nicht sagen angerichtet haben, aber heute erkenne ich, worin meine abgrundtiefe Abneigung gegen alles Kollektive, Kommunistische und Fremdbestimmte begründet ist.
Doch das Böse hatte natürlich auch eine Kompensation im Guten, das von unseren Verbündeten verkörpert wurde. Dabei traten in meiner Kindheit die Engländer oder Franzosen in den Hintergrund, wurden praktisch bedeutungslos. Viel mehr faszinierten mich die Geschichten der amerikanischen Rosinenbomber, die die eingeschlossene Stadt Westberlin vor dem „Hungertod“, retteten. Wobei die bösen Kommunisten mal wieder der Grund des Übels waren.
Auch die Care Pakete, die von der amerikanischen Bevölkerung zur Linderung der größten Not ehemaliger Todfeinde organisiert wurden, waren ein weiterer Baustein, alles Amerikanische in den Olymp des Guten zu befördern.
Und dann gab es noch diesen General Clay der amerikanischen Besatzungszone, der schützend seine starke Hand über unser kaputtes Land hielt, genauso wie sein Präsident Eisenhower, der es ihm ab 1953 gleichtat. Während der Repräsentant des für mich Bösen, der blutrünstige Josef Stalin war, und ebenso sein Amtsnachfolger, der unsere armen Kriegsgefangenen schikanierte und nicht nach Hause zu ihren Familien ließ.
So und nicht anders entwickelte sich der Schwarz-Weiß-Film in meinem kindlichen Kopf. Grautöne kamen erst später hinzu und gar Farbe bekam der Streifen, als ich in der Lage war das Thema Vietnam zu reflektieren. Aber noch bin ich an dieser Stelle der Betrachtungen etwa zehn Jahre alt, also Ende der fünfziger Jahre. Und so schieben sich weitere Dinge, die mein Bild von den USA prägen sollen, in den Blickwinkel meiner Betrachtung.
Da sind zum Beispiel die bewegten Bilder aus der Werbung, aus dem Fernsehen, wenn man schon so etwas wie eine „Flimmerkiste“ hatte, wie der Fernsehapparat volkstümlich genannt wurde. Oder aus den Wochenschauen im Kino, wo man Geräte des täglichen Bedarfs in den USA-Haushalten sehen konnte, wie Geschirrspüler oder superstarke Hoover-Staubsauger, während die deutsche Hausfrau noch mit der Hand spülte und die Teppiche mit dem Klopfer auf der an jedem Haus zu findenden Teppichstange ausklopfte, dass es nur so durch die Häuserzeilen schallte. Dabei hatte sie stets artig ihre Frisur mit einem Kopftuch in Putzfrauenmanier vor den Staubwolken geschützt.
Dagegen plauderte die Amerikanerin mit Mann, Freundin oder Kindern, während sie mit anscheinender Leichtigkeit dem Geschirrspüler per Knopfdruck Order erteilte, lackierte sich nebenbei ihre Nägel oder schien elegant gekleidet über den Teppichboden zu schweben, während ihr der Vacuum Cleaner offensichtlich mühelos folgte, um die ihr zugedachte Arbeit zu erledigen.
Da setzt sich in einem jugendlichen Kopf schon mal schnell fest, dass die Amerikaner technisch einfach weiter sind, nein, wesentlich weiter sind als wir, und das Gesehene wird zur Zielprojektion der Wünsche. Schließlich will man ja das Gute und nicht das Schlechte.
Von diesem berichten allerdings die vielen Briefe der in der DDR gebliebenen Verwandten, die sich mit allerlei Mangel herumschlagen müssen. Angefangen bei den Lebensmitteln, von denen einige überhaupt nicht zu haben sind, wie Südfrüchte über solche, die nur auf Bezugsmarken erhältlich sind, bis zu denen, die als sogenannte Bückware bezeichnet wurden. Also Waren, die es offiziell nicht gab, aber nachdem sich die Verkäuferin unter die Theke gebückt hatte, dann doch für Freunde oder Parteigenossen verfügbar waren.
Von technischen Erzeugnissen will hier gar nicht reden. Vieles entsprach zu dieser Zeit einfach nicht dem, was unseren Qualitätsanforderungen genügt hätte. Zur Ehrenrettung der „Werktätigen der DDR“ möchte ich hinzufügen, dass wir als Jugendliche nicht beleuchten konnten, dass dort ungleiche Verhältnisse herrschten, denn eine Förderung wie durch die USA oder die anderen Siegermächte hatte es dort nicht gegeben. Eher das Gegenteil war der Fall. Und so stand nun mein Amerika wieder auf der Seite des Besseren.
Als Kinder wurden wir gerne sonntags vormittags in die Freiheit der Kindervorstellung eines unserer Kinos entlassen, beziehungsweise in die frühe Jugendvorstellung ab 10 Jahre am Nachmittag um 3 Uhr. Nicht zuletzt, um den Eltern auch mal den Freiraum zu schenken, der ihnen als Eheleuten in manchmal beengten Wohnverhältnissen oft verwehrt ist. Wie richtig diese Betrachtung ist, zeigte sich bei Rückkehr aus dem Kino in einer abgeschlossenen Schlafzimmertür, die gedankenvergessen noch nicht wieder entriegelt war.
Aber welche Filme hatten wir uns als kleinere und größere Kinder angesehen? Erinnern kann ich mich an Märchenfilme, die fast ausnahmslos unter dem Namen des berühmten Walt Disney liefen oder mit Warner Brothers zu tun hatten. Später kamen Filme hinzu, in deren Vorspann der Löwe von Metro Goldwyn Mayer den Beginn einleitete oder besser gesagt „einbrüllte“.
Später interessierten uns eher Westernfilme, in denen die Föderierten oder die Gesetzesvertreter stets die Guten waren und die Mexikaner oder Indianer das Böse verkörpern mussten, was man heute sicher nicht mehr so darstellen dürfte, ohne einen gehörigen Shit Storm auf sich zu ziehen. Da waren sie wieder, die Guten, und nisteten sich im Kopf ein.
Und dann war da noch die allgegenwärtige FOX TÖNENDE WOCHENSCHAU. Zusammengefasste Wochennachrichten US-amerikanischer Produktion, die vor jedem Kinofilm präsentiert wurde. Theatralisch, ja teils dramatische Musik war den Bildern unterlegt, während der Nachrichtensprecher fast in der propagandistischen Manier eines Losbudenverkäufers die Texte dazu sprach. Da sahen wir Bilder von Wolkenkratzern ungeahnter Höhe, Verkehrswege, die unsere Autobahnen wie Nebenstraßen erscheinen ließen sowie Industrieanlagen gigantischen Ausmaßes.
Alles das erschien in einer Leichtigkeit des Seins, wobei die Autos eher kleinen Raumschiffen glichen, während sich der Deutsche Arbeiter mit einem Goggomobil, also einer Hutschachtel mit Rädern rumquälte, oder Lloyd Hansa mit einer imprägnierten Pappmaché-Karosserie fuhr, wenn er sich nicht als stolzer Besitzer eines Fiat Topolino fühlte, einem Autozwerg, der bis 1955 gebaut wurde.
Mich hat diese Wochenschau mit Sicherheit amerikanisiert. Ob es so gewollt war von den Machern, oder ob sie ein Instrument der politischen Medienpräsenz war - diese Betrachtung kam mir erst viel später in den Sinn. Keine Zeitung, und die Landschaft der Blätter war schier unübersehbar bis hin zur Parteizeitung der KPD, konnte gegen die aus USA stammende Wochenschau anschreiben und Dinge verbreiten, deren Wahrheitsgehalt im Kino widerlegt wurde.
Aus dem Kino kommend, nach einem amerikanischen Film noch in dessen Sphären badend (wer erinnert sich nicht an den O-beinigen Gang eines John Wayne?), fanden wir uns wieder in der grauen Tristesse des Ruhrgebietes, mit einem tief schlummernden Sehnsuchtsziel: USA. Während in unseren Köpfen die amerikanischen Straßenkreuzer rollten, die von meinem Patenonkel Fred, der in der Bundestagsverwaltung in Bonn arbeitete und diese als Diplomatenfahrzeuge täglich sah, als „Protzkübel“ verspottet wurden, sah die Realität vor Ort doch völlig anders aus.
Gerade noch meine Altersgruppe wird eventuell den Begriff der Speiswanne kennen. Eine ca. 30 cm hohe Metallwanne von etwa 2 x 4 Metern Ausmaß, in der Kalk mit Zementspeis mit einem Lochspaten verrührt wurde. Schwerste Handarbeit war das, und zum Feierabend wurde die Wanne von den Mauren oder Putzern von allen Resten gereinigt, damit beim nächsten Mischen keine Klumpen im Weg waren. Eine solche leere Wanne stand auf dem Lehrer-Parkplatz einer nahen Schule und die Stärkeren der Oberstufe hatten sich den Gaudi gemacht, das Goggomobil eines Lehrers dort hineinzusetzen. Der Mann war allerdings nicht geneigt, sich zu entblöden und seine Not den lauernden Schülern preiszugeben. Vielmehr kam er des Abends zurück und ließ den Job unbemerkt von jedem Schüler von ein paar kräftigen Kerlen erledigen, die seiner „Nuckelpinne“ wieder auf die Fahrbahn halfen. Mit einem Auto amerikanischer Bauart hätte das wohl kaum geschehen können.
Höher, größer, weiter, schneller.
Als Kinder hatten wir uns gerne zu Karneval als Cowboy, Indianer oder Trapper verkleidet, also wieder etwas von jenseits des Atlantiks. Kaum jemand kam auf die Idee den Russen zu mimen. Selten einmal zeigte sich der eine oder andere Kosake im Kinderkostüm, falls sich so eins noch im Familienbesitz befand. Indianer-Kinderbücher hatten unsere Fantasie hinreichend beflügelt. Dazu kamen meistens noch die Comic-Hefte von Mickey Mouse und Co, in die wir uns gerne mit all ihren Fantastereien vertieften, während ähnliche Heftchen deutscher Machart eher Langeweile unter uns Kindern verbreiteten.
Aber Amerika konnte nicht nur höher, schneller, weiter. Es konnte auch die emotionale Schiene der Kinder bedienen. Fernsehserien, wie Lassie, dem Colli, der seinem kindlichen Herrchen in allen Situationen beistand und beschütze, gruben sich genauso in die Herzen der kleinen Zuschauer wie Fury, der schwarze Hengst, der seine jugendliche Bezugsperson bis zum Äußersten verteidigte und dabei gefährlich auskeilen konnte oder auf den Hinterläufen stehend, den Bösewicht mit trommelnden Vorderläufen vertrieb. Auch Flipper war eine begehrte Serie von einem gelehrigen Delphin, der etliche Emotionen auslöste und sich lange im deutschen Fernsehen hielt. Bonanza, die allsonntäglich ausgestrahlte weichgespülte Westernserie war ein weiteres Stück USA, das regelmäßig von uns konsumiert wurde.
Später kamen die großen Kinofilme hinzu. Stellvertretend will ich hier nur „Giganten“ oder „Vom Winde verweht“ nennen, deren enormer Produktionsaufwand uns erst dann bewusst wurde, wenn wir zuvor Filme französischer oder italienischer Machart gesehen hatten, die zwar sehr gut gemacht waren, aber mit kleinstem Budget auszukommen hatten. Ähnlich wie die Filme der Serie Edgar Wallace deutscher Produktion, die einerseits als Krimi Spannung vermitteln konnten, andererseits aber bei weitem nicht die visuellen Eindrücke von Hollywood-Produktionen hinterließen.
In den Anfängen der sechziger Jahre holten wir meinen Vater öfter am Flughafen von Geschäftsreisen ab, und ich begann mich für dieses Fortbewegungsmittel der Lüfte ein wenig zu interessieren.
Alles was Reichweite und Größe hatte, kam offensichtlich aus den USA. Boeing mit ihrer 707 und den kleineren Kurz- und Mittelstrecken-Maschinen oder Mc Donald Douglas waren einfach eine andere Welt als die Flugzeuge aus englischer Produktion, die gern auf den Namen Trident One oder Trident Three hörten und einen Höllenlärm machten, genauso wie die französische Caravelle.
Auch hier waren es einmal mehr die Amerikaner, die sich als Bosse am Himmel zeigten, manifestiert in solch stolzen Namen der Carrier wie PAN AM oder TWA, die leider die Erfahrung nicht angepasster Marktpolitik machen mussten: „Gehst du nicht mitder Zeit, gehst du halt mit der Zeit.“ Das galt auch für amerikanische Giganten der Lüfte.
Am 4. Oktober 1957 versetzte mich ein schlichtes Piep-Signal in ungläubiges Staunen, und so erging es wohl den meisten Menschen. Russland hatte seinen Sputnik im All platziert, und die Welt schaute mit offenem Mund und hängender Kinnlade zu. Zumindest diejenigen, die sich zur westlichen Hemisphäre des politischen Systems rechneten. Erstens hatte man Russland diese technische Meisterleistung nicht zugetraut, und zweitens wollte niemand glauben, dass die so fortschrittlichen und technisch überlegen erscheinenden USA sich den Schneid abkaufen ließen.
Eisenhower war noch Amerikanischer Präsident, als das geschah, doch sein Nachfolger, der 35. Präsident der Vereinigten Staaten, John F. Kennedy, setzte alles daran, diese Schlappe auszumerzen, indem er dem Volk versprach, noch innerhalb eines Jahrzehnts einen Menschen auf den Mond zu bringen.
Unterstützt wurde er dabei von Wernher von Braun, einem deutschstämmigen charismatischen und äußerst fähigen Raketentechniker, der schon Hitler gedient hatte und den Nazis die verheerenden Vernichtungsraketen V1 und V2 in die Hand gab, mit denen unter anderem London bombardiert wurde. Von Braun, den wohl demokratische Kräfte eher als Kriegsverbrecher abgestraft hätten, war der Amerikaner technisch-menschliche Kriegs-Beute und nach kurzer Entnazifizierung geachteter Amerikaner, der dieser Nation zu einem technischen Vorsprung von etlichen Jahren vor den russischen Widersachern verhelfen konnte.
Im Wettlauf zu den Sternen zeigte sich alsbald, dass die USA wieder die Oberhand gewinnen würden und auch militärisch hatte der 35. Präsident der USA den Russen nichts geschenkt. Obwohl aus meiner persönlichen Retrospektive JFK in der Kubakrise mit dem Feuer gespielt hatte, aus dem schnell ein dritter Weltkrieg hätte entbrennen können. Vorerst war er mein Held, und meine Mutter bekam feuchte Augen, wenn sie Bilder von ihm sah und ich lebte in der trügerischen Gewissheit, im Schutze einer guten Weltmacht mit einem integren Führer aufzuwachsen.
Sechs Tage nach meinem fünfzehnten Geburtstag wurde mein Idol dann am 22. Nov. 1963 in Dallas, Texas, ermordet, was einerseits Bestürzung und Trauer, andererseits aber auch Ratlosigkeit bei mir hinterließ. Wie war es möglich, dass eine Nation wie eine Festung nicht mal den eigenen Präsidenten ausreichend schützen kann. Die danach folgende Ermordung des angeblichen Mörders hat schon damals erhebliche Zweifel bei mir geweckt und mich in das Lager der Verschwörungstheoretiker getrieben, was mir sonst eher fern liegt. Dabei hege ich den Verdacht, dass der eigene Geheimdienst am Werk war, um die Nation nicht in einen dritten Weltkrieg schlittern zu lassen, denn JFK hat politisch immer hoch gespielt, so mein Eindruck. Bisher hatte er gewonnen. Aber was hätte passieren können, sein Ritt auf der Rasierklinge wäre schief gegangen.
Was in der Technik höher, weiter, schneller war und fast immer von jenseits des Atlantiks kam, war in der Musik, die für uns in der Pubertät einen hohen Stellenwert hatte: „Lauter, rockiger, heißer und fetziger“. Auch das kam vom Westen über den großen Teich. Wilder Rock´n Roll und fetziger Jazz ließen die Partykeller erzittern. Schon die Gruppe um meinen fünf Jahre älteren Bruder tanzte, rockte und hüpfte nach den Liedern eines Elvis Presley und Bill Healey, Chuck Berry oder Little Richard. In meiner Alterskohorte kamen dann zum Twist und anderen Tänzen die Einflüsse aus England hinzu, namentlich durch die Beatles und die Rolling Stones, was den US-Einfluss bei uns etwas relativierte.
Auch in unserer Kleidung imitierten wir Jugendliche am liebsten, was die Amis so trugen. Dabei waren US-Army-Parka, am liebsten die echten in Olivgrün, besonders begehrt. Und hatte meine Mutter mir einem auf den Kapuzenrand noch einen Fuchsschwanz aufgepeppt, wurde das gute Stück leicht zur begehrten Beute. Also schön darauf aufpassen, denn schon ohne diesen Pelzbesatz kostete so ein Teil zwischen 50 und 80 Mark, was seinerzeit einem guten Tageslohn entsprach. Dazu waren als Beinkleider natürlich ausschließlich Jeans angesagt, aber bitte nur die echten, am liebsten von Levis, der großen US-amerikanischen Marke.
Dazu mehr im nächsten Kapitel. Hat mich doch die Biographie des Levi Strauss zutiefst beeindruckt und im Herzen berührt.
Vom tapferen Schneiderlein zum Multimillionär.
Im Jahre 1845 wanderte der 16-jährige Löb Strauss, der seinen Vornamen später in Levi ändern sollte, nach Amerika aus, um der Armut in seiner deutschen Heimat zu entkommen. Mit ihm reisten seine Mutter und ein oder zwei Geschwister, die ebenfalls den Ausweg aus größter wirtschaftlicher Not im „Land of the Free“ suchten. Dazu wollte man auf zwei Brüder in New York treffen, die sich dort mehr schlecht als recht mit einem Kurzwarenhandel, also Knöpfe, Nähzubehör, Tuche etc. über Wasser hielten.
Seine Heimat verließ der junge Löb Strauss nicht ohne seiner Angebeteten aus besser situiertem Kreis zu versprechen, sie alsbald nachkommen zu lassen und ihr in der Zwischenzeit regelmäßig über den Fortgang seiner Auswanderung zu berichten.
Bald zog es den Auswanderer, nach nur kurzer Tätigkeit bei den Brüdern in New York, an die Westküste nach San Franzisko, wo er mit anderen Verwandten ebenfalls im Kurzwarenhandel arbeitete. Seiner Braut in spe berichtete er mit jeder Postmöglichkeit von seinem Vorankommen und ließ sie wissen, dass sie bald nachkommen könne. Doch alle seine Briefe blieben zu seiner großen Enttäuschung unbeantwortet.
Schnell folgte sein Instinkt der Fährte der Goldsucher, denen der Dollar im Erfolg ihrer Bemühungen lockerer saß als den Farmern, doch mit Kurzwaren ließ sich dort nicht das große Geschäft machen. Da half schon eher ein großer Ballen Denim, grober Baumwollstoff, der ungefärbt etwa die Farbe von Kartoffelbrei hat und eigentlich für die Bespannung von Planwagen gedacht war. Doch was die Goldgräber brauchten, waren Hosen, die den Bedingungen in den rauen Claims standhalten konnten. Die „Digger“ hatten die Angewohnheit, ihre Hosentaschen mit allerlei Material und Werkzeug vollzustopfen, so dass schon bald Stoff und Nähte entzwei gingen.
Levi Strauss nähte kurzerhand aus seinem Denim eine Latzhose und verstärkte die Nähte. Die Goldgräber waren einerseits ob der Strapazierfähigkeit der neuen Kleidungsstücke begeistert, spotteten aber über die Farbe im Ton „Kartoffelbrei“ und reklamierten, dass die Nähte doch immer noch an den Enden einrissen. Erst als der Schneider David Jacobs zu ihm stieß und die Idee verwirklichte, die Nahtenden mit einer Sattlerniete vom Pferdegeschirr zu verstärken, wurden Levi Strauss die Hosen förmlich aus den Händen gerissen. Er oder Davis meldeten 1873 die Idee zum Patent an, um sich vor Nachahmern zu schützen, wobei die Legende sagt, es sei Davis gewesen und Strauss habe das Geld dafür beigesteuert.
Inzwischen war die Produktion der Denim-Hosen in einer mehrstöckigen Textilfabrik, die Levi sein Eigen nannte, in vollem Gange, und er war zu einem der reichsten Männer der Gegend aufgestiegen. Weil aber Amerikaner schon zu jener Zeit ihre linguistischen Schwierigkeiten mit dem Wort Denim hatten, was eigentlich und richtig „de Nimes“ heißt, also von der südfranzösischen Stadt Nimes, wo diese Art des Stoffes herstammte, hat man alles in „Jeans“ umgetauft, was der damaligen Aussprache nahekommt. Zeitgleich wurde wohl auch die Einfärbung des Stoffes in die uns heute noch bekannte indigoblaue Farbe vorgenommen.
In diesem Fall war es nicht die klassische Karriere vom Tellerwäscher zum Millionär, aber nur leicht von diesem Klischee abweichend vom Tapferen Schneiderlein zum späteren Weltmarktführer. Angeblich hat Levi Strauss nie geheiratet und immer auf seine Braut aus Deutschland gewartet.
Als gesetzter und arrivierter Mann mit Anfang fünfzig hat er sie dann auf einer Europareise in der Gegend der alten Heimat ausfindig gemacht. Beide sollen sich noch immer sehr zugewandt gewesen sein. Sie war jedoch inzwischen verheiratet, hatte mehrere Kinder und fragte ganz verzweifelt, warum er ihr denn nie geschrieben habe. Aber das habe er doch, antwortete er erregt, und jede Postkutsche habe einen weiteren Brief an sie mitgenommen.
Daraufhin untersuchten beide den Dachboden, auf dem noch Nachlass ihrer Mutter in einer ungeöffneten Kiste verwahrt war. Dort befanden sich mehr als einhundert ungeöffnete Briefe aus Amerika mit dem Absender von Levi Strauss. Die Mutter hatte sie der Tochter, so lange sie lebte, vorenthalten, da sie wohl nicht wollte, dass ihre Tochter eine Verbindung unter Standes einging.
Man kam überein, dass jeder sein Leben so fortsetzen möge wie es war, wobei Levi angeblich sehr großzügig die wirtschaftlichen Verhältnisse seiner ehemaligen Braut verbessert haben soll.
Die Biographie von Levi Strauss habe ich als junger Mann gelesen. Sie war ein weiter Mosaikstein in meiner Affinität zu diesem großen Land der scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten. Den Geist von Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft, den dieses Buch mir gleichzeitig vermittelt hat, konnte ich etwa fünfzig Jahre später dankbar selber spüren, als meine Frau und ich bei der Betreuung meines in die USA ausgewanderten Bruders und seiner dementen Frau auf das Wohlwollen anderer angewiesen waren.
Für mich ist es eine das Herz berührende deutsch-amerikanische Geschichte, die ich über die vielen Jahre nie vergessen konnte.
Keine Indoktrination
Während wir als Jugendliche nur wenige Informationen aus den Ländern bekamen, die dem Ostblock angehörten, also unter der Hegemonialmacht der UdSSR standen, es sei denn man hatte Verwandtschaft „drüben“, so waren doch die Staaten der westlichen Welt ein offenes Buch für uns.
Lernten wir Englisch als wichtigste Fremdsprache, auch ahnend, dieses erworbene Wissen einmal für weltweite Reisen bzw. im Beruf nutzen zu können, so sah die Situation bei unseren Brüdern und Schwestern in den Ostländern völlig anders aus. Alle mussten Russisch lernen, die wenigsten allerdings sahen sich in der Lage, diese Sprache auch anzuwenden. Lieber wollten sie das Erlernte schnell wieder vergessen, was mir unisono in den 90er Jahren meine Mitarbeiter bestätigten, die eine entsprechende Ostvergangenheit hatten.
Da war sie wieder, diese Stereotype, die mich von Kindesbeinen an begleitet hatte. Alles was über den Atlantik zu uns kommt, wird von den Menschen angenommen und von der Jugend regelrecht aufgesogen. Es bedurfte keinerlei Indoktrination, die uns veranlasst hätte, uns so zu verhalten, wie wir es taten. Es war einfach positiv besetzt. Also gut.
Anders war das schon in der DDR, aus der wir als „Geflüchtete“ immer mit den neuesten Nachrichten von den dort Gebliebenen versorgt wurden. Bei ihnen bestand ein indirekter Zwang, sich an der russisch-deutschen Bruderliebe zu beteiligen und die russische Sprache wenigstens in Grundzügen zu erlernen, wollte man keine Sanktionierungen in Beruf oder Studium riskieren oder gar ins Visier der Stasi-Schergen geraten. Auch hatte man brav die Partei-Doktrin, die mit denen der russischen Hegemonialmacht übereinstimmte, nachzuplappern. Das alles förderte eine Doppelgesichtigkeit, nämlich die des offiziellen Gesichtes auf der einen und des privaten auf der anderen Seite.
Also war das mal wieder der schlechte Teil der zuvor erwähnten Stereotype. Ich kann es bis heute nicht ändern, aber diese Erfahrungen gehören zu meiner Prägung, auch wenn politisch schwergewichtige Beobachter uns heute suggerieren, wir müssten mehr auf Russland zugehen, wie es die von mir hoch geschätzte Autorin Prof. Gabriele Krone-Schmalz nicht müde wird, uns in unser Pflichtenheft zu schreiben. Partiell teile ich sogar diese Meinung, aber das gehört in diesem Moment nicht hierhin. Noch bin ich dabei, meine anglo-amerikanische Prägung zu begründen und zu beschreiben.
In der Schule erfuhren wir keinerlei Indoktrination, weder zur einen noch zur anderen Seite. Die älteren Lehrer, die den Krieg miterlebt hatten und eventuell nicht nur Mitläufer im dritten Reich waren, sondern aktive Stütze des Naziregimes, taten einen Teufel, sich in irgendeiner Weise politisch aus dem Fenster zu lehnen oder erkennen zu lassen, wo sie politisch zu verorten waren. Die jüngeren unterschieden sich schon im Äußeren von den „Herren Studienräten“. Dort wo die Kleidung besonders lässig und die Haare provokant lang getragen wurden, kam auch schon mal eher ein lockerer Spruch, der das Gesamtbild der Lehrkraft abrundete. Auch der vermuteten politischen Verortung wurde nicht unbedingt widersprochen.
Gern erinnere ich mich an das Fach Geographie, es könnte in der Quarta oder Untertertia gewesen sein, so wie die Klassen damals hießen. Da war in meiner heutigen Erinnerung der Nordamerikanische Kontinent ein halbes Schuljahr lang unser Thema. Also jener Kontinent, der ohnehin bei der Jugend und bei mir insbesondere das Highlight all unserer Wünsche war.
Ich erinnere mich noch an eine halbseitige Abbildung im Schulbuch, auf dem versetzt eine Kolonne von Mähdreschern ein schier endloses Feld abernteten, während ich in der Realität bei uns altersschwache Ackerschlepper zu sehen bekam, die irgendwelche, nach heutigem Maßstab schmalbrüstigen Geräte, hinter sich herzogen. Erntemaschinen bekamen wir auch zu sehen, wenn es aufs Land ging, die waren aber der Größe unserer Felder angepasst und nicht in der Lage, mich oder meine heranwachsenden Zeitgenossen in irgendeiner Weise zu beeindrucken. Ganz zu schweigen von der Handarbeit auf bayrischen oder schwäbischen Hanglagen, die es zu dieser Zeit noch real gab, und nicht nur als Postkartenidyll eine heile „Heidi-Welt“ in die Köpfe zauberte.
Auch Luftbilder von Farmen aus dem mittleren Westen zeigten mir die gewaltigen Größenunterschiede zu unseren Bauernhöfen auf, wie sie zu Anfang der sechziger Jahre noch weit verbreitet waren. Kam ich doch des öfteren mit einem väterlichen Freund, von Beruf Metzger, selber dorthin, als ich ihn in meinen Schulferien beim Abholen von Schlachtvieh begleitete.
Auch Bilder der Fleisch-Industrie in Chicago überstrahlten bezüglich Größe und Menge alles, was ich bisher kannte. Und das waren die Schlachthöfe von Duisburg, Oberhausen oder Gelsenkirchen, die damals sicherlich zu den größten der Region zählten.
Indoktrinieren musste uns wirklich niemand, wir mussten nur selber hinschauen und aus den gesehenen Unterschieden unsere Schlüsse ziehen. Dabei kam die Komponente einer politischen Betrachtung erst etliche Jahre später hinzu.
Andere Länder und Kontinente gehörten natürlich auch zu unserem Lernstoff, schienen mir aber bei weitem nicht so interessant. Waren doch außer den geografischen und klimatischen Verhältnissen nur wenige Informationen wie beispielsweise Bevölkerungsstruktur, Fauna und Flora verfügbar.
Ein weiteres Mal begegneten mir die USA als Lernstoff beim Thema Geografie im Wirtschaftszweig der Oberstufe. Jetzt interessierten uns Verkehrswege, Warenströme, Bevölkerungsstruktur und weitere Dinge, die die Wirtschaft eines Landes oder Kontinents aus geografischer Sicht beeinflussen konnten. Die Standortvorteile dieses Staates USA lagen plötzlich wie ein offenes Buch vor mir, wobei mir schnell klar wurde, was es doch für ein gesegnetes Land war. Der Rest der Welt würde sich anstrengen müssen mit der dortigen Entwicklung Schritt zu halten, wollte man den Anschluss nicht verlieren.
Damals konnte allerdings jeder, der genauer hinsah, erkennen, dass die Legende vom großen „Meltingpot“, also dem großen Schmelztiegel USA, so nicht stimmte. Die ersten Rassenunruhen und das zunehmende Aufbegehren der schwarzen Bevölkerung wurden über das Fernsehen weltweit sichtbar und fanden einige Jahre später, 1968 mit der Ermordung von Martin Luther King, ihren vorläufigen Höhepunkt.
Wer es als junger „homo politikus“ in dieser Zeit genauer betrachtete, erkannte auch, dass der Typus der Kaukasischen Rasse, zu der auch wir Europäer zählen, dazu neigte, „closed shops“ zu bilden, da sich Untergruppen ethnisch-nationaler Herkunft gebildet hatten. So blieben Italiener oder Iren gern unter sich, was häufig den Stoff für Kriminalfilme liefern sollte. Ebenfalls mischten sich die unterschiedlichen Hautfarben nicht, sondern lebten in eigenen gettoähnlichen Vierteln und blieben in ihren sozialen Aufstiegsmöglichkeiten sehr eingeschränkt.
Hier begann sich bei mir eine differenzierte Betrachtungsweise auf die USA zu entwickeln. Ich war jung, alles was ich von den USA aus der Ferne sehen konnte war toll, aber nicht alles war wirklich gut.
Da gab es zum Beispiel den Vietnamkrieg, der vielen jungen US-Amerikanern das Leben kostete und tausende vietnamesische Familien ins Elend stürzte. Viele meiner Zeitgenossen haben sich in den sechziger Jahren politisch von den USA abgewandt und ihre frühere Affinität zu diesem Land ins Gegenteil verkehrt, indem sie einem mörderischen Kommunismus den Hof machten und bei Demonstrationen in Deutschlands Städten skandierten: „Ho-Ho-Ho-Chi-Minh“. Dabei wurde das „Spangled Banner“ die unverkennbare Nationalflagge, fast schon sakrosankt bei den Amerikanern, mit Füßen getreten und verbrannt.
Eine andere Gruppierung meines Alters zog es an die Westküste nach Kalifornien. Man versammelte sich in den Lagern der Hippies und frönte den Drogen und der freien Liebe.
Ich war zu dieser Zeit bei den Jungdemokraten engagiert, wie die Jugendorganisation der FDP damals hieß, und auch noch bis zum 21. Lebensjahr bei dieser Partei selbst. Mein Kopf konnte den Vietnamkrieg nicht gut heißen, da ich einerseits gegen alle Art von Gewalt bin, mir andererseits die Frage stellte, was der „Westen“ dort zu suchen hat. Für mich war es ein Stellvertreterkrieg, der aussichtslos erschien.
Mein Herz war trotz allem an der Seite der USA. Kämpften sie doch, um einen weiteren Pflock gegen den Kommunismus einzurammen, der sich die Weltherschafft auf die Fahnen geschrieben hatte. Niemals vergessen kann ich, wie sehr der Kommunismus unsere Familie geschädigt hatte. Und noch heute sitzt ein hassähnlicher Stachel in meinem Fleisch, wenn auch nicht mehr so tief.
Der Schock
Wie schon erwähnt, haben sich unsere Lehrkräfte bemüht, politisch völlig neutral rüberzukommen, und insbesondere für die Geschichtslehrer stellte die jüngste Vergangenheit der Nazi-Zeit wohl eine ganz besondere Herausforderung dar. Der „Eiertanz“ zeigte sich schon in den Schulbüchern, die dieses unsägliche Thema in einer Kürze behandelten, die der geschichtlichen Tragweite in keiner Weise gerecht wurde. Der Geschichtslehrer riet dazu, sich das Kapitel „Drittes Reich“ zu Hause durchzulesen, um es dann im folgenden Unterricht zu besprechen. Doch wie oft sind diese Stunden dann ausgefallen oder wurden anderweitig genutzt. Ich erinnere mich jedenfalls nicht, dass dieser Teil der damals jüngsten Geschichte kontrovers oder einvernehmlich in der Schule diskutiert wurde.
Ob schlicht Feigheit, Bequemlichkeit oder Angst vor der Konfrontation die Gründe waren, vermag ich nicht zu sagen. Damals, Ende der sechziger Jahre, war die Jugend gerade dabei, den Muff, der sich in der Gesellschaft eingenistet hatte, gründlich durchzulüften. Hatten sich doch nach dem Krieg etliche Stützen des Nazi-Regimes von den wohlwollenden Siegermächten entnazifizieren lassen, um wieder in Amt und Würden zu gelangen, ohne allerdings ihre Gesinnung wirklich zu ändern.
Zur Ehrenrettung unserer Gesellschaft muss aber auch gesagt werden, dass, wenn wir alle in die Wüste geschickt hätten, die politischen Dreck am Stecken hatten, keine funktionsfähige Verwaltung unserer BRD hätten aufgebaut werden können. Man bedenke nur, dass es um die zehn Jahre bedarf, einen einigermaßen handlungsfähigen Richter oder Staatsanwalt in sein Amt zu bringen. Und dann fehlt immer noch eine Menge Berufserfahrung. Also, wem sei es zu verdenken, wenn, der Not gehorchend, auch auf belastete „human recources“, wie man heute sagen würde, zurückgegriffen wurde.
Vor einem Thema konnte sich der Lehrkörper aber nicht drücken: dem Holocaust, wie die Vernichtung der Juden später hieß. Wir mussten gemeinsam mit unserer Parallelklasse einen Film in der Aula der Schule ansehen. Das war staatlich verordnetes Pflichtprogramm, und ich denke diese Pflicht entsprang noch einer Auflage aus den Verwaltungsregeln der englischen Militärverwaltung, der das Ruhrgebiet nach dem Krieg unterstand.
Der Film war ungeschönt und brutal. Einige Mitschülerinnen, hatten große Mühe ihr Frühstück dort zu behalten, wohin sie es gefuttert hatten. Die Schulleitung hatte die Filmvorführung wohlweislich auf die letzten zwei Stunden eines Samstags gelegt, ganz offensichtlich, um anschließenden Diskussionen aus dem Wege zu gehen und wohl auch, damit die heftigen Eindrücke übers Wochenende etwas verblassen konnten.
Der Film bestand in Teilen aus beschlagnahmtem SS-Material, denn die Nazi-Verbrecher waren dämlich genug, ihre kriminellen und völkerrechtswidrigen Taten auf Zelluloid zu bannen. Andernteils aus Filmmaterial der Amerikaner, die die Befreiung der Konzentrationslager filmisch dokumentiert hatten.
Der Film begann mit der Ankunft eines Güterzuges mit Viehwaggons auf einem Gleis vor einem Konzentrationslager. Es könnte Buchenwald gewesen sein, was ich später selber mit meiner Frau besuchte und in traurig schrecklicher Erinnerung habe. Einiges deutet drauf hin, denn am Ende des Filmes muss sich die deutsche Bevölkerung der nahen Umgebung das Desaster persönlich ansehen. Zwangsvorgeführt!
Kapos, also Hilfskräfte mit Knüppeln, reißen die verängstigten Menschen aus den Viehwaggons und treiben sie in Richtung Eingangstor, auf dem in vollem Hohn der Spruch steht „Arbeit macht frei“. Fast jeder trägt einen kleinen Koffer mit seinen persönlich wichtigsten Dingen in der einen Hand, die andere hält meist eine Kinderhand. Pervers an der Situation ist, dass die armen Menschen ihren Mördern noch ihre Wertsachen mitgebracht haben.
Am Eingang werden Familien, die bis dahin noch zusammen waren, auseinandergerissen und nach Geschlechtern in Gruppen geteilt. Dann wird aussortiert: noch arbeitsfähig oder sofort ins Gas. Diejenigen, die offensichtlich noch durch Arbeit auszubeuten sind, werden zu den Baracken getrieben. Soweit die Eigendokumentation der Nazis.
Im nächsten Abschnitt sieht der Betrachter in den Baracken auf Holzstellagen liegende, bis zur Unkenntlichkeit ausgemergelte Menschen, oder auch vor den Unterkünften Personen, die ob der Ankunft der Befreier zusammenbrechen oder gerade aufgrund der Aufregung ihren letzten Atemzug machen.
Haufen nackter Leichen, von Unterernährung entstellt, wild aufeinandergestapelt, versetzten mich in eine nie gekannte Fassungslosigkeit. Dazwischen immer wieder Sequenzen von gespenstartig anmutenden Menschen, die offensichtlich gerade dabei sind, vor Überlebensglück verrückt zu werden oder von solchen, die in endgültiger Lethargie zu versinken scheinen.
Ein ganze Halle ist voller abgeschnittener Haaren, aus denen wohl Stoffe gefertigt werden sollten, wie der Kommentator des US-Militärs im Film verkündet. Eine weitere ist bis zur Decke mit Schuhen gefüllt, und eine andere beherbergt Tonnen von Kleidung, die die Mörder ihren Opfern abgenommen hatten.
Gestorben wurde nackt. Die Opfer pferchte man unter Vortäuschung einer Entlausungsdusche in Duschräume, in denen aus den Duschköpfen kein Wasser strömte, sondern das tödliche Gas. Diesen Vorgang verdeutlichte der Film, in dem die auf dem Dach befindlichen Kammern für die Gaskartuschen gezeigt wurden und die Funktion mit einer Rauchpatrone demonstriert wurde.
Ein weiterer Teil des Filmes zeigte Haufen ausgebrochener Goldzähne, die man den Leichen noch vor der Kremierung entnommen hatte. Auch weitere perfide Tötungsanlagen waren Gegenstand der filmischen Aufarbeitung.
Am Ende des Filmes müssen sich Gruppen von Deutschen das Konzentrationslager ansehen, denen einerseits das Entsetzen ins Gesicht geschrieben steht, andererseits Mimik und Gestik auch ihre Ablehnung oder Trotz erkennen lässt. Fast jeder wird befragt, ob er davon gewusst habe, doch die meisten bleiben stumm, während ein Teil der Frauen in Tränen ausbricht.
Auch wir, die Zuschauer des Filmes bleiben stumm. Vor Schock oder vor Scham, oder vor beidem zugleich. Zu Hause merke ich bald, dass auch meine Eltern sich in ihren Ausflüchten eingerichtet haben. Sie wollen oder können nicht sprechen.
Für mich hat sich mein Weltbild gerade gehörig verändert. War ich eben noch Opfer des Kommunismus, war ich jetzt der Spross einer Tätergesellschaft. Erst die Besinnung auf das römische Recht hat meine Welt wieder ein wenig begradigt, denn darin heißt es schon: „Keine Strafe ohne Schuld“.
Wieder einmal waren die Guten die Amerikaner, die die Überlebenden befreit hatten und den Mitläufern einer Mörderbande die eigene Nase in den eigenen Dreck gesteckt hatten. Soweit meine Weltsicht damals. Gerechterweise sei hier aber auch vermerkt, dass ebenso russische Streitkräfte Konzentrationslager von ihrem Schrecken befreiten, so sie dort als erste ankamen.
Der Wind dreht sich
Immer öfter stehen nun Ende der sechziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts die Amerikaner, die sich von Kindesbeinen an als die Guten in meinem Kopf eingenistet hatten, in der Kritik, vor allem bei einer rebellischen Jugend, die sich anschickte einen anderen Wind durch unsere so gemütliche Republik zu blasen.
Die Protestierenden, ganz voran die linksorientierten und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vom kommunistischen Osten geförderten Studenten, machten ihren Hass gegen die USA vor allem an drei Punkten fest. Dabei möchte ich unbedingt erwähnen, dass die schweigende Mehrheit der Deutschen in dieser Zeit dem ganzen Treiben entweder mit einer apolitischen Haltung, mit Desinteresse oder mit kopfschüttelnder Ablehnung gegenüberstand. Schließlich musste sie das Geld verdienen, mit denen die Unis der Protestler finanziert wurden und hatten somit ganz andere Sorgen und Bedürfnisse.
Der erste und vordergründigste Punkt der Kritik war mit Sicherheit der Vietnamkrieg, wie schon zuvor erwähnt. Er fand auch bei der Bevölkerung in Europa und insbesondere in Deutschland die größte Beachtung, waren doch die US-Amerikaner unsere wichtigsten Verbündeten, die letztendlich unser Leben in Freiheit und Sicherheit garantierten. Mir ist kein anderes Land in Westeuropa in Erinnerung, dass sich so eng an den transatlantischen Partner angebunden hat, wie die BRD.
Ein überwältigender Teil unserer Militärtechnik, insbesondere in der Luftfahrt, stammte aus den USA. Wir öffneten amerikanischen Firmen Tür und Tor, allen voran einer damals als Giganten geltenden Computerfirma IBM, oder einer Firma Kodak in der Filmbranche, die bald unsere Agfa in den Bereich des Zwergenlandes verbannte.
Gute Fotokopierer kamen zumeist von Rank Xerox und mit technischen Innovationen überraschte immer wieder eine Firma mit dem Namen 3M Company, einem Tausendsassa der Industrieprodukte. Hier fand man zum Beispiel ein Kuriosum namens „Sound on Slide“, einen Diaprojektor mit integriertem Schallplattenspieler. Dabei war eine Mini-Schallplatte um das Dia herum platziert, so dass der Tonvortrag zusammen mit dem Bild ausgewechselt werden konnte, ohne in die damals noch analoge Choreographie einer Diashow, die vorwiegend kommerziell für Präsentationen genutzt wurde, eingreifen zu müssen.
Diese Firma brachte aber auch auf dem medizinischen Sektor selbsthaftende Verbände hervor, die in einer leichten Klett-Funktion sich selbst vor dem Verrutschen oder ungewolltem Öffnen schützten. Einer der bekanntesten Anbieter von Kreditkarten beispielsweise war American Express, und Reiseschecks wurden vorzugsweise in US-Dollar ausgestellt.
Andere europäische Länder waren dagegen bemüht, sich von den USA hinreichend abzugrenzen und kochten ganz bewusst ihr eigenes Süppchen, allen voran die Franzosen. Obwohl auch sie vom großen Nato-Partner profitierten, setze man sich dort gern in Sachen Lebensart, Konsumprodukten und Militärtechnik deutlich ab. Schließlich war man ja auch eine selbstbewusste Atommacht geworden.
Soweit zur engen Bindung der Deutschen an den USA-Partner, wie sie in meiner Wahrnehmung verankert ist. Ebenso deutlich wie die Aufhänger der Proteste Ende der sechziger Jahre.
Zum anderen wäre die Mittelamerikapolitik der USA zu nennen, die jenen Teil des amerikanischen Kontinents stets als ihren Hinterhof betrachtet haben, den sie „sauber“ zu halten hatten und in dem folglich mit scharfen Besen gekehrt werden müsse.