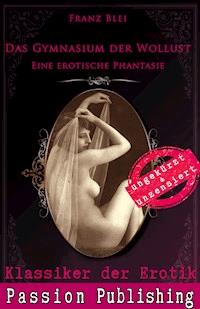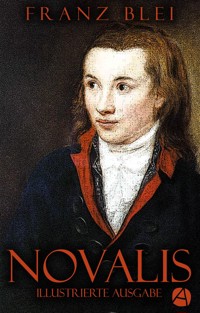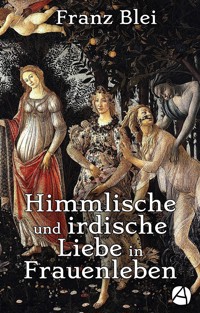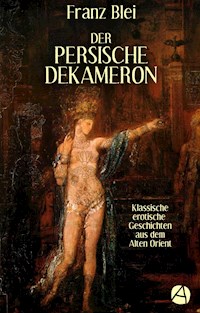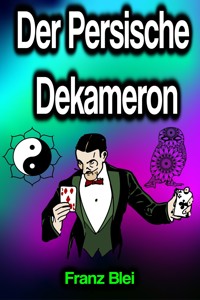Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Thema dieses Buches ist nicht das Geschlechtsleben des Menschen in seinen physiologischen Rapporten, wenn auch, gewissermaßen als Stichprobe, darauf Bezug genommen wird. Denn so luftzart sich auch manche erotischen Bildungen darstellen, bleiben sie oder sind sie doch erdgebunden und vollziehen sich nicht im luftleeren blutleeren Raum. Das nicht zu erschöpfende Thema des Buches ist die Phantasie, welche das menschliche Individuum, zeit- und gruppenbestimmt, zur Erhaltung oder Steigerung seines Lustgefühls aufbringt, diese Lustgefühle über den Tod hinaus zu verewigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Formen der Liebe
Franz Blei
Inhalt:
Formen der Liebe
Vorbemerkung
Das Erotische
Die phallischen Riten
Die Häteren
Die sokratische Freundschaft
Daphnis und Chloe
Der Baum der Erkenntnis
Die Geisha
Archaische Landschaft
Die jungfräuliche Mutter
Die Minne
Der Roman von der Rose
Die Auferstehung der Venus
Die erotische Besessenheit
Das Decamerone
Das Maß der Schönheit
Die Femmes Galantes
Die Sünde des Fleisches
Der Don Juan – Legende und Symbol
Der Preziöse Stil
Der galante Schäfer
Die Prinzessin von Cleves
Der frivole Stil
Die kleinen Meister des frivolen Stils
Miniaturen
Der venezianische Karneval
Casanova
Die Pornographische Idealistik
Der Marquis de Sade
Der empfindsame Stil
Die böse Lust
Ehe und Liebe
Die romantische Liebe
Stendhal über die Liebe
Dialogische Intermezzi
Das junge Mädchen
Die erotische Morbidezza
Der romaneske Eros
Der romantische Eros bei Richard Wagner
Nietzsche über die Liebe
Schlußbemerkungen
Formen der Liebe, F. Blei
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849623074
www.jazzybee-verlag.de
Formen der Liebe
Vorbemerkung
Mit streng wissenschaftlichen Methoden eine Darstellung der Probleme des Erotischen zu geben, lag nicht in der Absicht des Verfassers. Wer die wissenschaftlich geordneten Tatsachen des menschlichen Sexuallebens studieren will, der wird eine vortreffliche Literatur darüber vorfinden.
Das Thema dieses Buches ist also nicht das Geschlechtsleben des Menschen in seinen physiologischen Rapporten, wenn auch, gewissermaßen als Stichprobe, darauf Bezug genommen wird. Denn so luftzart sich auch manche erotischen Bildungen darstellen, bleiben sie oder sind sie doch erdgebunden und vollziehen sich nicht im luftleeren blutleeren Raum.
Das nicht zu erschöpfende Thema des Buches ist die Phantasie, welche das menschliche Individuum, zeit- und gruppenbestimmt, zur Erhaltung oder Steigerung seines Lustgefühls aufbringt, diese Lustgefühle über den Tod hinaus zu verewigen.
Die nichts als physiologische Tatsache der Lustgefühle erhält die Art und nichts weiter. Sie führt zu den stagnierenden Formen des Tierlebens. Mangel an der diesbezüglichen Phantasie macht das Liebes- und Kulturleben echt primitiver Völker so einfach wie das der Tiere, deren Verhalten auf die Einform der Gattung gerichtet ist, nicht auf die Varietät der Individuen. Im Gegensatz zum Menschen, der sich in Einzelehe und Einzelwirtschaft Formen geschaffen hat, welche die Varietät begünstigen – bis zur Bedrohung der Gattung.
Das Thema dieses Versuches ist mehr als irgendein anderes voller Fallen. Vorurteile gebärden sich als Urteile, Vorlieben wollen die natürliche Perspektive der Dinge verschieben, und Scheu tut das ihre, Wichtiges zu verschleiern und aus dem Licht, in dem es steht, in ein Clair-Obscur zu rücken. Wir sind noch nicht einmal so weit, nur das zu sagen, was sich sagen läßt. Unser Vorrat an Fragen ist noch weit größer als unser Vorrat an Antworten. Darum sind die Menschen geneigt, Wichtiges in den Fragen zu überhören, um mit einer bereiten, gefälligen Antwort zurechtzukommen.
Zu dieser Schrift gesprochen: der wechselnde Standpunkt in wichtigen Fragen erscheint mir fruchtbarer – oder entspricht meiner Art besser –, als die widerspenstigen, oft kaum haschbaren Dinge fälschend zurechtzubiegen, damit sie sich in den vorbestehenden Rahmen einfügen.
Die Problematik des Erotischen ist so reich an Lösungsversuchen wie die des Welträtsels. Den Sinn des Lebens zu suchen, muß jeder auf eigene Rechnung und Gefahr unternehmen, um zu schweigen, wenn er ihn gefunden hat oder, spricht er schon, so nicht anders als in Monologen.
Dieses hier soll nichts als ein Lesebuch sein. Nichts von einiger Wichtigkeit aus dem Stoffgebiet des Erotischen glaube ich unerwähnt gelassen zu haben. Die Stilformen der Liebe, deren individuelle und kulturelle Auswirkung, habe ich, wo es möglich war, in verschieden fallenden Schnittpunkten gezeigt: im allgemeinen kulturellen Bilde, in einer theoretischen Anschauung der Zeit, in einem charakteristischen Bildnis eines ihrer Träger, in einer künstlerischen Gestaltung.
Der turbulente Verfall und Zerfall der erotischen Phänomene, der für unsere Zeit so charakteristisch ist und auch für das schwächste Auge deutlich wurde an Hunderten von Einzelerscheinungen, gibt dieser Schrift etwas von einer Historie, vielleicht von einem Epilog. Der außerordentliche kulturelle Bruch zwischen dem Heute und der Vergangenheit weitet sich zu einem Abgrund, der alle bisher gültigen Ideologien verschlingt und höchstens mehr ihre Parodien für eine kleine Zeit noch leben läßt. Das muß sich auch im Erotischen auswirken. Man kann bereits dessen Geschichte schreiben, die bis heute, gerade noch bis heute reicht. Aus den wahrgenommenen Wirkungen sucht man deren Ursachen. Aber die Kenntnis dieser Ursachen gibt noch keine wohlgegründete Vermutung, wie veränderte und sich noch weiter ändernde Bedingungen sich transformierend im Erotischen äußern werden.
Die Liebe ist nicht, wie Schopenhauer meinte, als eine natürliche Blüte auf dem Zeugungstrieb gewachsen. Denn sie ist nicht das, was man natürlich nennt, sondern eine Reaktion gegen die Natur. Das geistige Individuum sucht der natürlichen Unterwerfung, die sich im geschlechtlichen Akte äußert, zu entfliehen, und durch die Liebe erobert es sich zwei Festungen gegen die nur an der Erhaltung der Gattung interessierte Natur: das Lustgefühl um seiner selbst willen und das formende Denken in dessen Dienst. Die Liebe ist ein Stück Freiheit, aber auch nicht mehr als das. Denn gänzlich konnte sich der Mensch nicht vom natürlichen Instinkt der Reproduktion befreien, woraus der höchst komplexe Begriff der Liebe entsteht, der in Einem sowohl Unterliegen wie Rebellieren enthält.
Man kann heute schon von einer Abwanderung von der Liebe sprechen. Die Ordnung des Lebens aufrechtzuerhalten, wird immer schwieriger, und man ist der Liebe – und nicht ohne ihre Mitwirkung – darauf gekommen, daß sie als eine Art Narrheit diese Ordnung stört. (Am wenigsten in der gedämpften Form der ehelichen Liebe.) Zuerst desertierten die Schwachen, die Ängstlichen, die Schüchternen und jene, die mehr einem Nachahmungstrieb als einem sinnlichen Trieb folgten. Die Not der Zeit, die wachsende Schwierigkeit einer Lebenshaltung unterstützten kräftig. Die geglaubte geschlechtliche Hörigkeit der Frau als Regel stellte sich als eine irrtümliche Annahme heraus in dem Augenblick, als die Frau sich von der wirtschaftlichen Abhängigkeit vom Manne befreite. Die Frau braucht sich nicht mehr vom Manne erhalten zu lassen, und dadurch ist das erotische Gewicht des Mannes für die Frauen leichter geworden. Noch kann er diesen bedeutenden Ausfall seines männlichen Prestiges nicht durch ein Erotisches ersetzen, das er nicht besitzt oder verkümmern ließ. Der an ihn von der Frau gestellte Anspruch macht ihn verlegen. Die Münze, mit der er bisher meist und das Meiste zahlte, hat bei der Frau, die wirtschaftlich unabhängig ist, keinen Kurs mehr. Der Sprung der Frau von der Unterordnung zur Gleichstellung findet den Mann unvorbereitet. Er erfindet sich Gründe, die ihn veranlassen, die Frau zu meiden. Er hat etwas Angst vor diesem ihm fremden Wesen. Das alte ihm vertraute Wesen ist noch in der Prostituierten für ihn verkörpert, die ihm so sehr Frau ist, daß sie allein aus dieser Tatsache ihren Lebensunterhalt gewinnt.
Ich will noch auf ein anderes die alte Form auflösendes aber noch keine neue Form schaffendes Moment hinweisen. Von der heutigen Frau ist in der Ehe ein großer Teil ihrer früheren Tätigkeiten genommen, sogar bis auf die Kindererziehung, die man heute besser von Instituten und Schulen besorgt glaubt als von den nervösen und meist ungeeigneten Eltern. Art und Quantum häuslicher Tätigkeit werden immer geringer und unbedeutender. Die Liebe vermag aber die vielen leeren Stunden nicht auszufüllen, jedenfalls nicht die Liebe des beschäftigten Gatten. Aber auch schon nicht mehr die Liebe des Dritten, der bei den Komödienschreibern des vorigen Jahrhundert noch eine Rolle spielte, die heute schon ganz ins Possenhafte gefallen ist, ein Zeichen, daß ihr kaum mehr viel Wirklichkeit entspricht. Die unverstandene Frau von heute findet nicht mehr im Dritten den, der sie versteht, und tut sie das noch, ist der Gatte nur zu oft bereit, den mitverstehenden Zweiten abzugeben. Die unverstandene Frau von heute erwartet etwas anderes als eine mehr oder weniger stürmische Wiederholung einer ihr bereits vertrauten Liebesszene. Aber was sie erwartet, ist noch nicht zu erraten. Sicher ist nur, daß sie über den Wert der Liebe und die Liebe als Wert skeptischer denkt als ihre Großmutter.
Man hat die zunehmende Verweiblichung des Mannes der Zivilisation konstatiert. Ihr entspricht keineswegs eine ebensolche Vermännlichung der Frau trotz mancher solcher Allüre in Tracht und Gehaben. Sicher ist, daß diese Entwicklung des Mannes von seinem spezifischen Geschlechtscharakter weg die erotische Spannung zwischen den Geschlechtern vermindert und weiter vermindern wird, wozu Gemeinschaftserziehung, Sport usw. das Ihre beitragen.
Wo ehemals die Liebe war, wird es immer leerer. Doch – im ewigen Kreislauf – kehrt sie zurück, um einmal in neuen Formen wieder zu kristallisieren.
Das Erotische
Der Begriff des Erotischen hat nicht durchaus scharfe Konturen, die ihn von nachbarlichen Gebieten deutlich trennen. Selbst wenn man ihn aus einer sehr bestimmten Form der Liebe gewänne, enthielte er immer dieses schwanke, fließende, sich verdunstende Gebilde Liebe, dem weder in einer rein metaphysischen Konstruktion, noch in einer naturwissenschaftlichen Deutung Festigkeit zu geben ist. Man hat dem Begriff raffiniert erdachte naturwissenschaftliche Fallen gestellt. Die Beobachtung am Tiere sollte zeigen, wie am Menschen zu beobachten sei. Man kam über sehr interessante Feststellungen, die Begattung und Fortpflanzung der Tiere betreffend, nicht hinaus. Das zerstreute viele Vorurteile hinsichtlich der gleichen Funktionen beim Menschen, und einige schickten sich schon an, dem tierischen Ausleben der Instinkte das Wort zu reden und dieses Gewähren- und Laufenlassen der Instinkte kurzweg Liebe zu nennen. Das kommt aber einer völligen Ablehnung dieses Begriffes Liebe gleich, denn diese setzt sich als ein Willensakt gegen das natürliche Funktionieren, woraus sich alles das ergibt, was wir menschliche Gesittung, Zivilisation und Kultur nennen. Daß und ob die Natur mit der Fortpflanzung der Gattungen etwas vorhat, ist eine falsch gestellte Frage, nicht lösbar mit dem Hinweis, daß wir mit den Organen für diese Fortpflanzung ausgestattet seien. Eine kleine geologische Veränderung, also ein anderes Stück Natur, könnte das menschliche Individuum auf der Erde vernichten von heut auf morgen. Daß die Natur mit dem Menschen etwas plane, ist ein Kompliment, das sich der Mensch macht im verzweifelten Anblick der Gestirne. Er hält sich damit am Rande eines Abgrundes.
Das Tier handelt gattungsgemäß, nicht individuell. Es läuft, wenn nicht äußere Behinderungen auftreten, sein Leben ab wie eine aufgezogene Uhr. Daß von hier ganz schmale Stege zum Sexualfunktionieren des Menschen führen, wenn auch kaum mehr sichtbar oder begehbar, wird man nicht leugnen. Aber daß sie zum Wesentlichen des menschlichen Eros führen, wird niemand behaupten. Das Tier handelt nicht, es funktioniert. Das Liebesleben in der Natur ist ein sentimentaler Romantitel, denn es gibt derlei nicht in der Natur. Die weibliche Spinne, welche nach der Begattung das kleine Männchen auffrißt, jene Gottesanbeterin, welche während des Aktes dem Männchen den Kopf abbeißt und ein Bein, ohne daß das Männchen geschlechtlich zu funktionieren aufhörte, das ist nicht Sadismus im Tierreich, ist kein Akt der Grausamkeit überhaupt, sondern das ganz selbstverständliche Fressen eines Tierkadavers, in den sich das Männchen nach Erfüllung seiner Funktion sofort verwandelt: es hat befruchtet und damit ausgelebt. Mit der menschlichen Romantik der Liebe hat das gar nichts zu tun.
Das Erotische ist nicht nur des Menschen, sondern noch bestimmter: des Mannes. Denn nur der Mann besitzt jenen Überfluß der sexuellen Substanz, für den er unmittelbar im geschlechtlichen Funktionieren keine Verwendung findet, auch dann noch nicht fände, wenn er jeden Tag hundert Frauen befruchtete. Der Frau ist die beschränkende Grenze gesetzt, nicht so dem Manne. Das farbig-bunte Glas, das uns jeder kulturelle Zeitstil vor das Auge drängt, damit wir durch es die Phänomene so sehen, wie es die jeweilige an ihrer Erhaltung interessierte Zeit wünscht, mag diese biologische Tatsache oft undeutlich machen, aber nichts kann sie widerlegen. Daß sich die Frau jeder vom Manne gewünschten Gestalt des Erotischen in genialer Einfühlung anpaßt und oft so sehr, daß sie als die selbständig Dirigierende – aber nur die Musik des Mannes Dirigierende – angesehen werden kann, das zeugt für die immer frisch aus unendlichen Quellen geschöpfte Stärke und Produktivität der männlichen Substanz, die nicht nur das unmittelbar Erotische erzeugt, sondern auch alles andre, was von dieser Fülle seiner sexuellen Substanz und deren ungeheuren sexuell nicht verbrauchbaren Überschuß lebt: die Künste, zumal aber auch das Denken, ja sogar die Geschäfte. Oder, wenn diese von der Tradition gesicherten Abflußformen verstopft sind, die Aktivität eines männlichen Rasens in Kriegen und religiösen Abenteuern aller Art.
Das Weibchen hat nichts zu verschwenden. Es ist die Hüterin und Bewahrerin der vererbbaren Qualitäten. Das Weibchen regelt die möglichen Exzesse der durch das verschwenderische Männchen hervorgerufenen Variationen. Das Weibchen balanciert die Natur aus. Die Natur sagt zum Männchen in der Form eines lebhaften appetitiven Interesses: Befruchte! Sie gibt dem Weibchen einen ganz andern Befehl, der lautet: Wähle! Ein sexueller auf die Fortpflanzung gerichteter Instinkt wäre, angenommen er existiert, hinsichtlich seiner präzisen Wirkung viel zu unsicher und ungenügend, um die Weiterführung der Gattung zu garantieren. Das allein leitende Lustgefühl des Männchens bedarf des Weibchens ja nicht zu seiner Befriedigung, es kann sich, wie man weiß, durchaus vom Weibchen emanzipieren. Man ist allzu geneigt, die Phänomene des Erotischen zu mystifizieren. Was auch dann der Fall ist, wenn wir einer gewissen Sozialform des Erotischen vor andern den Vorzug geben und aus ihr dessen Wesen bestimmen wollen. Biologisch ist das Erotische an die Tatsache gebunden, daß die männliche Substanz durch ihr enormes Überwiegen über das für die Prokreation Nötige zu anderer als unmittelbar geschlechtlicher Verausgabung gedrängt wird. Dies führt nicht nur zu dem nur dem Menschen Eigentümlichen, daß er den geschlechtlichen Akt wiederholt, trotzdem der Partner bereits empfangen hat, dem wiederholten Akt also keinerlei prokreativer Sinn mehr entspricht und er deutlich nur der Lust wegen getan wird. Es führt dies aber nicht nur zu allen Mannigfaltigkeiten der Phantasie innerhalb des Vorganges, sondern auch zu allen anderen Phänomenen, die man im Komplex Liebe begreift. Und es wirkt sich im Ästhetischen, im Religiösen, im Sozialen aus.
Das Individuum wird nicht nur ins Leben schlechthin geboren, sondern in ein bestimmtes kulturelles Leben, unter dessen Formgesetze es sich mehr oder weniger beugt, weil sie ihm seinen Bestand garantieren. Das gilt auch für das Erotische im engeren Sinne.
Die phallischen Riten
Bis auf heute hat sich in der ländlichen Umgebung Hannovers ein um Pfingsten aufgeführtes Maskenspiel erhalten. Der Hedemöpel, Dämon der dürren winterlichen Heide, führt mit seinem Gegner, einem Laubfrosch, dem Dämon der Feuchte und Fruchtbarkeit, ein Streitspiel auf, das um die Greitje geht, eine weibliche Gestalt, die für die Erde oder das Lebendige figuriert. Nach vielem Streit und groteskem Geprügel gewinnt der Laubfrosch die Greitje und führt mit ihr einen Tanz auf, dessen Charakter wohl charakterisiert, daß der Laubfrosch mit einem mächtigen Phallus ausgestattet ist. F. von Reitzenstein vermutet in diesem alljährlichen Maskenfest einen phallischen Ritus, wie er von den antiken Völkern des Mittelmeerbeckens, Ägyptern, Phöniziern, Griechen, Römern überliefert ist, wie ihn die alten amerikanischen Kulturen übten und wie er heute noch Brauch ist bei einigen zentralamerikanischen Indianerstämmen.
Dem ersten Dionysoskult, wie er aus Thrakien nach Griechenland kam, fehlt das phallische Moment durchaus, denn er war als ein Totenkult die im ekstatischen von Musik und Tanz und Geschrei begleiteten Rasen versuchte und erwirkte Vereinigung der vom Leiblichen erlösten Seele mit der Gottheit: dieser Kult war Absage an das Leben durch Eingang in den heiligen Wahnsinn, wie ihn die Sufis und die tanzenden Derwische übten, wie ihn periodisch wiederkehrend jene Raserei zeigt, die im Mittelalter als Spring- und Tanzwut ganze Völker ergreift.
Unter dem Einfluß der umwälzenden dorischen Wanderung kommt der dionysische Totenkult und dessen Raserei unter das beruhigende apollinische Gebot. Es entstehen die Ventile der Tragödie und des Satyrspieles, worin es der Schauspieler auf sich nimmt, verwandelt zu rasen. Es entstehen an den dionysischen alten Kultstätten die apollinischen Orakel, wo es eine Priesterin ist, die allein den heiligen Wahnsinn der Vereinigtheit mit der Gottheit auf sich nimmt. Und was von nun ab als Dionysien, Elephobolien, Pamylien, Bacchen gefeiert wurde, war festliche Begehung von Winterende und Frühlingsanfang. Diese Feste vollzogen sich unter dem Symbol des Lebenspendenden, als welches das phallische Symbol ist: er gibt die Feuchte, den befruchtenden Regen.
Was die frühen Kirchenväter, Tertullian oder Theodoret, über den Phalluskultus berichten, wird, abgesehen von der asketischen Einstellung, die sie auszeichnet, sich mehr auf das gestützt haben, was nach als was während des festlichen Umzuges geschah. Ich schäme mich, von den Phallusmysterien zu berichten, deklamiert Arnobius, der zur Zeit des Diokletian lebte. Und entrüstet schreibt Augustinus: Um den Gott Liber zu beruhigen, um eine reiche Ernte zu erhalten, um von den Feldern Mißwuchs fernzuhalten, ist eine ehrenwerte Frau verpflichtet, vor allem Volke das zu tun, was man nicht einmal einer Prostituierten auf dem Theater erlauben dürfte. Der Satz deutet an, worum es sich bei diesen Riten handelte. Und daß ihr Sinn ihnen selbst in diesen spätrömischen Tagen noch erhalten geblieben und jedem geläufig war. Aber es galt bis in die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts als eine erwiesene Tatsache, daß die antiken Völker den Phallus als dem Lustbringer zum Gotte erhoben und ihm kultische Ehren erwiesen hätten. Was die ungebundene sexuelle Glückseligkeitslehre der antiken Völker ganz ausschloß. Ihnen so Nahes, durch kein Gebot Verbotenes wie das geschlechtliche Funktionieren zu vergöttlichen, hatten sie gar keinen Anlaß. Der Phallus war ihnen auch dann nichts weiter als ein Symbol der Fruchtbarkeit, wenn sie figürliche Darstellungen dieses Symboles als Amulette gebrauchten. So wenig wie der wächserne Uterus, den heute noch die Bäuerin am Bildnisse ihres Heiligen befestigt, um ihn zu erinnern, daß er sie fruchtbar machen solle, zum Gotte wird, so wenig wurden es die phallischen Amulette, die man in Tempeln aufhängte oder um den Hals trug.
Die ältere klassische Archäologie hat sich die Einschränkungen und Richtigstellungen der Ethnographen gefallen lassen müssen, die von den Sitten und Bräuchen halbzivilisierter Völker berichten, wie den Amerindiern von Texas und Neu-Mexiko, in deren phallophorischen Prozessionen Reste jener phallischen Riten weiterleben, die man, oft bis in alle Details, aus den Monumenten, Inschriften und schriftlichen Weistümern der untergegangenen zentralamerikanischen Kulturvölker las. Die ersten meist geistlichen Entdecker und Beschreiber dieser Länder sprachen, wie ehemals die Kirchenväter, nur Entrüstung aus über die heidnischen ruchlosen und teuflischen Bräuche und Gottesdienste. Die neueren Erforscher haben ihre gewonnenen kontrollierbaren Kenntnisse dazu benutzt, daß sie ihnen auch das Alte deuten helfen, das in Resten auf uns gekommen ist. Auf einem Blatte des mexikanischen Codex Borbonicus empfängt die Ähren tragende Maisgöttin Tlagolteotl eine herantänzelnde Prozession kleiner maskierter spitzhütiger Männer, die in ihrer rechten Hand den monströsen Phallus halten. Es sind die Huazteken, die Dämonen der Vegetation, und das Ganze eine bildliche Darstellung einer agrarischen Zeremonie. Ihr verwandt ist eine andere Darstellung aus Awatobi, die im Berliner Museum verwahrt wird: zwölf Phallophoren schreiten hintereinander, gesenkten Hauptes, sich an der Hüfte des Vordermannes haltend. Zwei andere Phallophoren schütten über die Schultern der Zwölf aus einem Gefäß Flüssiges.
Es ist eine rituelle Geste. Wie bei den alten Völkern, so standen bei den Mexikanern die Sexualorgane in Beziehung zum Wasser. Heute noch gibt es bei den Zuni, Amerindiern von Neu-Mexiko, eine Brüderschaft von besonderen Individuen, Kovemamaschi genannt, deren Funktion es ist, Regen zu besorgen und eine gute Ernte. Sie verkleiden sich mittels Masken und Körperbemalung. Und einer ihrer Riten besteht darin, daß sie in Prozession einer hinter dem andern marschieren, sich an der Hüfte haltend. Sie ziehen an einem Haus vorbei, von wo herab andere Akteure, meist Frauen, ihnen über die Schultern Wasser, Urin oder Mehl schütten. Genau dasselbe ist auf der Berliner alt-mexikanischen Vase dargestellt. Ein amerikanischer Beobachter berichtet, daß diese heutigen Huazteken obszöne Gesten ausführen, wie die Greitjetänzer im Hannoverschen. Ein anderer Stamm, die Hopiindianer, haben ganz gleiche Bruderschaften, von denen man zwei phallisch nennt, die Tataukyamu und die Wüwütcimtu, weil ihre Mitglieder auf Brust, Rücken, Armen und Beinen phallische Malereien tragen und in ihren Händen in Holz gebildete weibliche Genitalien. Auch sie tanzen in Prozession längs Häusern, von deren Terrassen die Frauen sie mit Wasser besprengen. Bei keiner dieser Zeremonien wird der Geschlechtsakt wirklich ausgeführt oder simuliert. Die Verwendung der phallischen Symbole in diesen Riten hat nichts zu tun mit deren Qualität als Organe der Fortpflanzung oder gar der Lustempfindung, sondern sie symbolisieren das Flüssigkeit Spendende. Die Prozessionen beten um Regen. Es sei noch an einen Hindu-Ritus erinnert: um Dürre zu vermeiden, wird in Gegenden Nordindiens der Phallus der Mahadeva-Statue besprengt, um unausgesetzt feucht zu bleiben.
Man nimmt heute an, daß es sich auch bei den antiken Phallusriten um nichts anderes gehandelt hat als um Regenbeschwörung. In den Darstellungen griechischer Phallophorien, die auch uns geläufiger sind, zeigt eine Zeichnung sechs Männer, die mit großer Mühe ein Gestell tragen, auf dem ein enormer, mit einem Auge versehener Phallus angebracht ist, von dessen Spitze zwei flüssige Faden laufen. Ein nackter Riese hält mit der Linken diesen Phallus, mit der Rechten zieht er gegen ihn eine Weinrebe. Auf einer anderen Zeichnung sind es acht Männer, welche das Gestell tragen, und hier stützt den Phallus ein riesiger Satyr, auf dem ein kleiner Kerl reitet, der ein Trinkhorn schwingt; die Weinrebe ist als ein separates Ornament angebracht.
Allen diesen Riten liegt der universelle Glaube zugrunde, daß zwischen dem Menschen und der Natur eine magische Beziehung besteht: wenn der Mensch feierlich eine Handlung begeht, dann begeht die Natur notwendigerweise den gleichen Akt. Wasser über heilige Akteure gießen gibt Regen. Samen in einen Topf pflanzen, wie im Adoniskult, gibt Fruchtbarkeit der Felder. Sich rituell vereinigen, gibt Befruchtung der Erde. Es ist ein magischer Vorgang. Wie in der Beschwörung durch das Wort. Wie in der Annahme, daß Qualitäten durch Kontakt oder auf Distanz übertragbar sind. Es gibt Heilige, zu denen die unfruchtbare Frau um Kindersegen bittet. Es gibt, auch heute noch und in Europa, Riten, bei denen die Frau das Nachgebilde eines Geschlechtsorganes berührt, um durch diese Zauberhandlung den Effekt zu erzielen, den sie von der natürlichen Handlung bis nun vergeblich erwartet hat. Von der Venerierung eines zum Gotte gemachten Phallus ist dabei keine Rede. Bei der Einnahme der Stadt Mende im Jahre 1580 ließ der protestantische Heerführer die große Glocke der Kathedrale zu Kanonen einschmelzen. Mit dem Klöppel, der 2,30 m in der Höhe und an seiner Basis 1,10 m im Umfang mißt, gelang ihm dies nicht. Später stellte man diesen Klöppel an einer Seitenpforte der Kathedrale auf. Er steht noch dort, und jede Frau der Umgebung, die sich ein Kind wünscht, pilgert zu dem Klöppel, der eine auffallende phallische Form zeigt, um ihren Leib daran zu reiben und zur heiligen Jungfrau zu beten. Dies ist nicht, wie der Beobachter und Berichter meint, christianisierter Überrest eines phallischen Kultes, sondern Magie durch einen rituellen Kontakt. Einen göttlichen Kult des Phallus, eine Mythologisierung des menschlichen Geschlechtsvorganges hat es nie und nirgendswo gegeben.
Der Schritt vom Flursegen spendenden Fruchtbarkeitssymbol des Phallus zum schlechthin Glück spendenden oder vor Unglück bewahrenden Symbol war klein. So wurde der Phallus zum auf dem Leibe getragenen Amulett bei Kindern, er wird Weihgeschenk, wird auf Häusern, Toren und Gräbern aufgepflanzt zur Abwehr böser Geister. Er dient als ein Zaubergerät der Beschwörung, er wird als Zeichen der Macht zum Kommandostab des Zauberers wie der Doppelphallus, den man aus dem älteren Megdalenien in Laugerie Basse gefunden hat. Das Phallussymbol erscheint auf bronzenen sakralen Erntewagen, die man durch das Feld gezogen hat. Phallische Bildwerke erscheinen in der gotischen Kirchenplastik an den Fassaden zur Abwehr des Bösen. Phallusähnliche Steine, die Stenkloten, vergruben die Germanen in der Erde, um diese zur Fruchtbarkeit zu beschwören. Dem Gebäck gibt man noch heute bei ihm erhaltene und weitergebrauchte phallische Formen, wie man es auch mit den Flur- und Meilensteinen hielt und hält.
Die Meinung, daß es sich bei den phallischen Symbolen der antiken und halbzivilisierten Völker um einen regelrechten obszönen Kultus mit dem Träger und Bereiter einer Lustempfindung gehandelt habe, ist sicher vom ungläubig gewordenen Verhalten der Spätantike diesen Symbolen gegenüber bestimmt. Als man die Götter verspottete, da nahm man sicher auch dem phallischen Gebilde seine kultische Bedeutung und gab ihm eine nichts als sexuelle.
Die Häteren
Die dauernde Sonderehe in allen ihren Varianten ist eine Institution. Innerhalb der Tierwelt leben nur jene Tiere monogyn, deren Lebensdauer so kurz ist, daß sie nur Zeit für einen einzigen Liebesakt gewährt. Das Weibchen des in Freiheit lebenden Säugetieres flieht fast immer das Männchen, von dem es bereits gedeckt wurde; nur Not und Zwang lassen es eine zweite Deckung durch dasselbe Männchen dulden. Das Tier ist, wie die Natur, nur an der Gattung interessiert, nicht an der Varietät. Die Polygynie erhält nur den allgemeinen Typus der Gattung. Die Einehe aber formt Varietäten. Wandelt sich die Polygynie in Monogamie, dann nimmt die Unähnlichkeit der Individuen zu. Die Hündin, welche nur in Zwange der Not sich zweimal vom gleichen Männchen decken läßt, intendiert mit dem Wechsel des Männchens nicht, Individuen zu erzeugen, sondern eben durch ständigen Wechsel des Männchens einen typischen Hund, der alle Verschiedenheiten in sich vereinigt, welche die Hundefamilie aufweist. Die Hündin ist nicht an der Erhaltung der Hunderassen interessiert, sondern an der Erhaltung der Gattung Hund. Alle sexuelle Freiheit begünstigt die Erhaltung eines uniformen Typus. Die Monogynie hält diese Tendenz auf und begünstigt die Verschiedenheit. Die Monogynie des Menschen ist, so schwer er sich auch unter sie als physiologisch nicht gerechtfertigt beugte, die Hauptbedingung seiner Superiorität. Er wird die Monogynie als vorteilhaft in dem Moment hingenommen haben, als er seine Existenz als Gattung hinreichend gesichert erkannte. Mit der Seßhaftigkeit und dem numerischen Wachstum der primitiven Horde, deren Weiterungen zur Sippe, zur Notwendigkeit der Arbeitsteilung, wird das Interesse an der Varietät vorherrschend, und die sie fordernde Ehe der Älteren überläßt den geschlechtlichen Kommunismus der mannbar gewordenen Jugend. Auch das eheliche Leben schließt heimliche oder offene Polygynie nicht aus, aber diese löst nicht nur nicht die Ehe auf, sondern macht sie erträglicher und damit begehrenswerter. Die Sonderehe war eine Neuerung, oft als unerlaubt und naturwidrig empfunden, weil dem Hordeninteresse entgegen. Der Mythus verbindet ihre Einführung oft mit dem Namen eines bestimmten Gesetzgebers. Der Glaube an die Naturwidrigkeit der Ehe hat sich bis auf heute noch da und dort erhalten neben besonderen Bräuchen, die das zum Ausdruck bringen. Wie der Brauch sakraler Prostitution, wenn es gilt, Unglück und Gefahr vom Stamme fernzuhalten. So prostituierten sich einst bei drohender Gefahr die Frauen bei den Lokrern, so tun es heute noch die Frauen mancher australischer Stämme. Den kriegerischen Chewsuren im Kaukasus galt die Dauerehe zwischen Mann und Weib als etwas Schimpfliches. Und von den kriegerischen, also noch hordenmäßig empfindenden spartanischen Ehegatten wissen wir, daß sie sich nur des Nachts und heimlich zu ihren Eheweibern schlichen. Sie verabscheuten auch die Korrektur der Prostitution. Aber da und dort gehört die Braut die erste Nacht allen. Oder einer, der Priester, der Stammeshäuptling, vertritt in dieser Nacht alle andern jungen Männer. Vielleicht ist dies der Loskauf der Einzelehe.
Mit der Einzelehe tritt als deren Ergänzung die Prostitution auf, zunächst wohl in den sakralen Formen von Festen, in denen der Mensch vom Zwange der ehelichen Institution befreit wieder war, was er vorher gewesen: Mensch, das ist nicht-monogynes Wesen.
Die Unnatürlichkeit der Ehe gewann erst durch ihre kulturelle Einordnung so etwas wie eine kultische Bedeutung, zumal durch die kirchliche Sakramentierung, die sich als die einzige legale und sittliche Form der Gcschlechtsbeziehung auszeichnete, weil das über die ehefeindliche Kirche sieghafte Staatsinteresse es so wollte. Mit der Kult-Form der Ehe war eine Kult-Form der Prostitution unvereinbar. Man konnte sie nicht abschaffen, aber sie wurde geächtet. Die Polygynie des Menschen konnte man nicht ändern, aber man konnte sie als sündhaft verwerfen. Man fand sich mit der Prostitution ab, indem man sie duldete. Die Duldung der zeitweiligen Polygynie erkannte man als das sicherste Mittel, das Institut der Ehe und damit die soziale Stabilität zu erhalten. Mit der Auszeichnung der Ehe als größter Annäherung an ein kulturelles Ideal des Glückes adaptierte sich an dieses Ideal die Moral, welche nichts sonst ist als ein Führer zu einem Ideal: sie wechselt mit ihm.
Herodot berichtet, daß sich in Babylonien jedes Weib jedes Standes einmal in ihrem Leben beim Heiligtum der Istar-Madonna niederlassen und sich vom ersten besten Manne, der ihr ein Geldstück zuwarf, begatten lassen mußte. Strabo berichtet fünfhundert Jahre später den gleichen Brauch. Die Gesamtheit der Frauen löste vielleicht da und dort die Tempelmädchen ab, die Gottesbräute, wenn sie nicht unfruchtbar gemacht wurden. Ägypter, Babylonier, Assyrier, Phönizier hatten die Institution der sakralen Prostitution. Auch die Hetiter, die Inder kennen sie. Die Kedeschen der Juden waren Tempelhuren. Die Japaner wie die alten Mexikaner hatten das Institut, nicht die Chinesen. Vor dem 7. Jahrhundert den Griechen unbekannt, ist die sakrale Prostitution von da ab Brauch. Solon stellt die Hierodulen des von ihm gegründeten Tempels der Aphrodite Pandemos unter das Staatsgesetz. Die kultische Form, welche die asiatischen Völker der Prostitution gegeben hatten, konnte, nach Griechenland importiert, diese der homerischen Zeit noch unbekannte Form nicht rein behalten. Sie stieß hier auf andere Formen der Ehe und der staatlich-städtischen Bindung, wohl auch auf andere Formen der Wirtschaft. Vielleicht ist der Tempeldienst der geweihten Mädchen nur eine geregelte, unter äußerlichen religiösen Formen der Weihe vollzogene Art von Bordellierung – es gab ja überall daneben die profane Prostitution der Gassen- und Kneipenmädchen –, verbunden mit einem Unterricht in Tanzen, Musizieren, gutem Ton, Lesen und Schreiben, Dinge, welche der griechischen verheirateten Frau in der Regel unbekannt waren. Die Gattin hatte ja auch keinerlei erotische Funktion, und das Staatsinteresse an der auch von der Knabenliebe bedrohten Ehe verlangte größte Aufmerksamkeit den außerehelichen erotischen Gelegenheiten zu schenken. Zur heimlichen stillschweigenden Duldung und öffentlichen Schmähung der Prostituierten und der durch solche Haltung sich ergebenden Auszeichnung der Gattin fehlte die erst durch das Christentum gegebene Voraussetzung einer Trennung des Seelischen vom Leiblichen und der Begriff einer Liebe, der diese Polaritäten in sich wieder aussöhnend vereinigt. Auch die Knabenliebe war ja immer auch sinnliche Liebe, nie reine Schwärmerei. Das sinnliche Funktionieren war durch keinerlei Sentiments gebrochene naive Betätigung des Lebens. Vorteile oder Nachteile im nachirdischen Leben waren in keiner Weise mit einem diesseits sinnlich oder keusch geführten Leben verbunden. Es gab kein Ideal des geschlechtlichen Lebens, um dessentwillen Opfer zu bringen waren. Es gab also auch keine Geschlechtsmoral. Niemand konnte Anstoß daran nehmen, daß Perikles in zweiter Ehe eine ehemalige Hetäre zur Gattin nahm, die Aspasia. Ein brillanter Geist und ein schöner Leib legitimierten sie dazu. Daß sie den einen wie den andern als Hetäre ausgebildet hatte, war selbstverständlich. Die große Rolle, welche etwa vom sechsten vorchristlichen Jahrhundert ab die Hetäre im griechischen Privatleben gespielt hat, dürfte von der untergeordneten Stellung der verheirateten Frau wesentlich bedingt worden sein. Was und weshalb man heiratete, das entschied weder die leibliche Schönheit noch die besondere geistige Bildung der Erwählten, denn weder das eine noch das andere hatte in der Ehe irgendwelche Bedeutung. Zum Beweise, daß man auch ohne jede erotische Beziehung zur Frau mit ihr Kinder zeugen könne, dazu bedarf es übrigens nicht der Anrufung des Beispieles der Antike. Eine andere als solche Familienbedeutung kam der antiken Ehe nicht zu. Das Vergnügen in jeder Art übernahm in Arbeitsteilung die ihre Gunst verkaufende Frau, von der Dirne des Hafens und der Straße, für die man etliche dreißig Bezeichnungen hatte, bis zu der höchststehenden in Natur und Kunst, der man nur den einen auszeichnenden Namen der Freundin, der Hetäre gab. Wie in der nachfolgenden Zeit bis auf heute waren die Beziehungen des Mannes zu der Freundin keineswegs solche von der kurzen Dauer einer Nacht, meist dauerte die Beziehung zur Hetäre, die als eine gebildete Person ja mehr noch zu geben hatte als bloß ihre körperlichen Reize, länger, wenn auch meist nicht länger, als es die Mittel des Mannes erlaubten. Aber es kam, wie natürlich, nicht selten vor, daß sich in dieser Zeit eine Freundschaft ausbildete, die, von der sinnlichen Passion genährt, schon viele der gefühlsmäßigen Züge der moderneren Liebe zeigt. Athenaios wie Pausanias berichten von der Hetäre Leaina – ihr Kenname Löwin –, daß sie die Geliebte der Tyrannenmörder Harmodios und Aristogeiton war, sich für diese ohne zu verraten foltern ließ und dafür später durch ein Denkmal gefeiert wurde. Von einer Freundin des Alkibiades, des Schreckens der braven Athener, berichtet Xenophon in den Memorabilien. Als Alkibiades nach der Einnahme Athens durch Lysander der Regierung der Dreißig nicht vertraute und sich nach Phrygien begab, nahm er seine beiden Freundinnen, Timandra und Theodata mit und lebte mit ihnen in einem Hause im Dorfe Melissa. Lysander erpreßte vom Satrapen Pharnabakes das Zugeständnis, den Alkibiades umzubringen. Der lag, in Frauenkleidern und von Timandra geschminkt und coiffiert, in den Armen der beiden, als Rauch ins Gemach drang. Die Soldaten des Satrapen hatten das Haus angezündet. Alkibiades schlug sich mit vor dem Gesicht gehaltenen Mantel und das Schwert in der Hand durch ins Freie, wo man ihn mit Pfeilen niederstreckte. Die beiden Freundinnen hoben den Leichnam auf, wuschen ihn, legten ihn in Linnen und bestatteten ihn. Nach Plutarch war es Timandra, die das letzte Liebeswerk besorgte. Bei Athenaios war es Theodata. So waren es beide. Und sie blieben beisammen. Der tote Freund und die Gefahr hatten sie vereint. Sie setzten dem Alkibiades ein Grabmal, worauf Strafen standen, die sie nicht scheuten. Athenaios sah noch das marmorne Standbild in dem phrygischen Bauernnest. Diese Theodata wird von Athenaios ihrer schönen Brüste wegen gerühmt. Geist besaß sie nach ihm wenig. Auch Xenophon spricht nur von ihrer leiblichen Schönheit und machte den Sokrates auf sie neugierig, so daß der sie bei einem Maler aufsuchte, dem sie gerade Modell stand. Ihre Mutter saß neben ihr, nett und anständig von der Tochter angezogen, und es gab auch Dienerinnen. Sokrates fragt sie, wovon sie ihren Lebensunterhalt bestreite, und das Kind antwortet mit großer Einfachheit: Wenn ich einen Freund finde, der nett sein will, davon lebe ich. Sokrates gab ihr nach seiner Gewohnheit, die ihm die Athener so verübelten, gute Lehren, wie sie es anstellen müsse, zu einem solchen Freunde zu kommen, denn die flögen nicht so herbei wie die Fliegen, man müsse Netze stellen, sich verweigern, um sich begehrt zu machen, und ihnen Hunger geben, damit sie nicht auslassen. Was denn für Netze und Hunger? fragte die Hetäre, die nicht verstand und glaubte, Sokrates wolle ihr helfen, Freunde zu finden. Sie bat ihn darum. Und Sokrates führte eine seiner dialektischen Foppereien auf, ohne daß das Mädchen es merkte.
Die Hetären haben ihre Dichter und Historiker, ihre Maler und Bildhauer, auch ihre Altäre und Tempel gehabt. Was die Literaten und Historiker betrifft, so werden nicht wenige darunter gewesen sein, die verärgert über zu hoch hängende Trauben gewesen waren. Die Aspasia war nicht für kleine Federfuchser zu haben. Auch Enttäuschte und Betrogene werden darunter sein. Vielleicht auch Ehemänner, denen das Ganze nicht paßte. Sicher aber auch amüsierte Zuschauer und Freunde. Manche verraten ihre Voreingenommenheit selber. So der komische Theaterstückschreiber Anaxilas. Dieser Anaxilas nennt die Sinope die Hydra, Gnathaina die Pest, Phryne Charybdis und Nannion Szylla. Alle seien sie alte Vetteln und sähen aus wie gerupfte, enthaarte Sirenen. Athenaios ist liebenswürdiger als dieser Anaxilos, dem großes Alter und kleines Einkommen Freuden versagten, wofür er sich auf seine Skribentenweise rächt. Der herumhorchende und alles lesende Athenaios erzählt die ihm oft nacherzählte Geschichte von der goldenen Kette. Ein junger Mann aus Kolophon begehrte die Milesierin Plangion und wollte für sie seine Geliebte Bacchis aus Samos verlassen. Aber Plangion sah, wie schön Bacchis war, und wollte von dem Kolophoner nichts wissen. Sie hatte Korpsgeist. Der Mann wollte aber nicht abstehen. Da forderte Plangion als Preis für ihre Gunst eine goldene Kette, die sehr berühmt war und der Bacchis gehörte. Der Mann glaubte, Bacchis würde ihn nicht an seiner Liebe sterben sehen wollen; er verlangte die Kette und bekam sie auch, denn Bacchis konnte ihn nicht leiden sehen. Als die Plangion gerührt erkannte, daß Bacchis nicht eifersüchtig, gab sie ihr die Kette zurück und nahm den Kolophoner in ihre Arme. Von da ab wurden die beiden Mädchen Freundinnen und hatten ihren Freund gemeinsam.
Vielleicht trat um diese Zeit schon etwas wie ein Verfall des Hetärentumes ein, was ihre große Popularität vermuten läßt. Sie werden Heldinnen vieler Komödien. Man spielte eine Korianno, eine Thais, eine Phanion, eine Opora. Pherekrates, Menander, Alexis und viele andere sind die Autoren. Später kam dann der Sykionier Machon, Theaterdirektor in Alexandrien, und verfaßte über die Hetären Versgeschichten. Seinem Schüler, dem Grammatiker Aristoteles aus Byzanz, gab er den Auftrag, eine Geschichte der Hetären abzufassen. Das verkaufte sich gut an der Theaterkasse. Dieser Grammatiker erzählte hundertundfünfunddreißig Hetärenleben. Das ist eine geringe Zahl. Aber Apollodoros, Ammonios, Antiphanes und Georgias nennen viel mehr Hetärennamen und sagen zudem, daß sie die meisten vergessen hätten. Aber Machon und sein Schüler hätten noch weit mehr vergessen, zum Beispiel die Paroinos, die so viel getrunken hätte. Ferner die Euphrosyne und Theokleia, die Nelke genannt, und Synoris, die Laterne, und die Große, und die Lampe, und das Schweigen, und das Wunderchen, und die Haarlocke. Von Antiphanes erfährt man, daß Nannion den Spitznamen Vorhang bekommen habe, weil sie wohl die schönsten ägyptischen Kleider, mit Goldkörnern überstickt, getragen habe und auch erlesenen Schmuck, aber entkleidet recht häßlich gewesen wäre. Diese Mädchen zeigen manchmal ein gutes Herz, immer ein flinkes Mundwerk. Entweder sind die Hetären von ihrer ehemaligen Höhe herabgestiegen, oder es ist, was von Geist und Bedeutung der Aspasia, der Lais, der Phryne im Umlauf war, mehr dem Umstande zuzuschreiben, daß sie die Freundinnen hervorragender Männer waren, wie Perikles, Aristip, Hypereides, Demosthenes. Epikrates erzählt in seiner Anti-Lais von der Lais als einem alten Weibe, das den Trunk liebte und vor Neid platzte. Auch die Phryne soll nach Timokles schon recht bei Jahren gewesen sein, als sie vor dem Richter stand und sich vom verzweifelnden Anwalt dekolletieren ließ. Aber ein Scholiast des Plutus und Athenaios erzählt hinwiederum, daß die Lais jung und schön war, als sie den tragischen Tod erlitt. Sie fand Gefallen an einem gewissen Eurylokos, der sie nach Thessalien mitnahm. Die thessalischen Weiber wurden eifersüchtig, denn sie verdrehte den Ehemännern den Kopf. In Scharen brachten diese an ihrer Tür das Weinopfer. Da stürzten sich an einem Festtage der Aphrodite, wo die Männer keinen Zutritt zum Heiligtum hatten, die Weiber über die Lais und erschlugen sie mit den hölzernen Kirchenstühlen. Das war dieselbe Lais, die in Korinth den Dienst der Hierodulen eingeführt haben soll. Die Deutung hat etwas für sich, daß die Einschaltung der Freudenmädchen in den Tempeldienst und die Verleihung einer göttlichen Weihe dazu geschah, um die Mädchen, und damit auch die Männer, vor