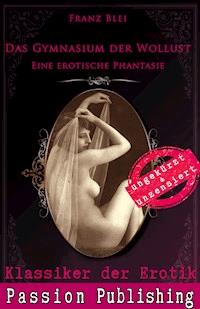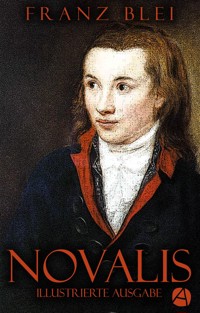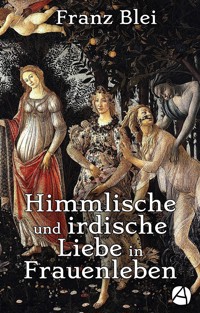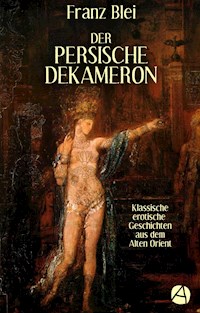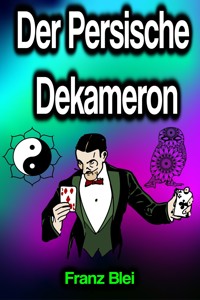Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In "Männer und Masken" zeichnet der bekannte österreichische Essayist und Literaturkritiker Blei gekonnt Porträts von bekannten Personen hauptsächlich seiner Zeit. Inhalt: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann Drei romantische Liebhaber - Friedrich Schlegel: Julius - Chateaubriand: René - Benjamin Constant: Adolphe Stendhal Beau Brummell Baudelaire Alexander von Villers Aubrey Beardsley Die Magier Oscar Wilde Charles Péguy Bildnis eines Boxers Prinz Hippolyt Walter Rathenau Heliogabal Der bestrafte Lüstling
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Männer und Masken
Franz Blei
Inhalt:
Männer und Masken
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
Drei romantische Liebhaber
Friedrich Schlegel: Julius
Chateaubriand: René
Benjamin Constant: Adolphe
Stendhal
Beau Brummell
Baudelaire
Alexander von Villers
Aubrey Beardsley
Die Magier
Oscar Wilde
Charles Péguy
Bildnis eines Boxers
Prinz Hippolyt
Walter Rathenau
Heliogabal
Der bestrafte Lüstling
Männer und Masken, F. Blei
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849623111
www.jazzybee-verlag.de
Männer und Masken
E. T.A. Hoffmann. Nach der eigenen Zeichnung
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
Die geistige Landschaft, in der jene sich bewegten, die als Knaben von der Revolution gehört hatten und als Jünglinge Napoleon erlebten, war ein blitzdurchrissenes Chaos, wo das erregte, zu äußerster Empfindlichkeit gesteigerte Gemüt dieser Jugend in den Pausen des Dunkels zu deuten versuchte, was es, blitzte es auf, von der infernalisch beleuchteten Trümmerwelt zu sehen bekommen hatte. So ungewöhnliches Geschehen, wie die von Napoleon und seinen Jünglingsgenerälen auf der Spitze des Schwertes durch die Welt getragene Idee der Revolution, selber als Gedanke sich nicht klar, da mit Affekten geladen, mit Blut getüncht, wird von der erschütterten Mitwelt, zumal ihrer Jugend, nichts als gefühlt erlebt und auch mit nichts als Gefühl begegnet werden, und dies in allen Graden der Intensität: spontan berauscht von jenen, die sich die dreifarbige Kokarde anstecken und politisch werden, übertragener von anderen, die, wie der junge Schlegel, das Zeitalter moralischer Ungebundenheit angebrochen wähnen und der Lucinde der Libertinage ein Denkmal setzen, oder die wie Shelley der endlich befreiten Menschheit Hymnen singen und die Fahnen noch weiter tragen wollen. Die Jugend und die Zeitgeschehnisse lassen es nicht zu, daß man – ist man nicht der in der Mittagswende des Lebens stehende Goethe – die Distanz gewinnt, die nötig ist, um zu dem, was sich in überstürzenden Ereignissen vollzieht, das zu haben, was man Gedanken nennt. Aber mit der dem Menschen eigentümlichen Neigung, die Dinge denken zu müssen, nimmt nichts als Gefühltes Form und Gebaren von Gedanken an, von Erkenntnissen und Einsichten. Die erste Generation der Romantiker, die den napoleonischen Akt der Revolution erlebt, verbraucht sich in ungeheuren Anstrengungen zu einer Denkhaltung. Sie fragt bei Goethe an, und der antwortet rätselhaft. Sie sieht ihn dem Kaiser seine Reverenz machen, und sie hört von der anderen Seite schon den Ruf, den »Tyrannen« zu stürzen. So gerät diese erste Romantik auf einen politischen Indifferenzpunkt und sublimiert den Kosmos ins Ästhetische. Dichterisch organisiert, versuchen diese Jünglinge, auf das Gedicht immer wieder verzichtend, sich im Kritischen, die ihnen von niemandem, auch vom nunmehr abgelehnten Goethe des Wilhelm Meister nicht, besorgte Vorbereitung ihres Auftretens, ihres »Neuen« zu geben, und es entstehen solche Zwischengebilde wie Wackenroders Ergießungen eines Klosterbruders – so einsam fühlt man sich in dieser bewegten Welt – oder Tiecks Literaturkomödien, oder ein Gebirge von Fragmenten, indem die Mineralogie aus dem Gefühle neu geordnet wird und das sinnliche Leben aus der Mathematik, und sich Identifikationen vollziehen wie diese: Christus und die kleine verstorbene Sophie Hardenbergs. Friedrich Schlegel, der Kenntnisreichste und Gewandteste, sucht, ihm von Weimar nahgerückt, die Antike aufzuarbeiten für seine Generation, und es ist nichts Geringes, was er hier zur Orientierung vollbrachte. Aber die Gefolgschaft verläßt ihn oder er sie. Wackenroder schwindet weg wie ein Schatten. Hardenberg verhaucht sich in einem von der Schwindsucht gefärbten übersinnlichen Erotismus, wie der viel männlichere Keats jenseits des Kanals. Der pedantische August Wilhelm geht auf die Ahnensuche, wobei er um Goethe einen diplomatischen Umweg macht, entdeckt Shakespeare und die Spanier, Tieck, ihm folgend, den Jacob Michael Lenz als nahen Verwandten. Da brechen die sogenannten Freiheitskriege ein, und die zweite Generation der deutschen Romantiker tritt auf den Plan. Man hat eine Topik gefunden nach dem Utopischen der sentimentalen Revolutionsvokabel, die man um 1798 ins Kosmische gedehnt hatte. Die Topik hieß das geknechtete Deutschland. Höchst ungleiche Stimmen fanden darin eine Einung. Da gab es den Schillerknaben Körner neben Clemens Brentano. Aber nur einer hatte dieses Deutschland in seiner wirklichen Zeit: Kleist. Und den ließ die Zeit im Stich. Die anderen hatten, soweit sie nicht im Klingklang ihrer kleinen Kriegslyrik untergingen, ihr Deutschland von irgendwann einmal, etwa aus der Zeit des Heiligen Römischen Reiches, der Hohenstaufen. Ihnen aber ist die Neuerwerbung alten deutschen Gutes zu danken, das, jahrhundertelang verschüttet, für einen Augenblick nur einmal von den Schweizern geahnt war: Arnim und Brentano das Volkslied, den Brüdern Grimm vor allem die Sprache.
Gab es aber noch romantische Dichter? Tieck, der Schwächliche, Gefühlige, hatte in einer mondbeglänzten Zaubernacht eine Legion von Dichtern geschaffen, die beglückt war, vom Denkenmüssen zu nichts als dem Gefühligen erlöst zu sein. Es ist bezeichnend für diese Schar, daß sie die Kontur des Substantivs, des Begriffs undeutlich macht durch Adjektiva, den Begriff romantisiert durch schillernde Färbung, ihn ins Vieldeutige, Unbestimmte drängt und vom Verbum, dem Bewegenden, Tuenden, den schwächsten Gebrauch macht. Löben ist der modische Dichter dieser Art. Spanischer und englischer Euphuismus erlebten eine deutsche Renaissance. Auch diese zweite Generation hatte ihre Deserteure, als sich das geschaffene Werk als nicht definitiv erwies, um fruchtbar für das weitere Schaffen zu wirken. Nicht Werner, der, wie Grillparzer, nur stofflich, nicht sprachlich zu den Romantikern gehört. Aber Tieck flüchtete in das Hausbackne seiner Erzählungen. Fouqué kopierte immer wieder seine erste Rittergeschichte. Brentano desertierte ins Schweigen. Der herüberlebende Friedrich Schlegel begab sich in die ihm wichtige Versorgung seines glutinösen Bauches, Kleist in den Tod. Und die Erben des verlassenen Gutes begannen über den romantischen Apparat, den Fundus, zu verfügen, zu dem sie noch hinzutaten, was sie aus Walter-Scottschen Burgen und Verliesen, aus Hugoschen Folterkammern bezogen. Inmitten dieser Ritter-, Räuber- und Schauerromantik, die den endlich wieder obrigkeitlich und wie hergebracht behüteten Bürger der zwanziger Jahre, den Biedermeier der Karlsbader Beschlüsse, am Ofen zum Gruseln brachten, gänzlich im Abstrusen Imaginiertes nach dem unfaßlich Phantastischen des eben zu Ende gegangenen Geschehens – inmitten dieses jammervoll verschmierten und verdruckten Löschpapiers, aus dem sich das junge Deutschland seinen Ekel am alten Deutschland erlas, kämpft ein Dichter, nur einer, um seine ewige Seele, um jeweils immer wieder dem billigen Teufel der Zeit zu unterliegen: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.
Als Gérard de Nerval auf dem Weg in das gelobte Land seiner Träume an den Rhein kam und drüben la vieille Allemagne, notre mère à tous schaute, da entzückte er sich zu der Apostrophe: la terre de Goethe, le pays d'Hoffmann... Das Wort muß den deutschen Literarhistorikern absurd vorkommen, denn sie sind an die Zusammenstellung mit Schiller seit Generationen gewöhnt; aber den Franzosen schien es nicht einmal paradox, nicht denen von damals, und auch die von heute werden daran nichts sonderlich Kühnes finden. Hoffmann ist ihnen ein Stück der deutschen literarischen Kultur, wenn sie uns mit diesem Worte schmeicheln wollen, die wir die Bezeichnung wohl erfunden haben, aber, aber was sie bedeutet, schmerzlich heute entbehren. Doch dieser wirkliche oder vermeintliche Kulturtypus ist es nicht allein, was die Franzosen immer wieder veranlaßt, sich mit unserem Hoffmann zu beschäftigen, ihn mit ihrer schätzenden Liebe zu entschädigen für das Schicksal, das dieser Dichter in Deutschland erfuhr, wo man ihn nach kurzer, wenig würdigender Liebe rasch vergaß, oder – noch schlimmer – ihm in einem Paragraphen der Literaturgeschichte eine bescheidene Unsterblichkeit mit queren Worten zusprach, oder – das schlimmste – ihn in schlecht geschriebenen Büchern um Dinge willen lobt, die, seine Bedeutung übersehend, am hinfälligsten sind. Ich glaube, die Franzosen lieben in Hoffmann den Artisten, der für seine Kunst sein Leben fast systematisch zu einem pathologischen machte, der à une voix, qui l'appelait au delà de l'être folgte, wie Barbey d'Aurevilly es ausdrückte, und der so ausgezeichnete Worte über das Menschlich-Unnütze der Kunst schrieb. Die Deutschen schätzen das nicht, denn sie haben wohl eine literarische, aber keine künstlerische Bildung. Und selbst, wenn sie in ihren besseren Exemplaren schon so weit sind, von den Künsten keinen Moralunterricht zu verlangen, überhaupt nichts mehr aus ihrem praktischen Verstand zu verlangen, seitdem man ihnen das so oft und eindringlich verboten hat: im deutschen Instinkte herrscht immer noch und trotzdem die so barbarische als freudlose Tendenz nach der Moral von der Geschichte, nach dem Schluß: der Künstler müsse auch die anderen erziehen, da er sich selber durch sein Werk erzieht. Die Deutschen sagen gern »die Kunst« – ein Wort, leer wie ein Sack, alles und nichts aufzunehmen geeignet, und sie vermeiden es möglichst, »der Künstler« zu sagen, was auf ein Bestimmtes, auf eine sinnliche Anschauung hinweist, weil das Wort den Menschen in sich begreift. »Der Künstler«, d.h. Goethe oder Hoffmann oder Immermann oder Hofmannsthal, die Deutschen sind als das Volk der Denker gleich und immer bereit, den Künstler durch das etwas nebulose Medium der »Kunst« in die gemeine Humanität und die allgemeine Ästhetik hinüberzuführen; sie wollen vom Kunstwerk Regeln bestätigt oder etwas für ihr Leben oder aus ihrem Leben erfahren; sie wollen ihre ethischen Gemeinplätze von ihm geprüft und für gut befunden sehen, und sie wollen etwas lernen, weil man viel auf Bildung hält. Der gemeine Deutsche wird die Phantasie immer überlegen fragen: Was beweist das? Denn er will sich wiederfinden im Kunstwerk idealisiert, wenn er altmodisch ist, naturalistisch, wenn er neumodisch, und symbolistisch, wenn er ganz neu, und sachlich, wenn er noch mehr als ganz neu ist. Sein Bildungsinstinkt verlangt von dem Kunstwerk die Rechenprobe auf seine des gemeinen Deutschen Existenz ausgeführt mit bekannten Zahlen. Er macht sich, wie man sieht, das Kunstwerk nicht leicht. Darum bedarf er auch einer Literatur, bei der er sich erholt. Er nennt sie, mit aller deutlich gezeigten Überlegenheit: Unterhaltungsliteratur.
Hoffmann mußte es sich bei seinen Lebzeiten gefallen lassen, den deutschen Philister, der damals am schläfrigsten war, zu unterhalten, mit den Anekdoten seiner Dichtungen natürlich, nicht mit ihrer Kunst. Es ging ihm wie E. A. Poe, an den in Frankreich Baudelaire einen großen Teil seines Lebens setzte, und den man in Deutschland in Übersetzungen kannte, die gerade die Anekdote herausbrachten, und nicht mehr wollten. Im Jahre 1898 hat Eduard Grisebach die Werke Hoffmanns wieder herausgegeben – ob die Heutigen sie anders lesen werden als Großväter und Väter, ist nicht zu sagen. Das Wort »Goethe und Hoffmann« ist literarhistorisch wahrscheinlich falsch, es mag ethisch paradox und für manchen Geschmack unerträglich sein – alles das, aber es ist im künstlerischen Sinne wahr, und dies gilt zuerst und vielleicht allein. Viele werden die Universalität des einen mit dem »begrenzten Stoffgebiet« des anderen vergleichen, des einen Mythos und des anderen Skurrilität. Aber einmal ist alles Vergleichen in künstlerischen Dingen vulgär, und dann ist die Universalität kein absoluter Vorzug. Der Kreisler ist gewiß nicht der Faust, aber der eine ist ganz Goethe, der andere ganz Hoffmann, in Formen nur so und nicht anders für allemal gebunden und gebannt. Wenn Faust und Kreisler sein sollen, können sie nur so und nicht anders sein. Alles Vergleichen der Ungleichen hierin ist letztens eine ethische Untersuchung, denn es geht auf die verschiedene Qualität der beiden Menschlichkeiten und unsere Sympathien für die eine oder die andere. Man kann Hoffmanns Persönlichkeit ablehnen als beschränkt, bizarr, pathologisch; aber sie ist in seinen Formen völlig aufgegangen, hat sich »unmittelbar mit der Materie verbunden«, wie Goethe sagt, und das Kunstwerk ist geworden. Dies ist genug und alles: das Leben des Künstlers und die Transponierung seines Lebens in Formungen, mag das Leben und das moralische, gefühlsmäßige und kritische Verhalten dazu sein wie immer. Geformte Narrheit kann Kunst sein, aber formloser Tiefsinn ist immer Ohnmacht und Dilettantismus, fällt ins menschlich Problematische zurück. Die Musiker und Architekten waren immer so glücklich, ihre Werke nichts als künstlerisch wirken zu sehen; die Maler sind dabei, durch ihr Tun die Leute zu überzeugen, daß die Kunst der Borgofresken keine anderen künstlerischen Wertungsgesetze kennt als ein Ornament. Nur dem Dichter will man es nicht glauben, daß sie Sprachbegeisterte sind; daß ihr Material das Wort ist, die Wörter aus dem und in dem sie schaffen, daß, was man Inhalt nennt, keine willkürlich vollzogene Wahl ist. Daß wir im Dichterwerke den Inhalt suchen, so weit gefaßt, daß wir damit das magische Leben seines Schöpfers umgreifen, heißt nicht, daß dieser Schöpfer auch die Absicht zu dieser Hinstellung eines Inhaltes gegeben hat. Die Kunst der Dichter wäre längst erschöpft, wenn es sich um die Inhalte handelte, um diese wenigen, immer wiederkehrenden Inhalte, feststehend seit dem Homerischen Gedicht. Aber wären es noch weniger als diese drei oder vier, ja gäbe es nur einen einzigen Inhalt, es wäre die Dichtkunst doch unendlich und unerschöpflich, weil sie aus Worten und mit Worten schafft, nicht deren gerade geläufigem Sinn nach, der kein ein für allemal fixierter ist, sondern nach der Bildlichkeit der Worte und ihrer formalen Wirksamkeit. Der Zwang zur Kunst ist die Form und das Formfühlen, nicht das sachliche Bedenken. Stilgefühl weist manches auf, einen Teil des Ganzen für das Ganze setzend; doch sollte man dieses Wort nicht brauchen, da es sein Gegenteil, die Stillosigkeit, auch noch irgendwie gelten läßt. Die Form ist das einzige Leben der Kunst. Ohne sie bleibt alles nur Intention. Das Chaos des formlosen Lebens wird von der Kunst in eine Ordnung gebracht, durch sie allein und nichts sonst. Und deshalb ist die Form auch eine lauernde Gefahr, denn sie wiederholt sich, kehrt wieder. Es ist an der Leidenschaft des Dichters, dem Rhythmus dieser Wiederkehr die ganze Heftigkeit seines persönlichen Lebens zu geben, d. h. sich zu opfern. Wer sein Leben nicht dem höchsten Geiste opfert, der wird der gefahrvollen Wiederkehr der Form entweder erliegen und das gefällige Nichtige hervorbringen, oder er wird die hohe Aufgabe, die die Form mit ihrer Bezwingung stellt, nicht durch das ganze Opfer lösen können, ins Formlose flüchten, und das Formlose als Gesetz verkünden. Aber das Formlose ist ein Verfall und Schauspiel moralischer Unmacht, gemein wie das nichts als Talentvolle, das, die Gefahr der Wiederkehr nicht sehend, von den Variationen der Kunst anderer lebt, nie etwas im leidenschaftlichen Geiste austragen, eine Schönheit erschaffen kann.
Der Inhalt ist ein gemeiner. Die Motive und die Formen sind ein Gegebenes: die Geschicklichkeit wiederholt und variiert sie, schafft sie nicht neu. Ein Neues wird das Vertraute, wenn die ganze Leidenschaft eines künstlerischen Ingeniums sich in den stärksten Zwang der Form begibt: dann ist es Schöpfung wie am ersten Tag.
Die neuere Zeit neigt sich in ihrer Bestimmung des einzelnen zu einer fatalistischen Überschätzung dessen, was man den Einfluß des Milieus nennt. Die neuere Zeit ist demokratisch und unterschätzt oder ignoriert die Kraft des Widerstandes, die Möglichkeiten von Milieuauswahl und -wechsel und die Fähigkeit einer Milieubeherrschung, die bei starken Persönlichkeiten sogar zu einer Milieubestimmung wird. Aber in der Zeit des Wachstums, in der Kinder- und Jugendzeit, da die Kraft noch nicht reif, der Widerstand nur instinktiv ist, und einer Wahl noch Möglichkeit und Erkenntnis fehlen, da werden die Einflüsse der Umgebung oft bestimmend sein zur Bildung dessen, was man vom späteren Scheinmilieu unterscheidend das innere Milieu genannt hat.
Hoffmanns inneres Milieu, das ihm seine Kindheit und erste Jugend schufen, erfuhr in der Umgebung seines späteren Lebens keine Änderungen. Nichts brachte ihn von seinem früh erworbenen Wesen ab; selten hat ein Mensch so stark wie Hoffmann dieses innere Milieu sein Leben hindurch behauptet. Er entwickelte sich nicht – er wickelte sich auf. Er tritt in das reife Leben wie ein Held in das Drama, fertig und bestimmt. Die Ereignisse ändern ihn nicht – sie zeigen ihn.
Als Hoffmann zur Welt kam, waren sich seine Eltern schon lange einig darüber, daß sie nicht zusammenpaßten und einander nur zu Leid und Verzweiflung lebten. Der Vater fand in nichts ein größeres Vergnügen, als gegen alle Ordnung und Regel bürgerlicher Gesellschaft sein Leben zu führen, während das der Mutter in Anstand, Frömmigkeit und peinlich befolgter Konvenienz aufging. Beides war beiden zum Prinzip gesteigerte Natur. Diese disparate Ehewirtschaft fand ein Ende, als Hoffmann noch ein Kind war. Der Alte zog mit seinem, wie berichtet wird, sehr begabten und später verkommenen Sohn in eine andere Stadt, Ernst blieb bei der Madame Hoffmann, die zu ihrer Mutter, einer verwitweten Rätin, zog. Hier fand sie alles, was sie vom Leben verlangte: korrekte Leute, korrekte Sitten, korrekte Anschauungen, und sie genoß das, bis sie eines Morgens in ihrem Zimmer, das sie kaum zu verlassen pflegte, still und korrekt verstorben war. Der Knabe blieb bei seiner Großmutter und in dem Kreis von Onkeln und Tanten, deren kein Mensch je mehr gehabt hat als er, und keiner größere Kuriosa dieser Gattung. Es gelingt ja Onkeln und Tanten leicht, da, wo sie in größerer Anzahl auftreten, ein Ziemliches an Groteskem und Überquertem zu leisten – in Hoffmanns Falle war aber alles mögliche dieser Art übertroffen. Die Rätin Dörffer, eine stattliche Dame, wuchs zum Riesenweib unter den übrigen zwerghaft kleinen Menschen Dörfferschen Samens, die bei ihr wöchentlich zweimal zusammenkamen, in den sonderbarsten Kleidungen vergangener Moden, um auf alten, gleichfalls aus der Mode geratenen Instrumenten sich einem lebhaften musikalischen Unwesen hinzugeben. Eine Tante spielte die langhalsige Theorbe, eine andere die Laute, andere sangen mit fadenscheinigen Stimmen; der Onkel Otto meisterte das Clavecin, und der Onkel Akziseeinnehmer blies die Flöte mit einem so mächtigen Atem, daß der Diener immer die Pultlichter anzünden mußte, die der Onkel mit seinem Spielen auspustete. Hoffmann-Kreisler beschreibt diese Konzerte aus der Erinnerung, da sie statthatten, als er noch ein Säugling war, »nur ba–ba sagen konnte und die Finger ins Kerzenlicht steckte«. Aber die Wahrheit des Berichtes bittet er deshalb nicht anzuzweifeln. Er ist, wie er sagt, überzeugt, daß jene Eindrücke, die man mit den Augen empfängt, von größerer Schärfe und längerer Dauer sind als jene anderen, die das Bewußtsein erfährt, beurteilt und durch Einordnung in Allgemeinbegriffe um ihre Dinghaftigkeit bringt. In dieser grotesken société musicale war auch die Tante Sophie. Sie trug immer ein grünes Taftkleid, mit rosa Bändchen geputzt, und spielte die Laute so schön, daß mir ernste Leute versicherten, daß sie zu Tränen gerührt würden bei der bloßen Erinnerung daran. Tante Sophie war des Kleinen guter Engel, sie nahm ihn auf den Schoß und erzählte ihm Geschichten. Aber der Onkel Otto war sein böser Dämon. Wenn Hoffmann von der Tante sagt: »sie brachte ein großes Licht in mein Herz«, so ist es der Justizrat Otto im blumigen Kamisol, der sich so ausdauernd wie vergeblich bemühte, dieses Licht auszublasen. In diesem Justizrat hatte die Familientugend der Dörfferschen: die Regelhaftigkeit und Wohlanständigkeit einen Grad systematischer Narrheit erreicht. Madame Barine zitiert in ihrer Studie über Hoffmanns Alkoholismus das typische Krankheitsbild eines dégénéré méticuleux nach Maiollier ganz zutreffend auf diesen Onkel, der durch das Leben ging mit der Uhr in der Hand; alles hatte seine genau bestimmte Zeit und Dauer: Mahlzeiten und Verdauung, Schlafen und Spazieren, Musik und Unterhaltung. Das Opfer seiner Erziehungswut war der kleine Hoffmann, der vom Vater alles hatte, was den peinlichen Onkel und Erzieher zur Verzweiflung treiben konnte. Der Lehrer litt unter dem Schüler nicht weniger als dieser unter dem Lehrer. Aber vielleicht hatte diese Dressur für den späteren Hoffmann die gute Folge, daß er sich nie ins Formlose verlor, daß ihm der künstlerische Verstand auch in den wildesten Zeiten seiner Träume nie verließ, daß er nicht unterging in seinem Leben steter Gefahren für den Verlust seiner selbst.
Der Philister und die Musik, beide so grotesk miteinander verbunden, waren Hoffmanns Jugendeindrücke, bestimmend für seine spätere Art. Er sah die Kunst von Narren und Pedanten malträtiert, und seine Begeisterung für sie wuchs, da er sie so leiden sah. Er haßte den »Philister« wegen seines gemeinen Verhältnisses zu den Künsten und zerrte ihn zur Karikatur. Sein Temperament treibt ihn in Haß und Liebe zum Äußersten: er sieht dämonisch. Seine Liebe zu den Künsten wird eine passion morbide, wie es Baudelaire von Poe sagte. Hoffmann fand in dem erbärmlichsten Leben allen Komfort, wenn es nur mit der Kunst zu tun hatte. Er vermochte es, sich mit einem Enthusiasmus durch das Jammerdasein eines kleinen Theaterdirigenten zu hungern, der sich beim Kulissenmalen, Textverbessern und sonstigen Elendigkeiten nützlich machen mußte, daß solche Kunstbegeisterung die Pathologie Hoffmanns deuten könnte, die ihn den Eros und die Landschaft kaum empfinden lassen, außer in der Strahlenbrechung durch ein artistisches Medium. Das Erotische nimmt bei ihm sofort musikalische Formen an; die Landschaft hat ein magisches Licht, wie aus einer farbigen Laterne. Nicht an der Zeit interessiert – allem Zeitsatirischen zum Trotz – ohne rechte menschliche Teilnahme an seiner Umgebung, ganz beschäftigt mit seiner Dämonologie, führt er, ein ausschweifender Musiker, ein artifizielles Leben. Wenn ihn die natürliche Kraft zum Leben verläßt, nimmt er Gift, nur um sich sein artifizielles Leben zu erhalten. Er wird ein Alkoholiker, nicht wegen des brutalen Rausches, nicht um zu vergessen, nicht der geselligen Lustigkeit wegen, sondern um der Rauschvisionen willen, die ihm künstlerische Substanz werden. Er will sich im Rausch entdecken, die Schwere ausschalten, die ihn am Flug hindert, seine Dürftigkeit aufheben, damit er in alles und alles in ihn eingehen kann. Er schreibt: »Gewiß ist es, daß in der glücklichen Stimmung, ich möchte sagen in der günstigen Konstellation, wenn der Geist aus dem Brüten in das Schaffen übergeht, das geistige Getränk den regeren Umschwung an Ideen befördert ... Man könnte rücksichtlich der Getränke gewisse Prinzipien aufstellen. So würde ich bei der Kirchenmusik alte Rheinweine, bei der tragischen Oper sehr feinen Burgunder, bei der komischen Champagner, bei einer höchst romantischen, wie dem Don Juan, einen Punsch aus Kognak, Arrak und Rum anraten.« Andere Beispiele, wie die pathologische nervöse Sensibilität zu einer schöpferischen Fähigkeit gemacht wird, sind: »Nicht sowohl im Traume, als im Zustande des Dilirierens, der dem Einschlafen vorhergeht, vorzüglich wenn ich viel Musik gehört habe, finde ich eine Übereinkunft der Farben, Töne und Düfte. Es kommt mir vor, als wenn alle auf die gleiche geheimnisvolle Weise durch den Lichtstrahl erzeugt würden, und dann sich zu einem wundervollen Konzerte vereinigen müßten. Der Duft der dunkelroten Nelken wirkt mit sonderbarer magischer Gewalt auf mich; unwillkürlich versinke ich in einen träumerischen Zustand und höre dann, wie aus weiter Ferne, die anschwellenden und wieder verfließenden Töne des Bassetthornes.« Ähnlich steht bei Poe in den Marginalien: »Das Orangegelb des Spektrums und das Summen der Fliege – das nie höher ist als das zweimal gestrichene A – erzeugt in mir nahezu die gleiche Sensation. Höre ich die Fliege, so erscheint mir die Farbe, sehe ich die Farbe, so kommt mir sofort das Summen der Fliege ins Ohr.« Bei Hoffmann: »Nervöser Kopfschmerz sucht mich oft heim, aber er gebärt das Exotische.« Es gibt unter den Künstlern wenige Fälle so rücksichtsloser leiblicher Selbstvernichtung um des künstlerischen Schaffens willen wie den Hoffmanns. Die Pathologie wird körperlich gefördert und bewußt der Kunst bedienstet.
Das Wunderbare in seiner Kreuzung mit dem Wirklichen: Hoffmann sah das mit dem sechsten Sinn, »der nicht nur alles, sondern noch viel mehr ausrichtet als die übrigen Sinne zusammen«. Alle Reminiszenzen an das Programm oder Requisit der Pseudoromantiker von der Art Fouqués sagen nichts über Hoffmann, der gar kein Verhältnis zu dem romantischen Wunderbaren hatte, zu den Feen, die aus Grotten kommen, zu den Gnomen, die im Feuer hausen und zu den Nixen in den stillen Wassern. Sondern: ein Herr tritt in den Raum, gekleidet wie jeder, aussehend wie jeder, auch redet er nicht viel anders – aber die im Räume fühlen: er zwingt uns. Und die Geschichte fährt fort in der Beschreibung der Gefühlszustände, nur werden diese alle sichtbar, kommen den Menschen unter die Haut, treiben diese auf, machen die Augen schielen, verlängern die Arme um Ellen, verändern, verzerren – doch alle bleiben Menschen. Berliner sogar, die in dem Zimmer eines Hauses am Gendarmenmarkt Tee trinken, aber unter die das Wunderbare getreten ist, das »Viel mehr« des sechsten Sinnes. Hoffmann sucht es nicht und erfindet es nicht in Allegorien, denn er findet es überall, im ganz Gewöhnlichen des Lebens, das für ihn durchaus dämonisch ist. Diese Illusion der Wirklichkeit, die alle seine phantastischen Individuen hervorrufen, erreicht er damit, daß er sie in einem geläufigen Milieu vorstellt. Er ändert nur die Beziehung der Sensationen. Du schlägst den Mittelfinger über den Zeigefinger deiner Hand, und unter die beiden Fingerspitzen legst du ein Kügelchen, das du nun leise bewegst: du wirst zwei Kugeln glauben. Es sind zwei Finger und eine Kugel, aber die Sensation ist geändert. Dies ist Hoffmanns Leidenschaft, welche die Serapionsbrüder zu einem kosmologischen System ausbauten, daß er die einfachen Dinge des Lebens in dem Rapport ihrer Sensationen ändern muß. Er sieht und fühlt alles in dieser Änderung, ist besessen davon, gepeinigt; er ruft mitten in der Nacht seine Frau, die brave Michaeline aus dem Bette, daß sie sich zu ihm setze und ihm gegen sich selber beistehe, denn er kann des Dämons nicht Meister werden.
E. T. A. Hoffmann. Nach einer Zeichnung von W. Hensel. Gestochen von Passini
Nicht alles, was Hoffmann, der sehr spät zu schreiben anfing, schuf, ist von der Art solcher Befreiungen. Wenige Jahre vor seinem Tode einten sich erst die vielartigen Elemente seiner Begabung zum Dichter, im früheren Werke manchmal stärker schon angedeutet. Aber zu Anfang hatte er manches gegen den »Philister« auf dem Herzen, das er ihm auch und ohne Umschweife sagen mußte – diese satirischen und humoristischen Dinge, zu denen auch der Murr im Katerbuch gehört, sind der literarische Hoffmann, nicht der Dichter. Und vieles ist in seinem Werk, das nur der Hoffmann geschrieben hat, der Geld braucht, triviale Wiederholungen älterer, besserer Motive, das der Künstler als Schund bezeichnete, »immer noch gut genug für das Publikum«. Er war nicht sehr streng gegen sich. Der echte Hoffmann ist in dem »Don Juan«, der »Brambilla«, dem »Goldenen Topf«, dem »Bergwerk von Falun« und den andern kürzeren Geschichten, jenen, welchen das Prädikat »krankhaft«, das ihnen Goethe gegeben hat, allein zukommt. In der Morbidität liegt seine künstlerische Bedeutung – das andere ist jeu d'esprit oder toure de force.
Hoffmanns dichterischem Werke fehlt der Schluß, die Erlösung. Man sieht ihn immer in die Nacht schauen und den Blick vor der Sonne verbergen. Man fragt sich, wie er das ertragen konnte, sucht nach dem Aufschwung dieser Natur und ihrer Verklärung. In seinen Schriften findet man sie nicht. Vielleicht liegt es außerhalb der artistischen Dichtung, diese schließende Verklärung zu geben, die ihn menschlich sein hieße, wo das Unmenschliche gerade sein Wesen ausmacht. Bei Hoffmann sind nur oft Wege angedeutet, die ihn zu seiner Ruhe führten: der Musik. Erst mit ihr scheint Harmonie in die bizarre Architektur seines geschriebenen Werkes zu kommen, das so vollendeter wird, je mehr er die Musik darin auflöst. Er ist jung gestorben. Das Flammenspiel seiner chthonischen Welt zehrte ihn auf.
Friedrich Schlegel. Nach einer Zeichnung von Augusta von Buttlar. Gestochen von J. Axmann
Drei romantische Liebhaber
Friedrich Schlegel: Julius
Wer das Ich auf eine Wirklichkeit festlegt, zerstört es; die Welt des genialen Ich ist allein die Welt der Möglichkeiten: mit einer solchen Einstellung suchten die deutschen Romantiker, mehr aphoristisch als systematisch, dem Segel ihres Schiffchens den Wind zu machen. Weil man aber immerhin lebte, was Verpflichtungen einschloß, und weil man sich äußerte, was nicht anders geht als in rationalen Formen, so fand man in der Ironie das Mittel, Verpflichtung und Rationales wenn auch nicht ganz aufzuheben, so doch sehr unzuverlässig und schwankend zu machen. Bei geringer produktiver Begabung war es opportun, eine Theorie der Ironie zu haben, die erklärte, es komme nicht auf das Werk an, sondern darauf, das Leben zu poetisieren, die Kunst ins Leben zu bringen. Da man aber auch kein sonderliches Leben hatte, eigentlich nirgendwohin gehörte als in ein paar Berliner Salons, so hatte dieses bißchen Leben nichts dagegen, sich poetisieren zu lassen. So balancierte der Romantiker auf der Brücke der Ironie, die er über seine Unzulänglichkeiten schlug, solche des Lebens und solche der Kunst. Das trug eine Weile, solange man jung war. Später kroch man unter, wo immer sich eine Gelegenheit bot, bescheidete sich im Staats- oder Kirchendienst subaltern.
Der deutsche Polizeistaat hatte sich hinreichend stark erwiesen, die politisch-literarischen Ungebundenheiten der jungen Romantiker ohne jede Ängstlichkeit hinzunehmen. Und die Kirche ließ als eine rationale Weltmacht das Genie-Christentum dieser jungen Leute seine Kapriolen schlagen, ohne auch nur hinzusehen.
Im Jahre 1799 schrieb und veröffentlichte Friedrich Schlegel die Lucinde. Als der Autor 1801 in Jena für die Erlangung des Doktorgrades disputierte, nannte einer seiner Opponenten das Buch ein Tractatum eroticum. Es gab einen Skandal, denn Schlegel warf dem Opponenten einen »Narren« an den Kopf. Der war er auch. Denn der junge Schlegel wußte eine Menge anderes, und es war nicht nötig, ihn bei dieser akademischen Gelegenheit, wo er den Gelehrten vorstellte, als erotischen Dandy anzugreifen. Denn nichts weiter als das Schattenbild eines solchen ist Julius, unter welchem Namen Schlegel in jenem Traktate sein Selbstbildnis zeichnet. »Alles konnte ihn reizen, nichts mochte ihm genügen. Daher kam es, daß ihm eine Ausschweifung nur so lange interessant war, bis er sie versucht hatte und näher kannte. Keine Art derselben konnte ihm ausschließend zur Gewohnheit werden: denn er hatte ebensoviel Verachtung als Leichtsinn. Er konnte mit Besonnenheit schwelgen und sich in den Genuß gleichsam vertiefen ... Die Frauen kannte er eigentlich gar nicht, ungeachtet er schon früh gewohnt war, mit ihnen zu sein. Sie erschienen ihm wunderbar fremd, oft ganz unbegreiflich und kaum wie Wesen seiner Gattung ... Er ward sinnlich aus Verzweiflung am Geistigen und war wirklich mit einer Art von Treuherzigkeit unsittlich.« Er erinnert sich eines Mädchens aus seiner Knabenzeit. Er eilt zurück in ihre Nähe, findet sie »ausgebildeter, aber noch ebenso edel und eigen, so sinnig und stolz wie ehedem.« Seinem »aufmerksamen Auge entgeht nicht die entschiedenste Anlage zu einer grenzenlosen Leidenschaft ... Aber mit Verdruß mußte er sich's gestehen, daß er seinem Ziele nicht näher kam, und schalt sich zu ungeschickt, ein Kind zu verführen. Willig überließ sie sich einigen Liebkosungen und erwiderte sie mit schüchterner Lüsternheit. Sobald er aber diese Grenzen überschreiten wollte, widersetzte sie sich ... vielleicht mehr aus Glauben an ein fremdes Gebot, als aus eigenem Gefühl von dem, was allenfalls erlaubt sei.« Aber es kommt der Moment, der das Mädchen nachgiebig zeigt. Doch im kritischen Augenblick entstürzen ihr Tränen, und Julius erschrickt heftig. Er kommt zur Besinnung. »Er dachte an alles, was vorhergegangen war, und was nun folgen würde; an das Opfer vor ihm und an das arme Schicksal der Menschen. Da überlief ihn ein kalter Schauer ...« Der Augenblick war versäumt. Er suchte nur das gute Kind zu trösten und »eilte mit Abscheu von dem Ort hinweg, wo er den Blütenkranz der Unschuld hatte mutwillig zerreißen wollen ...« Es kommen ihm aber doch Zweifel, ob er es da richtig gemacht hätte. »Indessen hielt er seine Dummheit doch für ausgezeichnet und interessant.« Aber das Mädchen schien mit dieser Dummheit unzufrieden. Darüber gerät Julius »in große Erbitterung«.
Nicht besser ergeht es ihm bei einer Koketten aus der Gesellschaft. Er kommt mit Hilfe von Freunden darauf, daß »sie es auch mit ihm nicht ehrlich meine«. Nun wandte er sich einem Mädchen zu, die er »so sehr als möglich allein zu besitzen strebte, obgleich er sie unter denen gefunden hatte, die beinah öffentlich sind ... Mitten im Stande der äußersten Verderbtheit zeigte sich eine Art von Charakter ... Nächst der Unabhängigkeit liebte sie nichts so unmäßig wie das Geld ... Dabei war sie billig gegen jeden, der nicht sehr reich war.« Den Wert dieses Mädchens erkennt Julius: »Darum hing sie auch mehr an ihm, als sich sagen läßt.« Aber er bleibt etwas geringschätzend, da sie ja doch eine Dirne ist. »Wie entrüstet war er daher, als sie ihm einst unerwarteterweise die Ehre der Vaterschaft ankündigte. Und er wußte es doch, daß sie trotz ihres Versprechens noch vor kurzem Besuche von einem andern angenommen hatte ... Aber sie brauchte mehr, als er geben konnte.« Das Mädchen ersticht sich verzweifelt, und Julius nimmt zur Erinnerung eine Locke. Wohlbereitet durch den nun folgenden Umgang mit den romantischen Damen, der Rahel, der Karoline Schlegel, der Dorothea Veit, lernt Julius endlich Lucinde kennen, die Künstlerin, in deren Armen er »seine Jugend wiederfindet. Die üppige Ausbildung ihres schönen Wuchses war für die Wut seiner Liebe und seiner Sinne reizender als der frische Reiz der Brüste und der Spiegel eines jungfräulichen Leibes. Die hinreißende Kraft und Wärme ihrer Umschließung war mehr als mädchenhaft; sie hatte einen Anhauch von Begeisterung und Tiefe, den nur eine Mutter haben kann. Wenn er sie im Zauberschein einer milden Dämmerung hingegossen sah ...«
Das Resultat dieser mit Aufwand erzählten Fadheiten und Plattitüden ist die magere Erkenntnis, daß »die Liebe für die weibliche Seele ein unteilbares, durchaus einfaches Gefühl ist, für den Mann nur ein Wechsel und eine Mischung von Leidenschaft, von Freundschaft und von Sinnlichkeit sein kann. Und Julius sah mit frohem Erstaunen, daß er ebenso unendlich geliebt werde, wie er liebe.«
Der sanfte Schleiermacher sah in der Lucinde – die den Jungdeutschen noch die Bibel der freien Liebe war – die nur zu lobende Zurückweisung einer Verleugnung der Sinne. Schlegel wollte aber mehr als diesen Bürgerschreck. Man lebte in gewissen Berliner Kreisen ganz unbekümmert und in nichts darin behindert den Sinnen, und eine Apologie wäre nicht nötig gewesen. Aber vielleicht ein System nach der romantischen Formel von der Identität von Leben und Poesie. Der große Hymnus auf die Sinnlichkeit war ja schon von Heinse im Ardinghello gesungen worden. Aber die romantische Formel, durch die Schlegel mit Worten, nach vor- und rückwärts zu lesen, die ganze Welt jagte, war zu schwächlich für ein System des Denkens, und die fehlende Geselligkeit einer noch nicht vorhandenen Nation – es existierten nur ein paar Zirkel, wo sich Adel und Schöngeister bei Frauen trafen – gab auch für einen Roman nichts her, in dem diese Formel Gestalt bekommen hätte. So wurde, unterstützt von der spezifischen künstlerischen Unbegabtheit und Phantasielosigkeit des kritischen Schlegel, aus beiden Ansätzen, dem denkerischen und dem künstlerischen, etwas hergestellt, das Lucinde genannt wurde. Genietet wurde schlecht und recht mit einem bißchen Frechheit, die verblüffen sollte. Und mit einer Ironie, die nichts verschonte außer sich selber. Diese Romantiker der Ironie waren gegen sich selber ja alle von einem tödlichen Ernst. Ein Spottvers traf das Produkt ins Schwarze:
Der Pedantismus bat die Phantasie Um einen Kuß; sie wies ihn an die Sünde; Frech, ohne Kraft umarmt er sie, Und sie genas von einem toten Kinde, Genannt Lucinde.
Nur mit der Sünde hat das Epigramm unrecht, das die Karoline ihrem Manne, es war gerade August Wilhelm Schlegel, mit erheiterter Zustimmung zitiert. Denn Karoline war, wie alle Frauen des Kreises, viel gescheiter als ihre respektiven Männer, wenn die auch alles taten, sie davon abzubringen. Wobei sie schließlich auch Erfolg hatten. Denn als sich die frühe Romantik in das in ihr von Anfang an beschlossene Idyll des Biedermeiers begab, da war es, daß ein Jungdeutscher klagte: »Das Unglück dieser Zeit – 1835 – ist, daß die Frauen so unendlich weit hinter den Männern zurückgeblieben sind. Man sagte uns, daß die Frauen nur da seien, uns von den Anstrengungen des öffentlichen Lebens angenehm zu erholen, oder wohl gar, daß sie die Ableiter unserer Leidenschaften wären, welche uns nur stören würden draußen in der Welt, wenn wir sie nicht tierisch befriedigten. So kam es, daß die Frauenherzen zusammenschrumpften. Ihre empfängliche Seele vertrocknete an kleinen Dingen; sie verstehn uns ja gar nicht mehr, unsere Ausdrücke nicht, unsern Stil, unsre Gedanken, unsre Interessen. Sie scheinen nur da zu sein, um durch ängstliche Rücksichten den Flug unsres Wesens niederzuhalten ... Ich rede von jenen, welche den ganzen Tag am Flügel sitzen, da Fra Diavolo singen und über die Krawattenschleife ihrer Tänzer beim gestrigen Ball nachdenken, von dieser Million allerliebster, aber ununterscheidbar ähnlicher chinesischer Chignonköpfe, welche vor Klavier, Tanz und Gesang nicht einmal dazu kommen, ihre Lieblingsschriftsteller Belani und Storch zu lesen, für welche die ganze klassische Literatur von ehemals und heute böhmische Dörfer sind ... Ihr begrüßt und küßt auch: Wie? Kamt ihr euch in diesem Augenblick neu und außerordentlich vor? Wußtet ihr, daß ihr unsterblich seid? Ach nein: Eure Weste ist heut nicht geschmackvoll, und die Mutter hat gezankt, daß Sie so lange blieben, mein Herr, und es wäre doch Zeit, auf die Promenade zu gehen.« Der jungdeutsche Verehrer der Lucinde, die er den Mädchen seiner Zeit empfiehlt, die »vom Strickzeug oder Höhe und Tiefe der Taille sprechen«, spricht von jener bessern Zeit, wo Berlin den »Ton der laxen Moral angab, als Sitz einer in der Wollust des Verwesens begriffenen Regierung, der Tummelplatz der Rouerie und Patronage und der große Venusberg leichter und raffinierter Sitten. Das Beispiel des Thrones heiligte jede Ausschweifung. Die Mode war revolutionär und griechisch genial, und der Enthusiasmus für Kunst und schöne Literatur kam hinzu, um für die kleinen Gewissensbisse Ersatz und geniale Entschuldigung zu geben ... Die Brust war sehr entblößt, die Kleider orientalisch weit und schwelgerisch geschnitten, einige Aspasien gaben reizende Teestunden, und die jungen Revolutionäre, Catilina Prinz Louis Ferdinand-Schmettau an der Spitze, liefen mit exzentrischen Redensarten aus einem Boudoir ins andere. Die Literatur war der Faden, an welchem sich allmählich statt der neuesten Rezension in den Horen die heiße und begehrliche Leidenschaft aufzog, welche nur einer Leiter bedurfte ... Schlegels Lucinde war der Ausdruck dessen, was man sich in einer verabredeten Stunde und bei Aufstellung eines wachsamen Kammermädchens nicht mehr versagte.«
Die kleine deutsche Gesellschaft, eben erst geworden, ohne Tradition, ohne Zentrum, das Beispiel hätte sein können, politisch verengt, sozial ungeordnet, religiös pietistisch aufgewachsen, bürgerlich regsam und beweglich, machte äußerste Anstrengungen, in kürzester Zeit ein verlorenes Jahrhundert nachzuholen. Sie mußte ihre Versittlichung von der Literatur beziehen, denn nur sie gab etwas. Dieser Gesellschaft war auch ein etwas romantisierter Crébillon noch nötig, und Schlegel gab die Mischung so gut er konnte, denn besser war ihm nicht gegeben. Er war am Erotischen nicht mehr als an den andern Realitäten beteiligt: es war ihm ein Anlaß oder Ausgangspunkt zum vermeintlich schöpferischen Genuß der eigenen Persönlichkeit. Wie man sich die Geliebte vorstellt, ist wichtiger, als wie sie ist. Was man an ihr findet, ist eignes Werk, sie hat kein Verdienst daran – »sie war nur der Anlaß«, wie Friedrich an seinen Bruder schreibt, der Anlaß für die unendlichen Möglichkeiten, welche allein die Freiheit der genialen Person garantieren. Praktisch wirkt sich das so aus, daß man ein Wort von Solger, der es vom Leben sagt, variierend sagen kann: man will nicht lieben, sondern vom Lieben schwatzen. Das unverpflichtende Gespräch ging über alles. Adam Müller, der sich für einen großen Staatsmann hielt, redete zwölf Reden über das Reden, und es ist seine beste Leistung. Man heiratete, trennte sich, heiratete wieder – bis man die geduldigste, nachsichtigste Freundin in der Frau gefunden hatte, die bewunderte und einiges verzieh. Es ist in allen diesen Frauentauschen dieser deutschen Romantiker nicht die Spur einer Leidenschaft: sie suchen nur das passende Komplement für ihre Passivität.
Die Lucinde hatte nicht Figur genug, um sich über das kleine Skandälchen des Tages zu behaupten. Und Julius, der ein bißchen provinzlerisch den Ton des Roué übertreibt, um in den Berliner Salons Wirkung zu tun, hatte keine brauchbare eindeutige Formel gefunden für das, was er als freie Liebe dozierte. Der Freund Schleiermacher, auch er wie Schlegel in Liebessorgen um die Frau eines andern Mannes, sprang ein mit Briefen zum Thema »gegen die Ehe«, wo »die Eheleute in gegenseitiger Verachtung voreinander leben, wo er in ihr nur ihr Geschlecht, sie in ihm seine bürgerliche Stellung, und beide in den Kindern ihr Machwerk und Eigentum erblicken«. Aber man hatte sich etwas zu viel vorgenommen, wollte in ein, zwei Jahren ein versäumtes Jahrhundert nachholen, glaubte, einige schöne Beispiele freier Frauen wie der Pauline Wiesel – Alexander von Humboldt ging zwölf Meilen zu Fuß, um sie zu sehen –, wie der Karoline Schlegel, weniger schön, aber geistig freier, wie der Rahel Varnhagen, der Dorothea Veit würden zusamt einem kleinen schlechten Buche genügen, der Nation klarzumachen, daß sie keine erotische Erziehung besitze, weil »ihre Männer von den Frauen Unschuld und Mangel an Bildung verlangten, wodurch die Frauen zur lächerlichsten Prüderie, zur Prätention der Unschuld ohne Unschuld gezwungen würden«. Man muß erinnern, daß die sittlichen Verurteiler der Lucinde die eifrigsten Leser des gerade viel übersetzten Crébillon und ähnlicher französischer Dinge waren, gar nichts gegen die Frivolität im Heimlichen hatten, aber sehr viel für die »Heiligkeit der Ehe« im Öffentlichen. Und diesen sagte nun der Prediger Schleiermacher, daß viele Versuche nötig seien, und daß, »wenn man drei, vier Paare zusammennähme, recht gute Ehen zustande kommen könnten, falls man sie tauschen ließe«. Es blieb dies auf den sehr kleinen Kreis der Romantiker beschränkt, und die Nation folgte ihrem Beispiel nicht. Vielleicht weil es in der Breite an den Frauen fehlte, welche die Mühe solchen Tausches lohnten. Vielleicht auch, weil es an den Männern fehlte, die imstande gewesen wären, Unterschiede wahrzunehmen. Das Erotische ist keine wesentliche Farbe im Charakter des protestantischen Deutschen. Er ist ein um der Fruchtbarkeit willen mehr ehelicher Typus, geneigt, sich des andern zu schämen, weshalb er es heimlich und mit schlechtem Gewissen tut. Man hört es auch in der Lucinde klopfen.
Chateaubriand: René
»Wir wollen selber Götter sein ...«: was stand dem aus religiöser und sozialer Bindung befreiten Individuum von 1800 im Wege, solches zu wollen? Ein kleiner Artillerieleutnant aus Korsika wird Kaiser der Franzosen und erobert Europa – jeder kann ein Kaiser sein und sein Europa erobern. Dieses Geschlecht, dem René angehört, der Held eines kleinen, unlesbar gewordenen Buches, in dem sich eine Epoche erkannte und daran bildete, dieses Geschlecht hat den stärksten, bedeutungsvollsten Satz der Liaisons Dangereuses im müden Blute: »On s'ennuie de tout, mon ange.« Prophetische Diagnose jener Gemütskrankheit, an der die Jugend der napoleonischen Zeit litt, die sie erlitt, abseits stehend, untauglich oder unwillentlich zum Soldaten, von Ehrgeiz zerfressen, eine Welt von Möglichkeiten offen sehend, aber ohne Kraft, sich in diese Welt zu stürzen. Da brach, der kaiserliche Adler flog vor ihm her, irgendein herrlich uniformierter Offizier auf drei Wochen Urlaub in die Stadt, es brauchte gar nicht der schöne Murat zu sein, selbst dem unansehnlichen Artillerieleutnant Henry Beyle gelang es – und der Uniformierte war ein Gott unter den Frauen, deren Nüstern sich blähten, um das Blut und den Schweiß dieser Männer zu schnüffeln. Und den Ruhm. Was hat man gegen diese Eroberer zu setzen? Was gegen den alles überklingenden Namen dieses Bonaparte, den Chateaubriand verächtlich, wie er meint, Buonaparte nennt und sich in demselben Jahre 1768 geboren sein läßt, um ihm darin gleich, wenn auch an Genie ein Jahr älter zu sein. Diese geistig von der Enzyklopädie genährte und ausgedörrte Generation hatte die Revolution gesehen und sah deren Sohn am außerordentlichen Werke. Über nichts als ihre Seele gebeugt in der Einsamkeit ihres frisch erworbenen Individualismus wird sie, das ist ihr Grundzug, schwermütig bis zur Todessehnsucht, steigert sich zur Genialität, um sich davon zu befreien, erliegt in jungen Jahren ihrer Erschöpfung: Lenz, Hölderlin, Novalis, Shelley, Keats, Byron, Kleist: alle sterben jung, weil sie jung alt werden. Die Überlebenden langweilen sich zu Tode, wenn sie sich nicht in die Kirche retten, ihrer melancholischen Langeweile damit ein pompöses Dekor geben wie Chateaubriand. In seinem einzigen heute noch lesbaren Buche, das charakteristischerweise die Memoiren aus dem Grabe sind, steht der wenige Jahre vor seinem Tode geschriebene Satz: »Ich glaube nicht mehr, weder an den Ruhm noch an die Zukunft, weder an die Macht noch an die Freiheit, weder an die Könige noch an die Völker. Ich hause allein in einem weitläufigen Appartement, wo ich mich langweile, und wo ich undeutlich irgendwas, ich weiß nicht was, erwarte, das ich nicht verlange, und das nie kommt. Ich lache gähnend über mich, ich gehe um neun schlafen. Ich bewundere meine Katze, die ihre Jungen wirft ... Je regarde passer à mes pieds ma dernière heure.« Das ist datiert 6. Juni 1841. Er hatte über siebenzig Jahre. Aber