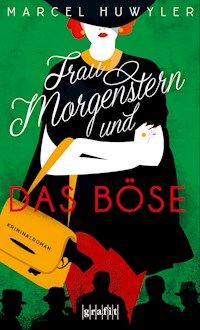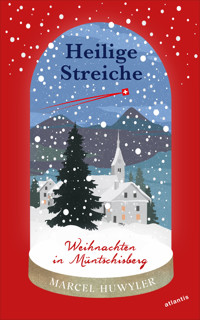12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Grafit Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Frau Morgenstern
- Sprache: Deutsch
Der siebte Streich von Nr.-1-Autor Marcel Huwyler! Eine so geniale wie irrwitzige Parodie auf das Agententhriller-Genre: die Erfolgsreihe um die kultige Auftragskillerin Violetta Morgenstern. Violetta Morgenstern, pensionierte Lehrerin und Auftragskillerin im Namen des Staates, hat ein neues Privatleben: Sie wohnt als Patchwork-Oma mit ihrem Kollegen Miguel Schlunegger und dessen Zwillingstöchtern zusammen. Zum Glück rettet sie ein neuer Auftrag vom Killerministerium »Tell« aus dem Familien-Chaos. Violetta und Miguel sollen einen Archäologen eliminieren. Der hat in Ägypten einen rätselhaften Fund gemacht, der die Geschichtsschreibung verändern könnte. Doch als die beiden zur Tat schreiten wollen, kommt ihnen ein Unbekannter zuvor ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2025 by GRAFIT in der Emons Verlag GmbH
Cäcilienstraße 48, D-50667 Köln
Internet: http://www.grafit.de
E-Mail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten
Dieses Werk wurde vermittelt von der
Verlagsagentur Lianne Kolf, München.
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, unter Verwendung der Bildmotive shutterstock.com/PanicAttac/Clash_Gene/CaptainMCity
Lektorat: Dr. Marion Heister
E-Book-Erstellung: Geethik Technologies Pvt Ltd
ISBN 978-3-98708-022-7
1. Auflage 2025
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Marcel Huwyler wurde 1968 in Merenschwand/Schweiz geboren. Als Journalist schrieb er viele Jahre Geschichten über seine Heimat und verfasste Reportagen aus aller Welt. Heute lebt er als freischaffender Romanautor an einem See in der Zentralschweiz.
www.marcelhuwyler.com
1
Drei Wochen zuvor
In der Grabkammer lag eine Schminktante.
Professor Gottlieb verwünschte erst die antiken Nilgötter – er tat dies im Geiste mit den grammatikalisch korrekten Hieroglyphen der alten Ägypter – und knurrte anschließend einen schweizerdeutschen Fluch.
Er war wütend, er war frustriert. Und ihm war viel zu heiß.
Aus einer der vielen Taschen seiner khakifarbenen Outdoorweste zupfte er ein Stofftaschentuch und wischte sich das Geschmier aus Schweiß und Wüstenstaub von der Denkerstirn. Selbst jetzt, im Dezember, wurde es tagsüber immer noch sehr warm. Die zwei Studentinnen und der einzige Student in seinem Team mochten dieses Wetter toll finden, zumal die Heimat jetzt bei Minustemperaturen im winterlichen Halbdunkel lag, den Professor jedoch quälte die Hitze nur. Er litt jedes Jahr mehr auf seinen Expeditionen. Die Grabungen schafften ihn, der Körper machte nicht mehr alles mit, und das ganze Drumherum nervte ihn von Mal zu Mal mehr. Archächzologie.
Ihm schon klar, warum: Er wurde alt und älter. Sein Eierkopf glänzte mittlerweile gänzlich kahl, war voller Pigmentstörungen (er vermied das Wort »Altersflecken«) und von den vielen Monaten unter der nordostafrikanischen Sonne mehr gesottenrot denn sportlichbraun.
Die Schminktante in der Grabkammer hatte einen Namen.
Nefer-Netuh.
So stand es gemeißelt. Mit den Fingerkuppen strich der Professor über die Keilschriftkerben der rötlichen Sandsteinplatte, die das Felsengrab wie eine überdimensionierte Haustür zusperrte.
Nefer-Netuh.
Gottlieb schloss für einen Moment die Augen und kostete das metaphysische Gruseln aus, das ihn auch nach über vier Jahrzehnten Forschung noch immer erfasste, wenn er Geschichte berührte. Und sie ihn.
Professor Dr. Werner Gottlieb hatte sich von dieser Expedition enorm viel erhofft. Obwohl das Unternehmen von Anfang an unter keinem günstigen Stern gestanden hatte. Zeit war Geld und Zeitreisen teuer – wusste niemand besser als die Archäologen. Doch der Kosten- und Termindruck heutzutage zermürbte viele altgediente Forschende. Die Leitung der Universität Helvetia hatte Gottlieb gerade mal vier Monate Ägypten bewilligt. Vier Monate. Ein Witz! Vier. Lausige. Monate. Bloß.
Wer die Vergangenheit eilig ausgrabe, begrabe die Zukunft des Wissens, hatte der Professor dem Uni-Präsidium ins Gewissen geredet, aber nur mitleidige Runzler geerntet sowie den zynischen Rat, es mit seinen antiquarischen Sprüchen doch besser an der Philosophischen Fakultät zu versuchen.
Längst vorbei die Zeiten, in denen Gottlieb mit einem zwanzig- oder gar dreißigköpfigen Team seiner Hochschule (zuzüglich einer halben Hundertschaft vor Ort angeheuerter ägyptischer Arbeiter, Quftis genannt) ein Jahr oder noch länger hatte Grabungen durchführen können.
Vier. Lausige. Monate. Bloß. Und trotzdem hatte sich der Professor von dieser Forschungsreise so einiges versprochen. Nach all den Entdeckungsreisen in seinem Archäologenleben hatte er einen siebten Sinn für solche Dinge entwickelt. Und beim aktuellen Projekt beschied ihm das Zwicken in den Eingeweiden, dass hier etwas Außerordentliches passieren könnte. Ja, doch, das hatte er tatsächlich geglaubt.
Und nun das. Nefer-Netuh. Eine Schminktante.
Wohlverstanden, er hatte ja nicht gleich den sensationellen Mumienfund eines Mitglieds einer Königsfamilie erwartet, aber ein ranghoher Beamter am Hofe des Pharaos lag doch im Bereich des Möglichen. Ein Wesir etwa oder ein Schatzhausvorsteher, meinetwegen auch ein Schreiber oder ein Siegler. Den Leibarzt der Herrscherfamilie hätte er mit Handkuss genommen, ein Hohepriester wäre auch ganz wundervoll gewesen.
Dass da aber jetzt in der Grabkammer bloß eine niedere Bedienstete liegen sollte, war für den Professor eine Riesenenttäuschung. Korrigendum – ein Desaster war’s.
Kam noch dazu, dass die Tote nicht einmal Palastdame gewesen war, auch keine Sängerin, Tänzerin oder Edelkonkubine, die sie alle bei Hofe ein gewisses Ansehen genossen hatten. Eine zweite Hieroglyphen-Zeile, direkt unter Nefer-Netuhs Namen, umschrieb ihre Funktion.
Die da Schönheit schenkt und Wohlgestaltetheit beschert zu Ehren Hathors.
Hathor war im Alten Ägypten unter anderem als Göttin der Schönheit verehrt worden. Die Tote im Grab war demnach eine Meisterin darin gewesen, Menschen von Stand und Rang in deren Aussehen zu verschönern. Eine Kosmetikerin, wie man heute sagen würde. Eine Visagistin, Beauty-Stylistin, Maniküristin, Podologin. Oder eben bloß eine Schminktante, wie der sonst so besonnene Gottlieb seinem Ärger jetzt lautstark Luft machte. Es war ihm gerade so was von schnurz, was sein Team und insbesondere die Jungstudenten von seinem Gefühlsausbruch hielten. Was für eine Schmach. Sein Gemüt zerbröselte gerade wie eine Mumie im Sandsturm.
Das elfköpfige Archäologen-Team aus der Schweiz – Ägyptologinnen, Grabungstechniker, wissenschaftliche Assistenten, Doktoranden und eben die drei Studenten – war im Frühherbst nach Ägypten gereist. Mit dem erklärten Ziel, in der sagenhaften versunkenen Pharaonenstadt Ar-En-Etapchon, westlich des Nils und nördlich von Theben gelegen, die Grabstätten uralter Herrscherfamilien zu finden und freizulegen. Professor Gottlieb war sich sicher, dass es sie gab und dass sie dort irgendwo in Felsenkammern lagen, unter Bergen von Sand verborgen. Eine Meinung, mit der er in der internationalen Fachwelt ziemlich allein dastand; die helvetische Expedition wurde von vielen Experten belächelt.
Vier Monate Entbehrungen, Hitze, Schmutz, zu fettiges Essen, ein hartes Nachtlager im Zelt, Dauertheater mit den ägyptischen Behörden, Schwärme von Aedes-Mücken und dann dieser Sand. Überall Sand, Sand, Sand. Als junger Abenteurer war ihm der egal gewesen, doch im Alter piesackte jedes Körnchen. Sogar in der Unterhose hatte der Professor Sand gefunden, ja selbst in seiner Rima ani – die Gesäßfalte war seit Monaten dauerwundgescheuert.
Und nun, nach all der Schinderei, lediglich eine Kosmetikerin. Immerhin musste diese Nefer-Netuh ihre Arbeit außerordentlich gut gemacht und Ägyptens Oberschicht von damals mit ihrer Kunst beeindruckt haben. Anders konnte Gottlieb es sich nicht erklären, dass ihr eine eigene Grabkammer dieser Größe gesponsert worden war.
Doch was bedeutete Gottliebs Nietenfund für seine Zukunft am Institut? Die Geldgeber zu Hause, die privaten Stiftungen, die Mäzene, aber allen voran die Direktion der Universität Helvetia sowie die Leitung des Instituts für Archäologische Wissenschaften, würden mit Sicherheit ernüchtert bis enttäuscht bis erzürnt sein. Und ganz bestimmt nicht länger bereit, weitere gottliebsche Expeditionen zu finanzieren. Tja, Herr Professor, da hat der legendäre Fluch des Pharaos nun wohl auch Sie erwischt.
Er stand vor einem Scherbenhaufen. Wobei: Scherben brachten mitunter Glück – wusste keiner besser als der Archäologe. Und das Blatt konnte sich ja so schnell wenden. Der britische Ägyptologe Howard Carter hatte fünf Jahre lang im buchstäblichen sandigen Nichts herumgestochert, ehe er 1922 im Tal der Könige das Grab von Pharao Tutanchamun fand und Weltruhm erlangte.
Dies hier war Gottliebs einunddreißigste Expedition. Womöglich die letzte. Nun gut, er ging ja auch bereits gegen Mitte sechzig. Und es gab genügend Anwärter auf seinen Posten. Er wusste, dass die Nummer zwei an seinem Lehrstuhl, Dr. Bickli, bei der Uni-Leitung bereits mehrfach diesbezüglich Andeutungen gemacht hatte. Dazu kamen die lieben Kollegen von ausländischen Universitäten, die mit einem besser bezahlten Job in der Schweiz liebäugelten. Tja, die Nachfolger waren längst da, wenngleich sie sich noch nicht offen zeigten. Sie lauerten wie Schakale in einer mondlosen Nacht in der Arabischen Wüste.
Gottlieb war müde, musste er selbst zugeben. Vierzig Jahre Feldarbeit unter sengender Sonne, in triefenden Regenwäldern und von Eiswinden erstarrten Steppen hatten Spuren hinterlassen. Seine Gelenke knarzten, das Herz pumpte hektischer und stolperte dann und wann, und das Heimweh stellte sich massiv früher ein als in jungen Indiana-Jones-Jahren. Zu dick war er auch. Die Grabung hier wollte er noch anständig zu Ende führen – heute war ihr viertletzter Tag –, und dann nichts wie heim. Die Festtage standen bevor.
Eine warme Vorfreude erfasste ihn, wenn er jetzt daran dachte, wie er Weihnachten bei sich zu Hause vor dem offenen Kamin sitzen würde. Mit einer Flasche sündsüffigem zwölfjährigen Lagavulin aus Schottland, einer dicken Cihoba und einem noch dickeren Sammelband von Dickens.
Sein Sekretariat hatte ihm in einer E-Mail mitgeteilt, sie hätten daheim seit Wochen Minusgrade und Unmengen Schnee, wie seit Menschengedenken nicht mehr. Gottlieb mochte Schnee. Und Gottlieb freute sich. Ja, doch, Sternefoifi, musste er zugeben – er sehnte sich nach seinem Institut, seinem Büro, der Studierstille darin und dem Duftmix aus Staub, Linoleumboden und dem vanilligen Leim antiquarischer Bücherrücken. Er vermisste die überquellenden Regale voller Geschichtsfolianten, seinen Schreibtisch (einen massiven, klassischen Chesterfield), den durchgesessenen Sessel und dann natürlich die Denkarbeit bis tief in alle Nacht hinein.
Ja, er vermisste sogar den obligaten Mitternachtstee, den er mit den Raumpflegerinnen zu trinken pflegte.
Letzteres war so ein Spleen von ihm, eine Schabernackerei bloß, aber noch ganz amüsant. Eine Gruppe von sieben Frauen putzte werknachts die Räumlichkeiten der Universität und kam auf ihrer Tour immer exakt zur gleichen Zeit – um zehn vor zwölf – in Gottliebs Institut vorbei. Der Herr Professor und die Damen (der Großteil von ihnen aus weit südlicheren Ländern stammend, alle mit blau-weißem Überwurfkasack bekleidet, einen Reinigungstrolley vor sich herschiebend) machten gemeinsam Pause, tranken eine Tasse marokkanischen Verveine-Tee, den Gottlieb von einer Tagung in Marrakesch mitgebracht hatte, und plauderten ein Viertelstündchen, ehe alle ihre Arbeit wieder aufnahmen.
Eine der Frauen – die einzige Schweizerin im Putzteam, vom Alter her vielleicht halb so alt wie er – mochte Gottlieb besonders gern. Weil sie Grips und Witz hatte, erstaunlich belesen war, sich für alte Geschichte interessierte und deswegen des Professors Forschung faszinierend fand, was ihn wiederum mit großer Freude erfüllte. Manchmal zeigte er ihr, woran er gerade arbeitete, legte ihr vieltausendjährige Artefakte in die Hand – »Spüren Sie diesen Zauber der Historie, meine Liebe?« – oder erzählte ihr von seinen Grabungsabenteuern, als er noch ein junger Historyjäger gewesen war. Und so war in all der Zeit … ja, doch, eine Art Freundschaft zwischen dem Professor und der Putzfrau entstanden – Putzfee, wie er sie manchmal in seinen Gedanken nannte. Alles rein reingeistiger Natur, wohlverstanden. Für Gottlieb hatte dieses Mitternachtsmiteinander etwas Väterliches an sich; die junge Frau allerdings, so befürchtete er, würde es wohl eher als Großväterlich bezeichnen.
Am folgenden Morgen, eine Stunde nach Sonnenaufgang, öffneten sie das Grab von Nefer-Netuh.
Professor Gottlieb wies die beiden Studentinnen an, jeden Arbeitsschritt mit Fotoapparat und Videokamera zu dokumentieren. Mit Hilfe von leichtem, hydraulischem Gerät stemmten sie die Steintür zur Seite – und blickten zu ihrer Verwunderung in eine kinderzimmergroße Vorkammer. Diese Grabstätte war größer und verwinkelter angelegt als vermutet. Nicht einfach nur eine Kammer, sondern eine Grabanlage.
So viel Aufwand und Ehrerbietung für eine niedere Bedienstete? Nefer-Netuh musste demnach über außerordentliches Können und somit großes Ansehen verfügt haben.
Sie schalteten ihre Stirnlampen ein und betraten die Vorkammer. Die Steinwände waren glatt behauen, aber ohne Verzierungen oder Schriftzeichen. Der Zugang zum eigentlichen Grab war bloß noch kindshoch – sie würden auf Knien hindurchrutschen müssen – und wiederum mit einer senkrechten Steinplatte verschlossen.
Unversehens hob Gottlieb die rechte Hand, wie der Anführer eines Soldaten-Trupps, der sofortigen Halt und Deckung befahl. Dann deutete er auf das Siegel an der Grabtür, drehte sich um und schaute seine Teammitglieder mit weit aufgerissenen Augen an. Sehen Sie, was ich sehe?
Das Siegel der Steintür war unversehrt. Was bedeutete, dass kein Mensch diese Ruhestätte betreten hatte, seit Nefer-Netuh zu Grabe getragen worden war. Das war doch endlich mal eine gute Nachricht! Ein ungebrochenes Siegel an einem Grab gab es äußerst selten und kam in Archäologenkreisen einem Lottosechser gleich. Meist waren antike oder moderne Grabräuber nämlich schneller gewesen als die Totenruhwächter von damals oder die Geschichtsgelehrten von heute und hatten die Stätte geplündert, geschändet und nicht selten gar verwüstet, um ihre Spuren zu verwischen.
Darum war dieser Ort hier ein Glücksfall. Der Professor schöpfte plötzlich wieder Hoffnung. Vielleicht würde die Entdeckung eines gänzlich jungfräulichen Grabes seine Expedition doch noch retten, die Geldgeber daheim entzücken, die Uni-Direktion verhalten euphorisch stimmen – und seine Karriere noch ein wenig verlängern.
Nach anfänglichem Zögern sowie einer Andachtsminute – »Kolleginnen, Kollegen, es handelt sich auch nach Jahrtausenden immer noch um einen bestatteten Menschen; begegnen wir ihm pietätvoll und mit angemessener Würde« – brach Gottlieb das Siegel. Sie hievten den Eingangsstein beiseite und spürten kühle Luft auf ihren erhitzten Gesichtern. Gottlieb fiel auf die Knie und rutschte mit eingezogenen Schultern und tief geneigtem Haupt durch den niedrigen Eingang. Als würde er sich vor einer Heiligkeit in den Staub werfen. Oder in die Hundehütte eines Bernhardiners kriechen. Sein Team folgte ihm ebenfalls auf Knien.
Der Raum war ein Meisterwerk, die Pracht atemberaubend. Sie starrten alle nur und sprachen kein Wort; noch wagte niemand, diese sakrale Opulenz mit wissenschaftlichen Begriffen zu entweihen. Die Grabkammer war ungefähr zehn auf zehn Meter groß und an die drei Meter hoch. Die glatt geschliffenen Steinwände waren mit Kalk geschlämmt und mit Ornamenten, Hieroglyphenbändern und Malereien verziert. Die Farben – das Blau vom Lapislazuli, das Grün vom Malachit sowie Rot und Gelb aus Ockermineralien gewonnen – leuchteten im Schein der Stirnlampen, als seien sie eben erst frisch aufgepinselt worden. Die Art der Darstellungen und die Schriftzeichen, das erkannte des Professors geschultes Auge sofort, deuteten auf eine Zeit um Christi Geburt hin, die Endphase der Pharaonenzeit, Ägyptens Ptolemäerepoche, »die Moderne der Antike«, wie der Professor in Vorlesungen gern klugjuxte.
Nefer-Netuh hatte folglich vor zweitausend Jahren gelebt.
Gottlieb sträubten sich die Nackenhaare, die Brust wurde ihm eng und klamm. Wie viele solcher Kammern hatte er in seinem Gelehrtenleben schon betreten? Und doch fühlte er sich in diesen Momenten noch immer wie ein Grabschänder. Störer der Totenruhe. Die Frage beschäftigte ihn schon seine ganze Karriere lang: Wie viele Jahrtausende alt musste ein toter Körper sein, bis er gänzlich entmenschlicht, entseelt und bloßes Wissenschaftsobjekt war? Nur mehr Mumie denn Mensch? Nie. Niemals. Das spürte er jetzt und hier einmal mehr ganz deutlich. Eine heilige Hitze durchflutete ihn. Andachtslava. Nefer-Netuh, bitte verzeih!
Gottlieb stemmte sich vom Boden hoch, drückte sein Rückgrat durch, nickte seinem Team zu und wies Videofilmerin und Fotografin an, den weißen Sandboden vor ihnen zu dokumentieren.
»Sehen Sie die vielen feinen, parallel und gleichmäßig verlaufenden Linien im Sand?« Und ohne eine Antwort abzuwarten: »Die stammen von Palmwedeln. Damit haben die Bestatter beim Verlassen der Grabkammer hinter sich ihre Fußspuren verwischt. Nichts Irdisches mehr sollte hier drin das Ankommen der Totengötter stören.«
Exakt in der Mitte des Raums stand der Sarkophag von Nefer-Netuh. Er war eher grob aus Basalt gehauen, erstaunlich schmal und kurz, in blassem Blau und Grün bemalt und hatte andeutungsweise die Form einer Frau mit verschränkten Armen. Die Kosmetikerin musste eher klein von Wuchs gewesen sein, etwa so wie eine heutige Viertklässlerin.
Sie hoben den Sargdeckel an – er war weniger schwer als gedacht – und setzten ihn vorsichtig auf dem Boden ab.
Nefer-Netuh. Hier bist du.
Im Sarkophag lagen nur Knochen.
Professor Gottlieb sog scharf die Luft ein und knurrte sie wieder aus. Dann beugte er sich über den Steinsarg und begutachtete das Skelett. Die Knochen lagen so ordentlich da, als wären sie in der Rechtsmedizin sortiert und aufgereiht worden.
»Ganz eindeutig eine Frau, das sehen Sie an der Form des Beckens«, sagte er so leise zu seinen Kollegen, als würden sie sich um eine Schlafende scharen.
Hier war keine Gewalt angewandt worden, die Knochen wiesen keinerlei Verletzungen oder gar Brüche post mortem auf; niemand hatte demzufolge die Totenruhe gestört. Es musste wohl etwas bei der Mumifizierung schiefgelaufen sein. Oder irgendwann im Laufe der zwei Jahrtausende war zu viel Feuchtigkeit in den Sarkophag eingedrungen und hatte den Verwesungsprozess ausgelöst.
Das war’s dann wohl gewesen. Gottlieb verabschiedete sich innerlich gerade von seiner prächtigen Mumie. Keine wissenschaftliche Sensation, nichts hyperhistorisch Herzeigbares, womit man die Fachwelt hätte beeindrucken können. Oder seine Chefs daheim. Der Professor sah sich im Geiste bereits die ihm nahegelegte Frühpensionierung einreichen und sein Büro räumen. Gut möglich, dass er sein Häuschen in der Vorstadt verkaufen und in etwas Kleineres, Günstigeres umziehen müsste. Seine Eltern hatten ihn ja schon immer gewarnt; Architekt hätte der Filius werden sollen, oder Bankier oder Anwalt. Aber doch nicht Historiker. Das sei bloß ein Tummelfeld für zurückgebliebene Ewiggestrige, hatte die Mama ihrem einzigen Sohn eingebläut. Und als der sich später trotzdem dem Spezialgebiet Archäologie verschrieb, nannte sein Vater es »im Dreck wühlen«.
Im Sarkophag lagen Grabbeigaben. Wenigstens das. Filigrane Schmuckstücke wie Ringe und Armspangen, eine Halskette aus länglichen Amethystperlen sowie zwei Kupferspiegel mit lotusförmigen Griffen. Nefer-Netuhs Schädel – als wär’s ihr Heiligenschein – wurde von farbigen Steinen umkränzt: Lapislazuli, Karneol und grünmilchige Quarze. Beidseits des Skeletts standen kleine, intakte, zugepfropfte Tongefäße, in denen entweder die Innereien der Toten lagen (eine übliche Mumifizierungs-Prozedur der alten Ägypter) oder feine Salböle, die man Nefer-Netuh auf ihrem Weg ins Jenseits mitgegeben hatte.
Und dann machten sie eine Entdeckung, die das Leben aller Anwesenden für immer verändern sollte. Und schon bald beenden.
Da lag ein zusammengerollter Papyrus.
Exakt zwischen den Oberschenkelknochen der Toten platziert, als wäre es die Verlängerung ihres Rückgrats. Das Schriftstück hatte etwa die Maße eines Hochglanz-Wochenmagazins.
Die Teammitglieder starrten ihren Professor auf eine Weise an, als wenn der längst wüsste, was sie hier vor sich hatten. Obwohl Gottliebs Herzschlagfrequenz sich verdoppelte, bemühte er sich um einen unbekümmerten Ton – »Wollen mal schauen, was uns da beschert wird« –, zupfte hellblaue Latexhandschuhe aus einer Tasche seiner Outdoor-Weste und streifte sie sich über. Behutsam schob er erst die eine, dann die andere Hand unter den Papyrus und hob ihn wenige Millimeter hoch. Bei solchen Artefakten wusste man nie: Entweder waren sie nach all den Jahrtausenden noch wie neu und geschmeidig, oder sie zerstaubten bei der geringsten Berührung.
Das Stück hier schien in stabilem Zustand zu sein. Gottlieb hievte die Rolle langsam und mit Gabelstaplerarmen aus dem Steinsarg, als würde er einer Frischentbundenen ihr Frühchen reichen. Nachdem er den Papyrus auf dem husch sauber gepusteten Sargdeckel abgesetzt hatte, rollte er ihn Zentimeter für Zentimeter auseinander, bis das Dokument in seiner ganzen Länge und Herrlichkeit vor ihnen lag.
Es war etwa so groß wie ein Jassteppich, und seine Färbung erinnerte an Kanalisationswasser; als hätte jemand Grüntee über ein Blatt feinstes Sandschleifpapier gekippt. Deutlich zu erkennen die vielen sich überlappenden, überkreuzenden Streifen, aus dem Mark des Cyperus papyrus gewonnen, geschnitten, geklopft und flach gepresst. Vor zweitausend Jahren hatte ein Schreiber mit Rußtinte und einem Binsengriffel oder Schilfrohr in der Hand auf den Papyrus geschrieben. Hieroglyphe für Hieroglyphe. Mit beeindruckender Klein-, Klar- und Sicherheit, nicht ein einziger Verzitterer oder Klecks war zu sehen.
Das Team scharte sich dicht um den Professor, wie Kinder an Weihnachten, wenn der Vater das Familiengeschenk der vermögenden Tante mit feierlichem Gehabe aufmachte.
Ohne den Papyrus zu berühren, bewegte der Professor den Zeigefinger langsam über die bildhaften Schriftzeichen und übersetzte laut.
Die Königin spricht. Siehe, ich will dich loben und preisen. Höre, ich tue es aus Liebe zu dir mit folgenden Worten: O, meine angesehene Dienerin, die du wie keine andere die Schönheit der Götter mir hast zuteilwerden lassen. Mit jedem Auftrag, den du ausführtest, hast du mein Herz gestillt. Nimm nun mit deine Weisheiten, Geheimnisse und Rezepte auf die andere Seite des sandigen Flusses. Deine Königin trauert. Ich bin es, die genannt wird die …«
Gottlieb stoppte die Übersetzung mitten im Satz. Sein Zeigefinger verharrte über dem Ende der Textstelle. Die ganze Hand begann zu zittern. Mit offenem Mund schaute er hoch in die Gesichter seiner Teammitglieder, als fände er auf deren Stirn die angemessenen Worte geschrieben.
»Die hier …« Seine Stimme heiserte. »Diese Zeichenfolge«, er räusperte sich, »dürfte Ihnen allen wohlbekannt sein.«
Er deutete auf die Unterschrift der Verfasserin, obgenannte Königin, die diesen Text, einen Nachruf, ihrem Hofschreiber in Auftrag gegeben oder ihm womöglich gar selbst diktiert hatte.
Da stand das Hieroglyphenzeichen für »Abhang«, dem heutigen Q oder K ähnlich. Dann der ruhende Löwe, das Schilfblatt, ein aufgerolltes Seil, der Hocker, zweimal auf der gleichen Zeile der Greifvogel sowie ein Brotlaib, eine Hand, ein stilisierter Mund …
In den Köpfen der Teammitglieder fügten sich die Zeichen zu einem Wort zusammen. Einem Namen. Dem Namen.
Kleopatra.
Die Tote im Steinsarg, Nefer-Netuh, war die persönliche Kosmetikerin der berühmtesten Königin Ägyptens gewesen. Pharaonin Kleopatra hatte von 69 bis 30 vor Christus gelebt und galt damals wie heute als Inbegriff von Schönheit, Betörung und Verführungskunst. Kleopatra war ein Superstar der Geschichte. Eine Diva auf der Weltbühne. Der Promi im Altertum. Und um ihre Nase und ihren Männerverschleiß rankten sich Legenden.
Professor Gottlieb stützte sich mit beiden Händen auf dem Sargdeckel ab und senkte den Kopf. Ihm war schwindlig. Und diesmal lag es nicht an der Hitze. Das hier … war nicht mehr und nicht weniger als eine Weltsensation.
»Liebe Kolleginnen und Kollegen.« Er blickte feierlich in die Runde. Die Lichter von zehn Stirnlampen bündelten sich auf seinem verschwitzen Kahlschädel. »Sie werden gerade Zeugen einer epochalen Entdeckung. Sie sind mit dabei, wenn Geschichte geschrieben wird. Wir schreiben hier eben Geschichte. Genießen Sie den Moment. Sie werden Ihr Leben lang daran denken.«
Da stand noch so viel mehr geschrieben, der ganze Papyrus war dicht und bis an die Ränder mit Zeichen gefüllt. Mit fiebrigem Blick überflog Gottlieb den Text; er wollte sich hier und jetzt bloß einen Gesamtüberblick des Inhalts verschaffen. Er würde das alles später im Institut und unter besseren, ruhigeren und vor allem clean-wissenschaftlicheren Bedingungen entschlüsseln und übersetzen. Am liebsten hätte er morgen schon damit begonnen. Er mochte nicht warten. Er glühte. Der längst eingemottet geglaubte Indiana Jones in ihm war plötzlich zurück.
Jetzt konnte Gottlieb es gar nicht erwarten, endlich nach Hause zu kommen und sich unverzüglich an die Arbeit zu machen. Weiße Weihnachten, das süße Nichtstun vor dem Kamin, Dickens, Zigarre und Edelschotte mussten warten. Das hier war jetzt viel wichtiger, dringender, großartiger. Die Welt wartete auf Professor Gottliebs neue Geschichtsschreibung.
Jetzt war ihm so einiges klar. Nefer-Netuh musste Kleopatras uneingeschränktes Vertrauen genossen haben. Das erklärte auch dieses prächtige Grabmal. Wer sich bei der Körperpflege so nah kam wie die Kosmetikerin und ihre Königin, redete doch auch über anderes, Privates, Intimes. Geheimes gar? Gottlieb kannte das aus eigener Erfahrung. Ab und zu ließ er sich im Barbershop rasieren und staunte jedes Mal, über was für vertrauliche Dinge er sich mit dem Frisör unterhielt. Gut vorstellbar also, dass Nefer-Netuh für ihre Pharaonin viel mehr als nur Verschönerungsdienerin gewesen war. Nämlich Vertraute, Freundin, Gefährtin. Persönliche Beraterin? Womöglich gar in politischen Dingen? Mussten Teile der altägyptischen Herrschergeschichte jetzt umgeschrieben werden? Wegen Nefer-Netuh? Wegen dieses Fundes? Also im Grunde … wegen mir?, überlegte Gottlieb und konnte sich einen zufriedenen Grunzer nicht verkneifen.
Er machte Anstalten, den Papyrus in seine ursprüngliche Form zurückzurollen, als sein Blick mehr zufällig über eine Passage am unteren Blattrand huschte. Er stutzte, schaute genauer, starrte schließlich. Entzifferte, was da stand, dann wieder und nochmals und ein weiteres Mal, um jeglichen Übersetzungsfehler auszuschließen. Er legte sich die Hand auf die Brust und spürte darunter den Herzschlag, als tobe da ein angeschossenes Tier.
Dann wies er eine Kollegin an, Expertin für altägyptische Sprache, die Textstelle zu übersetzen. Sie kam zum gleichen Schluss, wie er. »Aber, Professor, das würde ja bedeuten …«
»Ja, genau das bedeutet es, meine Liebe.« Gottlieb legte die gekreuzten Hände auf seinen Kahlkopf. Entsetzt. Er fühlte sich, als wäre er gegen eine unsichtbare Wand gelaufen. »Meine Güte, es ist einfach unglaublich. Das hier stellt alles auf den Kopf, was wir geglaubt haben zu wissen.«
Er fixierte jedes seiner Teammitglieder der Reihe nach, wie ein Lehrer, der denjenigen suchte, der den Streich ausgeheckt hatte. Sein Blick oszillierte zwischen Unglaube, Fassungslosigkeit und Ärger. »Ist Ihnen allen eigentlich bewusst, welche Sprengkraft diese Textpassage hat? Was Kleopatras Worte für Konsequenzen haben werden? Und nicht nur in der Fachwelt, sondern bei allen Menschen, und zwar global.« Und nach einer halben Minute bleischwerstiller Ewigkeit. »Es verändert einfach alles. Das wird international ganz groß Schlagzeilen machen.«
»Und was passiert jetzt bei uns daheim?«, fragte die Studentin mit der Videokamera. Sie schaute den Professor an, als stünde sie kurz davor loszuheulen.
»Für unser Land …«, antwortete Gottlieb und verzog das Gesicht zu einem bitteren Lächeln. »Für die Schweiz wird eine Welt zusammenbrechen.«
2
Operation Frozen startete Punkt drei Uhr nachmittags, mitteleuropäischer Zeit. In der Sprache der Kämpfer: um fünfzehnhundert MEZ.
Perfekt aufeinander abgestimmtes Timing sei nebst Kommunikation, präziser Feuerkraft und schnellem Stellungswechsel eines der wichtigsten Elemente, die zum Sieg über den Gegner führen würden, hatte der Kommandeur seinem Team immer und immer wieder eingetrichtert. »Und, hey, Leute, nützt die natürlichen Gegebenheiten von Gelände und Wohnregionen in der Combat Zone: Bäume, Kuppen, Schuppen und Häuserzeilen bieten euch Deckung. Jetzt könnt ihr beweisen, was ihr bei mir gelernt habt.«
Das hier würde hart werden. Der Kommandeur machte sich keine Illusionen. UOs, so hatten es damals seine amerikanischen Vorgesetzten im Irakkrieg genannt: Urban Operations meinte den Kampf in dicht bebautem, urbanem Gelände. Etwas vom Schwierigsten und Gefährlichsten für infanteristische Einheiten. Bei UOs waren Verluste vorprogrammiert. Und meistens hoch.
War lange her, dass Miguel Schlunegger einen Stoßtrupp kommandiert hatte. Zuletzt vor über zwanzig Jahren in der irakischen Stadt Falludscha. Als Söldner der privaten US-Sicherheitsfirma Yellowsky hatte er als einziger Schweizer im Kampfteam – our cheese sniper, wie seine Kumpels ihren Shootingstar seiner Herkunft und Scharfschützenkünste wegen nannten – zweieinhalb Jahre lang gedient. Im Nachgang zum Dritten Golfkrieg, der zum Sturz von Saddam Hussein geführt hatte, unterstützte Yellowsky die US-Streitkräfte auf operationeller und logistischer Basis. Gut verdienende Privatsoldaten wie Schlunegger bewachten vor Ort Einrichtungen wie Militärcamps, Botschaften, Flughäfen, Kraftwerke oder Öllager. Ab und zu wurden auch Einsätze im Bereich Personenschutz verlangt, Bodyguard-Dienste für amerikanische, europäische und UN-Diplomaten, Politiker und Geschäftsleute.
Damals, bei einer Operation in Falludscha, hatte Schlunegger letztmals einen Trupp im Quartier- und Häuserkampf befehligt und selbst angeführt. Ein Höllenjob. Weil absolut chaotisch, was die Aufklärung anbelangte. In solcherlei Gefechtssituationen war selten klar, wer Aufständischer und wer Zivilist war.
Im Zweifelsfalle schoss man. Man hatte eigentlich immer Zweifel.
»Elsa-1 an Elsa-2, bitte kommen.« Miguel raunte in das Mikro des Headsets. Seine Leute waren mit Sprechfunk ausgerüstet.
Nur eine Sekunde später empfing er die Antwort im Ohrstecker. »Hier Elsa-2. Bin in Position.«
»Copy that, Elsa-2. Alles klar bei dir?«
»Mir ist kalt.«
Schlunegger warf den Kopf in den Nacken und schickte einen stillen Fluch zum Heiligen Kanonenrohr, dem Schutzpatron aller Schönwettersoldaten, Hosenvollkrieger und Mündungsmemmen. Sein Team war ein Haufen Weicheier. Aber was wollte er machen? Er hatte nun mal nur dieses Personal zur Verfügung.
So ein Kampf im Stoßtruppverfahren erforderte eine intensive Ausbildung und hohe körperliche Leistungsfähigkeit. Darum war das drillmäßige Beherrschen von Standardsituationen überlebenswichtig. Dies hier war eine schier unmögliche Mission, weil seine Leute über nur wenig Combat Power verfügten, das war Schlunegger bereits in der Rekrutierungsphase klar geworden. Normalerweise beinhaltete das Ausbildungsprogramm von Frischkriegerlingen eine Menge Kampftaktik, Waffenhandhabung, Informationsbeschaffung, Überlebenstechniken – und wenn nötig auch mal ideologische Indoktrination. Doch angesichts dieser blutigen Anfänger hier hatte Schlunegger beschlossen, auf eine banale wie brachiale Hit-and-run-Taktik zu setzen. Zuschlagen und davonrennen.
Vielleicht käme ja sogar einer aus seinem Team lebend wieder zurück.
Er funkte den nächsten Kämpfer an: »Elsa-1 an Elsa-3, kommen.«
»Hier Elsa-3. Gib mir noch eine Minute, dann bin ich in meiner Deckung.«
»Warum geht das nicht schneller, Elsa-3? Du bist über der Zeit, verdam…« Im letzten Moment verkniff Schlunegger sich den Fluch. Durfte er sich hier unter keinen Umständen erlauben.
Kurz darauf raschelte es erneut in seinem Ohr: »Elsa-3 an Elsa-1. Jetzt bin ich in Position.«
»Positiv, Elsa-3. Hast du schon Feindkontakt? Siehst du etwas?«
»Nein, ich …«
»Das heißt ›negativ‹, nicht ›nein‹. Wie oft haben wir jetzt das trainiert?«
»Entschuldige, Elsa-1. Äh, also, nein … negativ, die anderen sind noch nicht in Sicht.«
Miguel ächzte im Geiste – »die anderen« … Warum nicht gleich ein putziger Kosename für den Gegner? Herrgott, warum plagte er sich mit solch einer Laientruppe herum? Er zog seinen Wollhandschuh aus, schob den Ärmel der Daunenjacke zurück und schaute auf die Armbanduhr. Schon sieben nach drei. Fünfzehnnullsieben. Wo blieb der Feind?
Zugegeben, es war schweinekalt heute. Weit unter null, dazu nasennagender, wangenstechender Biswind. Und seine Zehen ameiselten. Wer sagte denn, dass in der Hölle immer nur Hitze herrschen musste?
Fast wünschte sich Schlunegger das Klima im Irak zurück. Furztrockene Wärme, Staubsonne, Wüstenwetter. Wobei … Einmal, im August, in der Nähe von Basra war das gewesen, hatten sie achtundvierzig Grad gemessen. Einer von Miguels Kollegen hatte auf der mit hochballistischem Stahl gepanzerten Motorhaube ihres Humvees Spiegeleier gebraten. Ja, der Irak …
Selbst wenn Schlunegger jetzt hier im Schnee nur eine Sekunde daran dachte, hatte er alles schlagartig wieder präsent. Sämtliche Erinnerungen. Inklusive der Düfte. Der Sand und Staub, der nach dem würzigen Am-Imsaruk-Strauch duftende Steppenwind, der frische Farbanstrich an den Campbaracken, das Chlor im Trinkwasser, die Abgase im Fuhrpark von all den Humvees, Lkws und MRAPs. Und dann der typische Gefechtsgeruchsmix aus abgefeuerten Hülsen, Nitropulver und heißem Waffenöl. Ein Bouquet wie in einer Silvesternacht – einfach plus noch dem süßlich-kupfrigem Geruch von frischem Blut. Alles – Peng! – jetzt unversehens wieder da, in Miguels Kopf, als wäre es erst gestern gewesen.
Er konsultierte abermals seine Armbanduhr. Bereits elf nach drei. Fünfzehnelf. Wo blieb der Feind?
Sie hatten das doch gestern so vereinbart. Schlacht im Garten um Punkt drei. Das war mit dem gegnerischen Heerführer so abgesprochen. Ehrenwort unter Kommandeuren. Feldherren. Und Vätern.
In Schluneggers Ohrhörer knackte es. »Elsa-2 an Elsa-1.«
»Ich höre, Elsa-2.«
»Ich habe kalte Hände.«
Wieder verkniff er sich einen Fluch. »Äh … Handschuhe?«
»Hab ich ausgezogen, um bessere Munition machen zu können.«
Miguel stöhnte und blies dabei eine dicke Atemwolke aus. Minus acht Grad hatte das Thermometer vorhin beim Gartensitzplatz an der Wand neben dem Vogelhäuschen angezeigt. Er antwortete: »Dann machst du jetzt halt schnell deine Munition fertig und ziehst dir dann die Handschuhe wieder an. Verstanden?«
»Verstanden, Elsa-1. Wie viele Geschosse soll ich machen?«
»Herrg…« Wieder der Verkniffbiss auf die Unterlippe. Kein Gefluche, Schlunegger, rügte er sich selbst. Wäre pädagogisch ganz falsch, unsensibel, er war schließlich Vorbild – weil Erzieher. »Mach mal zehn Stück«, raunte er ins Mikrofon. »Nicht zu groß, aber dafür fest und hart. Schneebälle dürfen ruhig ein wenig eisig sein.«
»Elsa-3 an Elsa-1. Sie kommen!«
Jetzt war Schlunegger hellwach. »Elsa-1 an Elsa-3. Wo erfolgt der Angriff?«
Anstelle einer Antwort hörte Miguel mehrstimmiges Gebrüll aus dem Feindesland. Sie kamen. Griffen an. Die Nachbarbarbarenbande. Diese Hubers.
Miguel hatte sich bei den Vorbereitungen zu Operation Frozen von Anfang an für eine klassische »Feuer-und-Bewegungs-Strategie« entschieden. Die Deckungsgruppe hält hierbei den Feind durch gezielte Schüsse nieder, während die Sturmgruppe aus der Deckung losstürmt und angreift. Banal, aber effektiv, millionenfach in Kriegen bewährt, quasi das Einmaleins des militärischen Gefechtsdienstes, uralte Kombattantenweisheit. Schon ums Jahr 600 herum hatte der oströmische Kaiser Maurikios exakt diese Taktik in seinem Strategikon, einem spätantiken Militärhandbuch, erläutert.
Darum auch heute hier im verschneiten Garten: »Feuer-und-Bewegungs-Strategie«. Etwas anderes würde auch gar nicht funktionieren, Team Schlunegger besaß nämlich weder Unterstützung aus der Luft noch leichte oder schwere Artillerie, geschweige denn Panzer.
Und … Sie waren bloß zu dritt.
Der Gegner hatte einen Kämpfer mehr. Drei Schluneggers gegen vier Hubers. Zudem waren die Huberlinge im Durchschnitt vierzehn Monate älter als Miguels Streiter. Schwierig. Aber nicht unmöglich. Was Miguels Leuten an Anzahl und Lebensjahren fehlte, machten sie dadurch wieder wett, dass er als Kommandant militärisch um Welten besser geschult war (und über Irak-Ernsteinsatz-Erfahrung verfügte) als dieser Huber, der Anführer der Gegnerschaft. Der Nachbar hatte – das hatte Miguels Spionagetätigkeit hinter den feindlichen Linien ergoogelt – als junger Mann lediglich Zivildienst geleistet. Auf einer Igelauffangstation. Musste man sich auf der Zunge zergehen lassen. Null Kampfausbildung also, null Arschbackenzusammenklemmen, geschweige denn eine Ahnung von Kriegsführung oder Angriffsstrategie.
Schlunegger hatte seine beiden Leute gedrillt. Drei Trainingseinheiten à je zwei Stunden während des vergangenen Wochenendes und dann gestern nochmals drei Stunden am Stück. Mehr war der Mannschaft nicht zuzumuten. Es war zu frostig gewesen draußen, und die improvisierte Kampfbahn im Garten – Wippe, Schaukel, Rutsche, Kaminholzunterstand und Riesentrampolin – versank im Neuschnee. Seit gestern Abend schneite es zudem wieder ununterbrochen. Machte das Schlachtfeld zwar weicher, die Gefechtsbedingungen aber sehr viel schwieriger.
Er hatte seine zwei Sturmtrüppler zusätzlich zu motivieren versucht, indem er ihnen erlaubte, die Codewörter für die Operation sowie die Funknamen auszusuchen. Sie hatten dann unbedingt Frozen sowie Elsa-1, -2 und -3 gewollt. Weil sie doch den Disney-Film so mochten und sich diesen wohl mittlerweile eine Million Mal angeschaut hatten. Miguel hatte gestöhnt, aber eingewilligt. Der Titelsong des Films lief bei ihnen zu Hause seit der Adventszeit in der Endlosschleife. Verfluchtes Eisprinzessinnen-Elsa-Kitschzeugs. Kleinmädchenkram. Ja, jaaa, es gab halt immer noch Momente, in denen Miguel sich in seiner neuen Rolle nicht auf Anhieb zurechtfand. Er, der Ganz-plötzlich-Papa, schwamm manchmal gehörig.
Er hatte seinen Zwillingen das Grundprinzip der Kampftaktik »Feuer-und-Bewegung« einzubläuen versucht. Es ihnen mehrfach erklärt, auf dem großen Zeichenpapier an der Malstaffelei im Kinderzimmer aufgezeichnet, dann mit Lego-Figuren durchgespielt und schließlich im Haus mit Sofadeckung, der Küchenzeile als Schützengraben und aufmunitioniert mit zerknüllten Zeitungspapierbällen eingeübt.
So weit Schluneggers Theorie.
In der Praxis endete Operation Frozen bereits mit dem allerersten Feuerschlag des Feindes. Ein Volltreffer. Kopfschuss.
Miguel hörte den Klatscher (klang weich – also wohl Wange), dann den Aufschrei des Opfers und gleich darauf ein sirenenartiges Losheulen.
»Elsa-1 an Elsa-3. Was ist los? Bist du getroffen? Statusmeldung?«
Er bekam keine Antwort, stattdessen meldete sich Elsa-2 im Ohrhörer.
»Papa, mir ist kalt. Können wir reingehen und etwas anderes spielen?«
Die Schlacht war ein einziges Desaster. Schluneggers Leute hatten einfach aufgegeben – ohne selbst auch nur einen einzigen Schneeball geworfen zu haben. Welch Schmach! Manchmal fragte sich Schlunegger, wie es wohl wäre, Söhne zu haben. Vielleicht hatte er sogar welche, von denen er nichts wusste. Die Mädchen hatte er ja auch quasi über Nacht bekommen.
Er erhob sich hinter der Mauer seiner Schneeburg, streckte die Arme gegen den Himmel und schrie: »Haaaalt! Feuer einstellen. Wir ergeben uns, ihr habt gewonnen.«
Kurz darauf gab er seinem Nachbarn Huber, diesem Weichei und Vater von drei Kindern, die klamme Hand und gestand die Niederlage ein. Die Männer lachten, pufften sich gegenseitig die Fäuste in die Schulterblätter und verabredeten sich für demnächst auf ein Winterbier. Friedensgerste statt -pfeife.
Huber übergab Miguel die beiden durchgefrorenen Gefangenen in ihren rosa Skianzügen mit den blauen Sternen.
Ida und Frida. Demnächst wurden sie fünf.
Ida trug über ihrer Mütze eine Krone aus goldener Pappe. Sie hatte vor ein paar Tagen das Plastikfigürchen im Dreikönigskuchen gefunden.
Miguel kniete sich in den Schnee und umarmte seine Zwillingstöchter.
»Ihr seid mir vielleicht Kriegerinnen …« Er zog ihnen die Handschuhe aus, packte die zwanzig Finger in seine Pranken und hauchte hinein. »Na, hat jemand Lust auf heiße Schokolade?«
»Ou, ja«, jubelte Ida. »Machst du uns wieder so einen riesigen Schlagsahne-Eisbären obenauf?«
Frida schniefte, dann sagte sie: »Ich habe Seitenstechen im Kopf.« Sie hatte rechts eine watschenrote Wange, ihre Lippen zitterten, aber sie verbiss sich tapfer die Tränen. Dafür lief die Nase.
»Tut’s noch sehr weh?«, fragte ihr Papa und wischte mit einem Papiertaschentuch den halbgefrorenen Kampfschnodder weg. »Bist meine Heldin. Kriegst einen Orden.«
»Was ist ein … Orden?«
»Ein glänzendes Abzeichen, das man sich an den Pullover heften darf, damit alle sehen, wie tapfer man war.«
Jetzt strahlte Frida. »Das will ich, das will ich. Darf ich den Orden morgen mit in den Kindergarten nehmen?«
»Darfst du.« Miguel lächelte gequält. Er würde die halbe Nacht mit Schere, Leim, Seidenbändern und Goldfolie verbringen.
Frida jubelte, schlang ihre Arme um Papas Hals, griff dann blitzschnell in die Seitentasche seiner Jacke und zog das Handy hervor. »Das muss ich sofort erzählen.«
»Hey, Frechdachs. Wen willst du denn anrufen?«
»Na, Omistern.«
3
Violetta Morgenstern mochte die Adventszeit – weil sich die Leute dann praktisch von allein umbrachten.
Das Fest der Liebe war für Auftragskiller wie Weihnachten und Ostern zusammen. Nie eliminierte es sich einfacher als während der hochheiligen Wochen um die Jahreswende herum. War im Grunde einfachste Psychophysik, fand Morgenstern: je mehr Kerzen, desto mehr Schatten. Die arglose Freude am hell erleuchteten Tannenbaum machte Zielpersonen blind für finstere Absichten.
Besinnlichkeit vernebelte deren Aufmerksamkeit.
Nie war Lichterausblasen einfacher.
Kam noch helfend hinzu, dass sich die meisten Opfer in einem dauerangepunschten, geeierlikörten, glühweinseligen Zustand befanden, da sich die Verwandten und Verdammten und all die Familientreffen nun mal nur im narkotisierten Zustand ertragen ließen.
Highsse Weihnachten.
Und dann erst diese Fülle an Kill-Methoden, die sich einem Berufstotmacher im Advent boten. Kam Morgenstern vor, als stünde sie vor einem opulenten, eiskalten, morbiden Buffet. Bedienen Sie sich, meine Dame. Was darf es sein? Welche Eliminierungsart hätten Sie denn gern?
Morgensterns Arbeitgeber, dem geheimen Schweizer Killer-Ministerium Tell, war es enorm wichtig, dass die Terminationen ihrer Angestellten auf gar keinen Fall nach Mord aussahen. Sondern nach Schicksal, Zufall oder Unfall. Also keine Kugel in den Kopf (außer in absoluten Notfällen und unter Zeitdruck), kein Messer im Rücken, nix da Bombe mit Druckzünder unter dem Autositz. Nein, es musste stets nach natürlicher Todesursache aussehen. Von denen es eben zur Weihnachtszeit einen riesigen Geschenkekorb voll gab.
Zum Beispiel all der gebackene Süßkram, den die Oh-du-Fröhlichen in Unmengen knabberten. Vertrug sich oft überhaupt nicht mit deren Lebensmittelunverträglichkeiten. Längst vorbei die Zeiten, in denen der Mensch alles kaute und verdaute. Nein, heutzutage litten alle an irgendetwas – und gingen damit auch noch stolz hausieren. War mittlerweile Small-Talk-like: Mich quält dies und das, woran kränkeln Sie denn, mein Lieber?
Früher hatte Morgenstern der Zielperson eigens ein Gift verabreichen müssen, heute trugen die Leute ihr Toxikum bereits in sich – man brauchte es nur noch mittels besonders heftigen Anreizes auszulösen.
Zugegeben, die Leidenschaften klangen aber auch prätentiös: Laktoseintoleranz, Fruktoseintoleranz, Histaminintoleranz, Sorbitintoleranz, Sacharoseintoleranz. Die Leute überreagierten auf Hausstaubmilben, Pollen, Tierhaare, Schimmelpilze, Insektenstiche, den Zürcher Tatort und zig Zutaten in Medikamenten und Insektiziden. Oder sie hyperten bei Hautkontakt mit Nickel, Latex, Duftstoffen in Kosmetika, Reinigungsprodukten oder Pflanzen.
Verdammt, heutzutage konnte man selbst mit Weihnachtsguetzli töten.
Bei einem Tell-Auftrag Mitte Dezember hatte sich Morgenstern als Cateringmitarbeiterin verkleidet und während einer Firmenfeier der Zielperson – diese litt laut ausspioniertem Arztdossier an Cinnamomumintoleranz – einen hoch überdosierten Zimtstern aus der Tell-eigenen Chemieküche untergejubelt. Der Mann bekam binnen zweier Minuten Atemnot und einen krebsroten Kopf, dann quoll ihm das Gesicht auf und der Hals zu, Kreislauf galoppierte, Herz kolibrierte, Hirn desertierte, er schäumte und bäumte sich auf. Sein Leben war nach total sieben Minuten und fünfzig Sekunden verglüht. Verzimtsternschnuppt. Morgenstern hatte die Zeit extra noch gestoppt. Galt seither Tell-intern als neuer Rekord in der Kill-Kategorie Patisserie & Feingebäck. Ja, so himmlisch flott ging das zur Weihnachtszeit.
Doch die Festtage boten noch mehr. Mindestens ebenso viel Eliminationspotenzial steckte in der festlichen Dekoration. Selbst der nüchternste Zeitgenosse schmückte im Advent sein Daheim. Innen wie außen. So was ließ sich gewinnumbringend nutzen. Manchmal sogar noch weit über die Weihnachtszeit hinaus …
Es war ein Samstag im Januar, und Violetta Morgenstern hockte in einem Kirschlorbeer-Gebüsch.
Sie wartete. Sie beobachtete. Sie fror.
Das Gesträuch war von Eiswind, Frost und Schneegestöber eingepudert und trug eine meterdicke Neuschneekappe, weswegen Morgenstern zur Tarnung ihren weißen Skioverall sowie gleichfarbene Moonboots angezogen hatte. Die ebenfalls weiße Strickmütze trug sie lediglich, weil ihr sonst die Ohren abgeklirrt wären; ihr hochgestecktes Silberhaar wäre an sich Camouflage genug gewesen.
Aus dem Gebüsch heraus konnte sie das gesamte Haus der Zielperson beobachten, ohne selbst gesehen zu werden.
Sie hatte einen Auftrag. Das hier war ein Eine-Frau-Einsatz. Ihr Solo-Kill. Und Bibber-Job.
Sternefoifi, war ihr kalt! Seit der Morgendämmerung harrte sie hier aus, hatte sie doch irrtümlicherweise angenommen, der Kerl würde bereits früh am Tag mit seinem Projekt loslegen – und sie ihn umlegen. Um sich ein wenig abzulenken, ließ sie laute Musik in ihrem Kopf laufen. Aus ihrer Kindheit, Ende Fünfzigerjahre. Marina von Rocco Granata.
Morgenstern zückte ihr Handy und checkte die Uhrzeit. Mist, schon so spät. Bereits halb eins am Nachmittag. Wo blieb die Zielperson nur? Typen in seinem Alter waren doch keine Nachtschwärmer mehr, die an den Wochenenden ausschliefen bis gegen Mittag. Jede Wette, der war morgens nach fünf Uhr bereits wach. Ü60-Bettflucht kombiniert mit Prostatadruck.
Zum Glück trug sie Thermounterwäsche, Funktionskleider, Wärmebeutel in sämtlichen Taschen und beheizbare Einlegesohlen in den Stiefeln. Gerry, der IT-Chef von Tell, hatte die High-Tech-Fußwärmerchen eigenhändig für Frau Morgenstern ein wenig aufgepeppt. Die heizten nun mit doppelter Leistung, konnten notfalls per USB-Kabel am Handyakku aufgeladen werden und wirkten eine halbe Ewigkeit, nämlich ganze sechs Stunden – die jetzt aber eben so langsam verstrichen. Und das Ladezustandsymbol auf Morgensterns Handy zeigte auch bereits niedrig an und eiskalt Dunkelrot. Verflixte Kälte. Scheißwarterei. Lahmarschige Zielperson.
Dabei hatte der Kerl seiner Frau doch hoch und heilig versprochen, den Job endlich zu erledigen. Es ihr versprechen müssen. Meine Güte hatte die Kuh ihren Gatten angezickt: Ob er eigentlich wisse, dass sie das Gespött der ganzen Nachbarschaft seien? Nach Dreikönig sei’s – und sie hätten immer noch die blinkende Weihnachtsdeko am Haus. Und überhaupt, warum er eigentlich immer kneife, wenn es darum ginge … Bestimmt eine ganze halbe Stunde lang hatte die Alte so weitergepfuttert, ehe ihr Gatte eingeknickt war. »Ja, jaaa, hör schon auf zu nerven. Ich mach’s ja. Am Samstag rupfe ich die verdammte Deko wieder von der Hütte. Zufrieden jetzt, Cordula?«
Das war vor achtundvierzig Stunden gewesen. Und Morgenstern hatte mitgehört – in 3D-Dolby-Recording-Qualität – und endlich gewusst, wie sie Job und Mann erledigen konnte.
Seit Silvester kaute sie an diesem Fall, eine eher zähe Sache, da alltagslangweilige Zielperson. Der Kerl zeigte keine brauchbaren Ansatzpunkte, aus denen heraus sich Eliminationsmöglichkeiten ergeben hätten. In solchen Fällen empfahl sich eine Rundumüberwachung. Irgendwo würde sich bestimmt etwas finden lassen. Der Alltag des Subjekts wurde hierbei lückenlos ausspioniert und mittels Foto, Film und Ton dokumentiert. So etwas erledigten heutzutage Drohnen. Und Tell verfügte über einige ganz besondere Exemplare. Unikate. IT-Gerry hatte sie zusammen mit ein paar genialen wie illegal agierenden Freaks aus der Hackerszene (zwei davon rangierten auf der FBI-Liste Most wanted tech criminals