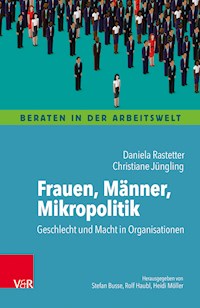
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Beraten in der Arbeitswelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Chancengleichheit, Frauenquoten in Vorständen und Aufsichtsräten, Diversity Management oder Gender Mainstreaming – diese Debatten sind hoch aktuell. Doch wie gelingt Geschlechtergerechtigkeit tatsächlich in Organisationen? Wissen über Gender, organisationale Machtstrukturen und weitere Dimensionen von Ungleichheit ist in der Aus- und Weiterbildung von Coaches und Supervisor*innen noch nicht sehr verbreitet. Daniela Rastetter und Christiane Jüngling schließen diese Lücke. Kompakt und fokussiert zeigen sie anhand von Fallbeispielen, wie die verschiedenen Dimensionen in mikropolitischen Handlungsfeldern zusammenwirken und Erfolgschancen prägen. Denn Beratende brauchen mikropolitische Kompetenz und Genderkompetenz, um auch in Beratung und Supervision mehr Geschlechtergerechtigkeit zu realisieren. Die mikropolitische Perspektive betont, dass unterschiedliche Interessen und Ziele von Einzelpersonen und Gruppen in Organisationen alltäglich sind und Interaktionen beeinflussen. Gender und Merkmale wie Hautfarbe, sexuelle Orientierung, Herkunft, Sprache oder Religion wirken im Kontext der jeweiligen organisationalen »Innenpolitik«. Wie kann dieses Verständnis von Strukturen und Prozessen der Ungleichheit und Macht in die Beratung eingebracht werden? Das erklären die Autorinnen, denn strategische Beratung unterstützt Klientinnen und Klienten darin, Kompetenzen zu entwickeln, um im beruflichen Kontext passende Lösungen zu finden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 115
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BERATEN IN DER ARBEITSWELT
Herausgegeben vonStefan Busse, Rolf Haubl und Heidi Möller
Daniela Rastetter / Christiane Jüngling
Frauen, Männer,Mikropolitik
Geschlecht und Macht in Organisationen
Vandenhoeck & Ruprecht
Mit 2 Abbildungen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Umschlagabbildung: maximmmmum/shutterstock.com
ISBN 978-3-647-90094-0
© 2018, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,Theaterstraße 13, D-37073 GöttingenVandenhoeck & Ruprecht Verlagewww.vandenhoeck-ruprecht-verlage.comAlle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Inhalt
Zu dieser Buchreihe
1 Einleitung: Wozu dieses Buch?
2 Perspektiven auf Geschlecht
Gleichheitstheoretische Positionen
Differenztheoretische Ansätze
Konstruktivistische Denkansätze
Queer-theoretische Zugänge
Männlichkeits- oder Maskulinitätsforschung
Erweiterungen der Perspektiven auf Geschlecht: Intersektionalität und Diversity
3 Frauen sind …, Männer sind …: Geschlechterstereotype und Rollen von Frauen in Organisationen
Ist Weiblichkeit eine Stärke?
Riskante Rollen von Frauen in Organisationen
4 Mikropolitik als allgegenwärtige Handlungslogik
Mikropolitisches Kompetenzmodell – die Bedeutung der einzelnen Dimensionen
Mikropolitische Handlungsfelder
Strengere (Emotions-)Regeln für Frauen – nur im Management oder überall?
Emotionsarbeit ist Frauenarbeit
5 Fazit: Auf die Perspektive kommt es an – Geschlecht und Macht am Arbeitsplatz
Literatur
Zu dieser Buchreihe
Die Reihe wendet sich an erfahrene Berater/-innen und Personalverantwortliche, die Beratung beauftragen, die Lust haben, scheinbar vertraute Positionen neu zu entdecken, neue Positionen kennenzulernen, und die auch angeregt werden wollen, eigene zu beziehen. Wir denken aber auch an Kolleginnen und Kollegen in der Aus- und Weiterbildung, die neben dem Bedürfnis, sich Beratungsexpertise anzueignen, verfolgen wollen, was in der Community praktisch, theoretisch und diskursiv en vogue ist. Als weitere Zielgruppe haben wir mit dieser Reihe Beratungsforscher/-innen, die den Dialog mit einer theoretisch aufgeklärten Praxis und einer praxisaffinen Theorie verfolgen und mit gestalten wollen, im Blick.
Theoretische wie konzeptuelle Basics als auch aktuelle Trends werden pointiert, kompakt, aber auch kritisch und kontrovers dargestellt und besprochen. Komprimierende Darstellungen »verstreuten« Wissens als auch theoretische wie konzeptuelle Weiterentwicklungen von Beratungsansätzen sollen hier Platz haben. Die Bände wollen auf je rund 90 Seiten den Leserinnen und Lesern die Option eröffnen, sich mit den Themen intensiver vertraut zu machen, als dies bei der Lektüre kleinerer Formate wie Zeitschriftenaufsätzen oder Hand- oder Lehrbuchartikeln möglich ist.
Die Autorinnen und Autoren der Reihe werden Themen bearbeiten, die sie aktuell selbst beschäftigen und umtreiben, die aber auch in der Beratungscommunity Virulenz haben und Aufmerksamkeit finden. So werden die Texte nicht einfach abgehangenes Beratungswissen nochmals offerieren und aufbereiten, sondern sich an den vordersten Linien aktueller und brisanter Themen und Fragestellungen von Beratung in der Arbeitswelt bewegen. Der gemeinsame Fokus liegt dabei auf einer handwerklich fundierten, theoretisch verankerten und gesellschaftlich verantwortlichen Beratung. Die Reihe versteht sich dabei als methoden- und schulenübergreifend, in der nicht einzelne Positionen prämiert werden, sondern zu einem transdisziplinären und interprofessionellen Dialog in der Beratungsszene angeregt wird.
Wir laden Sie als Leserinnen und Leser dazu ein, sich von der Themenauswahl und der kompakten Qualität der Texte für Ihren Arbeitsalltag in den Feldern Supervision, Coaching und Organisationsberatung inspirieren zu lassen.
Stefan Busse, Rolf Haubl, Heidi Möller
1 Einleitung: Wozu dieses Buch?
Noch ein Beratungsbuch für Beraterinnen und Berater, noch dazu über Themen, die seit Langem im Zentrum einschlägiger Veröffentlichungen stehen: Macht und Politik in Organisationen, Gender, Diversität und Geschlechtergerechtigkeit. Warum? Diskussionen über Chancengleichheit, Quoten, mehr Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten, Diversity Management oder Gender Mainstreaming werden nach wie vor sehr kontrovers geführt, zum Teil mit den gleichen Argumenten wie vor dreißig Jahren. Dennoch ist das Wissen über die vielen Facetten der Genderthematik und ihre Verknüpfung mit organisationalen Machtstrukturen und anderen Bedingungen gesellschaftlicher Ungleichheit in de Aus- und Weiterbildung von Coaches und Supervisorinnen/Supervisoren1 noch nicht sehr verbreitet. Erst seit Kurzem gibt es Literatur zu Gender- und Diversity-Kompetenz in Beratung, Coaching und Supervision. Wir selbst beschäftigen uns seit geraumer Zeit mit den Erfahrungen bei der Einführung von Frauenförderungs- und Gleichstellungsmaßnahmen und weiterführenden Forschungsansätzen zur erfolgreichen Gestaltung von organisationalen Veränderungsprozessen (Jüngling u. Rastetter, 2011b).
Der Begriff Gender bezeichnet in den Sozialwissenschaften die durch Gesellschaft und Kultur geprägten Geschlechtseigenschaften einer Person in Abgrenzung zu ihrem biologischen Geschlecht (engl. »sex«). Er wird in diesem Kontext meist mit »soziales Geschlecht« übersetzt und dient unter anderem zur analytischen Kategorisierung.
Wir sind davon überzeugt, dass nur ein organisationspolitischer Ansatz die in einer Organisation auftretenden Interessenkonstellationen, Konflikte und Widerstände angemessen reflektieren kann, denn Menschen in Organisationen handeln nicht sachrational, sondern in erster Linie sozial rational. Eine organisationspolitische Perspektive kann auf allen Ebenen mit ganz unterschiedlichen Zielen nützlich sein: Auf der Makroebene kann es z. B. darum gehen, ein gleichstellungspolitisches Projekt unternehmensweit realistisch zu planen und in verschiedenen Bereichen strategische Koalitionspartner zu identifizieren. Auf einer mittleren Ebene gilt es, auf der Basis dieser strategischen Analyse mittels einer passenden Projektplanung verschiedene Akteure und Akteurinnen in Unternehmensbereichen und Abteilungen einzubinden, um dann in konkreten Kontexten geplante Umsetzungsschritte erfolgreich zu realisieren. Auf einer Mikroebene kann es das Ziel sein, als Protagonist/-in organisationalen Wandels – z. B. als Gleichstellungs- oder Diversity-Beauftragte/-r – erfolgreich zu sein (vgl. Edding, 2000), sich mit einem bestimmten Anliegen in Projektgruppen oder betrieblichen Gremien besser durchzusetzen oder – ganz individuell gedacht – die eigene berufliche Weiterentwicklung zu befördern.
Das Besondere unserer Herangehensweise ist also die organisations- und mikropolitische Sicht: Wir betrachten Beratungsanliegen unter einer mikropolitischen Lupe. Dieser Fokus hebt hervor, dass unterschiedliche Interessen und Ziele von Einzelpersonen und Gruppen in Organisationen normal und alltäglich sind und alle Interaktionen beeinflussen. Inwieweit diese Interessen durchsetzbar sind, hängt von den jeweiligen Machtpotenzialen ab. Gender und weitere Dimensionen von Ungleichheit wie Hautfarbe, sexuelle Orientierung, Herkunft, Sprache oder Religion wirken im Kontext dieser je spezifischen organisationalen »Innenpolitik«. Dies gilt sowohl für die Verfolgung individueller Ziele als auch für strukturelle Veränderungen in Unternehmen. Wir stellen deshalb zwei Thesen auf:
1) Alle Beraterinnen und Berater brauchen mikropolitische Kompetenz
Beratung mit mikropolitischer Perspektive heißt, die Bedeutung von Macht, Interessen und individuellen Zielen stets mit zu bedenken, auch wenn sie auf den ersten Blick keine Rolle zu spielen scheinen. Dies könnte so aussehen:
Ein Klient möchte mit dem Coach zusammen seine weitere Laufbahn im Unternehmen planen und beschreibt dafür seine Qualifikationen, bisherigen Erfahrungen und zukünftigen Ziele. Der Coach lenkt den Blick des Klienten auf die Machtkonstellationen im Unternehmen, die dieser noch nicht bedacht hatte: Welche unterstützenden Personen hat oder braucht der Klient, wenn er eine bestimmte Position anstrebt? Welche Netzwerke muss er sich erschließen? Welche Erfolge muss er wie und bei wem herausstellen, um als Aufstiegskandidat bei seinen Vorgesetzten Beachtung zu finden?
Wenn nun eine Klientin dasselbe Anliegen hat und ihre Aufstiegsperspektiven reflektieren und verbessern will, spielen noch weitere, genderspezifische Aspekte eine wichtige Rolle. Hier müsste die Beraterin weitere Dimensionen erkunden, die auf die Aufstiegschancen von Frauen besonderen Einfluss haben. Das mikropolitische Feld wird komplexer (vgl. Jüngling u. Rastetter, 2012).
Wichtige zusätzliche Fragen für eine weibliche Klientin wären: Welche Einstellung hat der unmittelbare Vorgesetzte gegenüber aufstiegsmotivierten Frauen (Frauen wird oft weniger Aufstiegsmotivation zugetraut als Männern)? Wie nimmt die Klientin die Unternehmens- und Abteilungskultur wahr (frauenfreundlich oder eher ablehnend)? In welchem Verhältnis stehen Frauen und Männer in ihrem Arbeitsbereich (Mehrheit–Minderheit)? Wie sind die unternehmensinternen Angebote und Gepflogenheiten hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Präsenzkultur oder flexible Arbeitszeiten)? Gibt es für die Klientin Mentorinnen/Mentoren und Vorbilder im Unternehmen, die sie motivieren und fördern könnten?
Natürlich kann (Mikro-)Politik auch explizit im Auftrag enthalten sein, etwa wenn ein kleineres Unternehmen oder eine Abteilung in einem Fusionsprozess befürchtet, Einfluss zu verlieren und seine wesentlichen Strukturen und Prozesse erhalten will.
– Eine Gruppe von Psychotherapeutinnen will sich beraten lassen, um die Interessen ihrer Berufsgruppe gegenüber der Klinikleitung, bestehend aus einem Chefarzt und dem Geschäftsführer eines großen Klinikkonzerns, besser durchsetzen zu können.
– Die Gleichstellungsbeauftragte einer Behörde sucht Beratung, um verschiedene Gleichstellungsprojekte erfolgreich umsetzen zu können. Der Berater muss erfragen und reflektieren, welche Aufgaben und Machtressourcen sie hat, welche Rollen sie ausfüllen kann und mit welchen Blockaden, Widerständen und entgegengesetzten Interessen sie bei verschiedenen Projekten zu kämpfen haben wird.
In den beiden letzten Beispielen mischen sich – wie so oft – politische und Genderaspekte: berufliche Statusunterschiede, Interessen der Geschäfts- oder Behördenleitung, Interessen verschiedener Verwaltungsabteilungen, Berufsgruppen- oder Geschlechterunterschiede können relevant sein.
Damit kommen wir zu unserer zweiten These:
2) Alle Beraterinnen und Berater brauchen Genderkompetenz
Beraterinnen und Berater müssen sich darüber bewusst sein, dass Einstellungen und Verhalten von Frauen und Männern mit sozialen Festlegungen im privaten, beruflichen und betrieblichen Alltag verbunden sind. Dementsprechend existiert eine Vielfalt von Lebensentwürfen und Lebenslagen. Auch Organisationen sind durch Geschlechtsrollen (und -bilder) und die damit verbundenen gesellschaftlichen Zuschreibungen und Geschlechterverhältnisse geprägt und bilden entsprechende tief verankerte und zum Teil auch benachteiligende Strukturen aus. Genderkompetenz umfasst dieses Wissen über die soziale Konstruktion von Geschlechterrollen und ungleichen Geschlechterverhältnissen, ebenso wie die Fähigkeit, diese zu erkennen und so zu beraten, dass benachteiligende Strukturen verändert werden können und allen an einer Beratung Beteiligten neue Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet werden. Dazu sind Kenntnisse über geschlechterpolitische Strategien notwendig sowie die Fähigkeit, Instrumente und Verfahren zur Verwirklichung von Gleichstellung und Chancengleichheit anzuwenden.
Auch in Interaktionen spielt Geschlecht als soziale »Masterkategorie« eine zentrale Rolle, selbst wenn das eigentliche Thema, das in der Beratung besprochen wird, ein ganz anderes ist. Interaktionen finden dabei auf zwei Ebenen statt: Zum einen sind sie Gegenstand der Beratung, z. B. ein Konflikt mit dem Vorgesetzten oder der Umgang mit einer schwierigen Mitarbeiterin. Zum anderen findet die Interaktion in der Beratung selbst statt. Für die Beratungsinteraktion ist es ein Unterschied, ob ein Berater eine Gruppe von Erzieherinnen supervidiert oder ob eine Karriereberaterin eine männliche Führungskraft coacht. Beratende und Supervidierende sollten diese Unterschiede reflektieren und sich möglichst geschlechtergerecht verhalten (siehe Möller u. Müller-Kalkstein, 2014; Abdul-Hussain u. Baig, 2009; Gröning, Kunstmann u. Neumann, 2015; Pannewitz, 2012).
Genderkompetenz bedeutet, dass Supervisoren/Supervisorinnen und Coaches in Beratungen je nach Auftrag flexibel verschiedene Reflexionsebenen einbeziehen (vgl. Schigl, 2014, S. 100):
– Die Mikroebene: Sie umfasst die individuelle Entwicklungsgeschichte und das Selbstverständnis der Klientinnen und Klienten, die davon geprägte Kommunikation und Interaktion, die individuelle Bereitschaft zur geschlechtstypischen oder untypischen Rollenübernahme etc.
– Die Mesoebene: Zu ihr gehört die Bedeutung von Gender und Genderdynamik in den jeweils relevanten Teams, Abteilungen, Organisationsbereichen und Organisationen.
– Die Makroebene: In ihr sind der Einfluss des gesellschaftlichen und politischen Umfelds, die herrschenden Regeln und Systeme und die jeweils dominierenden Einstellungen (Stichwort: Zeitgeist) zur Chancengleichheit verortet.
– Die Meta-Reflexions-Ebene: Diese Ebene betrifft ebenso die Selbstreflexion als Supervisor/-in oder Coach im Hinblick auf Gender als auch die Reflexion der relevanten sozialisatorischen und historischen Einflüsse (Lebensbedingungen und Handlungsmöglichkeiten, Werte, Philosophien, Wissensbestände und Diskurse).
In Beratungsfällen kann es verschiedene Konstellationen geben, in denen Genderkompetenz erforderlich ist. Eine Beraterin kann selbst zu dem Schluss kommen, dass Klientinnen und Klienten für die Lösung ihrer Probleme Genderkompetenz benötigen. In diesem Fall ist Genderkompetenz ein Wissen, das in die Beratung einfließt und an die Klientinnen und Klienten weitergegeben wird. Die Beraterin tut das implizit und eigeninitiativ:
– Eine im technischen Bereich tätige Frau sucht Rat für die Gestaltung ihrer Laufbahn. Sie ist eine von wenigen Frauen in ihrer Abteilung und hat nur männliche Vorgesetzte. Sie selbst hatte den Einfluss von Geschlecht auf Karriere bislang nicht im Blick. In diesem Fall kann es helfen, der Klientin diese Perspektive anzubieten.
– In einem Change-Projekt einer Abteilung soll die Beraterin den Veränderungsprozess begleiten, Widerstände abbauen etc. Sie erkennt, dass dieser Prozess auch die Geschlechterverhältnisse in der Abteilung berührt und Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen verstärkt: Arbeitsplätze in einer Berufsgruppe, in der weibliche Arbeitskräfte in der Mehrheit sind, sollen systematisch abgebaut werden. Männliche Experten sollen gefördert werden. Die Beraterin bezieht dieses Wissen in die Beratung ein und konfrontiert die Projektgruppe mit den Fakten, um faire Lösungen mit Entwicklungsperspektiven für beide Geschlechter zu entwickeln.
In manchen Fällen gehört Genderkompetenz auch explizit zum Auftrag:
– Eine weibliche Führungskraft möchte ihre Probleme mit einigen ihr unterstellten älteren Kollegen lösen und bringt das Thema Gender selbst in die Beratung ein.
– Eine öffentlich geförderte Organisation (z. B. ein Unternehmen, eine Forschungsinstitution, Stiftung, ein Verband oder Verein) will und muss Gender-Mainstreaming-Kriterien erfüllen, um weiter förderungsfähig zu bleiben. Die Organisation sucht Unterstützung, um diesen Prozess zu planen und umzusetzen.
Genderkompetenz wird von Beratenden also explizit oder implizit eingefordert, auch in organisationalen Kontexten. Aus diesen Gründen verknüpfen wir in diesem Buch die Themen Geschlecht und Mikropolitik. Das Kapitel 2 gibt einen Überblick über die verschiedenen Ansätze zum Thema Geschlecht. Denn die langjährige und breit gestreute Forschung hat dazu keine einheitlichen Konzepte, sondern verschiedene, teils widersprüchliche Perspektiven entwickelt, die man kennen sollte, wenn man geschlechtersensibel beraten möchte. Eng verbunden mit diesen Ansätzen ist das Thema der Geschlechterstereotype, das wir in Kapitel 3 aufgreifen. Stereotype führen dazu, dass mit Weiblichkeit und Männlichkeit bestimmte Merkmale, Verhaltensweisen und Eigenschaften verknüpft werden, die wiederum bestimmte Bewertungen und Entscheidungen veranlassen.
Gender-Mainstreaming ist eine Strategie zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter. Gender-Mainstreaming bedeutet, die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern bei allen Entscheidungen auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu berücksichtigen, um so die Gleichstellung durchzusetzen. Gender-Mainstreaming wird in öffentlichen Institutionen und Verwaltungen umgesetzt, während in der Privatwirtschaft zunehmend Diversity Management als Konzept zur Umsetzung von Chancengleichheit verwendet wird.
In Kapitel 4 wird Mikropolitik als spezifisches Verständnis von Interaktionen und Situationen am Arbeitsplatz dargestellt. Diese Perspektive entwirft das Bild einer Organisation als »politischer Arena«, in der alle nach Macht und Einfluss streben, um kollektive oder individuelle Ziele durchzusetzen, jedoch in unterschiedlichem Ausmaß, mit unterschiedlich ausgereiften Strategien und unterschiedlichen Einstellungen und Gefühlen dazu. Hierbei spielt Geschlecht eine erhebliche Rolle. Mikropolitik und Genderdynamiken sind meist eng verflochten. Frauen müssen sich nach unseren Erfahrungen in größerem Ausmaß als Männer mikropolitische Kompetenzen und die Bereitschaft zu strategischem und rollenunabhängigem Handeln aneignen, um ihre beruflichen Ziele zu erreichen.2 Dafür haben wir ein Kompetenzmodell entwickelt, das vier mikropolitische Kompetenz-dimensionen beschreibt.
Das Modell hilft in der Beratung zu klären, welche Kompetenzen bei der Klientin/dem Klienten bereits vorhanden sind oder möglicherweise noch fehlen. Zur weiteren Fokussierung können die sechs mikropolitisch bedeutsamen Handlungsfelder herangezogen werden. Eines von ihnen ist das Thema Emotionalität.





























