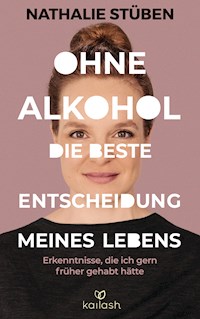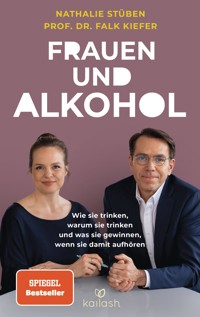
19,99 €
Mehr erfahren.
Sie trinken anders.
Alkohol zu trinken, ist für Frauen mittlerweile selbstverständlich. Sie tun es, um zu feiern, um dazuzugehören oder sich kultiviert zu fühlen. Aber auch, um Sorgen, Überforderung und Ängste zu bewältigen. Trinkmuster, die für ältere Generationen noch undenkbar gewesen wären, gehören heute zum Alltag und sind gesellschaftlich akzeptiert. Das hat fatale Folgen.
Die ehemals selbst betroffene Journalistin Nathalie Stüben und der renommierte Suchtmediziner Prof. Dr. Falk Kiefer erklären, warum Frauen Alkohol trinken, wie sie ihn trinken und wie sich das auf ihren Alltag, ihre Gesundheit, ihre Beziehungen und Ambitionen auswirken kann. Sie zeigen Möglichkeiten auf, damit aufzuhören. Und verdeutlichen, welch immense Freiheit es bedeutet, wieder selbst Regie im eigenen Leben zu führen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
NATHALIE STÜBEN
PROF. DR. FALK KIEFER
FRAUEN
UND
ALKOHOL
Wie sie trinken, warum sie trinken und was sie gewinnen, wenn sie damit aufhören
Die Informationen in diesem Buch sind vom Autor und Verlag sorgfältig erwogen und geprüft, dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors bzw. des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Originalausgabe
© 2024 Kailash Verlag, München
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Lektorat: Doreen Fröhlich
Umschlaggestaltung: ki 36, Daniela Hofner Editorial Design, München
Infografik: Sabine Timmann
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-31768-3V003
www.kailash-verlag.de
Inhalt
Vorwort
1 Frauen und Alkohol Deine Generation prägt dich, auch im Trinkverhalten
2 Halbwissen und Verharmlosung So wirken sich politische und kulturelle Rahmenbedingungen auf dein Leben aus
3 Alkohol und weibliche Gesundheit Auch diese Zusammenhänge sind wissenswert
4 Alarmsignale und Augenöffner Erkenntnisse, die etwas verändern können
5 Wege aus dem Alkoholproblem Du bist nicht allein, und du kannst es schaffen
6 Abstinenz als Chance Was du ohne Alkohol gewinnen kannst
Wichtigste Quellen
Danksagungen
Kurzbiografien
Register
Vorwort
»Ab wann hat man denn ein Problem mit Alkohol?«
Kaum eine Frage wird uns häufiger gestellt. Und sie ist gar nicht so leicht zu beantworten. Denn es hängt davon ab, was wir unter »problematisch« verstehen. Noch vor 70 Jahren wäre es hochproblematisch gewesen, sich als Frau öffentlich zu betrinken. Heute gilt genau das in manchen Kreisen als Ausdruck von Emanzipation. In einer Hochkonsumregion wie Europa scheint es unter sozialen Gesichtspunkten oft sogar problematischer zu sein, nicht zu trinken, als es zu tun. Wir nehmen häufig nur die Sucht als Problem wahr. Aber selbst da stellt sich die Frage: Wo beginnt die? Psychologisch betrachtet wird es bereits kritisch, wenn wir Alkohol als Droge einsetzen. Also als psychoaktive Substanz, die verändert, wie wir denken und fühlen. Doch ebendieser Einsatz gehört ja zu unserem kulturellen Repertoire: Wir trinken Alkohol, um zu feiern, um dazuzugehören, um Probleme zu vergessen, uns zu belohnen, runterzukommen, Stress zu bewältigen, um den Erwartungen anderer zu entsprechen und um uns selbstbewusster zu fühlen. Das ist normal, das machen fast alle. Haben dann auch fast alle schon ein Problem? Es kommt darauf an, denn bei der Antwort spielen viele Ebenen mit rein.
Dieses Buch wird sie dir aufzeigen und dabei vor allem auch darauf eingehen, warum Alkoholkonsum für Frauen etwas anderes bedeutet als für Männer. Warum er sowohl auf biologischer, psychischer, seelischer und sozialer Ebene andere Konsequenzen hat und dass er möglicherweise mehr als nur ein Stein dieser Mauer ist, gegen die du immer wieder rennst. Du wirst dir am Ende differenziert beantworten können, ab wann Alkoholkonsum problematisch wird, weil dir die einzelnen Kapitel verdeutlichen, welche Dimensionen dieses Thema umfasst und warum ausgerechnet die Alkoholmenge dabei keine entscheidende Rolle spielt. Wir legen dar, was für unterschiedliche Funktionen Alkohol in verschiedenen Lebensabschnitten übernehmen und welche Folgen das jeweils haben kann. So wirst du ein Verständnis dafür entwickeln, dass deine Realität als Frau formt, wie du trinkst – und wie das Trinken wiederum deine Realität als Frau formt. Wir sprechen über mögliche Ursachen für Alkoholprobleme, und natürlich gehen wir auch darauf ein, was es ohne Alkohol alles zu gewinnen gibt und warum sich ein Leben ohne ihn nicht nach Verzicht anfühlen muss, sondern Selbstbestimmung und Freiheit mit sich bringen kann.
Um dir dieses Wissen sowohl für den Verstand als auch fürs Herz aufzubereiten, haben wir uns dazu entschlossen, fünf Frauencharaktere aus fünf Generationen zu erschaffen, die mit ihren Geschichten durch unser Buch führen. Helga, Sabine, Carmen, Jamila und Elena existieren nicht wirklich, sie sind Kreationen. Ihre Geschichten haben es uns ermöglicht, die Jahrzehnte unserer persönlichen und beruflichen Erfahrung zu verdichten sowie verschiedene Stadien und Ausprägungen von Alkoholproblemen so zu illustrieren, dass du dich abgeholt fühlst, nicht nur intellektuell, sondern auch emotional.
Beim Schreiben haben wir uns darum bemüht, möglichst viele Lebensrealitäten abzubilden, aber alles abdecken können wir natürlich nicht – zumal wir aufgrund unserer Herkunft blinde Flecken haben, die sich auch durch Recherche nie ganz beseitigen lassen. Hinzu kommt, dass das Konzept »Generation« ein Hilfskonstrukt ist. Es ermöglicht, Gruppen von Menschen danach zu unterscheiden, in welcher Ära sie geboren und aufgewachsen sind, welche weltgeschichtlichen Ereignisse, technologischen Fortschritte, kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Hintergründe sie mitgeprägt haben. Aber Generationen lassen sich nie sauber voneinander abgrenzen. Genauso wenig, wie sich der Begriff »Frau« klar definieren lässt.
Wir verstehen Frauen als Menschen, die sich selbst als weiblich einordnen. Diese Einordnung deckt sich nicht zwangsläufig mit dem biologischen Geschlecht, das aber wiederum Einfluss darauf nimmt, wie schädlich Alkohol für menschliche Körper ist. Deswegen werden wir in diesem Buch auch erläutern, wo der Unterschied zwischen biologischem und sozialem Geschlecht liegt und welche Rolle das beim Alkoholkonsum und seinen Folgen spielt.
Wir wünschen dir viele Aha-Erlebnisse und Erkenntnisse dabei, deine Antworten zu finden.
Nathalie Stüben und Falk Kiefer
1
Frauen und Alkohol
Deine Generation prägt dich, auch im Trinkverhalten
Carmen, 50 | Gen X | Leistung um jeden Preis
Er hat ihre Punkte nicht anständig eingearbeitet. Sie klickt sich durch die Folien. Zwei Fehler entdeckt sie auch noch. Er kann es einfach nicht. Er ist ihr Chef, er plustert sich auf wie ein Gockel, aber eigentlich hat er in dieser Position nichts zu suchen. Carmens Herz fängt an zu stolpern. Wie immer, wenn sie sich über mittelmäßige Männer in hohen Führungspositionen ärgern muss. Wie war noch gleich der Spruch? Natürlich können Frauen hierzulande Kanzlerin werden, aber Gleichberechtigung haben wir erst erreicht, wenn auch mittelmäßige Frauen in Führungspositionen landen.
»Davon sind wir weit entfernt«, murmelt Carmen und korrigiert seine Fehler. Sie arbeitet als Abteilungsleiterin in einem Automobilkonzern, der kurz vorm Launch eines neuen Modells steht. Carmen ist verantwortlich für den Einkauf der Reifen und Räder. Mit dem neuen Automodell will sich ihr Konzern als Technologieführer behaupten. Heute, an diesem heißen, schwülen Sommertag, entscheidet der Vorstand darüber, mit welchem Reifenhersteller sie kooperieren. Seit Wochen hat Carmen an der Beschlussvorlage gearbeitet, sorgfältig die Vor- und Nachteile der jeweiligen Hersteller recherchiert, die Produkte bewertet und eingeordnet, sämtliche Kalkulationen erstellt. Ihr Chef präsentiert das heute, und sie weiß, dass er ihr insgeheim danken wird. Bisher konnte sie nicht den Mut aufbringen, um darauf zu bestehen, ihre Arbeit selbst vorzustellen und zu verdeutlichen, dass alles, was in dieser Präsentation Substanz hat, von ihr stammt. Noch immer hofft sie, dass die anderen das von selbst merken.
Sie freut sich jetzt schon auf ihr Glas Prosecco später.
Carmen klickt auf »Speichern«, sprüht sich Thermalwasser ins Gesicht, schlüpft in ihre unbequemen Riemchensandalen und läuft an der Glasfront des Konferenzraums entlang. Sie betritt ihn als Erste. Die Klimaanlage brummt, es riecht nach Leder und neuem Teppich. Ein paar Minuten später rauschen über ein Dutzend Männer in Maßanzügen durch die Tür. Die Farbpalette reicht von Dunkelblau bis Dunkelgrau. Alle tragen teure Uhren. Bevor es losgeht, erzählen sie von wichtigen Menschen, mit denen sie heute Morgen schon telefoniert haben, oder von wichtigen Menschen, mit denen sie später noch zu Mittag essen. Männliche Machtsignale. Carmen verdreht die Augen, es ist so albern. Ihr fällt auf, dass der Laptop noch nicht mit dem Beamer verbunden ist. Carmen hatte heute Morgen schon den Vorstandsvorsitzenden am Apparat, weil der sich lieber an sie wendet als an ihren Chef. Aber sie würde nicht im Traum darauf kommen, das in ihren Small Talk einzubauen. Stattdessen verbindet sie den Laptop mit dem Beamer.
»Ganz reizend, dass Sie das machen. Ich hätte auch wirklich gern noch einen Kaffee«, sagt einer und schnaubt. Er trägt gelbe Socken zu seinem dunkelgrauen Anzug. Sie hasst diesen Typen. Auch er ist Abteilungsleiter, auch er hat ein Auge auf den Bereichsleiterposten geworfen. Der nächste Karriereschritt, für den sie alles geben würden, beide, nur auf unterschiedliche Art und Weise.
»Kaffee hätte ich auch gern«, kontert Carmen. Sie hat diese Art von Schlagfertigkeit 100.000-mal vorm Spiegel geübt. Es fühlt sich trotzdem noch unverschämt an. Niemand würde von Carmen denken, dass sie schwach sein kann. Sie ist die, die sich immer durchbeißt. Sie zieht an, wenn alle anderen müde werden, und springt ein, wenn sich sonst keiner meldet. Carmen wirkt straight und stark. Aber unter ihrer Bluse bricht ihr der Schweiß aus, und ihr Magen fängt wieder an zu schmerzen. Sie ist sich nie ganz sicher, ob das körperliche oder seelische Schmerzen sind. Weh tut es schon lange.
»Hört, hört«, entgegnet er einen Ticken zu laut. Seine Augen funkeln, und er bleckt die Zähne. Sie kann nicht deuten, ob er amüsiert oder gekränkt ist. Dann hat sie wieder Sorge, nach Alkohol zu riechen, und steckt sich eine ihrer Minzpastillen in den Mund. Wird schon keiner merken, dass sie gestern etwas zu viel getrunken hat. Sie bleibt einfach im Hintergrund, sagt auch heute nichts, überzeugt durch ihre inhaltliche Vorarbeit und lässt diesen Zirkus über sich ergehen. Nach dem Meeting tritt Gelbe Socke nah an sie ran. So nah, dass sie sich sicher ist, dass er es riecht. »Dein Arsch war auch mal knackiger«, flüstert er in ihr Ohr. Dann verlässt er den Raum, und Carmen weiß, dass es auch heute Abend eher eine Flasche als ein Glas wird.
Carmen Hampfer ist eine Leistungsträgerin der Generation X. Sie legt Wert auf ihre Karriere. Immer noch ein bisschen mehr, das ist ihr unbewusstes Mantra. Immer noch ein bisschen mehr arbeiten, wissen, können. Sie hat alles gegeben, um in ihrer gut bezahlten Führungsposition zu landen. Gesundheit und Wohlbefinden hintanzustellen, verschaffte ihr lange ein Gefühl von Überlegenheit. Ihre Laufbahn hatte sie seit der Oberstufe geplant: erst Maschinenbaustudium, dann ein paar Jahre bei der Unternehmensberatung, dann rüber in den Konzern, dann rauf im Konzern. Sie ist fleißig und brillant, unglücklich und erschöpft. Und vor allem ist sie einsam. Je höher sie auf der Karriereleiter klettert, desto schroffer erscheint ihr das Umfeld. Und desto männlicher. Mit ihrem Aufstieg hat sich auch ihr Ruf im Konzern verändert. Früher war sie das fleißige Bienchen, heute nennen sie Carmen Eiskönigin. Anders als ihre männlichen Kollegen schien sie mit jeder Beförderung für die anderen unsympathischer zu werden, kritischer beäugt und stärker beobachtet zu sein. Carmen war mal bekannt für ihr lautes Lachen, sie trug bunte Kleider und umarmte zur Begrüßung die halbe Belegschaft. Heute isst sie ihr Mittagessen allein vorm Laptop, weil sie die Blicke der anderen so anstrengend findet und eh keine Zeit hat für Pause. Ihre Haare trägt sie nur noch zum strengen Dutt gebunden, die Farbpalette ihrer Kleidung entspricht der ihrer Konkurrenten auf Führungsebene. Ihre Stimmung hat sich auch angepasst, Dunkelgrau bis Schwarz.
Es macht sie krank, dass es auf dieser Karrierestufe immer seltener um Kompetenz oder um Inhalte geht, dafür immer stärker um Politik: Wer kann seine Interessen am gewieftesten durchsetzen? Wer kann sich am besten inszenieren? Wer eignet sich strategisch für wen auf welchem Posten? Sie mag ihren Konzern, aber es frustriert sie so hart, wie viel Arbeitszeit versickert in persönlicher Profilierung, ineffizienten Prozessen, Postengeschacher und Sich-Wegducken. Während ihres Studiums ging sie nach langen Lerntagen in der Bibliothek mit Kommilitoninnen noch einen Prosecco trinken. Dann redete sie sich den Druck von der Seele, das Diplom mit exzellenter Note bestehen zu müssen. Sie hatte ja keine Ahnung, dass diese Runden ihr irgendwann verloren gehen würden. Sie hatte keine Ahnung, wie sehr der Druck noch steigt.
Laut Angaben des Statistischen Bundesamts liegt der Frauenanteil in akademischen Berufen in Deutschland bei ungefähr 50 Prozent. Dieser Prozentsatz hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Im Schnitt gerechnet sind also rund die Hälfte aller Menschen in Berufen, für die es ein Studium benötigt, weiblich. Ärztinnen, Juristinnen, Ökonominnen, Lehrerinnen – zusammengenommen über alle Berufsgruppen hinweg haben wir hier Gleichberechtigung erreicht. Aber nur auf den ersten Blick. Bei den Führungspositionen spiegelt sich dieser Fortschritt zum Beispiel nicht wider. Auf Vorstandsposten, in der Geschäftsführung und bei leitenden Positionen in Handel, Produktion und Dienstleistung ist weniger als jede dritte Führungskraft weiblich, 2022 waren es 28,9 Prozent. Dieser Wert hat sich in den letzten zehn Jahren nicht maßgeblich verändert.
Das sind die Zahlen hinter dem Begriff »gläserne Decke«. Die Qualifikation ist da, die Möglichkeiten, aufzusteigen, sind es theoretisch auch, aber sowohl die Struktur als auch die Kultur unserer Arbeitswelt bevorzugt Männer. Strukturell kann sich das so zeigen, dass Frauen in exakt derselben Position niedrigere Gehälter bekommen als ihre männlichen Kollegen. Oder darin, dass die Gehälter in »typischen Frauenberufen« wie jenen in der Pflege, der sozialen Arbeit oder der Kinderbetreuung Welten unter dem liegen, was Männer in »typischen Männerberufen« verdienen, also zum Beispiel jenen in Informatik, Technik, Mathematik oder Naturwissenschaften. In Deutschland liegt der sogenannte Gender Pay Gap aktuell bei 18 Prozent. Frauen verdienen pro Stunde im Schnitt also 18 Prozent weniger als Männer. Gleichzeitig wenden sie mehr als doppelt so viel Zeit für unbezahlte Fürsorgearbeit auf. Also dafür, sich kostenlos um Kinder oder andere Angehörige zu kümmern. Wo wir bei den kulturellen Nachteilen wären, die Frauen an die gläserne Decke stoßen lassen. Mal ganz davon abgesehen, dass es Energie kostet, nach einem regulären Arbeitstag noch eine zweite und dritte Schicht für Sorgearbeit einzulegen – oft finden die wichtigen, für Beförderungen relevanten informellen Runden zu Zeiten statt, in denen Frauen Einkäufe für ihre pflegebedürftigen Eltern erledigen, ihre Kinder ins Bett bringen oder ihnen bei den Hausaufgaben helfen. Und wenn sie für eine Firmenfeier einen Babysitter organisiert haben, gibt es nach dem Essen in manchen Kreisen sogar heutzutage noch »Zigarren und Whisky für die Herren«. Es ist gar nicht mal so, dass Frauen hier aktiv ausgeschlossen werden, aber die Gepflogenheiten, über Jahrzehnte hinweg von Männern geformt, machen es für sie ungleich anstrengender, teilzunehmen und aufzusteigen – geschweige denn an die Spitze zu gelangen.
Viele Unternehmenskulturen belohnen Ellenbogen, Wettbewerb und jene, die Auseinandersetzungen suchen. Da geht es ab einem gewissen Level nicht mehr um Bestenauslese, sondern um Kampfstärke. Rücksichtnahme und für andere mitdenken entwickelt sich in diesem Kontext zum geldwerten Nachteil. Aber darauf sind Frauen durch ihre Sozialisation gepolt. Die Dilemmata, die das mit sich bringt, beschreibt die Journalistin und Topmanagerin Mirijam Trunk in ihrem Buch Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte. Zum einen stellt Mirijam darin ein interessantes Modell der Professorin Christiane Funken vor. Es veranschaulicht den Sozialisationsunterschied zwischen Jungs und Mädchen – und liefert damit eine weitere Erklärung dafür, warum es Frauen in der Regel schwerer fällt, sich durchzusetzen. Laut Funken wachsen Mädchen in horizontalen Kommunikationssystemen auf, Jungs in vertikalen. Im horizontalen System ist der oberste Wert das Gemochtwerden, im vertikalen System hingegen das Respektiertwerden. Jungs lernen also von früh auf, wie sie Wettkampf und Kooperation miteinander vereinbaren. Für sie sind Konflikte ein Instrument, um Interessen durchzusetzen. Sie machen schon in jungen Jahren die Erfahrung, dass Beziehungen es abkönnen, sich in der Sache zu streiten. Mädchen hingegen lernen, dass Konflikte etwas Persönliches und damit etwas Bedrohliches sind. Ihr Wohlfühlmodus ist daher in der Regel nicht der Wettbewerb, sondern die Harmonie. Wer das verinnerlicht hat, geht Konflikten natürlich lieber aus dem Weg, anstatt anzuecken. Und dass wir das alle mehr oder weniger so lernen, hat noch auf einer weiteren Ebene Konsequenzen.
Denn wenn Frauen sich dazu überwinden, diese Sozialisationsmauer einzureißen, rennen sie schon gleich gegen die nächste. Wie die aussieht, illustriert Mirijam Trunk damit, wie »Begriffe im Geschlechterkontext ihre Bedeutung verändern«. Sie zitiert dafür einen Text der Journalistin Lara Fritzsche, der sich auf den Wahlkampf von zwei Spitzenpolitikerinnen bezog – und der es auf den Punkt bringt: »Aus energisch wird hysterisch. Aus konsequent wird zickig. Aus realistisch wird verbittert. Aus attraktiv wird Barbie. Aus Vollzeitpolitikerin wird Rabenmutter. Aus durchsetzungsstark wird eiskalt. […] Aus emotional wird gaga. Aus machtbewusst wird Königsmörderin.« Im Anschluss an dieses Zitat spricht Mirijam noch aus eigener Erfahrung. Nachdem sie die Geschäftsführung eines Start-ups übernommen und es erfolgreich am Markt etabliert hatte, erzählte ihr ein Kollege, sie sei ja bekannt als pushy und nervig. In ihrem Buch fragt sie: »Was hätte er wohl zu einem männlichen Geschäftsführer gesagt, der nach drei Jahren eine Firma in die schwarzen Zahlen und eine gute Marktposition geführt hat? Wären pushy und nervig die ersten Worte gewesen, die ihm über die Lippen gekommen wären? Durchsetzungsstark, ein Macher, lässt nicht locker – im männlichen Kontext wäre die Bewertung sehr wahrscheinlich anders ausgefallen.«
Ja, wahrscheinlich. Und um diese Doppelstandards überhaupt mal sichtbar zu machen, sind Bücher wie ihre so wichtig. Denn das Gemeinste und Energieraubendste an der gläsernen Decke ist, dass sie oft so blitzblank geputzt ist, dass sie gar nicht wie eine Hürde wirkt. Durch das Glas können sowohl Frauen als auch andere strukturell und kulturell benachteiligte Gruppen all die Möglichkeiten sehen. Sie schauen nach oben, und in ihren Ohren ertönt die Erzählung moderner Industriegesellschaften, es herrsche Chancengleichheit in der Arbeitswelt. Erst langsam erkennen und spüren sie, dass das eine Illusion ist. Dass es sich beim Versprechen, gesellschaftlicher Status, Aufstieg und Erfolg gingen auf die eigene Leistung zurück, zu großen Teilen um Wunschdenken handelt, um nicht zu sagen: um eine Lüge. Denn für gesellschaftlichen Status, Aufstieg und Erfolg spielen in erheblichem Maße Herkunft, Besitz, Alter, Aussehen und Geschlecht eine Rolle. Diese Schieflage zwischen angeblicher Chancengleichheit und Strukturen, die diese verhindern, übersetzt sich in Phänomene, die wir alle kennen: Maximilian bekommt schneller eine Eins als Kenan oder Kevin. Armutsbetroffene müssen Pfade schlagen, um vom Bildungssystem zu profitieren, während Wohlstandskinder auf gut ausgebauten Straßen Richtung Hochschule kutschiert werden. Übergewichtige Menschen bekommen nach Bewerbungsgesprächen Absagen, weil unsere Gesellschaft sie als undiszipliniert und faul stigmatisiert, während wir großen Männern mit ausgeprägtem Kinn automatisch Führungsstärke attestieren. Und Frauen erleben eben nach wie vor, dass sie qua Geschlecht weiter unten starten, wenn es um die Anerkennung dessen geht, was sie leisten. Weil der gesellschaftliche Standardmodus ihre Arbeit im Verhältnis erst mal schlechter bewertet und bezahlt als die von Männern. Um voranzukommen, müssen sie also mehr leisten. Diese Denk- und Bewertungsmuster sind so tief in unseren Umgangsformen verankert, dass wir sie ohne entsprechende Aufklärung gar nicht bemerken. In ihrer Konsequenz führen sie dazu, dass die Balance zwischen Einsatz und Belohnung verrutscht. Hier liegt eine Quelle für psychische Belastung und eine massive Bedrohung für den eigenen Selbstwert. Der Schweizer Medizinsoziologe Johannes Siegrist nennt dieses Ungleichgewicht in der Arbeitswelt Gratifikationskrise. Gratifikationskrisen fördern ungesundes Verhalten wie Stresstrinken. Darin dürfte eine Erklärung dafür liegen, dass der Alkoholkonsum bei Frauen mit zunehmender Qualifikation und beruflicher Teilhabe steigt. Denn es ist tatsächlich so, dass Frauen mit einem hohen Bildungsabschluss im Durchschnitt mehr trinken als jene mit niedrigem Bildungsabschluss. Und wenn wir uns die Gruppe derjenigen Frauen anschauen, die entweder fast täglich trinken oder sich regelmäßig betrinken, dann zeigt sich: Über 70 Prozent davon sind berufstätig.
Bewegen sie sich dann auch noch in so männerdominierten Sphären wie Carmen, geraten sie automatisch in eine Außenseiterinnenrolle. Sie fallen stärker auf und verspüren Druck, sich an Gegebenheiten anzupassen, die weder zu ihrer Sozialisation noch zu ihren Lebensumständen passen. Das fördert zusätzlichen Stress. Im Rahmen der 2009 veröffentlichten Shape-Studie an hochambitionierten Persönlichkeiten befragten Forschende 500 Führungskräfte des mittleren und oberen Managements zu Bereichen wie Gesundheitszustand, persönlicher Arbeitsbelastung und Work-Life-Balance. Den Ergebnissen zufolge erlebten weibliche Managerinnen signifikant mehr chronischen Stress, sowohl im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung als auch im Vergleich zu ihren – durchaus ebenfalls belasteten – männlichen Managerkollegen.
GEN X
Carmen gehört zur Generation X, also zu jenen, die zwischen 1965 und 1980 zur Welt kamen. Ihre Jugend war geprägt vom Kalten Krieg, dem Fall des Eisernen Vorhangs und der beginnenden digitalen Revolution. Es heißt, die Gen X strebe nach Selbstständigkeit und Unabhängigkeit, weil sich traditionelle Familienstrukturen in ihrer Kindheit und Jugend zu wandeln begannen: mehr Scheidungen, mehr arbeitende Mütter. Diese Generation hat den Übergang von der analogen zur digitalen Welt mitgestaltet, kennt also beide gut.
Frauen der Generation X sind nicht mehr die Ersten auf ihren Positionen, aber sie sind noch immer Vorreiterinnen, noch immer die Minderheit. Auf dem Weg zu mehr Verantwortung im Arbeitsleben schuften sie, klotzen sie, dringen in männliche Sphären vor und passen sich dort den Gepflogenheiten an. Das geschieht bei der Kleidung, im Habitus, im Führungsstil und auch beim Alkoholkonsum. Und das ist normal. Menschen passen sich ihrer Umwelt immer an. Umgebung formt Menschen, Ämter formen Menschen, Posten formen Menschen. Durch Gründerinnen, ihr Auftreten in sozialen Netzwerken, Podcasts und zunehmende Solidarisierung unter Frauen ändert sich das zwar langsam. Immer mehr weibliche Führungskräfte kleiden sich bunt und feminin, nehmen den Menschen stärker in den Blick als die Sache, sprechen über psychische Belastungen, gesunde Lebensführung und Pausen, führen horizontal und inklusiv, mit Emotion, Verletzlichkeit und Verständnis für Periodenschmerzen, Kitaschließzeiten und Wechseljahre. Aber das sind die Anfänge. In Bereichen wie dem Konzernleben oder der Politik weht noch ein anderer Wind. Hier regiert oft noch der Druck, hier werden die 70-, 80- und 90-Stunden-Wochen durchgeballert, und hier sind alkoholgetränkte Runden eben auch oft noch entscheidend für Karrieren. Wobei, was das betrifft, gleich ein doppeltes Ungleichgewicht herrscht. Denn die psychischen und körperlichen Schäden, die durch Alkoholkonsum auftreten, zeigen sich bei Frauen schneller und schwerer als bei Männern. Dazu zählen depressive Verstimmungen und Depressionen, Panikattacken und andere Angsterkrankungen, Sodbrennen und Magengeschwüre, dazu zählt Abhängigkeit. Fachleute bezeichnen dieses Phänomen als Teleskopeffekt. Er ist der Grund dafür, dass Schutzfaktoren wie geringere Verträglichkeit oder späterer Einstieg in den Alkoholkonsum Frauen schlechter vor schädlichen Folgen bewahren, als sie das bei Männern tun. Frauenkörper sind sensibler, was Alkoholkonsum betrifft. Bei gleicher Trinkmenge weisen sie in der Regel eine höhere Blutalkoholkonzentration auf. Das liegt zum einen daran, dass sie im Schnitt kleiner sind und weniger Körpervolumen haben als Männer. Zum anderen, dass sie von Natur aus mehr Fett und weniger Wasser im Körper haben. Der Alkohol konzentriert sich daher stärker, weil weniger Wasser ihn weniger verdünnt. Hinzu kommt, dass der weibliche Körper Alkohol langsamer abbaut. Die giftige Wirkung entfaltet sich also stärker und länger.
Sabine, 63 | Babyboomer | Lieber nichts fühlen als diese Entwertung
Sabine schwitzt, als sie sich die Treppen hochschleppt. Es ist 14 Uhr, und die Hitze hat sich mittlerweile auch im Haus breitgemacht. Sie hört ihr Keuchen, riecht ihren Körper. Noch ist sie nicht dazu gekommen, sich zu waschen. Langsam stapfen ihre Füße auf die Marmorstufen ihrer Bogentreppe. Als sie wahrnimmt, wie geschwollen sie sind, erschrickt sie kurz. Dann verdrängt sie die Angst, die immer aufsteigt, wenn sie diese Schwellungen sieht. Ebenso wie die Tatsache, dass ihr Schlabberkleid schon lange nicht mehr schlabbert. Ihr ist so schwindelig, dabei hat sie doch nur ein Gläschen getrunken. Nicht morgens, natürlich nicht, nie morgens. Aber heute bei diesen Temperaturen, in diesem knallheißen Sommer, in ihrem leeren Haus, da hat sie sich ausnahmsweise schon mittags eins gegönnt. Wie gestern auch. Und vorgestern. Und wenn sie ehrlich ist, dann steht »ein Gläschen« auch eher für zwei Gläser.
Als sie in der ersten Etage ankommt, muss sie sich an der Wand abstützen, um nicht umzukippen. Ihr Herz rast, ihr Mund schmeckt sauer. Sie hebt den Kopf, und ihr Blick fällt ins ehemalige Kinderzimmer, in diesen schönen, hellen Raum, der ihr mal so vertraut war. Hier ist ihr geliebter Sohn erwachsen geworden. Lange hatten ihr Mann Werner und sie es probiert und schon fast nicht mehr dran geglaubt, aber als Sabine 40 war, klappte es doch noch. Sie brachte Alexander zur Welt, ihr Ein und Alles. Sabine erinnert sich daran, wie sie morgens in dieses Zimmer kam, als Alexander noch klein war. Wie sein Lockenkopf auf seinem Elefantenkissen lag, wie er selbstvergessen »Kleine Spinne« sang und mit seinen Fingerchen die Bettdecke entlangkrabbelte. Wie er strahlte, sobald er sie bemerkte. Wie sie zu ihm ging und ihn umarmte, seinen Duft in ihrer Nase. Wie schön das war. Wie schön sie war, damals. Wie erfüllt. Sie ging darin auf, Werner den Rücken freizuhalten und hier alles zu managen, war so gern Mutter und Hausfrau. Brotdosen packen, Spieleabende organisieren, Fernurlaube planen, Werner einkleiden, Werner zuhören, bei Hausaufgaben helfen, Mittagessen kochen, Elternbeiratssitzungen organisieren und Alexander herumfahren von Pfadfindern zu Fechtturnieren. Hat ihr das eigentlich jemals jemand gedankt? Hat sie eigentlich jemals jemand gefragt, ob es für sie okay ist, hier einen Fitnessraum einzurichten? Werner zumindest nicht. Der stellte eines Tages einfach Hantelbank und Fahrradergometer in das alte Kinderzimmer und fing an zu trainieren. Seit Alexander ausgezogen ist, um Forstwirtschaft zu studieren, verhält Werner sich so komisch. Er wechselte die Themen, spricht nicht mehr über Unternehmertum und Gänseleber, sondern über Intervallfasten und Achtsamkeit, macht einen auf gesundheitsbewusster Familienmensch. Erzählt ihr, wie schön er es gefunden hätte, mehr Zeit mit Kindererziehung zu verbringen. Wie gern er im Garten geholfen hätte. Wie viel Druck es für ihn bedeutete, derjenige zu sein, an dem die Familienexistenz hing. Sabine kann da nicht mehr folgen. Sie fand ihr Leben nämlich schön, so wie es war. Sie wollte auch nicht, dass sich etwas verändert. Werner offensichtlich schon. Sie empfindet das als persönlichen Angriff. Du hast mich zu sehr unter Druck gesetzt, hört sie aus seinen Worten. Er sagt es nicht, aber Du alte Glucke musstest dich um alles kümmern, hast alles an dich gerissen. Du bist fett geworden und solltest auch mal aufs Fitnessbike, das hört sie.
Sabine Schneider ist eine treue Seele mit teurem Geschmack. Status ist ihr wichtig. Ansehen ist ihr wichtig. Sie ist gutmütig, doch sie hat auch einen untrüglichen Blick für Makel. Das war schon so, als Werner sie zum ersten Mal zum Tanzen aufgefordert hat. Noch bevor sie sein Lächeln sah, erkannte sie sein schlampig gebügeltes Hemd. Aber Werner war lieb und großzügig und versprach ihr ein gutes Leben. Durch die Heirat mit ihm ist sie sozial aufgestiegen. Er war schon immer so ein Fleißiger, ganz Korrekter. Die beiden waren sich einig: Er verdiente das Geld, Sabine wuppte den Haushalt. Und sie liebte dieses Leben. Was konnte sie sich früher daran erfreuen. An der Schönheit der Hortensien vor ihrem Haus, am Kinderlachen unter ihren Kirschbäumen, an Grillpartys am Wochenende im Garten, am Gefühl eines startenden Flugzeugs, an einem perfekt genähten Saum, am Eintauchen in historische Romane in ihrem Lesesessel, am Vogelgezwitscher am Morgen, an Alexanders Humor und Werners Scharfsinn. Daran, wie Werner abends eine Flasche ausgesuchten Rotwein entkorkte und ihr bei einem Glas von seinem Tag erzählte. Was für ein Genuss! Und ein Glas soll ja auch gesund sein, wegen des Resvera-trols, das hat sie mal gelesen. Sie war damals so beschäftigt, dass es ihr nicht in den Sinn gekommen wäre, sich ein zweites einzuschenken. Nie konnte sie die Frauen verstehen, die sich im Literaturclub darüber unterhielten, dass es schon auch mal eine Flasche wird. Es war gar nicht mal so, dass sie die Nase darüber rümpfte, aber sie selbst wäre nicht auf die Idee gekommen, mehr zu trinken als ihr eines Glas.
Diese Frau in ihrer Erinnerung hat kaum noch etwas mit der Gestalt zu tun, die heute durchs Haus geistert. Die freut sich über gar nichts mehr. Vielleicht noch über den ersten Schluck Wein, aber selbst der verliert seinen Reiz. Das Gute ist, dass dafür aber auch kaum noch etwas wehtut. Vielleicht ist das der Preis, um sich das Gefühl von Enttäuschung vom Leib zu halten. Die brutale Wahrheit, dass ihr das Leben all die Schönheit auch wieder geraubt hat. Früher hat sie darauf gewartet, dass Werner nach Hause kommt und den Rotwein holt, mittlerweile macht sie das selbst, und meistens trinkt sie deutlich mehr als ein Glas. Irgendwie hat Werner mit seinem Gehabe alles entwertet. Ist weitergezogen und hat sie zurückgelassen in einer Lebensphase, die es nicht mehr gibt und die er anscheinend auch ganz schrecklich fand. Gemein ist das.
»Mama?«
Sabine zuckt zusammen. Sie fühlt sich ertappt und weiß kurz nicht, warum. Dann fällt es ihr ein. Sie schaut auf den Boden, während sie redet, damit er ihren Atem nicht riecht. »Gütiger Himmel, Alexander, was machst du denn hier?«
»Ich sollte dir doch mit dem Garten helfen.«
Alexander kneift die Augen zusammen. In einer Millisekunde hat Sabine ihren Sohn gelesen. Er ekelt sich.
»Sind das Rotweinflecken auf deinem Kleid?«
Sabine schaut an sich herunter. Das sind Rotweinflecken.
»Nein.« Ihre Stimme rutscht in den Kopf, wird hoch und schrill. »Nein, nein! Das ist von dem Rote-Bete-Mixgetränk, das ich für deinen Vater machen soll. Der lebt ja jetzt so gesund und ›achtsam‹.«
Sabines Finger malen Anführungszeichen in die Luft. Alexander legt die Stirn in Falten. »Mama, ich …«, doch Sabine redet weiter.
»Der jagt gerade jeder neuen Mode hinterher, sag ich dir. Weißt du, was in ihn gefahren ist? Mit ihm solltest du mal sprechen. Diese Flecken kriegt man jedenfalls nicht mehr raus, aber das interessiert in diesem Haushalt ja niemanden.«
Sie spürt, dass er ihr das nicht abkauft, aber sie hofft, dass er mitspielt. Dass er ihnen beiden den Gefallen tut und mitspielt.
Aber heute spielt er nicht mehr mit. »Mama, ich mache mir Sorgen um dich. Und Papa auch.«
BABYBOOMER
Sabine gehört zu den Babyboomern, manchmal auch Boomer genannt. Diese Generation kam nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zur Welt, in den Jahren 1946 bis 1964. Es waren Jahrzehnte, in denen im geteilten Deutschland nicht nur die Wirtschaft einen Boom erlebte, mit ihr boomten auch die Geburtenraten, daher der Name. Sie sanken erst wieder, als in den 60ern sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR die Antibabypille auf den Markt kam.
Die ostdeutschen Boomer erlebten ihre Jugend hinter der Mauer mit einem Lebensgefühl zwischen Aufsässigkeit und Resignation. Sie hörten das staatliche Jugendradioprogramm DT64 und besorgten sich gleichzeitig Karl-May-Bücher. Die westdeutschen Boomer marschierten währenddessen zu Antiatomprotesten und sahen im Fernsehen Berichte über den RAF-Terror. Sie verinnerlichten, dass sozialer Aufstieg möglich ist, wenn man sich nur stark genug dafür einsetzt. Boomer gelten als pflichtbewusst mit hoher Arbeitsmoral. Stabilität, Loyalität und Sicherheit zählen viel in dieser Generation. Mittlerweile kommen sie ins Rentenalter und müssen sich von Jüngeren vorwerfen lassen, welch gewaltiger Naturverbrauch mit ihrem Wohlstand einherging.
Während Babyboomer-Frauen in der DDR in der Regel arbeiten gingen, repräsentiert Sabine Schneider eine Generation westdeutscher Frauen, für die zu Hause zu bleiben ein Statussymbol war. Wobei das Wort Hausfrau natürlich verschleiert, dass Hausarbeit und Kindererziehung ebenfalls Arbeit sind. Wenn die Kinder ausziehen, fühlt es sich demnach auch häufig nach Arbeitslosigkeit an – und kann auch ähnliche Folgen haben. Plötzlich ist da Leere, ein Tag, der gefüllt werden will. Aber es gibt weniger Aufgaben und kaum noch jemanden, der dich braucht. Das schlägt auf den Selbstwert, familiäre Spannungen und Konflikte brechen auf oder nehmen zu. Je weniger Erfolgs- und Sinnerleben der Alltag bereithält, desto stärker sinkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, Probleme zu lösen, Herausforderungen zu meistern und sein Leben gestalten zu können. Das wiederum zieht einen Rattenschwanz aus Lethargie, Müdigkeit und Teilnahmslosigkeit nach sich – und oft auch erhöhten Alkoholkonsum. Wenn Trinken eh schon eine Gewohnheit war, wie bei Sabine, dann liegt ein häufigerer Griff zum Glas nahe. Zum einen, um diese unangenehmen Gefühle von Langeweile und Nutzlosigkeit zu dämpfen. So mündet Gewohnheitstrinken schleichend in Wirkungstrinken. Zum anderen aber auch schlichtweg dadurch, dass es keinen Grund mehr zu geben scheint, nicht zu trinken. Wenn du dir früher abends ein Glas Wein eingeschenkt hast, nachdem das Taschengeld ausgezahlt, die Schulprüfungen vorbereitet und die kommenden Tage organisiert waren, dann trinkst du heute, ohne groß drüber nachzudenken, eben auch schnell mal mittags ein Glas, wenn die Lebensmittel eingekauft und die Fenster geputzt sind. Alkoholtrinken ist oft ein Automatismus. Und das kann in Kombination mit der Tatsache, dass es sich um eine süchtig machende Droge handelt, schnell dazu führen, dass sich dieser Automatismus in herausfordernden Lebenssituationen ausbreitet – und es ist eine Herausforderung, wenn Kinder das Elternhaus verlassen.
Fallen Menschen, die sich vorher um die Fürsorgearbeit gekümmert haben, dann in ein Loch, nennt sich das Empty-Nest-Syndrom, wörtlich übersetzt Leeres-Nest-Syndrom. Es handelt sich nicht um eine Krankheit, sondern um ein relativ junges Phänomen. Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es das im Grunde nicht, weil Menschen gar nicht so lange lebten, als dass sie in ein Loch hätten fallen können. Das Empty-Nest-Syndrom entwickelte sich also erst mit Anstieg der Lebenserwartung. Heute haben Eltern nach dem Auszug der Kinder noch mal ungefähr ein Drittel ihres Lebens vor sich, Paare noch mal rund die Hälfte ihrer Partnerschaft. Manche bemerken in dieser Phase kaum einen Unterschied, was ihr Wohlbefinden angeht, erst recht nicht, wenn die Kinder in der Nähe bleiben und Enkelkinder zur Welt kommen, die wiederum Fürsorgearbeit bedeuten. Das ist aber lange nicht mehr die Regel. Oft ziehen Kinder in andere Städte, manchmal sogar in andere Länder. Manche Eltern feiern die Autonomie, die damit einhergeht. Sie stürzen sich ins Leben, gestalten sich die Tage und ihr Zuhause nach ihren Vorstellungen und genießen es, den Fokus wieder auf sich, ihre Liebesbeziehung, ihre Hobbys und ihre Freundschaften richten zu können. Andere erfahren einen Kompetenzverlust, weil das, was sie gut können, nicht mehr zum Einsatz kommt. Sie erleben sich selbst nicht mehr als wirksam und fühlen sich isoliert ohne ihr Rudel, um das sie sich kümmern können. Vor allem Frauen, die sich in erster Linie über ihre Mutterrolle identifiziert haben, kann die Tatsache, nicht mehr gebraucht zu werden, aus der Bahn werfen. Oft fällt diese Lebensphase auch noch mit den Stimmungs- und Befindlichkeitsschwankungen der Wechseljahre zusammen. Für Partnerschaften kann die Intensität dieser Etappe ähnlich heftig sein wie die Phase nach der Geburt des ersten Kindes. Ähnlich heftig und ähnlich kritisch. Denn wenn diese Veränderungen Gefühle von Einsamkeit, Entwertung, Isolation und Sinnlosigkeit hervorrufen, bringt das alles, was nicht passte in der Beziehung, zum Vorschein. Viele Umbrüche also, viele Unsicherheiten, ein idealer Nährboden für neue Rituale und Gewohnheiten, sowohl für gute als auch für schlechte. Wenn Alkohol im Spiel ist, leider oft für schlechte. Denn Alkohol raubt Energie und belastet die psychische Gesundheit. Frauen über 50 leiden den Diagnosedaten zufolge überdurchschnittlich häufig an depressiven Symptomen oder an Symptomen einer Angststörung. Schlaflosigkeit, Unruhe und Unzufriedenheit sind schwer zu ertragen. Ohne gute Behandlung gehen sie oft Hand in Hand mit Alkohol- und oft auch mit Tablettenkonsum. Diese kurzfristige Erleichterung hat zur Folge, dass Frauen ihr Unglück herunterschlucken und schweigen. Anstatt ihren Schmerz zu artikulieren, verstummen sie. Der Drogenkonsum überlagert die Chance, in eine neue, selbstbestimmte Lebensphase aufzubrechen, in der du ausschlafen und Tage nach deinem Geschmack gestalten kannst. Er nimmt dir die Möglichkeit, unangenehme Gefühle als Wegweiser zu betrachten, weil er dir nach und nach vermittelt, dass du gar nicht in der Lage bist, unangenehme Gefühle auszuhalten und zu verarbeiten, geschweige denn ihren Nutzen zu erkennen.
Das ist ein schleichender Prozess, und vieles davon passiert unbewusst. Es kann sein, dass du dein Glas Wein am Abend als völlig harmlose Belohnung empfindest. Denn hey, die Kinder sind aus dem Haus! Was du da geleistet hast in den vergangenen Jahrzehnten, verdient Hochachtung. Du hast ein Baby auf dem Weg ins Erwachsenenleben begleitet. Hast jahrzehntelangen Bereitschaftsdienst hinter dir, hast deine Bedürfnisse zurückgestellt, dich gesorgt, mitgefiebert, mitgelitten, mitgedacht und mitgeholfen. Natürlich hast du dir eine Belohnung verdient. Aber vielleicht geht es eben gar nicht um Belohnung, sondern darum, deinen Schmerz zu lindern. Dieses schreckliche Gefühl von Verlust. Vielleicht trinkst du, um nicht trauern zu müssen – ein ziemlich sicherer Weg in die Depression. Und ein klassischer Weg ins Alkoholproblem.
Sabines Beispiel verdeutlicht somit etwas, das wichtig ist zu verstehen: Alkoholprobleme können sich auch im Alter noch entwickeln. Die Tatsache, dass jemand in jungen oder mittleren Jahren kaum oder »moderat« trinkt, bedeutet nicht automatisch, dass das ein Leben lang so bleibt. Tatsächlich ist es vielmehr so, dass bei Frauen der sogenannte late-onset – der späte Start in die Abhängigkeit – häufiger vorkommt als bei Männern. Dass also Frauen suchtassoziierte Probleme tendenziell eher nach dem 25. Lebensjahr, manchmal sogar erst im Rentenalter entwickeln, während das bei Männern eher schon in der Jugend beziehungsweise im sehr jungen Erwachsenenalter der Fall ist.
Helga, 81 | Stille Generation | Ehrliche Haut mit Geheimnissen
»Singst du’s für mich, an meinem Achtzigsten?« Heidemaries blaue Augen leuchten wie ein Dorfteich in der Sonne.
»Was? Ute Freudenberg? Heidemarie, das ist nicht dein Ernst!« Helgas dunkles Lachen dröhnt durchs Wohnzimmer. Sie trägt eines ihrer lustigen Shirts. Heute steht drauf:
Ischschwör
ischbin
vollromantisch
Sie hat das bei einer Künstlerin namens Vigdis entdeckt und findet es total witzig. Letztens hat sie sich noch eins gekauft, auf dem vorne ein rotes Herz prangt. Hinten steht Bad Bitches Everywhere. Aber ihr Favorit ist ein schwarzes Shirt, auf dem in schwarzer Schrift Titties steht. Man muss schon sehr genau hinschauen, um das lesen zu können. Helga greift nach rechts und krault den Kopf ihrer Zwergpudelhündin Lexa. Die fängt an, mit dem Schwanz zu wedeln. Wie immer, wenn ihr Frauchen sich amüsiert. Dann legt Lexa sich hin und schlägt ihre Vorderbeine übereinander, sie ist eindeutig die Vornehmere von den beiden.
»Auslachen werden die dich, Heidemarie! Deine Kinder, deine Enkelkinder, die ganze feine Gesellschaft. Soll ich nicht lieber was von den Stones singen? Oder zumindest ›Über sieben Brücken musst du gehn‹?«
Lexa bellt.
»Nein, Helgalein. Das ist mein Geburtstag, und ich wünsche mir, dass du Ute Freudenberg singst.«
Mit einer schnellen, fast abgehackten Bewegung pfeffert Heidemarie die Würfel in den Becher. Die beiden Freundinnen spielen Kniffel und trinken ein bisschen Bier, wie jeden Dienstagnachmittag. In gut neun Monaten wird Heidemarie 80, und sie schmeißt ein Fest in der Stadthalle. 200 Leute werden kommen. Alles, was Rang und Namen hat.
»Welches Lied soll ich denn singen? ›Jugendliebe‹?«, fragt Helga belustigt.
»Sehr witzig. Nein, bitte sing ›Herzen kriegen keine Falten‹.«
»Heidemarie!« Helga wirft ihren Oberkörper vor Lachen auf den Tisch, der Kniffelbecher fällt um, Lexa jault, aber Heidemarie verzieht keine Miene.
»Ich wünsch mir das von dir, Helgalein. Wenn du das singst, ist es das schönste Lied auf Erden.«
Helga beißt auf ihre Unterlippe, um den nächsten Lachkrampf zu unterdrücken. Sie atmet tief ein, und ihr Herz dehnt sich aus. Das ist so typisch für Heidemarie. Sie war schon immer ein Sturkopf, und ob sie sich blamieren könnte, war eine Frage, die sie sich nicht stellte.
»Nun gut. Soll ich danach noch ›Die Internationale‹ singen? Die fandest du auch mal gut«, neckt sie ihre Freundin.
Heidemarie zwickt sie. »Jetzt werd man nicht so frech, Helga. Die Melodie fand ich gut, also Ruhe jetzt. Ein Lied, dann darfst du in der Menge baden und dich anbeten lassen.«
»Zu Befehl«, sagt Helga, nippt an ihrem Bier und schaut auf ihre Hündin, die nun mit offenem Maul auf dem Rücken liegt, ihre Zunge zur Seite raushängen lässt und ihre Hüften hin und her schmeißt. Es könnte nichts Schöneres geben als diese Nachmittage mit den beiden Wesen, die ihr auf dieser Erde die liebsten sind. Nur ganz am Rande ihres Bewusstseins schwebt die Erinnerung an einen kleinen, harten Knoten, der ihr heute Morgen beim Duschen auffiel.
Helga von Skopnik wurde im Luftschutzbunker geboren, mitten in der Nacht. Es ist ein Wunder, dass sie überlebt hat. Der Putz bröckelte ihrer Mutter in den Mund, während sie lauter schrie, als die Bomben dröhnten, und Helga mit der letzten Wehe zur Welt brachte. Mein Wunder, hatte ihre Mutter sie immer genannt. Es wurde Teil ihres Selbstverständnisses. Wer so etwas überlebt, kann alles schaffen.
Helga sah zeit ihres Lebens »interessant« aus. Sie galt nie als schön, doch ihr Charme und ihr Selbstvertrauen ziehen andere bis heute in ihren Bann. Helga ist witzig, direkt und ehrlich. Aber sie hat ein Geheimnis. Sie ist verliebt in ihre Freundin Heidemarie. Sie war es schon, als die beiden unter Bombenbeschuss laufen und später in den Berliner Trümmern klettern lernten. Sie war es, als ihre Mütter die Stadt wieder aufbauten und den Mädchen beibrachten anzupacken. Sie war es, als ihre Väter aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrten und die Rolle des Familienoberhauptes beanspruchten, in die ihre Mütter längst hineingewachsen waren. Sie war es, als Ulbricht die Mauer hochzog, und sie war es, als sie kurz darauf den Reißverschluss von Heidemaries Brautkleid zuzog. Helga weinte bitterlich, als sie ihre Freundin zur Eheschließung zum Kulturhaus schreiten sah. Nicht vor Freude, sondern vor Sehnsucht. Vor lauter Kummer, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Als Helga schließlich selbst Ja sagte und Ernst heiratete, dachte sie an Heidemarie. Obwohl sie Ernst mochte. Mochte, nicht liebte. Denn Helga liebte Heidemarie. All die Jahre. Als Heidemarie den Sozialismus als Ingenieurin unterstützte und Helga in den staatlichen Kitas Kinder betreute, damit Frauen wie Heidemarie das tun konnten. Sie liebte Heidemarie, als sie ihr auf Spaziergängen die Ohren vollheulen konnte über Strukturen, in denen die Kinder alle zur selben Zeit aufs Töpfchen gehen und den Teller aufessen mussten. Helga vertraute Heidemarie so sehr, dass sie ihr erzählte, wie sie übersah, wenn Kinder ihr Fleisch in den Schürzen verschwinden ließen, weil sie satt waren und nicht mehr konnten. Wie sie überhörte, wenn Kinder von geheimen Treffen mit ihren geflüchteten Vätern erzählten oder wenn sie Lieder aus dem Westfernsehen sangen. Sie hätte die Familien der Kinder nie denunziert, und sie wusste, dass Heidemarie sie genauso wenig verraten hätte. Helga liebte Heidemarie in diesem Land, das nur Vati, Mutti und Kind kannte und in dem Homosexualität offiziell nicht vorkam. Sie liebte sie, als die Mauer fiel und die Diktatur implodierte. Als ihre erste Hündin starb. Als ihre zweite Hündin starb. Als Ernst starb und bald darauf Heidemaries Mann. Sie liebte jede Falte, die Heidemarie mit den Jahren bekam. Sie liebte alles an ihr, aber sie hat sich noch nie getraut, es ihr zu sagen. Helga war ein Wunder, dem eines der größten Wunder überhaupt verwehrt blieb: die romantische Liebe zu der Person, die man liebt.
Und wenn Helga ganz ehrlich ist, dann hat sie noch ein zweites Geheimnis. Sie trinkt manchmal auch allein, heimlich, wenn niemand es mitbekommt. Nie im Übermaß. Aber schon so viel, dass es ihr vor anderen unangenehm wäre. Denn nach dem zweiten Bier verliert sie die Kontrolle über ihre Mimik, und nach dem dritten verliert sie die Kontrolle über das, was sie sagt. Was gar nicht gut ist. Denn Helga wird vulgär, wenn sie so viel Alkohol im Blut hat. Sie weiß das. Starker Alkoholkonsum war ihr deshalb schon immer ein Dorn im Auge. Schon vor diesen ganzen Gesundheitstrends. Aber wenn sie nach Hause kommt, dann ist da niemand außer Lexa, und das macht sie immer trauriger. Natürlich hat sie Heidemarie, aber die fühlt sich in erster Linie ihrer Familie verbunden, ihren drei Kindern und sieben Enkeln. Helga hat nie Kinder bekommen. Sie wollte keine, und irgendwie ist außer Heidemarie und Lexa niemand geblieben. Sie fühlt sich oft einsam, da hat sich das mit dem heimlichen Bier so festgesetzt.
STILLEGENERATION
Darunter fallen die Jahrgänge zwischen 1928 und 1945. Diese Generation erlebte Massenarbeitslosigkeit, den Aufstieg Hitlers, den Zweiten Weltkrieg und seine direkten Folgen. Hier liegt auch die Erklärung dafür, dass sie als sparsam, anpassungsfähig und resilient gilt. In der Bundesrepublik beeinflusste sie im Anschluss der Siegeszug des Fernsehens sowie die ersten Schritte der wirtschaftlichen europäischen Integration. Wer im ostdeutschen Teil des Landes aufwuchs, so wie Helga, für den waren Ereignisse wie der Aufstand des 17. Juni, der Mauerbau und eine Gesellschaft auf dem Weg in die nächste Diktatur prägend.
Wenn wir Frauen wie Helga von Skopnik mit Frauen anderer Altersgruppen vergleichen, müssen wir im Hinterkopf behalten, dass hier zwei Umstände überlappen. Zum einen repräsentiert Helga eine Generation, die unter völlig anderen Bedingungen aufgewachsen ist als die anderen Protagonistinnen in unserem Buch. Die stille Generation hat beigebracht bekommen, dass sich übermäßiger Alkoholkonsum als Frau nicht gehört. Das verlagert ihn noch heute hinter die Kulissen. Die meisten Seniorinnen, die mehr als mal ein kleines Glas trinken, tun das heimlich und schämen sich dafür. Das ist der eine Umstand. Er ergibt sich durch Sozialisation und ist dafür verantwortlich, dass Alkoholprobleme unter heutigen Seniorinnen anders aussehen, als sie das bei Seniorinnen in 40 Jahren tun werden. Der andere Umstand ist jener, dass Helga, rein körperlich betrachtet, alt ist. Das hat in Kombination mit Alkohol unabhängig von der Prägung Folgen, die sich ähneln. Die sozialisationsbedingten Backstorys verzahnen sich also mit Phänomenen, die durch die psychischen und körperlichen Veränderungen entstehen, die ein Körper durchläuft, wenn er altert und Alkohol zugeführt bekommt. Und die sind verhältnismäßig heftig.
Denn die Fähigkeit, Alkohol abzubauen, verlangsamt sich mit dem Alter. Der Wassergehalt im Körper sinkt mit den Lebensjahren, was das Hirn noch empfindlicher für Alkohol und seine hochgiftigen Abbauprodukte werden lässt. Am deutlichsten zeigt sich das dadurch, dass sich die Regenerationszeiten verlängern. Ein Rausch am Abend endet nicht mehr »nur« mit einem dicken Kopf am nächsten Morgen, sondern mit einem tagelangen Tief. Die erhöhte Alkoholkonzentration fördert neben Leber- und Bauchspeicheldrüsen-, Herz- und Krebserkrankungen aber auch das Risiko für Demenzen. Und natürlich auch das für Stürze. Wobei ein Sturz ungleich schlimmere Folgen hat als in jungen Jahren. Das liegt daran, dass Knochen im Alter nicht mehr so viel Kalzium einlagern können und dadurch brüchig werden. Der Fachbegriff hierfür lautet Osteoporose. Wenn Frauen »schrumpfen«, dann liegt das insbesondere daran, dass Wirbelkörper im Rumpfbereich zusammenbrechen. Und die Osteoporose ist auch ein Hauptgrund dafür, warum sich ältere Frauen bei Stürzen so oft die Knochen brechen, zum Beispiel den berüchtigten Oberschenkelhals. Das ist ein Knochen, der so nah am Hüftgelenk sitzt, dass wir seinen Bruch in der Alltagssprache oft mit »sie hat sich die Hüfte gebrochen« in Worte fassen.
Wenn du alt bist und Alkohol trinkst, kommen zu diesen natürlichen Entwicklungen drei Faktoren verschärfend hinzu. Zum einen führt Alkoholkonsum gern mal zu einer schlechteren Ernährung mit verminderter Kalziumaufnahme. Hinzu kommt, dass Alkohol den Vitamin-D-Stoffwechsel beeinträchtigt. Vitamin D ist ein Hormon, auch wenn es Vitamin heißt. Die Vorstufen von Vitamin D kann dein Körper selbst bilden, die positiven Auswirkungen auf den Körper, zum Beispiel auf dein Immunsystem, entwickelt es aber erst durch Sonneneinstrahlung auf die Haut. Vitamin D ist wichtig fürs Immunsystem, aber nicht nur. Es ist auch wichtig dafür, dass dein Darm Kalzium aufnehmen kann. Ist dein Vitamin-D-Stoffwechsel gestört, funktioniert das nicht mehr gut – also noch weniger Kalzium für die Knochen. Und das ist noch nicht alles. Denn Alkoholtrinken führt auch zu einem gestörten Östrogenstoffwechsel. Östrogen ist ein Geschlechtshormon, das eine zentrale Rolle bei der Regulation deiner Knochendichte spielt. Die Östrogenkonzentration in Frauenkörpern sinkt bereits während der Wechseljahre deutlich ab, danach bleibt sie niedrig. Noch stärker fällt sie bei zusätzlichem Alkoholkonsum ab. Was zu noch brüchigeren Knochen führt. Also: In puncto Knochendichte und Knochengesundheit ist es megaschädlich, zu trinken, insbesondere für Frauen in und nach den Wechseljahren.
Wenn du zusätzlich noch Medikamente nimmst, solltest du zudem um die Wechselwirkungen wissen. So kann Alkohol die Wirkung von blutdrucksenkenden Medikamenten wie ACE-Hemmern, Betablockern oder Kalziumkanal-Blockern verstärken, was zu einem gefährlichen Abfall des Blutdrucks führen kann. Solltest du entzündungshemmende Medikamente einnehmen, zum Beispiel zur Behandlung von Gelenkerkrankungen wie Arthritis, dann erhöht Alkohol das Risiko von Magen-Darm-Blutungen, Geschwüren und Leberschäden. Manche Medikamente verlieren ihre Wirkung auch ganz oder teilweise, wenn du gleichzeitig trinkst. Zum Beispiel jene gegen den Diabetes mellitus, also die Zuckerkrankheit. Alkoholkonsum beeinträchtigt die Wirkung dieser Medikamentengruppe, was zu einer ungewollten Schwankung des Blutzuckers mit erhöhten Spitzenwerten führt und damit zu schweren Folgeerkrankungen der Nervenbahnen oder zum Beispiel zu Sehstörungen. Auch die Wirkung von manchen Psychopharmaka zur Behandlung von Depressionen und Angstzuständen lässt durch Alkoholkonsum nach, insbesondere die Wirkung von trizyklischen Antidepressiva, MAO