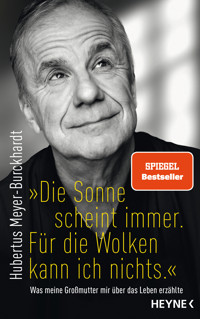12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»›Meine‹ Frauen werden nicht in Würde alt, sie bleiben in Würde jung.« (Hubertus Meyer-Burckhardt)
Als Gastgeber einer der erfolgreichsten Talkshows im Fernsehen hat Hubertus Meyer-Burckhardt eine Erfahrung gemacht: Frauen werden im Alter eher anarchisch, Männer im Alter eher bedeutungsschwanger.
Was bleibt von der Person ohne die Funktion? Eine Frage, der sich Frauen mit Vergnügen, Männer mit Sorge stellen. Frauen brechen auf, wenn das Leben die Verabredung nicht einhält, Männer ein. Hätte Mutter Erde ein Weltkulturerbe zu vergeben, dann wären das die Frauen. Diese Frauen sind - stellvertretend für alle anderen: Doris Dörrie, Veronica Ferres, Elke Heidenreich, Leslie Malton, Ina Müller, Ulrike Murmann, Erika Pluhar, Marianne Sägebrecht, Barbara Schöneberger und Christine Westermann.
Über Meyer-Burckhardts in diesem höchst unterhaltsamen Buch versammelten Frauengeschichten steht ein Satz wie eine Überschrift: er stammt von Barbara Schöneberger: »Ich empfehle zu leben.«
- Diese Frauen haben etwas zu sagen
- Weisheit und Lebenserfahrung von: Doris Dörrie, Veronica Ferres, Elke Heidenreich, Leslie Malton, Ina Müller, Ulrike Murmann, Erika Pluhar, Marianne Sägebrecht, Barbara Schöneberger und Christine Westermann
- »Meyer-Burckhardts Frauengeschichten« – vom Talk zum Buch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Hubertus Meyer-Burckhardt
Frauengeschichten
Was ich von starken Frauen
gelernt habe
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Copyright © 2017 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Das Interviewmaterial wurde freundlicherweise vom Radiosender NDR Info zur Verfügung gestellt, der die Reihe »Meyer-Burckhardts Frauengeschichten« seit 2014 immer am ersten Sonntag des Monats sendet. Lizensiert durch Studio Hamburg Enterprises GmbH.
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
Redaktionelle Bearbeitung der Interviews: Christel Gehrmann, Gütersloh
Umschlaggestaltung: Gute Botschafter GmbH, Haltern am See
Umschlagmotiv: © Achim van Gerven Photography, Hamburg
ISBN 978-3-641-21917-8V004
www.gtvh.de
Ich danke meiner Assistentin Jeanette Witthaut
für ihre immer währende Unterstützung,
ferner meiner wunderbaren Redakteurin
Doris Schiederig, ohne die diese Gesprächsreihe
nicht denkbar wäre.
Das Buch ist für Lilly!
INHALT
Prolog
1 DORIS DÖRRIE
»Ich kann schwer immer nur an einem Ort sitzen. Ich muss immer unterwegs sein.«
2 VERONICA FERRES
»Ich musste viel Kraft darauf verwenden, mich freizuschwimmen.«
3 ELKE HEIDENREICH
»Ich bin auch eine Kneipenschreiberin.«
4 LESLIE MALTON
»Mache aus deiner privaten Scheiße Gold.«
5 INA MÜLLER
»Heimat ist irgendwie gar nicht mein Thema.«
6 ULRIKE MURMANN
»Man sollte sein Leben so einrichten, als ob es Gott gibt.«
7 ERIKA PLUHAR
»Ich hatte immer nur eine Sturheit im Tun.«
8 MARIANNE SÄGEBRECHT
»Ich bin der Knoblauch im Film.«
9 BARBARA SCHÖNEBERGER
»Ich empfehle zu leben.«
10 CHRISTINE WESTERMANN
»Ja, ich zocke. Ich darf nur keine Kreditkarte mitnehmen.«
Frauen, die bei mir zu Gast waren
Musikübersicht
Epilog
PROLOG
Annelie Keil, Soziologin, Mitbegründerin der Universität Bremen, früher Kämpferin für den Kommunismus, heute Kämpferin gegen den Krebs – gegen ihren Krebs –, war ganz zu Beginn Gast in meiner Radiosendung »Meyer-Burckhardts Frauengeschichten«. Eine Frau, der kein Schicksalsschlag erspart blieb und die dennoch oder deshalb die Lebensfreude in Person ist.
Ihr Credo: »Das Leben muss nicht halten, was ich mir von ihm versprochen habe.«
Das Leben sei eben eine ungesicherte Unfallstelle, und für eine glückliche Kindheit sei es nie zu spät. Und genau das, was Annelie Keil formuliert, hat mich schon immer an Frauen interessiert: dass eine Liebeserklärung an das Leben den Kampf gegen Trübsinn und Selbstmitleid einschließt.
Als kleiner Junge hatte ich einem prügelnden und meist alkoholisierten Vater zu vergeben. Hat mich das Leben je gefragt, ob ich den wollte? Nein. Genauso wie Annelie Keil nicht gefragt wurde, ob sie es erstrebenswert fand, in Hitlers Reich hineingeboren zu werden. Sicher nicht!
»Glücklich sein ist eine Entscheidung«, pflegte meine Mutter zu sagen. Und sie übernahm in diesem Geist, gemeinsam mit meiner Großmutter, den Haushalt, nachdem ich im Alter von etwa zwölf Jahren meinen Vater aus dem Haus geworfen hatte.
Meine Großmutter, die sich als »Hohepriesterin der Unvernunft« verstand, lebte nach der Devise: Wir rechnen mit dem Schlimmsten und hoffen auf das Beste.
Zwei Weltkriege hatte sie überlebt, alles verloren, nur ihr Leben nicht, und das sei aus ihrer Sicht doch recht erfreulich. Meine ›frühen‹ Freundinnen lud sie regelmäßig in eine Weinstube ein. Wenn sie nicht trinkfest waren, dann erhielt ich am nächsten Tag einen Anruf: »Mein Junge, die kannst du vergessen. Die verträgt ja nichts.«
Und das hat mich interessiert, als ich »Meyer-Burckhardts Frauengeschichten« erfunden habe: Frauen zu porträtieren, die etwas ›vertragen‹, die das Leben abkönnen, die sich dem Leben stellen, die mutig sind und unvernünftig, die sich für ihre Lebenszeit verantwortlich fühlen und für nichts anderes. Das ›Plankton des Lebens‹ erspürst du nur, wenn deine Sinnesorgane offen sind, und es war Truman Capote – ja, ein Mann –, der sagte: »Die Wahrheit ist zu interessant, um sie zu ignorieren.«
Ob Doris Dörrie oder Barbara Schöneberger, ob Ina Müller oder ob Elke Heidenreich … Sie alle betrachten ihr Leben als Naturschutzgebiet. »Frauen kommunizieren über Beziehungen, Männer über Status«, sagt die Psychologin Eva Wlodarek, die ebenfalls Gast bei mir war.
Als Gastgeber einer Talkshow habe ich schon lange den Eindruck, dass Frauen im Alter eher anarchisch werden, Männer eher bedeutungsschwanger.
Was bleibt von der Person ohne die Funktion? Eine Frage, der sich Frauen mit Vergnügen, Männer mit Sorge stellen. Frauen brechen auf, wenn das Leben die Verabredung nicht einhält, Männer ein. Hätte Mutter Erde ein Weltkulturerbe zu vergeben, dann wären es die Frauen. Während die Männer häufig nichts anderes tun, als einer Bonsai-Existenz hinterherzulaufen, um dann am Lebensende die Niederlagen zu bejammern, sehen Frauen zu, dass stattdessen die Versäumnisse nicht überhandnehmen. Es gibt nämlich keinen Grund, dass der Schuster bei seinen Leisten zu bleiben hat. Und es missfällt nur denen, dass der Esel, wenn es ihm gut geht, aufs Eis geht, die Angst haben, das heimische Sofa zu verlassen, weil draußen bisweilen ein kalter Wind (übers Eis) pfeift.
Über meinen Frauengeschichten steht ein Satz wie eine Überschrift, fast wie ein Dogma. Der Satz stammt von Barbara Schöneberger, beiläufig geäußert, aber man kann ihm nicht entgehen: »Ich empfehle zu leben.« Meine Frauen werden nicht in Würde alt, sie bleiben in Würde jung. Petula Clark sagte kürzlich in einem Interview: »Ich bin total offen für das, was noch kommt. Unter einer Bedingung: Es muss Spaß machen.«
Das Leben als Labor, als ein ständiger Versuch. Es gibt keine Generalprobe, die Vorstellung läuft bereits.
Und gibt es ein besseres Lebensziel als das von Meike Winnemuth: »Ich möchte eines Tages eine glückliche Leiche sein.«?
Freuen Sie sich also auf Geschichten vom Leben.
Hubertus Meyer-Burckhardt
1
HUBERTUS MEYER-BURCKHARDT
DORIS DÖRRIE
Wir haben diese Begegnung für die FRAUENGESCHICHTEN in München aufgezeichnet. In ihrer Stadt. Und nach dem Gespräch, das keiner Kommentierung bedarf, weil es für sich steht, weil es in wunderbarer Weise zeigt, wie stark diese Frau ist und warum sie da ist, wo sie ist, gingen wir recht schnell auseinander, weil sie eine sich anschließende Verabredung getroffen hatte und weil auf mich das Flugzeug nach Hamburg wartete.
Genau das habe ich im Nachhinein sehr bedauert. Hätte ich sie doch noch zum Mittagessen eingeladen, denn ich habe ihr so verdammt gern zugehört, so gern, dass ich fast vergaß, meine Fragen zu stellen.
Doris Dörrie beobachtet präzise, reflektiert klug, nimmt ihren Beruf der Erzählerin ernst und sich nicht wichtig. Den Schicksalsschlägen setzt sie Lebenswillen entgegen, inspiriert durch das, was sie ein Wunder nennt, dass man nämlich durch 26 Buchstaben Welten entstehen lassen kann. Und genau deshalb hätte ich ihr noch sehr lange zuhören, besser zusehen können: wie sie so neben einem sitzt und eine Welt nach der anderen entstehen lässt, eine spannender als die andere. Aber lesen Sie doch bitte selbst …
»ICHKANNSCHWERIMMERNURANEINEM ORTSITZEN. ICHMUSSIMMERUNTERWEGSSEIN.«
Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr über unseren Gast heute. Es ist die große Autorin und Regisseurin Doris Dörrie. Und ich freue mich, dass Sie Ihren Weg ins Studio zu mir gefunden haben. Herzlich willkommen!
Danke! Es war nicht so schwierig, ist ja meine Stadt: München.
Es gibt ein Haiku – Haiku ist die kürzeste japanische Gedichtform, die kürzeste, die es auf der Welt gibt –, mit dem Sie einmal einem Interviewpartner auf seine Frage: »Können Sie auch einfach mal gar nichts machen?«, geantwortet haben: »Still sitzen, nichts tun, der Frühling kommt, und das Gras wächst von alleine.«
Ist Ihnen die Ruhe gegeben, oder mussten Sie sich die Ruhe erarbeiten?
Das ist gemischt. Für mich ist es schon sehr schwierig, still zu sitzen. Gleichzeitig bin ich ein sehr fauler Mensch, deshalb fällt es mir phasenweise auch wieder sehr leicht. Aber dann muss ich wieder losrennen. Und ich kann schwer immer nur an einem Ort sitzen, ich muss eigentlich immer unterwegs sein. Und dann sitze ich gerne wieder irgendwo rum auf der Welt.
Dazu kommen wir gleich. Auf die Frage, was Ihr größtes Talent sei, haben Sie bescheiden gesagt, Ihr größtes Talent sei Schlafen. Und jetzt kommt der wichtige Zusatz: Aber das Talent kommt mir langsam abhanden.
Ja, ich bin leider relativ schlaflos geworden, das hat wohl einfach mit dem zunehmenden Alter zu tun und mit Vererbung. Mein Vater ist ein sehr schlafloser Mensch. Aber ich bemühe mich weiter.
Sie sprechen von Ihrem Vater … Sie sind 1955 in Hannover geboren, Tochter eines Arztes, Ihr Onkel war Altphilologe Heinrich Dörrie, der sich – soviel ich weiß – sehr mit Platon beschäftigt hat. War das ein intellektuelles Elternhaus?
Gemischt, glaube ich. Es war natürlich sehr praktisch, weil mein Vater Arzt war. Meine Mutter auch, und Ärzte sind ja bis zu einem gewissen Grad Handwerker, und gleichzeitig gab es eben diese große Liebe zur Literatur und wirklich auch dieses klassische Bildungsideal, humanistische Bildung. Mein Vater hat mich schon sehr geschubst, Griechisch in der Schule zu wählen, was ich eigentlich gar nicht wollte, wofür ich ihm aber dann doch immer sehr dankbar gewesen bin.
Später sind Sie aufgebrochen nach New York und hatten offensichtlich wenig Geld, aber dazu kommen wir später. Was war das für ein Haushalt, wo man gesagt hat, man hält die Kinder kurz, aber Geld für Bücher und Theater gibt es immer?
Geld für Bücher gab es wirklich immer. Aber wir waren halt vier Geschwister, und es war vollkommen klar, dass das Geld nicht für vier ausreicht, wenn jeder endlos lange studiert oder ohne Unterstützung ins Ausland geht. Das ging einfach nicht. Man musste halt darauf achten, dass es gerecht verteilt blieb, und jeder musste schauen, dass er auch relativ schnell mit dem Studium fertig wurde und sein eigenes Geld verdiente.
Sie erwähnen Ihre Geschwister. Als Sie drei Jahre alt waren, bekam Ihre Mutter Zwillinge. Und Sie haben sehr früh angefangen, diese jüngeren Geschwister zu inszenieren. Wie mir scheint, auch sehr brachial oder sagen wir autoritär.
Na klar, ich war sechs, und die waren drei.
Na ja, Sie haben das mal so beschrieben: Ich sagte meinen Geschwistern, Zitat Doris Dörrie: »Ich sage jetzt, ach hätten wir doch ein Kind. Aber sie waren so verschüchtert, dass sie immer genau meine Worte wiederholten und sagten, ich sage jetzt, ach hätten wir doch ein Kind.« Und dann haben Sie sie einfach geprügelt, sie weinten, und das Weinen haben Sie gebraucht für Ihre Inszenierung.
Ja, da habe ich gemerkt, wie man das so macht mit der Regie. Ohrfeigen helfen. Nein, ich habe das neulich noch mal beschrieben, als ich in Leipzig eine Poetik-Vorlesung hielt, dass es schon für mich der Grund für das Erzählen war, verstoßen worden zu sein. Natürlich nicht wirklich von meiner Mutter verstoßen, aber ich fühlte mich so. Daraus strickte ich mir dann als Geschichte, wie ja jeder seine Lebensgeschichte strickt, dass ich von diesem Zeitpunkt an eben ein bisschen außen vor war. Ich war plötzlich Beobachter und konnte diesen kleinen Geschwistern zuschauen, die aus meiner Sicht natürlich wahnsinnig jung waren, weil sie noch nicht sprechen und spielen konnten und man eigentlich gar nichts mit ihnen machen konnte. Aber sie waren süß, und alle Leute fanden sie hinreißend, weil es eben wirklich wunderhübsche Zwillinge waren. Diese Position, ob man beobachtet oder zufrieden mittendrin ist, legt sich schon relativ früh fest. Und zufrieden mittendrin war ich eigentlich nie, sondern wie gesagt, immer eher die Beobachterin. Und ich habe großen Spaß entwickelt, und das ist – glaube ich – inzwischen mein Haupttalent, nicht mehr zu schlafen, sondern zu flanieren. Ja, ich betrachte mich heute mehr als Flaneuse denn als Schläferin.
Der große, leider verstorbene Schauspieler Wolfgang Kieling und die wunderbare Elke Heidenreich haben eine Sache gemeinsam: Sie haben die Literatur über die Buchstabensuppe entdeckt. Und mein Eindruck ist, dass die Literatur für Sie sehr früh – nicht über eine Buchstabensuppe und über Russischbrot entdeckt – eine Fluchtburg oder ein Fluchtpunkt war. Beobachte ich das richtig?
Ja, sicherlich, aber es war eben auch dieses Wunder, als ich gemerkt habe, dass man mit diesen sechsundzwanzig Buchstaben tatsächlich Welten entstehen lassen und sich genauso in diese Welten durch die Literatur hineinbegeben kann. Und wir hatten keinen Fernseher; ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Abends wurde gelesen, die ganze Familie hat abends gelesen.
Aber wir sprechen dann doch über ein intellektuelles Elternhaus?
Ja. Ich wehre mich ein bisschen gegen diesen Begriff, ›intellektuell‹, weil ich bis heute nicht so genau weiß, was das eigentlich sein soll. Gebildet, ja, intellektuell ist noch mal was anderes. Also das ist auch, finde ich, zum großen Teil das Angeben damit, dass man etwas begrifflich fasst. Das meine ich überhaupt nicht, sondern es war einfach dieser große Genuss, den meine Eltern uns Kindern schon sehr früh vermittelt haben, durch die Literatur in andere Welten zu gelangen und damit auch die Menschheitsgeschichte durch die Literatur begreifen zu können. Das haben sie uns sehr klar beigebracht.
Sie hatten keinen Fernseher als Kind, aber Ihr Traummann war Pierre Brice. Das setzt aber voraus, dass man Ihnen das Kino erlaubt hat.
Ja klar. Meine Eltern gingen wenig ins Kino, weil sie so wenig Zeit hatten mit vier Kindern und ihren Berufen. Aber ich durfte mit meinem Vater zum Beispiel in »Winnetou« gehen, und das war für mich wirklich ein irrsinniges Erlebnis, weil das Kino auch noch in einem Hochhaus in Hannover ganz oben in den Wolken war. Ich glaube, dieses Haus hatte sechs Stockwerke, das war irrsinnig hoch. Und das hat mich tief beeindruckt. Schließlich aber auch die Fernseherlebnisse bei einer Tante, die wir alle drei, vier Wochen besuchten. Tante Hildchen. Da lief zwar immer nur »Der Blaue Bock«, aber auch das fand ich als Kind faszinierend.
Heinz Schenk hatte eine späte Karriere als ganz ordentlicher Schauspieler.
… und einen tollen Film mit Hape Kerkeling gemacht.
Sprechen wir über Heimat. Sie haben bereits an anderer Stelle öffentlich über Heimat gesprochen und gesagt, die Fußgängerzone in Hannover sei deutsche Realität per Definition. Kröpcke heißt sie.
Na ja, es ist seltsamerweise etwas, das ich überall in Japan wiederentdeckt habe, was dann auch ein seltsames Heimatgefühl auslöste. Es hat natürlich sehr stark mit den Zerstörungen durch den Zweiten Weltkrieg und diesem schnellen Wiederaufbau zu tun, wobei auf Schönheit nicht so viel Rücksicht genommen werden konnte. Und was auch eine gewisse Zerrissenheit ausdrückt, dieser Beton und dieses Zerrissensein zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Tradition und Moderne, das ist in Hannover genauso zu spüren wie z. B. in Fukuoka.
Sie haben seit dem vierten Lebensjahr gewusst, dass Sie sterben werden.
Ja, an diesen Moment kann ich mich sehr genau erinnern: Ich wachte eines Nachmittags aus dem Mittagsschlaf auf, den ich anscheinend mit vier Jahren noch gemacht habe, und begriff plötzlich, wie Tod sein muss. Und davon habe ich mich nie wieder erholt.
Das heißt, Sie wissen um die Kostbarkeit des Lebens?
Ja, das hat natürlich auch mit meinem Elternhaus zu tun, mit dieser Nähe zu Krankheit und Tod, wenn die Eltern Ärzte sind. Das begreift man schon sehr genau als Kind. Und sich davon auch bedroht zu fühlen, dieses Gefühl hatte ich sehr früh, weil es natürlich in den Gesprächen zwischen den Eltern sehr oft um lebensbedrohliche Situationen von Patienten ging.
Wenn ein Kind Angst hat, sucht es Heimat. Sie haben einmal gesagt, dass für Sie die deutsche Sprache Heimat sei. Gibt es einen Zusammenhang, dass Sie die Furcht vor dem Tod auf der einen Seite kompensiert haben mit einer Flucht oder – vielleicht weniger pathetisch – Zuwendung zur Literatur, die Ihnen einen gewissen Schutz bot?
Das habe ich wohl relativ früh verstanden, dass das wirkliche Blut und das wirkliche Leid für mich zu viel waren. Dafür hatte ich zu schwache Nerven. Aber das erzählte Leid und das erzählte Blut, das konnte ich besser verkraften. Denn es ist alles immer eine Frage, was man selbst verkraftet. Und natürlich gab es auch diese Sehnsucht, durch das Erzählen gewappnet zu sein, was natürlich nicht funktioniert. Aber ich glaube schon, dass wir uns gegenseitig erzählen, um uns weniger zu fürchten. Also ist das Erzählen wie das Pfeifen im Dunkeln. Und egal, ob mir jetzt erzählt wird oder ob ich selbst erzähle, diese Funktion hat mich daran immer angezogen.
Solange man erzählt, stirbt man nicht.
Genau, aber auch von anderen zu hören, wie die das so machen mit dem Leben. »Die Geschichte von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen« … Der hat seltsamerweise keine Angst und lernt sie dann trotzdem. Dagegen ist unsere normale Situation ja, dass wir alle Angst haben und versuchen herauszubekommen, wie die anderen das eigentlich machen, wie sie es hinkriegen, denn bedrohliche Dinge passieren ständig. Und genau das ist, was mich bis heute fasziniert, fesselt und nicht loslässt: Wie machen die anderen das mit dem Leben, das ja nie gut ausgeht?
Ja, der Tod kommt immer. Sie haben auf die Eingangsfrage, »Können Sie auch einfach mal gar nichts machen?«, vom stundenlangen Herumliegen irgendwo in der Welt gesprochen. Kann es denn prinzipiell sein, dass die Menschen in ärmeren Ländern mehr genießen können als wir?
Natürlich! Das ist etwas, was kulturell gewachsen ist. Wobei in Frankreich oder Griechenland jeder noch zu verstehen scheint, dass das ganz, ganz wichtig ist, zusammen rumzusitzen und nicht alles auf seinen Nutzen hin zu überprüfen: Was bringt es mir, und kann ich das verwerten? Das, glaube ich, nimmt uns sehr viel von unserem Menschsein. Wie gut ist dagegen dieses sinnlose Rumsitzen! Aber ich merke auch, wie schwer das geworden ist, weil alle immer so wahnsinnig beschäftigt sind. Mal alle meine Freundinnen zusammenzutrommeln, das ist schier unmöglich geworden. Ich schließe mich da durchaus ein, denn ich habe auch dauernd irgendwas, was dann aber vielleicht gar nicht so wichtig ist.
Ein Freund sagte gerade zu mir: Ich rufe manchmal Menschen ohne Grund an, und sie sind dann immer furchtbar irritiert.
Das gibt es gar nicht mehr. Das Telefon klingelt ja auch kaum noch, weil man alles über Mails und WhatsApp erledigt, weil man niemanden stören will, weil man genau weiß, der andere ist wahnsinnig busy.
Ein Regisseur arbeitet mit Licht, er arbeitet mit Ton, aber er arbeitet auch mit Musik. Gab es in Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend einen Song, von dem Sie sagen, der wird mich die nächsten Jahrzehnte begleiten?
»(I Can’t Get No) Satisfaction.« Damals fragte ich meine Mutter, was das denn eigentlich hieße – ich weiß es noch genau –, und sie antwortete: Dafür bist du zu jung. Und natürlich hatte dieser Satz den Effekt, dass ich mich wahnsinnig dafür interessierte, was die da eigentlich singen. Doch meine komplette Identifikation mit Musik – bei den Stones war es Begeisterung – passierte hier in München mit Patti Smith. Sie war früher schon meine Heldin und ist es eigentlich auch geblieben. Ich habe sie gerade erst vor zwei Jahren wiedergesehen, auf der Berlinale habe ich sogar mal mit ihr geredet, sie ist wirklich eine Zeitgenossin geworden.
Und wenn man mit Patti Smith redet, was für eine Persönlichkeit kommt einem da entgegen, was für eine Stimmung?
Na ja, sie ist so – wie viele im Showbusiness – sehr, sehr schüchtern. Was ich gut verstehen kann, weil ich auch sehr schüchtern bin.
»Wenn ich unterwegs bin, wenn ich irgendwo fremd bin, dann bin ich zu Hause«, sagt Doris Dörrie. Das heißt, der Weg ist immer der Zustand des Wohlgefühls und das Ankommen der der Melancholie und Nervosität?
Nein nein, es ist eher das Fremdsein. Ich bin sehr, sehr gerne fremd, denn dann komme ich zu mir.
Ich kenne keinen anderen Filmschaffenden, keine Regisseurin, die sich so mit Japan auseinandergesetzt hat wie Sie. Ist Ihnen Japan immer noch fremd, oder ist es Ihnen ein bisschen begreifbarer geworden?
Nein, es ist immer noch fremd, und manchmal wird es fremder, als ich je gedacht hätte. Bei meinem letzten Film »Grüße aus Fukushima« war es wieder sehr, sehr fremd. Es ist erstaunlich, wie sehr sich dieses Land immer wieder von einem zurückzieht, wenn man glaubt, man hat es begriffen.
In diesem Film hat mich die Hauptdarstellerin Rosalie Thomass sehr beeindruckt. Wie gelingt es Ihnen, einen deutschen Zugang zu finden? Wenn Sie ein Thema in diesem Land aufgreifen, ist es ja nur von einer gewissen Relevanz für ein deutsches Publikum.
Indem ich damit sehr autobiografisch umgehe. Nehmen wir z. B. diese Rolle der jungen Deutschen, Marie, die nach Japan fährt, um in der Katastrophenzone zu helfen: Das bin natürlich zum großen Teil auch ich. Ich bin auch immer zu groß für dieses Land, ich verstehe es bis heute nicht und ich habe trotzdem einen sehr direkten und auch klaren und herzlichen Kontakt – damit fange ich dann an. Ich kann nur aus meiner Perspektive heraus erzählen, ich kann nicht so tun, als wäre ich die ultimative Japan-Expertin und könnte Geschichten aus japanischer Sicht erzählen. Das würde ich mir nie anmaßen. Es ist und bleibt immer diese fremde Perspektive, mit der ich dort arbeite.
Wir sprachen bereits über Ihr frühes Wissen um den Tod, und dieser Film hat ja unmittelbar mit Tod zu tun, weil es um die Reaktorkatastrophe von Fukushima geht. Gehen Japaner aus Ihrer Sicht anders mit Trauer um, als wir das tun?
Das ist eine schwierige Frage. Ich habe ja auch in Mexiko einen Film gedreht und darüber geschrieben, was der Umgang mit dem Tod den Mexikanern bedeutet … Ich glaube, dass die Gefühle überall gleich sind, dass sich Trauer überall gleich anfühlt. Was man dann an ritueller Bewältigung zur Verfügung hat, das jedoch unterscheidet sich sehr stark. Und in Japan ist es sicherlich so, dass durch den buddhistischen Hintergrund das Leiden an sich eine größere Akzeptanz hat – also diese erste noble Wahrheit Buddhas, dass das Leben Leiden ist. Das ist in Japan schon sehr viel klarer, oder jeder scheint es tiefer begriffen zu haben als wir hier. Wir tun am liebsten so, als gäbe es das Leiden nicht, als müsste man sich davon fernhalten, um nicht angesteckt zu werden. Das ist schon ein Unterschied.
Buddha sagt ja auch, oder er rät, dass wir die Welt auf uns wirken lassen sollten. Nun sind Sie ja in Ihrem Beruf jemand, der die Welt gestaltet.
Na ja, da habe ich mir über die Jahre ein kompliziertes System angeeignet, das diese beiden Dinge zusammenbringt. Ja klar, ich bin diejenige, die sich die Geschichten ausdenkt und die sie dann auch inszeniert, gleichzeitig versuche ich aber eben auch, diesen Raum zu schaffen, dass Dinge auch wieder entstehen können. Und das funktioniert ziemlich gut. Ich versuche dann, der Wirklichkeit Gelegenheit zu geben, in die Fiktion hineinzukommen. Also in diesem Film auch Platz zu nehmen. Bei Fukushima ist es beispielsweise so, dass da die wirklichen Bewohner der Notunterkünfte mitspielen, dass ein wirklicher Abt von einem buddhistischen Tempel auftaucht, dass es an den echten Orten spielt und dass man als Zuschauer schon sehr, sehr genau spürt, dass das nicht alles ›make believe‹ ist, sondern dass es da um das Echte, das Wirkliche geht. Bei »Kirschblüten« war es ähnlich. Und so habe ich es in fast all meinen Filmen auf diese Art, die Art von »Erleuchtung garantiert«, gemacht. »Erleuchtung garantiert« drehte ich in einem Kloster in Japan, und das war der Anfang dieser dokumentarisch fiktiven Form.
In Ihrem Lieblingsfilm von Akira Kurosawa, dem Großmeister des japanischen Films, geht es um einen Beamten der Stadtverwaltung, der eine todbringende Diagnose bekommt, der aber noch einmal etwas Sinnvolles tun möchte und einer Bürgerinitiative hilft, die sich um die Errichtung eines Spielplatzes kümmert. Er will sie unterstützen, weil damit wenigstens irgendetwas von seinem Leben bleibt. Warum ist das Ihr Lieblingsfilm?
Weil dieser Film wirklich das Leiden sehr eindrücklich schildert, das der Mensch an sich hat, dass er nur sehr kurz auf dieser Welt ist und dass er natürlich letzten Endes sehr bedeutungslos ist. Und dieser Bürokrat – das ist eine große Kritik auch an der japanischen Bürokratie – begreift, dass es nicht darum geht, irgendwelche Formulare irgendwann mal abzustempeln, sondern um eine sehr kleine Aktion, um eine wirklich winzige soziale Interaktion. Und da geht es gar nicht so sehr darum, dass er jetzt der Menschheit etwas großartig Gutes tut: Ein paar Kinder bekommen eine Rutsche, er sitzt auf einer Schaukel … Es gibt diese großartige Szene, wo er alleine auf der Schaukel sitzt, und es schneit, und er singt ein sehr altes japanisches Lied. Aber er für sich ist zum Menschen geworden.
Eine besondere Rolle in Ihrem Leben spielt Bob Dylan, welche Rolle z. B. spielt der Song »Changing Of The Guards« für Sie?
Ach, mit Bob Dylan habe ich natürlich eine lange Geschichte, wie fast jeder. Ende der Siebziger gab es ein großes Konzert in Nürnberg, wo alle Freunde hinfuhren und eben auch mein Freund. Und ich weigerte mich damals wirklich standhaft, weil Bob Dylan eben in Nürnberg in der doch historisch sehr belasteten großen …, wie soll man es nennen, es ist eine Arena oder ein …
Ja, eine sehr völkische Architektur.
Genau! Und da trat eben Bob Dylan auf, und darüber habe ich mich wirklich sehr aufgeregt. Mit der Konsequenz, dass ich nicht mitgefahren bin. Ich erinnere mich bis heute daran, wie ich dann allein zu Hause saß und nicht mehr so sicher war, ob ich es jetzt bereue oder ob ich stolz darauf bin. Und habe, während die anderen beim Livekonzert waren, »Changing Of The Guards« gehört.
Bob Dylan. Der hatte übrigens einen berühmten Gestalter, nicht aller seiner Plattencover, aber einiger, und das war Milton Glaser. Milton Glaser gründete 1968 den New Yorker, das ist nach wie vor die Zeitung, die Zeitschrift, das Magazin, das Sie begleitet.
Ja, ich lese es mit religiöser Inbrunst, inzwischen digital, weil sich meine Familie drüber beschwert hat, dass ich keinen einzigen New Yorker der letzten fünfundzwanzig Jahre wegwerfe. Das nimmt einfach überhand, und jetzt darf ich ihn nicht mehr als Papier lesen.
Ich habe das vorhin erwähnt, 1974 sind Sie, gerade achtzehnjährig, nach New York gegangen. Sie hatten für eine junge deutsche Regisseurin sehr schnell die Aufmerksamkeit Amerikas. Ihr erster Film in den USA war »Mitten ins Herz«. Es scheint mir ganz bezeichnend für Ihre Persönlichkeit zu sein, dass Sie sich für die Premiere einen Boxermantel gekauft haben. Ist das Ausdruck einer kämpferischen Natur?
Ja, sicherlich, aber das war natürlich auch ein bisschen Posing, weil diese Boxermäntel einfach wahnsinnig cool aussahen, und man bekam sie nur in Amerika. Damals war das ja noch so schön, dass man manche Dinge nur an einem Ort bekam und sonst nirgendwo. Und es war halt einfach wahnsinnig cool, ich hatte auch immer diese Boxerstiefel dazu an – das war einfach so ein Outfit, das ich mir ausgedacht hatte.
Sie wirken – zumindest war das so, als Sie das Studio hier betraten – wie eine Frau, die ihrer selbst sicher ist und die um Optimismus bemüht ist, auch wenn das nur mein erster, vielleicht oberflächlicher Eindruck war … Aber Sie haben immer wieder Schicksalsschläge zu ertragen gehabt, allen voran der Tod Ihres ersten Ehemannes, Helge Weindler. Falls jemand nicht ganz in der Filmgeschichte zu Hause ist: Helge Weindler war ein bedeutender Kameramann, der, bevor er mit Ihnen gearbeitet hat, auch mit Peter F. Brinkmann drehte. Meine Lieblingskomödie aus dieser Zeit »Theo gegen den Rest der Welt« hat er fotografiert, aber auch den »Schneemann« zusammen mit Gabi Kubach.
Viel auch mit Dominik Graf.
Viel mit Dominik Graf. Was mich beeindruckt: Auf die Frage: »Werden Sie oft an ihn erinnert?«, haben Sie geantwortet: »Immer, wenn ich Licht sehe. Also gestaltetes Licht sehe, das ist die Ausdrucksform des Kameramanns, das Licht, man sagt ja auch: der Licht setzende Kameramann.« Aber wenn dem so ist, Frau Dörrie, werden Sie ja immer an ihn erinnert, weil Licht immer um Sie herum ist.
Ja, so ist es auch, ja!
Amerika hat eine große Rolle gespielt, auch in dieser Liebe, denn Sie haben in Neu-Mexiko geheiratet.
Bei den Navajos, ja.
Warum gerade bei denen?
Das ist auch so ein deutsches Ding: wegen Winnetou und weil die Deutschen und die Indianer vielleicht wirklich durch Karl May eine seltsame Nähe zueinander haben. Kein Indianer in Amerika hat jemals von Winnetou oder von Karl May gehört, und das kommt denen immer ein bisschen rätselhaft vor. Inzwischen haben sie sich daran gewöhnt, dass die Deutschen kommen. Und jetzt gibt es Standing Rock, und irgendwie habe ich das Gefühl, unbedingt nach Standing Rock zu müssen. Dort protestieren verschiedene Stämme gegen die Verlegung einer Pipeline durch ihr Reservat und durch wirklich alte Begräbnisfelder. Das ist ein Kampf, der da entflammt ist, der auf wirklich seltsame Art und Weise noch einmal zeigt, wie vehement die Interessen der Ölindustrie und auch die des Kapitals gegen die Ureinwohner immer wieder verfochten werden, immer wieder und immer noch. Standing Rock.
Bei Ihren Filmen fällt mir freilich nicht immer, aber doch sehr häufig auf, dass Sie eine gesellschaftliche Position beziehen.
Ja, alles sind auch immer politische Filme gewesen.
Sie lehren mittlerweile an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Haben Sie den Eindruck, dass junge Studenten, denen Sie Drehbuch oder auch Regie beibringen, auch diesen gesellschaftlichen Ansatz haben?
Was ich dort beobachte, ist, dass die Distanz sehr groß geworden ist und dass die Studenten insgesamt sich eher vor dem direkten Kontakt fürchten. Ich habe sie z. B. in einem Seminar zwangsverpflichtet, sie mussten dann wirklich Klamotten für Flüchtlinge sortieren, damit sie einfach Kontakt auch zu Themen bekommen, die erzählt werden müssen. Sie konnten sich nicht zurückziehen; Sicherheit ist ein wichtiges Thema heute. Und natürlich ist man hinter einem Computer erst mal sehr viel sicherer, als wenn man sich hinauswagt. Doch es gibt auch andere, die da ganz anders drauf sind. Aber bei der Mehrheit spielt die Sicherheit schon die größte Rolle. Ich bin der Überzeugung, dass gerade da auch eine große Gefahr liegt. Wir sollten uns bemühen, direkt miteinander zu kommunizieren und auch Streit auszuhalten und Kompromisse versuchen zu finden, statt uns immer nur in unserer Blase zu bewegen, die uns ständig das zurückspielt, was uns sowieso schon gefällt.
Jetzt unterrichten Sie ja Studentinnen und Studenten, und Sie haben immer wieder Position bezogen, wie unterschiedlich Männer und Frauen im Berufsleben sind. Von Ihnen stammt der Satz, korrigieren Sie oder ergänzen Sie mich, wenn ich es falsch sage, dass Männer vielleicht spielerischer mit Konflikten umgehen, aber letztlich auch feiger.
Ja, Männer sind es sehr viel mehr gewöhnt, abgewiesen zu werden. Das fängt mit dem ersten Flirt an, mit dem ersten Mal fragen: »Gehst du mit mir?«, oder was immer, um dann einen Korb zu bekommen. Das ist eine männliche Erfahrung, die Frauen so nicht haben.
Interessanter Gedanke. Und das stählt fürs Leben?
Es stählt fürs Leben, sich zunächst mal zu trauen. Und wenn sie dann sagt, nee, dann hat man eben Pech gehabt. Das machen Frauen nicht so. Sondern wir schlagen erst zu, wenn wir uns relativ sicher sind, dass das auch funktioniert. Und das ist im Beruf eher hinderlich. Man muss schon das Risiko eingehen, dass man eine Schlappe erleidet oder dass man scheitert, das ist schon sehr wichtig, das muss man auch üben, das muss man lernen.
Das hieße aber in der Verlängerung Ihres Gedankens, dass Männer, die besonders aus der Frauenperspektive heraus unattraktiv sind, also viele Körbe bekommen haben, im Beruf dann später Anlass zum Optimismus geben.
Ja, darüber muss man mal nachdenken und sich solche Exemplare vorknöpfen. Das könnte gut sein, oder? Wenn wir uns erfolgreiche Männer anschauen, die attraktiv sind …
Sind Sie eigentlich für die Frauenquote?
Ich habe zähneknirschend eingewilligt mitzumachen, weil ich das sonst nicht verantworten kann. Denn ich bilde mehr als fünfzig Prozent Frauen aus, im Drehbuch-, »Creative Writing«-Studiengang. Und am Ende arbeiten nur fünfzehn Prozent als Regisseurin und Autorin, und das geht nicht, das geht einfach nicht! Also, das müssen wir ändern, das ist eine ganz einfache Frage der Gleichberechtigung und der Gerechtigkeit. Und wenn wir es nicht von alleine hinkriegen, dann brauchen wir so was Blödes wie die Quote.
Lassen Sie uns bitte noch einmal in Ihre Jugendzeit zurückgehen. Was ich bemerkenswert finde: Sie haben sich immer mal wieder und auch gerne geprügelt.
Ja, früher.
Früher, ja. Es sagt ja doch etwas aus, dass Sie Neonazis verprügelt haben oder Bauarbeiter, die eine junge Frau provozieren wollten und ihr eine tote Taube aufs Auto gelegt hatten.
Ja, das klingt so, als hätte ich gewonnen, das habe ich aber nicht. Also, ich habe dann auch schwer was abgekriegt.
Na ja, gut, aber man muss ja für Mut nicht belohnt werden, dann wären wir alle mutig. Zumindest sind Sie couragiert da rangegangen.
Aber auch mit einer Portion Dummheit, denn ich habe schon irgendwann kapiert, dass, wenn Männer wirklich zurückschlagen, dass das dann nicht so schön aussieht. Also, es gibt bei Männern schon bis zu einem gewissen Grad eine Art Hemmung, Frauen wirklich zu schlagen. Aber wenn die wegfällt, wenn sie richtig zuschlagen, dann hat man als Frau schlechte Karten. Das habe ich zum Glück auch irgendwann begriffen.
Else Lasker-Schüler, die große Dichterin aus Wuppertal, hat ihrem jüngeren Lebenspartner, Gottfried Benn, gesagt: Die wichtigste Charaktereigenschaft, die der Mensch haben kann, ist Mut. Denn eine andere ist Ehrlichkeit, und um ehrlich zu sein, brauchen wir Mut. Sie sind in dem Sinne mutig, dass Sie gelernt haben, Ihre Ängste zu überwinden, immer wieder?
Das weiß ich gar nicht. Dieses Prügeln kam aus dem Gefühl der absoluten Gleichheit heraus. Ich habe es nicht einsehen wollen, dass ich als Frau nicht dazwischengehen kann, wenn Männer sich blöd verhalten. Das ist sicherlich auch ein Grund dafür, warum ich als Frau im Beruf nie so wirklich Probleme bekommen habe, weil ich das vollkommen vergessen habe. Nein, es war mir nie bewusst, dass es da überhaupt eine Ungleichheit geben könnte. Und das hat weniger mit Mut zu tun als mit einer gewissen, fast gesunden Ignoranz der Nicht-Gleichberechtigung.
Empfinde ich die Pole, zwischen denen Ihr Leben immer ein bisschen, wenn ich das so sagen darf, irrlichtert oder sich bewegt, richtig, wenn ich sie wie folgt benenne: Trost, Mut, Unbeirrbarkeit, Wissen um den Tod, aber auch ein großes Maß an Lust aufs Leben?
Ja, und auf Komik und Humor. Das betrachte ich als lebensrettend.
Sie gehen gerne shoppen?
Ich gehe wahnsinnig gerne shoppen, viel zu gerne!
Auch in Japan?
Ja klar! Inzwischen habe ich es mir allerdings abgewöhnt, immer wie eine Irre Geschirr mit nach Hause zu schleppen oder auch Soßen oder selbst Reis, alles, was mir so unterkommt, von dem ich denke, dass es toll und besonders ist und ich es zu Hause zeigen muss oder damit kochen kann.
Ich fand – das ist eine ganz hübsche Geschichte –, dass Sie aufgrund einer Retrospektive Ihres Werkes, Ihrer Filme in China, dass Sie dort dann alle Nationalküchen Chinas kennenlernten …
… Ja, aber nur, weil die Retrospektive verboten wurde.
Ach, das war der Grund!
Ich war eingeladen und sollte auch Reden halten, aber keiner hatte mir gesagt, dass alle meine Filme von der Zensur verboten worden waren. Die Chinesen fanden das total normal, dass die Filme nicht liefen. Protest war völlig sinnlos. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich will jetzt für jeden Tag, an dem ein Film gelaufen wäre, einen Kochkurs haben. Fanden die Chinesen auch total in Ordnung. So habe ich chinesisch kochen gelernt.
Und das darf ich mir wie vorstellen? Das heißt, wie viele Filme wurden verboten?
Sechs.
Das heißt, Sie haben sechs verschiedene chinesische Nationalküchen gelernt?
Ja, und auch von Provinzen, von denen ich zuvor nie gehört hatte, so z. B., wie man in Yúnnán kocht, das hatte ich vorher noch nie gegessen. Es war hochinteressant. So muss ich sagen: Mein Mann hat sich auch sehr darüber gefreut, dass die Zensurbehörde so streng war und alle Filme verboten hatte. Aber natürlich ist es eigentlich eine Katastrophe, und die Zensur in China wird auch immer schlimmer, strenger und rigider. Leider interessiert es uns in Europa nicht so sehr, weil unsere ökonomischen Interessen in China so stark sind.
Dr. Mathias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende von Axel Springer, hat neulich in einem Aufsatz gesagt: »Es fehlt die Empörung der bürgerlichen Mitte.«