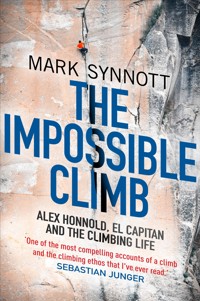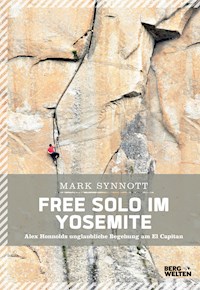
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BERGWELTEN
- Sprache: Deutsch
Alleine und ungesichert Nur wenige wagen sich an die Freerider-Route am El Capitan im Yosemite Nationalpark. Alex Honnold klettert die senkrecht abfallende Granitwand in Rekordzeit. Ohne jede Sicherung. Free solo zu klettern ist ein Balanceakt: zwischen Luft und Fels, Hängen und Fallen, Leben und Tod. Mark Synnott begleitet in diesem Buch den jungen Kletterer Alex Honnold auf seiner Mission eine Route zu begehen, die im Free Solo-Stil als unschaffbar gilt. Dabei zeichnet er ein feinfühliges Portrait dieses Ausnahmesportlers und öffnet Türen für ein tieferes Verständnis des Klettersports, der selbst im gesicherten Zustand ein mitunter großes Verletzungsrisiko birgt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 665
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
MARK SYNNOTT
FREE SOLO IMYOSEMITE
Alex Honnolds unglaubliche Begehung am El Capitan
aus dem Englischen von Doris Steiner
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren bzw.
Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
Die amerikanische Originalausgabe ist 2019 unter dem Titel The Impossible Climb – Alex Honnold, El Capitan, and the Climbing Life bei Penguin Random House, New York, erschienen.
Copyright © 2018 by Mark Synnott
Published by Arrangement with Mark Synnott
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
1. Auflage
© 2019 Bergwelten Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – München eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Gesetzt aus der Palatino, Quan, Clarendon
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Umschlaggestaltung: b3K design, Andrea Schneider
Coverfoto: Tom Evans
Grafik: Clay Waldman
ISBN 978-3-7112-0007-5
eISBN 978-3-7112-5004-9
Inhalt
Prolog
TEIL 1 – Jugend
»Hon wird den El Cap free solo klettern«
Crazy Kids of America
Die Vision der Stonemasters
Stone Monkey
TEIL 2 – Die Berufswelt
Schnelles Geld in der vertikalen Welt
Die Geheimwaffe, der Sicherheitsapostel und Xiao Pung
Nonprofit
Geheime Wände
TEIL 3 – Topping Out
Amygdala
Der Ursprung
»Ihre Einstellung ist großartig«
Spaß
Vergleich der Schwierigkeitsgrade
Anmerkungen des Autors
Danksagung
Über den Autor
Für Tommy,Lilla,Matt,Will undHampton
Foto: getty images/Kelly Cheng Travel Photography
PROLOG
Der Graben, wie das Yosemite-Tal von Kletterern manchmal genannt wird, bleibt meist bis weit in den September hinein sommerlich warm, aber über Nacht war aus dem Nichts eine Kaltfront herangezogen. Gegen Osten hockte eine blasse Sonne tief unten am Himmel, kaum zu erkennen hinter einem dichten Wolkenschleier. Winzige Wassertröpfchen sättigten die Luft. Alex fragte sich: Wird der Fels nun rutschig? Die Reibung schien noch gut zu sein, wahrscheinlich weil eine steife Brise den Fels ebenso schnell wieder trocknete, wie die von Feuchtigkeit gesättigte Luft ihn benetzte. Aber der Fels hatte die raue graue Kälte aufgenommen, und das machte sich in seinen Füßen unangenehm bemerkbar. Seine Zehen waren ein wenig taub, und seine 42er-Schuhe fühlten sich an dem vom Gletscher polierten Granit schlabbrig an. Er hätte besser seine 41er nehmen sollen, dachte er.
Jahre zuvor, als er zum ersten Mal eine Free-Solo-Begehung des El Capitan in Betracht zog, hatte Alex eine Liste aller Schlüsselstellen der Route Freerider angefertigt – jener Stellen, die ein sorgfältiges Studium und eine gründliche Einübung erfordern würden. Die Querung zum Round Table Ledge, der Enduro Corner, das Boulder-Problem, das Abklettern in das Monster und die Platte in Seillänge Nummer 6, 200 Meter über dem Boden, die er gerade in Angriff nahm. Von all den Knackpunkten an der 1000 Meter hohen Route verfolgte ihn dieser am allermeisten, und das aus einem einfachen Grund: Es ist eine Reibungskletterei ohne jegliche Griffe zum Stehen oder Ziehen. Als ob man auf Glas hochläuft, dachte Alex.
Er konnte den Gedanken an die Tatsache nicht loswerden, dass er einmal an dieser Stelle gestürzt war. Sie ist nur mit 5.11 1 bewertet, was zwar immer noch sehr schwierig ist, aber drei Grade unter Alex’ Maximum von 5.14 liegt. Doch im Gegensatz zu den überhängenden Routen im Kalkfels in Marokko, die Alex schaffte, indem er sich an Löchern und Leisten festkrallte, musste er an dieser Schlüsselstelle sein Schicksal voll und ganz seinen Füßen anvertrauen, die auf einem äußerst schmierigen Reibungstritt standen. Die Kunst dabei ist, die Gummi-Haftsohle der Kletterschuhe möglichst stark an den Fels zu pressen. Ob der Schuh haftet, hängt von vielen Faktoren ab, insbesondere aber vom Winkel, mit dem er an den Fels gepresst wird. Man findet den besten Winkel, indem man den Körper so weit wie möglich vom Fels weg neigt, ohne nach hinten zu kippen. So belastet der Fuß den Fels in möglichst senkrechter Richtung und erzeugt die größtmögliche Reibung. Je entspannter ein Kletterer dies bewerkstelligen kann, desto besser fühlt sich ein Reibungstritt an. Umgekehrt lehnt sich ein angespannter oder ängstlicher Kletterer instinktiv zum Fels hin und sucht dabei mit den Händen nach einem nicht existierenden Halt. Sich in einer ungesicherten Situation nur auf eine solch heikle Balance zwischen der nötigen Reibung und dem Überschreiten des Kippwinkels zu verlassen, ist vielleicht die gefürchtetste Bewegung, vor der ein Kletterer stehen kann.
Alex war diesen Abschnitt des El Cap 20 Mal geklettert und war ein Mal bei dieser Bewegung gestürzt. Er, der über jede Klettertour seit seiner Highschool lückenlos Protokoll führt, hatte in den letzten Tagen ausgerechnet, dass bei dieser Bewegung fünf Prozent seiner Versuche fehlgeschlagen waren. Und das in Situationen, wo er gesichert war; er hatte ein Seil benutzt, das einen halben Meter unterhalb seiner Taille in einen Bohrhaken eingehängt war.
Neun Jahre lang, fast ein Drittel seines Lebens, war er vom Gedanken besessen gewesen, den El Capitan free solo zu klettern. Inzwischen hatte er alle Facetten dieser Frage analysiert. »Manche Dinge sind einfach so cool, dass sie jedes Risiko wert sind«, hatte er mir in Marokko erklärt. Dies war das letzte Free Solo auf seiner Liste, und wenn es klappte, dann konnte er vielleicht beginnen, alles ein wenig entspannter anzugehen, vielleicht zu heiraten, eine Familie zu gründen, sich mehr Zeit für seine Stiftung zu nehmen. Er liebte das Leben und hatte nicht die Absicht, jung zu sterben und mit Ruhmesglanz von der Bühne zu gehen. Und deshalb war eine Chance von 20 zu 1 zu wenig. Er musste diese Bewegung und auch die anderen Schlüsselstellen mit einer Sicherheit im Blut haben, die so nahe wie möglich an 100 Prozent war.
Aber im Augenblick dachte Alex an nichts von alledem. Er hatte sich antrainiert, seine Gedanken nicht wandern zu lassen, wenn er am Fels war. Schließlich war er berühmt für seine Fähigkeit, die Angst in eine Box zu sperren und diese auf einem entlegenen Regal in seinem Hinterkopf zu deponieren. Die Lebensfragen, die Analysen – diese Dinge reservierte er sich für die Zeit, in der er in seinem Bus abhing, wanderte oder mit dem Rad unterwegs war. In diesem Augenblick hatte er bloß Spaß und dachte nur ans Klettern, an gutes Klettern.
Details, mochten sie nun an die Oberfläche seines Bewusstseins dringen oder nicht, mischten sich in die Klettergleichung, die zu lösen er soeben im Begriff war: etwa, dass er das Gefühl in seinem rechten Fuß nicht so gut deuten konnte, weil der große Zeh leicht taub war, dass die Hornhaut an der Spitze seines linken Zeigefingers sich am kalten Fels glasig anfühlte oder dass sein peripheres Sehvermögen, der Schlüssel für das Auffinden all der subtilen Kräuselungen und Vertiefungen im Fels, abnahm, wenn er die Kapuze aufhatte, was gerade jetzt der Fall war.
Damals in den 1960ern, als dieser Abschnitt des El Cap erstmals begangen wurde, bohrte der Erstbesteiger ein Viertel-Zoll-Loch in den Fels, hämmerte einen Bohrhaken hinein, hängte eine Leiter ein und stand auf, um über die blanke Stelle hinwegzugreifen. Dieser Bohrhaken – inzwischen durch eine viel stabilere Drei-Achtel-Zoll-Version aus rostfreiem Stahl ersetzt – war immer noch da, gerade neben Alex’ Knöchel.
Auf seinem linken Fuß balancierend hob Alex sein rechtes Bein hoch an und drückte seine Schuhspitze an den blanken, 75 Grad steilen Fels. Dann, auf die Reibung mehr vertrauend als sie spürend, verlagerte er plötzlich sein ganzes Körpergewicht auf diesen Fuß.
Er hielt, aber nur eine Sekunde lang.
Oft kann ein Abrutschen des Fußes durch den Halt der Hände an den Griffen unter Kontrolle gehalten werden. Aber Alex’ Hände lagen flach auf der glatten, grifflosen Platte; nichts konnte dem gnadenlosen Zug der Schwerkraft entgegenwirken. Alex war gewichtslos und im freien Fall, als die Ferse seines rechten Fußes auf einen Vorsprung der Wand knallte, wobei sein Fuß am Knöchel hart abknickte. Aber noch bevor er Schmerzen verspürte, straffte sich das Seil an seinem Gurt, und er kam rutschend zum Stillstand. Es hätte ein kurzer Routinesturz sein können, so wie beim anderen Mal, als er abgerutscht war, aber Alex hatte sich absichtlich nicht am Bohrhaken der Schlüsselstelle eingehängt, denn er wollte sich an ein Free Solo des Freerider langsam herantasten. Er baumelte etwas mehr als zehn Meter unterhalb der Stelle, an der er abgerutscht war.
»Oje«, wimmerte Sanni, die nun nur etwa drei Meter rechts unter Alex war. Während er stürzte, hatte sie versucht, eine Handvoll Seil einzuholen, um den Sturz zu verkürzen. Das tat sie mit ihrem linken Arm, ihr rechter lag unten an ihrer Hüfte. Als Alex’ 70 Kilo am Seilende ankamen, zog der Ruck Sanni heftig nach oben, sie klatschte gegen die Bandschlinge, mit der sie am Haken gesichert war, ihr linker Arm knallte gegen den kalten Granit.
»Bist du okay?«, fragte Alex seine Freundin.
»Ich bin okay, es ist nur ein blauer Fleck«, rief sie nach oben, ihr Atem kam schnell und stoßweise. »Und du?«
»Ich glaube, ich bin auch okay, aber mein Knöchel tut wirklich weh.« Alex blickte hinunter und sah, dass sein rechter Knöchel anschwoll. Um ihn herum war die Wand mit rotem Blut bespritzt. Er presste seine Finger an sein Knie. Es fühlte sich schwammig an und wie voll Flüssigkeit, als wäre im Inneren etwas geborsten.
»Ich versuch mal, es zu belasten«, sagte er. Er setzte seinen Fuß an einem schmalen Absatz auf und versuchte, auf ihm zu stehen. Stechende Schmerzen schossen wie Blitzstrahlen in seinem Bein hoch. »Okay, das fühlt sich schlecht an, verdammt schlecht.«
Alex’ erster Vorstoß am Freerider in dieser Saison hätte schlimmer ausgehen können. Wäre dies ein Free-Solo-Versuch gewesen, so läge er jetzt tot am Fuß der Wand.
1 Im Text wird das in den USA gebräuchliche Yosemite Decimal System (YDS) für die Bewertung der Routen verwendet. Im Anhang des Buches findet sich ein Vergleich mit der in Mitteleuropa gebräuchlichen UIAA-Skala.
Teil 1
JUGEND
»Hon wird den El Cap free solo klettern«
Jimmy Chin holte tief Atem, blies seine Wangen auf und atmete langsam aus. »Es gibt etwas, das ich dir erzählen muss«, flüsterte er. »Kannst du ein Geheimnis für dich behalten?« Wir standen Brust an Brust in der Jackson-Hole-Gondel, hineingepfercht mit etwa hundert weiteren rotgesichtigen Skifahrern. Es war Februar 2016, und ich war mit meinen beiden 17 und 14 Jahre alten Söhnen in ihren Februar-Schulferien in den Tetons. Sie standen ein paar Meter neben mir, ohne mich zu beachten, und versuchten, durch das beschlagene Plexiglasfenster einen Blick auf die Berge zu erhaschen. Wir hatten Jimmy vorher in der Warteschlange getroffen. Ich hatte ihn schon fast ein Jahr lang nicht mehr gesehen.
»Natürlich«, flüsterte ich zurück. »Was gibt es denn?«
Jimmy lehnte sich vor, bis sein Gesicht wenige Zentimeter von meinem entfernt war. Seine Augen wurden groß. »Hon [so wird Alex Honnold in der Kletterszene genannt] wird den El Cap diesen Herbst solo klettern«, sagte er.
»Was? Du nimmst mich auf den Arm, oder?«
»Ich schwöre es.«
Ich schaute mich um, um zu sehen, ob jemand uns gehört hatte, aber alle wippten zu AC/DCs »Back in Black«, das aus dem Lautsprecher dröhnte. Jimmy starrte mich an, mit offenem Mund.
»Hat er dir das gesagt?«, fragte ich.
»Ja. Chai und ich drehen einen Film darüber. Die paar Personen, die davon wissen, haben alle ein Stillhalteabkommen unterzeichnet, also plaudere bitte nichts davon aus.« Elizabeth Chai Vasarhelyi ist Jimmys Frau und wie er selbst preisgekrönt im Dokumentarfilmen.
»Macht er den Freerider?«
»Ja.«
»Wann?«
»Wahrscheinlich Anfang November.«
Als mir die Bedeutung dessen, was gerade gesagt worden war, langsam bewusst wurde, schüttelte es mich in meinem Innersten. El Capitan. Ohne Seil. Wahnsinn.
Ich war den Freerider geklettert. Oder, besser gesagt, hatte es versucht. Ich erreichte den Ausstieg nach mehreren Tagen brutaler Strapazen, aber nicht ohne unterwegs mehrmals zu stürzen, wobei die Seile und Sicherungen jeden meiner Stürze abfingen. Auf einigen der härtesten Abschnitte, den Schlüsselstellen, schaffte ich es nicht, die Fingerspitzenklemmer zu halten, und die Risskanten waren so rund, dass meine Hände abrutschten. Deshalb war ich notgedrungen »technisch« geklettert, das heißt, ich hing an Sicherungsgeräten, die ich in die Risse geklemmt hatte. Ich mogelte. Die Route wird Freerider genannt, weil sie frei geklettert werden kann, das bedeutet, man kann an ihr hochkommen, ohne andere Hilfsmittel als die eigenen Hände und Füße zur Fortbewegung zu verwenden, das Seil dient nur als Sicherung für den Fall eines Sturzes. Die allerbesten Kletterer schaffen es, Freerider ohne technische Hilfsmittel zu klettern, aber ich konnte keine einzige Person nennen, die auf ihrem Weg nach oben nicht wenigstens ein Mal ins Seil gestürzt war.
Was um alles in der Welt dachte also Alex? Der El Capitan ist eine 1000 Meter hohe, senkrechte, schimmernde, vom Gletscher blank geschliffene Wand. Und er hatte vor, sie solo zu versuchen. Unangeseilt. Ohne Ausrüstung. Ohne Sicherung. Auf Präzision bei jedem Griff und jedem Tritt hoffend. Ein Ausrutschen, eine um einen Zentimeter zu hoch gesetzte Schuhspitze, ein um ein paar Grad verkanteter Schuh, ein mit der falschen Hand angefasster Griff – und Alex würde nach unten stürzen, vielleicht schreiend, wenn der Grund mit 200 Stundenkilometern auf ihn nach oben zuraste. Wenn er am Boulder-Problem stürzte, das die Schlüsselstelle der Route ist, 640 Meter über dem Erdboden, würde er ganze vierzehn Sekunden lang in der Luft sein – etwa die Zeit, die ich brauchen würde, um eine Strecke von der Länge eines Fußballplatzes zu laufen.
Ich wusste, dass es Alex’ Traum war, als Erster den El Capitan free solo zu klettern – nur hatte ich es nie für möglich gehalten, dass es wirklich geschehen würde. Als ich ihn 2009 auf seine erste internationale Expedition nach Borneo mitnahm, vertraute er mir an, dass er darüber nachdachte. In den darauffolgenden Jahren begleitete mich Alex auf weiteren Kletter-Expeditionen, in den Tschad, nach Neufundland und in den Oman. Dabei erlebte ich allerlei klassische »Alexis-men«. Zum Beispiel, als er mir in Borneo am Fuß der Wand erklärte, warum er nicht mit einem Helm kletterte, auch wenn der Fels gefährlich lose war (er besaß gar keinen Helm); oder damals in der Ennedi-Wüste im Tschad, als er gähnend dasaß und die Haut um seine Fingernägel inspizierte, während Jimmy Chin und ich vier messerbewaffneten Banditen entgegentraten (er glaubte, es wären kleine Kinder). Der vielleicht beeindruckendste Alexismus entstand unter einem 750 Meter hohen Felsen im Oman, als er unser Seil auf seinen Rücken schnallte und mir sagte, er würde haltmachen, sobald es »angebracht sei, sich anzuseilen« (die Stelle, wo es angebracht war, tauchte nie auf). Aber Alex und ich verbrachten auch unzählige Stunden, in denen wir über Philosophie, Religion, Wissenschaft, Literatur und Umwelt diskutierten, und über seinen Traum, eine gewisse Wand free solo zu klettern.
Ich spielte oft seinen Gegenpart, besonders wenn es um das Thema Risiko ging. Ich bin nicht gegen die Idee des Free-Solo-Kletterns – ich tue das gelegentlich auch selbst. Ich wollte nur, dass Alex es sich bewusst machte, wie nahe an der Grenze er sich bewegte. Wie die meisten Kletterer hatte ich eine ungeschriebene Liste der Personen, von denen ich glaubte, dass sie ein zu hohes Risiko in Kauf nahmen – und Alex stand ganz oben auf der Liste. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich ihn kennenlernte, waren die meisten auf meiner Liste schon eines frühen Todes gestorben (und der Rest war nicht weit im Rückstand). Ich mochte Alex und hatte nicht den Eindruck, dass es viele Leute gab, die Lust hatten, ihm ins Gewissen zu reden, deshalb hatte ich nichts dagegen, die Vaterfigur zu spielen. Und Alex schien es auch recht zu sein. Ja, es schien ihm sogar zu gefallen, mich in Diskussionen über das Risiko zu verwickeln, und er entkräftete meine Argumente mit derselben Geschicklichkeit und Eleganz, wie er Fingerrisse und Überhänge überwand. Worauf das Ganze hinauslief, war, dass es für Alex Honnold ein viel schlimmeres Schicksal wäre, nicht voll gelebt zu haben, als jung zu sterben.
Ich blickte zu meinen beiden Söhnen hinüber, die noch immer durch das Fenster der Gondel guckten und es nicht erwarten konnten, Ski zu fahren. Alex war erst 29 Jahre alt. Wenn er es schaffte, so alt zu werden wie ich, dann war sein Leben viel mehr als nur Klettern; vermutlich würde sein Verlangen nach Risiko in entsprechendem Maß abnehmen – so wie es auch bei mir der Fall gewesen war.
Aber am allermeisten beschäftigte mich der Gedanke, jetzt, da Jimmy mir die Last des Wissens um das Bevorstehende aufgebürdet hatte, was ich nun tun sollte. Sollte ich versuchen, es ihm auszureden? Konnte ich das? Oder sollte ich dieses verrückte Unternehmen unterstützen und ihm helfen, seinen Traum zu erfüllen?
»Komm mit uns«, sagte ich zu Jimmy, als wir unsere Sachen packten und aus der Gondel ausstiegen. »Wir gehen nach Rock Springs. Da gibt es jede Menge guten Schnee.«
»Das würde ich gerne tun«, antwortete er, »aber ich kann nicht. Ich habe zurzeit viel zu tun. Ich bin nur schnell mal hochgefahren, um einen frischen Kopf zu bekommen. Ich muss zurück an die Arbeit.«
Er klopfte Will und Matt mit der Faust an die Brust und lehnte sich dann vor, um mit mir zu sprechen.
»Ich glaube, ich möchte über diese Sache schreiben«, sagte ich, als wir uns die behandschuhten Hände reichten. Ich hatte mich rasch entschieden, dass es mir nicht zukam, zu versuchen, Alex die Sache auszureden. Selbst wenn sich einer meiner Söhne oder meine Tochter einer ähnlichen Herausforderung verschrieben hätte, so würde ich versuchen, ihnen denselben Respekt zu zollen. Es würde schwer sein, aber ich würde es versuchen.
»Ja, das hatte ich mir schon gedacht. Ich ruf dich dann an«, sagte Jimmy. Dann drückte er die Skistöcke in den Schnee und fuhr los. Nach wenigen Sekunden verschwand er im Halbdunkel.
Jimmy und ich sprachen im Laufe der nächsten paar Monate oft miteinander. Es war ein Jahr vergangen seit dem Debüt von Meru, Jimmys und Chais erstem gemeinsamen Film. Meru erzählt die Geschichte eines der letzten großen Probleme des Himalaja-Kletterns, der sogenannten Haifischflosse, das Jimmy, Conrad Anker und Renan Ozturk schließlich im Jahr 2011 lösten. Gute Bergsteigerfilme sind in Kletterkreisen eine Weile angesagt, dann geraten sie in Vergessenheit. Mit Meru jedoch gelang Jimmy und Chai ein Supererfolg. Meru gewann den Zuschauerpreis beim Sundance-Film-Festival, kam in die enge Auswahl für einen Oscar und war der höchstbezahlte Dokumentarfilm im Jahr 2015. Hollywood hatte Jimmy und Chai entdeckt. Filmstudios wie Sony, Universal und 21st Century Fox wollten wissen, was die beiden als Nächstes vorhatten. Jimmy erzählte mir, dass er eines Tages einen unangemeldeten Anruf von einem Typen namens Evan Hayes bekam, Vorsitzender der Filmproduktionsfirma Parkes+MacDonald. Walter Parkes und Laurie MacDonald sind legendäre Hollywood-Produzenten. 1994 waren sie bei der Gründung des DreamWorks-Filmstudios dabei, wo sie dann drei Oscargewinner in Folge herausbrachten – American Beauty, Gladiator und A Beautiful Mind – Genie und Wahnsinn. Hayes hatte gerade die Dreharbeiten für das Drama Everest beendet, inspiriert durch das Everest-Unglück von 1996, das auch die Grundlage für John Krakauers Buch In Eisige Höhen war. Hayes mochte das Bergsteigergenre und wollte noch einen Film dieser Art drehen. Und er war in der Zuschauermenge beim Sundance-Festival, als Meru fünfminütige Standing Ovations bekam.
Hayes machte einige Vorschläge für Kletterfilme, aber keiner begeisterte Jimmy. Sie waren schon dabei aufzulegen, als Jimmy sich entschloss, eine halb ausgegorene Idee aus dem Sack zu lassen, die ihm schon seit ein paar Monaten vorgeschwebt war.
»Nun gut, da ist dann noch diese eine Idee, mit der ich gespielt habe«, sagte er.
Und dann berichtete er Hayes über Alex Honnold, den weltbesten Free-Solo-Kletterer. Er sagte nichts vom El Capitan, denn zu diesem Zeitpunkt hatte er keine Ahnung, dass Alex an das Free Solo dachte. In all den Jahren, die er Alex nun kannte, hatte er ihn nicht ein einziges Mal danach gefragt. Und Alex selbst hatte noch keiner Menschenseele verraten, dass er es ernsthaft in Betracht zog.
»Das ist es!«, sagte Hayes. »Das ist der Film.«
Jimmy lenkte ein: »Also, ähm, ja, ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich diesen Film wirklich machen will. Ich muss noch darüber nachdenken.«
Später besprach er das Thema mit Chai, und sie beschlossen, dass sie Alex anrufen sollte, um ihn kennenzulernen und einzuschätzen, das heißt sicherzustellen, dass es genug zu erzählen gab, damit ein ganzer Dokumentarfilm in Spielfilmlänge über ihn gedreht werden konnte. Während dieses Telefongesprächs mit Chai erwähnte Alex so ganz nebenbei, dass er den El Capitan vielleicht free solo klettern würde. Chai ist keine Kletterin, deshalb bekam sie die Bedeutung der Worte, die Alex gerade fallen lassen hatte, nicht unmittelbar mit.
»Als Chai mir das über den El Cap berichtete, wollte ich das Ganze aus gutem Grund abblasen«, erzählte mir Jimmy. »In diesem Moment wusste ich, dass ich den Film nicht drehen wollte. Wenn du in dieser Welt lebst und das Jenseits vor dir siehst … so herrlich ist das Sterben ja nun auch wieder nicht.« Zwei Monate lang hielt sich Jimmy von Hayes fern. Und er fand kaum Schlaf.
Jimmy benötigte damals Rat und Hilfe, aber er wollte sich an keinen seiner Mentoren wenden, weil er befürchtete, sie würden ihn verurteilen, weil er die Idee überhaupt in Betracht gezogen hatte. Dann fand er sich gleichzeitig mit seinem alten Freund Jon Krakauer in Manhattan wieder. Als sie zusammen durch eine Avenue der Upper East Side schlenderten, erzählte Jimmy Jon Krakauer von seiner Idee für den Dokumentarfilm. Er sagte, es sei eine Geschichte, in der es darum geht, »Träume zu verwirklichen« und Entscheidungen zu treffen, bei denen es um Leben oder Tod geht. Dann erwähnte er, dass Alex gesagt hatte, er denke, er könne vielleicht als Teil des Projekts den El Cap free solo klettern.
Laut Jimmy antwortete Krakauer: »Aha, also darum geht es also.«
»Ja, vermutlich«, antwortete Jimmy.
»Na, er wird das durchziehen, mit dir oder ohne dich, und wenn er möchte, dass es gefilmt wird, so seid ihr die richtigen Leute dafür.«
»Also? Soll ich es machen?«, fragte Jimmy.
»Ich werd mir den Film anschauen«, sagte Krakauer.
Es musste noch viel geschehen. Und viel war schon geschehen. Dieses Buch handelt davon, wie es zu dieser unglaublichen Begehung kam. Um zu begreifen, was Alex schon bald versuchen würde, muss man ein wenig Bescheid wissen über seinen Lebensstil und über die Welt, in der er der Mensch wurde, der er heute ist. Es ist die Welt des Kletterns. Nicht jeder lebt in ihr. Aber ich bin glücklich, ja sogar stolz, sagen zu können, dass ich es sogar jetzt noch tue. Ich denke, man könnte auch sagen, dass es ein Glück war, dass mein Lebensweg sich mit denen von Alex Honnold und Jimmy Chin und einer ganzen Menge anderer Menschen kreuzen sollte, welche die Grundlagen für das schufen, was dann geschah.
Alex war im Begriff, im Klettern über sich selbst und über alle von uns hinauszuwachsen.
Crazy Kids of America
»Was passiert, wenn man stirbt?«, fragte ich eines Tages meinen Vater, der im Wintergarten unseres im Kolonialstil erbauten Backsteinhauses saß und die New York Times las.
Mein Vater senkte die Zeitung und sah mir in die Augen. »Dann bist du Futter für die Würmer, Mark.« Er hob seine Zeitung wieder hoch und las einfach weiter, während ich entgeistert dastand.
Als ich an diesem Abend im Bett lag, ging mir dieses kurze Gespräch noch lange in meinem zehn Jahre alten Kopf herum. Wenn es auf der anderen Seite nichts gibt, grübelte ich, wenn Himmel und Hölle nur Produkte unserer kollektiven Fantasie sind, dann muss der Tod endgültig sein – eine ewige Leere, aus der es keine Rückkehr gibt. Wurmfutter. Für immer.
Von da an dachte ich wie besessen über meine eigene Nicht-Existenz nach. Wie kann man sich mit dem Gedanken versöhnen, fragte ich mich, dass man an einem unbekannten zukünftigen Zeitpunkt aufhören wird zu existieren? Was sollte ich mit meiner begrenzten Zeit auf Erden anfangen? Ich versuchte, durch Denken einen Weg aus diesem existenziellen Irrgarten zu finden, aber die Gedanken in meinem Kopf begannen, sich endlos im Kreis zu drehen – und ich konnte den Abschaltknopf nicht finden.
Mein Idol war damals Evel Knievel. Mein Papa kaufte mir einen aufziehbaren Evel auf seinem Stunt-Bike, und ich verbrachte Stunden damit, den Plastik-Superhelden von ausgeklügelten Rampen springen zu lassen, die ich aus alten Schuhschachteln und Dachziegeln gebaut hatte, sodass er in Zimmerpflanzen und Spielzeug-Soldaten krachte, die ich darunter aufgestellt hatte. Dann ging ich ohne zu zögern dazu über, das alles in die Wirklichkeit zu übertragen. Auf einem langen, unbenutzten Schotterweg hinter einem Altersheim bauten meine Freunde und ich aus Holzplatten und Sperrholz eine drei Meter hohe, zweifache Sprungschanze. Die Rampen waren etwa doppelt so hoch wie wir selbst und hatten die Eigenschaft zusammenzubrechen, wenn wir auf unseren Rädern mit hoher Geschwindigkeit darüberfuhren. Mir passierte das ziemlich häufig, und meine Wunden mussten so oft genäht werden, dass das Newton-Wellesley-Krankenhaus meinen Vater wegen des Verdachts der Kindesmisshandlung ins Verhör nahm.
Spätabends wartete ich, bis meine Eltern eingeschlafen waren, um dann heimlich durch das Fenster meines Zimmers im dritten Stock aus dem Haus zu klettern. Ich rutschte über die Schieferschindeln hinunter, ließ mich von der Dachrinne hängen und sprang leise auf das Kupferdach über Papas Arbeitszimmer. Dann ein kurzer Rutscher über ein Regenabflussrohr hinunter, und ich war frei. Manchmal zog ich mich bis auf Socken und Schuhe nackt aus und streifte durch die Nachbarschaft, um Klingelputzen zu spielen. Ich klingelte und versteckte mich dann in einem nahe gelegenen Gebüsch. Wenn meine Nachbarn mit schlaftrunkenen Augen ihre Haustür öffneten, um nachzusehen, wer da mitten in der Nacht geklingelt hatte, dann schoss ich mit Flaschenraketen auf sie, die ich treffsicher mit einem in der Mitte auseinandergesägten und in der Form einer Maschinenpistole wieder zusammengeklebten Plastik-Baseball-Schläger abfeuerte.
Meine Entdeckung der Risikofreude als existenzieller Balsam führte später zu lang haltenden Freundschaften mit Menschen, die diese Angewohnheit mehr oder weniger teilten, aber damals fehlte meinen jungen Freunden oft die Motivation, etwas Waghalsiges zu unternehmen. Einmal, als ich im Arbeitszimmer meines Vaters herumstöberte, fand ich eine Schachtel extravaganter Streichhölzer mit goldenen Köpfen; er musste sie wohl auf einer seiner Dienstreisen bekommen haben. Ich hatte einen geheimen Platz im Wald hinter unserem Haus, wo ich alle möglichen Dinge anzündete, von Kerzen und Birkenrinde angefangen bis zu Flaschenraketen und Feuerwerksleuchtschlangen, deshalb steckte ich die Zündhölzer in meine Tasche.
Am nächsten Morgen, auf dem Weg zur Bushaltestelle, beschloss ich, dass die Streichhölzer zum Verbrennen zu wertvoll waren. Als ich ein Exemplar meiner neuen Kostbarkeiten zwischen meinen Fingern in die Höhe hielt, starrten es die anderen Jungs aus meiner Nachbarschaft ehrfürchtig an.
»Ist das echtes Gold?«, fragte einer von ihnen.
»Ja, das ist es«, antwortete ich.
»Kann ich eins haben?«, fragte er.
Neben der Bushaltestelle war ein kleiner, seichter, schmutziger Teich. Es war Frühwinter, und eine dünne Eisschicht bedeckte das schwarze, schlammige Wasser. Mitten im Eis, etwa 50 Meter vom Ufer entfernt, schaukelte ein Einweg-Kaffeebecher.
»Hol mir diesen Becher«, sagte ich zu ihm, »und das Ding gehört dir.« Sekunden später bahnte er sich, halb watend, halb schwimmend, das Eis mit seinen Fäusten zerbrechend, seinen Weg durch das eiskalte, sumpfige Wasser. In die Schule schaffte er es an diesem Tag nicht mehr, aber er bekam sein Zündholz – und wurde damit der Erste der »Golden Fellows«.
In den nächsten paar Wochen konnte ich dank meiner Goldkopf-Streichhölzer meine Freunde motivieren, eine wichtige und schwierige Aufgabe zu meistern, die ich für die Golden Fellows ausgearbeitet hatte – auf dem Kamin jedes Hauses in der Nachbarschaft zu tanzen. Jeder meiner Freunde – vom schmächtigsten bis zum stärksten – kletterte über ein meist schneebedecktes Dach hinauf und vollführte einen kitschigen Disco Dance an oder auf dem Dachfirst, während wir uns vor Lachen bogen. Dann kletterte der Junge herunter, meist mit einem Lachen im Gesicht und brennend vor Aufregung, um seinen Preis entgegenzunehmen. Ich gab mir Mühe, aus dieser Verleihung des Goldenen Zündholzes inmitten der eisigen Nacht eine Zeremonie zu machen.
Als ich das letzte Goldene Zündholz überreichte, war es wie in dem Kinderbuch Der Lorax von Dr. Seuss, als der letzte Baum gefällt wurde – alle packten ihre Sachen zusammen und gingen nach Hause. Es waren noch einige Häuser auf der Liste übrig geblieben, also hielt ich allein durch, kletterte an Abflussrohren hinauf, überwand Schieferdächer in Reibungskletterei, hangelte mich an Dachrinnen entlang; aber wenn ich dann auf den Dachfirsten der Häuser alleine meinen kleinen Tanz vollführte, war es nicht mehr dasselbe, denn niemand sah mir zu und feuerte mich an.
Jeden Freitagnachmittag verstaute meine Mama uns Kinder auf dem Rücksitz unseres zitronenfarbenen Chrysler Kombi, um meinen Vater in der Tiefgarage der Bank of Boston abzuholen. Dort übernahm er das Steuer für die dreistündige Fahrt zu unserem Ferienhaus in den White Mountains in New Hampshire. Als Beifahrerin war es Mamas Hauptaufgabe, ihn laufend mit Bierdosen zu versorgen und ihm zuzuhören, wenn er sich über die Ärgerlichkeiten und die Käuflichkeit und Korruption in der Welt des Bankgeschäfts Luft machte, in der er einen großen Teil seines Lebens verbrachte.
Meine Schwester und ich rutschten unangeschnallt und gelangweilt auf dem Rücksitz herum und gingen uns gegenseitig auf die Nerven. Ich hatte eine Methode entdeckt, wie ich von meinen Eltern ein wenig Geld erpressen konnte: Wenn ich ununterbrochen vor mich hinquasselte, was mein Vater »Munddurchfall« nannte – so sang ich zum Beispiel den damals gängigen Coca-Cola-Slogan »Coke is it!« und fügte vor dem »it« ein »sh« ein –, dann boten sie mir Geld an, damit ich aufhörte. Die Belohnung betrug nur 25 Cent, aber damit konnte ich in einem Gasthaus in der Nähe unseres Hauses einmal »Pac-Man« auf dem Flipper spielen oder im Süßwarenladen einen Charleston-Chew-Schokoriegel kaufen. Ich bin mir sicher, dass meine Eltern keine Ahnung hatten, wie aufmerksam ich während dieser Autofahrten ihren Gesprächen zuhörte oder wie stark sie sich mir einprägten. Nach so vielen Jahren kann ich mich noch immer an die Namen all dieser Leute erinnern, die versuchten, am Stuhl meines Vaters zu sägen, der damals Senior Vice President war. Meine Zwangsvorstellung von der schwarzen ewigen Leere des Todes, die auf mich zukam, machte mir deutlich bewusst, dass es wichtig war, was man aus seiner Lebenszeit machte. Das Bankgewerbe oder irgendetwas Ähnliches klang nicht nach sinnvoll verbrachter Zeit. Jahre später, als mein Vater mich fragte, was ich nach meinem College-Abschluss im Fach Philosophie zu tun gedachte, sagte ich ihm in vollem Ernst: »Ich habe mich entschlossen, nicht Karriere zu machen.«
In New Hampshire gründete ich nach dem Vorbild der Golden Fellows einen neuen Klub, den ich »Crazy Kids of America« nannte und der rasch meine Kumpels aus dem Skitraining anzog. Zum Klub gehörten einige nennenswerte Mitglieder, wie zum Beispiel Tyler Hamilton, ein Energiebündel, in dessen Augen immer ein listiges Funkeln blitzte und der später Lance Armstrongs rechte Hand bei der Tour de France werden sollte, und Rob Frost, der klein für sein Alter, aber streitlustiger als jeder Dorfköter war und der heute ein auf die Vogelperspektive spezialisierter Kameramann und Filmemacher ist. Sogar Chris Davenport, heute ein legendärer Extremskifahrer, machte gelegentlich bei Crazy-Kid-Aktionen mit; seine katzenartige athletische Geschicklichkeit und sein draufgängerischer Wagemut ergänzten unsere Mannschaft perfekt.
Ich hatte bei den Golden Fellows gelernt, dass die Belohnung für einen Stunt nicht etwas sein sollte, das nur in beschränkter Anzahl vorhanden war; für die Crazy Kids of America definierte ich deshalb eine Rangordnung. Aber statt Hauptmann, Feldwebel, Leutnant und so weiter verwendete ich verschiedene Superhelden – Spider-Man, Batman, Robin, Superman, Aquaman, Wonder Woman –, und wenn mir die Superhelden ausgingen, fügte ich Tom Sawyer und Huck Finn hinzu. Jeder Rang war zudem in drei Stufen unterteilt: junior, middle und senior. Je nachdem wie gefährlich die Aufgabe war, erhielt man einen gewissen Rang.
Unsere Spezialität war es, mit Ski-Torstangen aus Bambus, die wir aus unserem Skilager in Wildcat Mountain klauten, über Treibeis führende Flüsse zu springen. Einige meiner besten Leutnants – darunter ein senior Aquaman und ein junior Batman – und ich selbst entwickelten im Springen eine große Kunstfertigkeit, wir schafften es über offene Wasserstellen mit vier Metern Breite. Natürlich hatten wir aus dem vorhandenen Vorrat die stabilsten Bambusstangen herausgesucht, und die restlichen Jungs mussten mit den übrig gebliebenen vorliebnehmen, die dünn waren und oft im ungünstigsten Moment auseinanderbrachen.
Die verschiedenen Aufgaben folgten einem ähnlichen Schema. Ein hochrangiges Crazy Kid und ich legten zuerst an einem kleinen Fluss, der hinter der Wildcat-Base-Hütte vorbeifloss, eine Überquerungsstelle fest, wo wir als Meister gerade noch drüberkamen; dann opferten wir ein paar Ränge als Belohnung, und meine senior Superhelden und ich übten intensiven Gruppendruck auf die Jungen mit niedrigeren Rängen aus, es uns nachzumachen. »Das schaffst du locker, Mann!«, rief ich etwa einer junior Wonder Woman von der anderen Seite des Flusses her zu, wobei ich mir in Erwartung eines spektakulären Misserfolgs die Hände rieb.
So manches noch unerfahrene Crazy Kid erlebte den sogenannten »Nestea Plunge« wie im bekannten Nestea-Werbeclip, wo die Leute rückwärts ins Nasse fallen. Ein neuer Rekrut kreuzte einmal mit Skischuhen auf (statt mit Moon Boots, die wir anderen trugen) und versuchte sich just an der schwierigsten Stelle an einem Sprung von einem vereisten Felsbrocken, gerade so, als wäre er Leistungsstabhochspringer. Wir wussten, dass es reine Torheit war, einen Spider-Man-Rang ohne vorheriges Training anzustreben, aber wie konnten wir es ihm verbieten, wenn er es versuchen wollte? Es ging gründlich daneben, und er verschwand völlig unter Wasser. Ein kurzes Stück weiter unten tauchte er wieder auf und kämpfte sich, wie es sich für ein gutes Crazy Kid gehörte, seinen Weg zum Ufer zurück.
Unsere Skitrainer taten so, als ob sie von den außerplanmäßigen Aktivitäten ihres Teams nichts wussten, aber sie mussten den rapid schwindenden Vorrat an Torstangen und unsere Neckereien darüber, wer zu welchem Rang aufgestiegen war, sehr wohl bemerkt haben. Und in stillschweigendem Einverständnis erlaubten sie mir, im Rahmen des Festessens zum Saisonende meine eigene Preisverleihung für die Crazy Kids of America vorzunehmen. Jedes Crazy Kid erhielt eine Burger-King-Krone aus Pappe, auf die ich ein Logo geklebt hatte – eine Bleistift-Handzeichnung eines Jungen, der über den Fluss springt. Die am höchsten bewerteten Kids erhielten Spielzeug-Fallschirmspringer, die wir aufbewahrten, um sie vom Gipfel des Cathedral Ledge, eines 150 Meter hohen Felsens im nahe gelegenen North Conway, hinabschweben zu lassen.
Die meisten Eltern schätzen meinen Beitrag zur Jugendkultur New Hampshires im Sinne von »Lebe frei oder stirb«, aber andere dachten, dass ich leichtsinnig sei und einen schlechten Einfluss ausübte. Zumindest wurde einem Jungen, der einen »Nestea Plunge« gemacht und leicht unterkühlt nach Hause gekommen war, verboten, an weiteren Aktivitäten unseres Klubs teilzunehmen.
Durch eine Lücke zwischen den hochragenden Kiefern, welche den Fuß des Cathedral Ledge säumten, konnte mein Vater vom Fahrersitz aus die senkrechte Granitwand deutlich sehen. Im Vordergrund standen zwei fünfzehn Jahre alte Jungen. Einer davon war meine Wenigkeit, sein hyperaktiver Sohn, der im Kindergarten zurückgeblieben war, weil er andere Kinder biss – und nicht zählen, das Abc nicht aufsagen und seine Schuhe nicht binden konnte.
Vielleicht waren es die eng geschnürten Converse Chuck Taylors an meinen Füßen oder das weiße Allzweck-Seil aus dem Baumarkt, das ordentlich über meine Schulter gelegt war, oder die Tatsache, dass mein Kumpel Jeff Chapman, ein hervorragender Leutnant der Crazy Kids und bewährter Komplize, an meiner Seite stand, auf alle Fälle bemerkte mein Vater diesmal – der eine seltene Gabe dafür hatte, wenig von dem zu bemerken, was um ihn herum vorging –, dass etwas am Laufen war.
»He«, rief er zu uns herüber, während er seinen Arm aus dem Fenster des Kombi heraushängen ließ. »Was genau habt denn ihr beiden hier vor?«
»Oh, nichts Besonderes«, antwortete ich. »Mach dir um uns keine Sorgen. Komm einfach in ein paar Stunden wieder her, um uns abzuholen.«
Mein Vater warf noch einmal einen prüfenden Blick auf die Szene und klopfte dann zweimal kräftig auf die holzvertäfelte Tür. »Okay«, sagte er. »Dann viel Spaß, Jungs.«
Alles, was ich übers Felsklettern wusste, hatte ich einem Poster entnommen, das mein Vater an der Wand meines Schlafzimmers aufgehängt hatte. Es zeigte einen Mann mit einem markigen Gesicht, der an seinen Fingerspitzen von der Kante eines Überhangs hing, rings um ihn nur gähnende Leere und ein dünnes Seil, das er um seine Hüfte gebunden hatte. Warum mein Vater mir dieses Poster gekauft hatte, habe ich nie ergründet; er war ein langweiliger Banker, der Aktivitäten im Freien wie Wandern und Skifahren genoss, aber er war keiner, der Grenzen sprengen wollte. Niemand hatte mir gesagt, dass es ein Poster aus der Frühzeit des Klettersports war, vor der Erfindung von Gurten und Kernmantel-Seilen. Und ich hatte nicht danach gefragt.
Mit dem Poster als unserem einzigen Ratgeber entwickelten Jeff und ich unsere Grundregel: Der Vorsteigende durfte auf keinen Fall fallen. Der Nachsteigende jedoch, so entschieden wir, konnte sich durchaus auf die Sicherheit des von oben festgehaltenen Seiles verlassen. So musste immer nur eine Person ihr Leben riskieren.
Für unsere erste Felskletterei wählten wir eine moosige Rinne in der Mitte der Wand. Mit ihrem üppigen Vorrat an Bäumen und Vegetation war sie für uns die ideale Route zum Gipfel. Abwechselnd krabbelte einer von uns durch loses Gestein und Vegetation voraus, und wenn das Seil aus war, band er sich los, wickelte es ein paar Mal um einen Baum und nützte die Reibung an der Rinde, um den Nachkommenden zu sichern. Je höher wir kletterten, desto steiler wurde die Wand, bis wir endlich beide links und rechts von einer stämmigen Schierlingstanne standen, die aus einem Nährboden aus harten Erdbrocken, Moos und verrosteten Bierdosen herauswuchs. Über uns die furchterregende Schlüsselseillänge, eine senkrechte Wand aus übereinandergestapelten losen Blöcken, wie ein lebensgroßes Wackelturm-Spiel.
Jeff war mit dem Vorsteigen an der Reihe, aber er traute sich nicht so recht. Ich wollte natürlich auch nichts mit der zerbröckelnden Wand über uns zu tun haben, deshalb bot ich ein paar Crazy-Kids-Ränge an. Inzwischen hatte ich es beim Überreden der Jungs zu gefährlichen Dingen zu einer gewissen Meisterschaft gebracht, und Jeff war gegenüber meinen Verlockungen nicht immun; außerdem gab ich nur äußerst selten jemandem die Gelegenheit, die Rangstufe eines junior Tom Sawyer zu erlangen. Einige Minuten später war er mehrere Körperlängen über mir und klammerte sich an ein Kartenhaus aus Moos. Als er nach einem horizontalen Spalt über seinem Kopf langte, verschob sich eine Schuppe von der Größe eines Fernsehers und ließ Steinbrocken und Dreck über die Wand auf meinen Kopf herunterregnen. »Ich glaub, ich fall gleich«, schrie er.
»Warte noch eine Sekunde«, rief ich hinauf, während ich das Seil losband und es um mich und die Schierlingstanne wickelte, als wäre ich ein Märtyrer am Scheiterhaufen. Nach mehreren Windungen um den Baum befestigte ich das Ende mit einer Reihe von Halbschlagsknoten, die zu knüpfen ich durch Ausprobieren gelernt hatte. Zufrieden, dass ich nun nicht mehr in Bewegung gesetzt werden konnte, falls er herunterfallen sollte, rief ich Jeff irgendwas Fieses zu wie: »Okay, du kannst nun fallen.«
Jeff schaute zwischen seinen Füßen herunter und sah mich an den Baum gebunden. Zwei Dinge waren ihm klar: Er würde sterben (oder zumindest schwer verstümmelt sein), wenn er stürzte – ich aber nicht. Irgendetwas an dieser Sache schien unseren Ehrenkodex zu verletzen, und die Ungerechtigkeit, dass ich nicht blutend und zerschunden am Fuß der Wand an seiner Seite liegen würde, inspirierte ihn dazu, sich zusammenzureißen und herunterzuklettern.
Als wir uns wühlend und scharrend einen Weg durch die Rinne hinunter bahnten, immer noch mit der Absicht, zum Gipfel aufzusteigen, bemerkte ich eine horizontale Stufe, die eine potenzielle Querung hinüber zur Hauptwand ermöglichen konnte. Wir folgten ihr, indem wir seitwärts kraxelten und uns unseren Weg Hand über Hand durch Büsche bahnten, und erreichten ein schmales Band, etwa 60 Meter über dem Boden, das von allen Seiten von blanken, mächtigen Granitwänden umgeben war. Noch immer durch das Seil verbunden, jeder mit einigen Reserveschlingen über seiner Schulter, saßen wir Seite an Seite und blickten aus der Vogelperspektive auf das Tal tief unter uns hinunter. Jeder warf dem anderen einen wissenden Blick zu. Wir hatten die Crazy Kids of America auf eine ganz neue Stufe gehoben, und dieser Gedanke tat uns wohl.
Unsere Träumerei wurde durch ein klirrendes metallisches Geräusch unterbrochen, und ein paar Sekunden später erschien an der Kante unter unseren Füßen eine Hand, die zu einem Mann gehörte, der sich auf unser Band hinaufschwang. Was nun folgte, war ein Moment beidseitiger Ungläubigkeit, als die beiden Seilschaften einander in Augenschein nahmen. Er war vermutlich so Mitte zwanzig, bärtig, mit schwieligen Fingern und straffen Armen, die nur aus Muskeln und Sehnen bestanden. Ich starrte auf seine Sammlung futuristisch wirkender Geräte, die mit Metallschnappern an einer Schulterschlinge befestigt waren. Sein Seil hatte eine glatte Außenhülle, die mit einem indianisch-rot-schwarzen Muster verziert war – während unseres nur aus drei groben Strängen bestand.
»Mann, das ist aber eine schicke Ausrüstung, die du da hast«, sagte ich.
Der durchtrainierte Mann starrte uns mit einem Gesicht an, das ganz aus Staunen bestand, und sagte: »Wie zum Teufel seid ihr zwei Trottel denn hier heraufgekommen?«, oder etwas Ähnliches.
Jeff und ich machten ihm eilends Platz und beobachteten aufmerksam und hingerissen, wie er sich an einigen Bolzen in der Wand mit ein paar Metallschnappern, die er von seinem Gurt abnahm, sicherte. »Beim nächsten Mal wäre es gut, wenn wir auch so was zur Hand hätten«, sagte ich zu Jeff.
Als der Kletterpartner ankam und uns neben seinem Freund sitzen sah, war er genauso verblüfft. Aber die beiden verloren keine Zeit, sie fädelten ihre Seile durch Ringe in der Wand und machten sich für etwas bereit, was man, wie ich später lernte, Abseilen nennt. Ich beobachtete jede ihrer Bewegungen mit Adleraugen, mit der heimlichen Hoffnung, unsere neuen Freunde würden uns ein paar Ratschläge für unseren Abstieg geben oder, noch besser, uns helfen hinunterzukommen. Sich an einem Seil nach unten zu lassen schien eine tolle Möglichkeit zu sein, aber als ich beobachtete, wie sie ihre Ausrüstung dafür einsetzten, war es offenkundig, dass es ohne Gurte, ohne diese Schnapper oder diese schicken Dinger, die wie eine kunstvolle 8 aussahen und in die sie nun ihre Seile fädelten, eine knifflige Sache sein würde. Zum allermindesten wünschte ich mir einige Aussagen, ein paar Worte, mit denen sie anerkannten, dass wir Männer alle aus demselben Holz geschnitzt waren.
Aber stattdessen traten sie vom Band auf die steile, glatte Felswand hinab, über unser Schicksal ebenso unbekümmert, wie unser Vater es an diesem Morgen gewesen war, und glitten an ihren Seilen nach unten. Uns ließen sie allein auf dem Band zurück, wir konnten unseren eigenen Weg nach unten ja selbst herausfinden.
Am Boden angekommen, zogen sie ihr Seil aus den Bolzen neben unseren Köpfen und ließen sie leer zurück. Also fädelten wir unser Seil durch die Ringe, genau so, wie wir es bei ihnen gesehen hatten. Da wir außer unserem Seil keine Ausrüstung hatten, war die einzige Option ein Abseilen mit bloßen Händen im Batman-Stil, was mir auch so lange gelang, bis ich ans Seilende gekommen war und mich mitten in einer blanken Wand baumeln sah, immer noch etwa 30 Meter über dem Grund. Zum Glück gelang es mir, mich mit den Füßen abzustoßen und zur Schlucht hinüberzupendeln. Jeff folgte im gleichen Stil. Von dort aus war es ein Leichtes, zurück zum Erdboden zu kraxeln.
Nun war ich ein Kletterer, und das bedeutete, dass es an der Zeit war, eine echte Ausbildung zu beginnen. Deshalb war ich begeistert, als ich entdeckte, dass die öffentliche Bibliothek in Wellesley eine Abteilung für Kletter- und Alpinliteratur hatte. Ich hatte in dieser Bibliothek herumgestöbert, seit ich ein kleines Kind war, und in all diesen Jahren war der Schatz direkt vor meiner Nase gewesen: The Vertical World of Yosemite von Galen Rowell, Mountaineering: The Freedom of the Hills von The Mountaineers, Climbing Ice von Yvon Chouinard, Die Weiße Spinne von Heinrich Harrer, The Six Mountain-Travel Books von Eric Shipton, Annapurna von Maurice Herzog und The Shining Mountain von Peter Boardman. Ich lieh sie aus und las sie begierig und rasch hintereinander. Diese Bücher und noch andere öffneten meine Augen für eine mir bisher unbekannte Welt rasanter Abenteuer, in einem Zeitraum, den die Autoren »das Goldene Zeitalter« des Alpinismus und der Erforschung nannten. Aus dem, was ich las, entnahm ich, dass das Goldene Zeitalter eine Zeit war, in der es noch weiße Flecken auf der Landkarte gab, die hohen Weltberge noch unbestiegen waren und Männer oder Frauen, die genügend Mut, Entschlossenheit und Zähigkeit hatten, zu einem Ort der Erde, den vorher noch kein Mensch betreten hatte, gehen und dort eine Flagge hissen konnten.
Im Bildteil des Buches The Shining Mountain gab es ein Foto des bärtigen Joe Tasker, der in schwindelerregender Höhe, mehr als 1000 Meter über dem weit unten sichtbaren Gletscher, in einer Hängematte hing, die an der Seite einer gefrorenen senkrechten Wand aus weißem Himalaja-Granit befestigt war; die Wand gehörte zu einem Berg namens Changabang. Tagelang starrte ich auf dieses Bild, bis ich schließlich beinahe den kalten Granit an meinem Rücken spüren konnte, die Nylonschnüre, die meine Schultern einschnürten, den kalten Wind, der mein Gesicht vereiste. Viel stärker als der Gipfel fesselte mich der Gedanke des Biwakierens, jener Momente während dieser dramatischen Routen, in denen man sich entspannen, vielleicht eine anständige Mahlzeit einnehmen und sich im warmen Biwaksack einmummen konnte, bequem und sicher inmitten einer Welt aus dünner Luft und Fels und Eis.
Es gab einen Berg, der wie ein Leuchtturm zwischen all den anderen herausragte – den Trango Tower. Ich bekam seine überirdische Gestalt zum ersten Mal zu Gesicht, als ich gemütlich an einem Lesepult in einem Hinterzimmer der Bibliothek saß. Diese himmlische, in den Nebel emporragende Turmspitze entsprach genau meiner Vision, wie ein Berg sein sollte. Eines Tages …
Auch wenn meine neuen Helden nicht aus ihren Büchern gestiegen sind und es mir mit Worten gesagt haben, so wusste ich doch, dass das Goldene Zeitalter des Alpinismus die großartigste Zeit der Menschheitsgeschichte war. Und ich hatte sie verpasst. Hier war ich, ein hyperaktiver Junge, der verzweifelt nach etwas suchte, das seinem Leben Sinn und Richtung geben konnte. Aber kaum hatte ich Helden entdeckt, die mir den Weg weisen konnten, zerstörten sie meine Illusion von Größe schon wieder. Warum hatte ich nicht eine Generation früher zur Welt kommen können?
Eine Woche lang oder so verzagte ich, bis mir ein Gedanke kam: Was, wenn das Goldene Zeitalter nun doch noch nicht ganz vorbei war? Was, wenn es immer noch ein paar unbekannte weiße Flecken auf der Landkarte gab, die noch nicht gefüllt worden waren? Was, wenn ich irgendeinen unbekannten Berg finden konnte, von dem noch niemand etwas gehört hatte, den meine Helden übersehen hatten?
Und so hatte ich hier, im muffigen Leseraum der öffentlichen Bücherei, mein Lebensziel gefunden.
Die Vision der Stonemasters
Alex Honnold war in Schwierigkeiten.
Er war Hunderte Meter über die gefrorene Rinne hinaufgeklettert, angelockt durch die anfänglich sanfte Steigung und den weichen Schnee. Aber als er höher stieg, indem er mit REI-Schneeschuhen, die er im Schrank seines Vaters gefunden hatte, Tritte in den Schnee hackte, war die Rinne immer enger und steiler geworden, und schließlich bemerkte er, dass er sich nun mit bloßen Fingern am harten, vereisten Schnee festkrallen musste. Wenn er eine Ahnung gehabt hätte, wie man in Schnee und Eis klettert, hätte er seine Schneeschuhe schon längst in den Rucksack gesteckt und gegen Steigeisen mit stählernen Frontzacken getauscht. Aber Alex hatte weder Steigeisen noch einen Pickel. Es war seine erste Tour im Winter. Und er war allein.
Ein erfahrenerer Bergsteiger hätte sich wohl immer noch zu helfen gewusst, er wäre an den kleinen, mit den Schuhspitzen gehackten Stufen rückwärts wieder zurückgestiegen, ähnlich wie man an einer Leiter nach unten steigt. Als Alex merkte, dass seine einzige Chance der Rückzug war, drehte er sich mit dem Rücken zum Hang, um sich den steilen Hang unter ihm genauer anzusehen, so wie ein Skifahrer die Abfahrtsstrecke beurteilt. Eine Sekunde später lag er auf dem Rücken und sauste den Berg hinunter. Während er immer schneller wurde, schaute er nach unten und erblickte am Ende des Abhangs eine Ansammlung kantiger Granitblöcke. Sein letzter Gedanke, bevor er in die Geröllhalde donnerte, war: »Nun werde ich sterben.«
Dierdre Honnold stand in der Küche und machte Tee, als das Telefon läutete.
»Hallo?«
»Hallo, Mama.«
»Alexandre?« Es hatte nach Alex geklungen, aber irgendetwas stimmte nicht. Seine Stimme klang dumpf, als wäre sein Mund voller Wattekugeln.
»Wo bin ich? Warum bin ich überall voll Blut?«
Dierdre stürzte ins Schlafzimmer, weckte ihre Tochter Stasia, die zwei Jahre älter als Alex ist, und reichte ihr den Telefonhörer. »Halt ihn am Reden«, sagte sie. »Ich rufe den Rettungsdienst an.«
Die Notrufzentrale der Polizeidienststelle in El Dorado sagte Dierdre, sie solle Alex fragen, was er sehen könne. Gab es irgendwelche Orientierungspunkte, anhand derer sie bestimmen konnten, wo er sich befand? Sie nahm Stasia den Hörer aus der Hand.
»Was kannst du sehen?«
Schweigen. Hat er das Bewusstsein verloren? »Alex, Alex, bist du da? Bist du wach?«
»Wer ist das?«
»Hier ist Mama.«
»Also, warum sprichst du auf einmal auf Englisch?«, antwortete Alex. Seine Stimme klang verärgert. »Ich dachte, du wärst jemand anderer.«
Tatsächlich war es das erste Mal seit neunzehn Jahren, dass Dierdre, eine Professorin, die Französisch, Spanisch und Englisch als Fremdsprache unterrichtete, mit ihrem Sohn auf Englisch gesprochen hatte. Sie wollte ihre Kinder zweisprachig erziehen. Alex antwortete meist auf Englisch, das war seine Methode, seiner Mutter klarzumachen, dass er das Ganze ziemlich bescheuert fand.
»Assister à une aide serrée est sur son chemin« (Warte, Hilfe ist unterwegs), sagte sie, wieder ins Französische verfallend.
Er besaß das Handy seit nicht einmal 24 Stunden. Seine Mutter hatte es ihm zu Weihnachten geschenkt. Beinahe hätte sie es wieder zurückgegeben, weil man ihr bei Verizon das falsche Modell gegeben hatte, das raffinierte mit der eingebauten Kamera. Aber gerade die Kamera war es gewesen, was Alex dazu bewogen hatte, es an diesem Tag mitzunehmen. Zum Glück hatte es den Absturz überlebt.
Bewusstsein und Ohnmacht wechselten einander ab. In seinen helleren Momenten starrte er nach Norden zum Lake Tahoe hinüber, den er undeutlich erkannte. Aber er wusste immer noch nicht, warum er in einem Haufen von Felsbrocken am Fuß eines Schneefelds lag. Am Hang über ihm war ein Streifen Blut zu sehen. Er sah auf seine zerschundenen Hände hinunter. An seinem Daumen war die Handschuhkappe abgerissen, er fühlte sich an, als wäre er gebrochen. Die Seite seines Kopfes war aufgeschürft und geschwollen. Seine Wange hatte ein Loch, und seine Brust schmerzte unerträglich, wenn er einatmete. Seine Daunenjacke sah aus, als hätte sie ein Tiger bearbeitet. Überall an seinem Körper klebten die Daunen am Blut, er sah aus wie geteert und gefedert. Je länger er seinen Körper untersuchte, desto mehr verletzte Stellen fand er.
Der erste Hubschrauber, ein Airbus H135, fand Alex, konnte aber wegen starker Windböen nicht landen. Der Pilot gab seine Position per Funk an das Polizeibüro durch, dieses teilte Dierdre mit, dass man ein Rettungsteam zu Fuß losschicken müsse. Aber das würde Stunden dauern, und über der Sierra Nevada braute sich ein kräftiges Unwetter zusammen. Er wird erfrieren, dachte Dierdre. Dann jedoch kam eine gute Nachricht. Ein kleinerer Hubschrauber der kalifornischen Autobahnpolizei hatte eine kühne Landung am Fuß der Südostrinne gemacht. Als sie Alex für den Transport einpackten, verlor er wieder das Bewusstsein.
Spät an diesem Abend brachte Alex’ Mutter ihn vom Krankenhaus in Reno nach Hause. Er war an den Händen und im Gesicht genäht worden, hatte ein Loch in der Nasennebenhöhle, ausgeschlagene Zähne, gebrochene Rippen, ein gebrochenes rechtes Handgelenk und eine schwere Gehirnerschütterung. Am nächsten Tag trug Alex, im Bett liegend, die Tortur in das Tagebuch ein, das er einen Monat zuvor angelegt hatte. Mit seiner linken Hand (er war Rechtshänder) schrieb er:
Tallac
Abgestürzt, Hand gebrochen … Hubschrauber.
Hätte die Ruhe bewahren und heimlaufen sollen.
Schlappschwanz.
In den nächsten paar Monaten erholte sich Alex zu Hause in Carmichael, einer Vorstadt von Sacramento. Ein neues Videospiel war gerade auf den Markt gekommen, es hieß World of Warcraft und spielte in einer außerirdischen Welt namens Azeroth, die von Zombies, Werwölfen und Greifen bewohnt war. Sinn des Spiels ist es, Aufgaben zu bewältigen, wofür der Spieler dann mit Punkten und Geldbeträgen belohnt wird, mit denen er Waffen und Superkräfte kaufen kann. Jeden Tag entfloh Alex für Stunden nach Azeroth. Im Spiel konnte er sich in einer Fantasiewelt verlieren und sein eigenes Leben vergessen, das in letzter Zeit nicht besonders glücklich verlaufen war.
Sein Großvater, zu dem er eine enge Bindung hatte, war diesen Sommer gestorben. Der Weg, auf dem Alex mit dem Fahrrad zur Kletterhalle fuhr, führte am Haus seines Großvaters vorbei, und er hatte hier oft angehalten, um vorbeizuschauen und mit ihm ein Kartenspiel namens Cribbage, Backgammon oder Schach zu spielen. Am Tag, nachdem sein Großvater gestorben war, erfuhr er, dass seine Eltern die Scheidung eingereicht hatten und sein Vater aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen würde. Am Ende dieses Sommers immatrikulierte er sich an der University of California, Berkeley, mit der Absicht, Bauingenieurwesen als Hauptfach zu studieren. Er wohnte außerhalb des Universitätsgeländes bei einem Bekannten der Familie. Alex lief in Jogginghosen und einem Sweatshirt in Übergröße herum, gewöhnlich mit aufgesetzter Kapuze. Er war schon immer introvertiert gewesen, aber nun, ohne den Rückhalt des besten Freundes seiner Kindheit, Ben Smalley, oder seiner Freundin Elizabeth, zog er sich ganz in seine eigene private Welt zurück, an einen Ort, mit dem er schon bestens vertraut war.
Laut Smalley hatte Alex in der Highschool eine ausgeprägte Sozialphobie. Er ging zu keiner einzigen Party und bemühte sich nicht im Geringsten, sich anzupassen und beliebt zu sein. In der Mittagspause, wenn die coolen Cliquen sich in ihren exklusiven Ecken der Cafeteria versammelten, zog sich Alex in den Mathe-Raum zurück, um Pokémon Go zu spielen.
»Wenn ihm etwas nicht behagte oder nervös machte, ging er ihm einfach aus dem Weg«, sagt Smalley. »Er machte manchmal spontane Kommentare über strahlende, glückliche Leute, aber es klang nie wie: ›Ach, wäre ich doch einer von ihnen, ich wäre so gern bei ihnen beliebt.‹ Es war eher wie eine Bestätigung, dass sie existieren und er keiner von ihnen war. Er war so grundverschieden von ihnen, dass er beschloss, sich gar nicht die Mühe zu machen, auch nur zu versuchen, einer von ihnen zu werden.«
Aber obwohl Alex ein unverbesserlicher Außenseiter war, respektierte man ihn, sagt Ben, weil er so intelligent war. Er war einer der Besten beim International-Baccalaureate-Programm der Schule, obwohl er keine echte Leidenschaft für die Wissenschaft hatte. Er tat nur das unbedingt Notwendige, um über die Runden zu kommen. Alex’ Mutter war ein Mitglied von Mensa, einem Verein von Menschen mit hohem Intelligenzquotient. Sie hatte Alex getestet. Ihrer Meinung nach war er ein Genie.
An der Universität Berkeley war Alex von mehr glücklichen Personen umgeben, als er je zuvor in seinem Leben gesehen hatte, aber er war so scheu und schüchtern, dass manchmal Monate vergingen, ohne dass er mit jemandem von Angesicht zu Angesicht sprach. Er behauptet, in diesem Jahr keine einzige Freundschaft geschlossen zu haben. In seinem zweiten Semester begann er damit, Vorlesungen zu schwänzen, um klettern zu gehen. Sein bevorzugtes Ziel war Indian Rock in den Berkeley Hills, zwei Meilen nördlich des Universitätsgeländes. Er fuhr mit seinem Fahrrad dorthin und verbrachte Stunden damit, an den Felsen aus Vulkangestein hin und her zu klettern. Wenn er nicht kletterte, saß er gern auf dem höchsten Punkt der Felsen, neben den Kuhlen, welche die indianischen Ureinwohner gegraben und verwendet hatten, um Eicheln zu mahlen. Hier aß er einfaches Brot und starrte über die Häuser hinweg nach Süden zum Campus. In nördlicher Richtung konnte er die Bucht von San Francisco sehen, die oft im Nebel lag, aus dem nur die Türme der Golden Gate Bridge herausragten.
Klettern war für ihn die Erlösung schlechthin, und er tat es fast jeden Tag. Wenn er nicht in der Kletterhalle, am Indian Rock oder bei den mit Steinen verkleideten Gebäuden am Campus war, saß er in seinen Boxershorts herum, spielte Videospiele oder machte am Türrahmen seines Zimmers Klimmzüge. Seine Kommilitonen, die von seiner Existenz wenig oder nichts bemerkten, konnten nicht wissen, dass der stille Genius, der unterhalb jedermanns Radar flog, sich langsam in einen Kletterer verwandelte, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hatte.
Das erste Honnold-Signal auf dem Radar der Kletterwelt erschien nach seinem ersten Jahr in Berkeley im Juli 2004 bei den Nationalen Klettermeisterschaften. Sie wurden in Pipeworks in Sacramento abgehalten, in Alex’ heimatlicher Kletterhalle. Er war Mitglied des Teams dieser Halle, seit sie 2000 eröffnet worden war. Angefeuert von der Energie der Menschenmenge seiner Heimatstadt, lief Alex zu Höchstleistungen auf, und er belegte den zweiten Platz in der Jugendklasse der Vierzehn- bis Neunzehnjährigen. Das qualifizierte ihn für die Weltmeisterschaft in Schottland, die zwei Monate später stattfand. Kurz nach den Nationalen Meisterschaften starb Alex’ Vater, der in den letzten acht Jahren sein Ein-Mann-Betreuungsteam gewesen war, ihn in ganz Kaliforniern zu Wettbewerben herumkutschiert und ungezählte Stunden am Seil gesichert hatte, an einem Herzinfarkt, als er sich am Flughafen Phoenix abhetzte, um einen Flug zu erreichen. Er war 55 Jahre alt.
Für die Weltmeisterschaften im September konnte Alex keine Motivation und keine Begeisterung aufbringen. Er blieb hinter den Erwartungen zurück und belegte den 39. Platz.
Der Gedanke an ein weiteres Jahr an der UC Berkeley erfüllte Alex mit Grausen, deshalb bat er seine Mutter, das Studium abbrechen zu dürfen. Da sie wusste, wie unglücklich er gewesen war – er hatte seine Zeit dort als »grauenhaft« beschrieben –, war sie damit einverstanden. Dann kam jener zweite Weihnachtsfeiertag, an dem Alex am Mount Tallac beinahe umgekommen wäre.
Nach diesem Unfall saß Alex mehrere Monate lang im Haus seiner Mutter herum und beklagte sein Schicksal. Später nannte er diese Zeit seine »melancholische Phase«. Er beschreibt sich selbst während dieser Zeit als einen »schlaksig wirkenden« Kerl mit schlechter Gesichtsfarbe, der »einfach überhaupt nicht cool war, keine wirklichen Perspektiven hatte, keine wirkliche Zukunft«. Smalley besuchte Alex in jenem Winter und war besorgt wegen der Art und Weise, wie sein Freund mit dem Tod des Vaters umging, die darin bestand, dass er so tat, als wäre nichts geschehen.
»Ich erinnere mich, dass ich ihn ausdrücklich fragte: ›Warum nimmst du es dir nicht mehr zu Herzen?‹«
Alex spielte die Sache herunter, er sagte Smalley: »Mein Vater und ich hatten keine übermäßig enge Bindung. Alles, was er tat, war, mich zum Klettern zu fahren – das war alles, was wir gemeinsam hatten. Wir sprachen nicht miteinander. Er geisterte gewissermaßen nur durch das Haus. Es ist schwierig, jemanden zu vermissen, der nicht wirklich da war.«
Als Smalley nachhakte und Alex erklärte, dass es für seine seelische Gesundheit wichtig sei, den Prozess des Trauerns durchzumachen, antwortete Alex: »Du verstehst es nicht. Deine Familie ist normal und gesund und meine ist bizarr und kaputt.«
Alex erzählte mir später einmal, dass der Tod seines Vaters etwas Irreales an sich gehabt habe. Eines Tages kam er nach Hause und fand seine Mutter am Rand des Schwimmbeckens sitzend, ihre Füße baumelten im Wasser. Sie weinte. »Dein Vater ist gestorben«, sagte sie. »Ich sah weder seine Leiche noch ging ich zu einer Beerdigung oder sonst was in dieser Richtung. Es gab keinen Abschluss. Und ich erinnere mich, dass ich dachte, es gibt keinen wirklichen Nachweis, dass er tatsächlich tot ist.« Rückblickend erzählte mir Alex auch, dass der Tod seines Vaters Charlie besonders tragisch war, weil er nach der Scheidung im Begriff war, ein neuer Mensch zu werden. Als wäre ihm ein Gewicht von den Schultern genommen, zeigte der einsilbige, reservierte Mann, der selten etwas sagte, eine völlig neue Seite seiner Persönlichkeit. Er begann wieder zu reisen, was seine Leidenschaft gewesen war, bevor Stasia und Alex zur Welt gekommen waren. Er hatte Pläne, die Welt zu sehen. Er hatte vor, all die Länder zu besuchen, die noch auf seiner Liste standen, und weitere Souvenir-Masken für seine Sammlung zu kaufen, die er im Ferienhaus der Familie in Tahoe aufbewahrte. Über dieses Alter Ego hatte Alex bisher nur von Vaters Angehörigen gehört, aber nun konnte er ihn zum ersten Mal selbst sehen. Er war gespannt darauf, diese neue Person kennenzulernen. Und dann war sie plötzlich nicht mehr da.