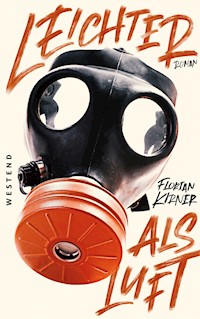18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: fifty fifty Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
FLORIAN KIRNER, auch bekannt als PRINZ CHAOS II., erzählt mit Charme und Finesse, wie er ohne Geld zur Rettung eines schwer sanierungsbedürftigen Schlosses in Südthüringen antrat: eine spektakuläre Geschichte über die Integration und Sturheit eines Bayern in Ostdeutschland - vollgestopft mit saukomischen und hochdramatischen Begebenheiten. Ein Buch über Denkmalpflege und Verwaltungslogik, zwischenmenschliche Schönheiten und Abgründe, wilde Schlossfeste, Wandergesellen, Neonazis, Paradiesvögel und die Absurditäten der Corona-Politik im ländlichen Raum. Ein Blick auf die Thüringer Provinz fernab von Wessi-Klischees und ostdeutscher Nostalgie - kurz gesagt: der Bericht von einem, der auszog, in der innerdeutschen Fremde eine Heimat zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ebook Edition
Florian Kirner
Freies Land!
Prinz Chaos, die Thüringer und ein Schloss
Impressum
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN: 978-3-946778-56-1
1. Auflage 2025
© Fiftyfifty Verlag Imprint der Buchkomplizen GmbH,
Siemensstr. 49, 50825 Köln
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Satz: Publikations Atelier, Weiterstadt
Inhaltsverzeichnis
Cover
Zum Geleit
Mit einem Schlag legendär
Auf Umwegen zum Ziel
Schlossjäger!
Ein Basislager errichten
Frühlingserwachen
Es zieht ein dunkler Wolk herein …
Haupt- und Staatsaktionen
Baron von Stockhausen
Summer of Love
Neue Freunde, Schlossbewohner
Schloss Stalingrad
Eine Hochzeit und zwei Scheidungen
Die schwärzeste Stunde
Polizeiaufmarsch für Paradiesvögel
Selbsterkenntnis und Waffenstillstand
Opium-Entzug mit Heinrich Mann
Digitale Geld- und Weltbeschaffung
Schlossbewohner kommen, Schlossbewohner gehen
Eigene und väterliche Schmerzen
Wasserspiele & Kulinarik
Von Cybergärtnern und Hendekagönnern
Weltverschwörung mit Kuh und Coming-out
Gemobbt mit 100 000 Euro
Vaterpflanzen
Neuanfang mit Weltenfahrern und Waldpiraten
Als Staatsunterhaupt im Narrenkäfig
Popularitätsschub durch motorisierte Gewalt
Von Prinzessinnen, Pferden und Wandergesellen
Lockdown im Paradies
Offensive zwischen zwei Lockdowns
Hochburg der Corona-Kritiker
Das perfekte Verbrechen
Flieg, Paradiesvogel: Flieg!
Der totale Gamechanger (I): Fenster
Der totale Gamechanger (II): Frieden
Wenn eine Tür sich schließt …
Bürgermeisterwahlkampf 2023
Stichwahl!
Schattenarbeit
Spezialist für Neuanfänge jeder Art
Die Freiheitsformel
Lied für Thüringen
Orientierungspunkte
Titelbild
Inhaltsverzeichnis
Zum Geleit
Dieses Buch ist ein autobiographischer Roman.
Für seine Figuren gibt es Vorbilder in der Realität, und doch sind die Figuren im Roman und ihre Handlungen fiktiver Natur.
Diese Herangehensweise hat womöglich zur Folge, dass sich auch einige Menschen in diesem Buch partout nicht wiederfinden können, die sich darüber sehr gefreut oder sich das gewünscht hätten. Deswegen sei an dieser Stelle meiner tiefen Dankbarkeit all jenen gegenüber Ausdruck verliehen, die mich in schwierigen und schönen Zeiten begleitet haben auf meinem Weg. Ihr seid weder vergessen noch unterschätze ich die alles überragende Bedeutung eurer freundschaftlichen Unterstützung auch nur eine Sekunde.
Ich liefere in diesem Buch keine Analysen politischer oder gesellschaftlicher Phänomene. Ich erzähle – ausschließlich aus meiner subjektiven Sicht und ohne Faktizitätsanspruch – den Roman meines Lebens. Der Ich-Erzähler stellt dabei auch nur eine Version aus der Unendlichkeit möglicher Versionen dieses Lebens dar. Wie Max Frisch in seinem Roman »Mein Name sei Gantenbein« formulierte: »Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält.«
Allgemein ist es mir ein Anliegen, mit dieser Erzählung einen Beitrag zu allseitigem Verstehen zu leisten. Dieses Buch möge eine Quelle der Versöhnung und der Gemeinsamkeit sein.
Ich widme dieses Buch meiner Mutter Gabi.
Florian Kirner
Kapitel 1
Mit einem Schlag legendär
Dass der Begriff Faschismus in Wahrheit von Fasching hergeleitet ist, ist ein Verdacht, den ich seit geraumer Zeit hege. Kein Wunder, denn ich lebe seit Januar 2008 in Hildburghausen.
Diese kleine Kreisstadt in Südthüringen war einstmals das Fluchtziel jener mysteriösen Dunkelgräfin, die eine Tochter von Marie Antoinette gewesen sein könnte, sowie ganz sicher die Prinzessinnenheimat jener späteren Königin Therese von Bayern, deren Hochzeit mit Ludwig I. das allererste Oktoberfest in München verursacht hat. Dazu kommen in der jüngeren Geschichte gescheiterte Kleinstadt-Bürgermeister, die plötzlich Landesminister sind, irre Wahlergebnisse für Rechtsextremisten – sowie Corona-Demos mitten im Lockdown, bei denen 400 Leute singend und jubilierend durch unsere schöne, kleine, alte Stadt ziehen. Zu diesem Zeitpunkt war unser Landkreis seit Wochen Tabellenführer der Inzidenzwertbundesliga, und diese Aktion hat uns sogar in die New York Times katapultiert und in den Guardian und in die Zeit, in die Tagesschau, die Süddeutsche, die FAZ, die taz undden Spiegel.
Aber mei: Berühmt ist berühmt! Ein mit starken Reichweiten ausgestattetes Image von negativ auf positiv umzupolen, lässt sich mit den klassischen Tools der Werbewirtschaft bewerkstelligen.
Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich bin weltberühmt. Zwar nicht in der Welt selber, das leider nicht. Aber in unserem schönen Hildburghäuser Land bin ich eine Weltberühmtheit, und das schon recht lange.
Der steile Anstieg meiner Berühmtheit begann sofort nach meiner Ankunft in Weitersroda, einem winzigen Dorf, das nach der Wiedervereinigung in die Kreisstadt Hildburghausen eingemeindet worden war. Das dortige Schloss war ab 1478 von – beziehungsweise für – einen gewissen Eucharius von Heßberg (ca. 1451–1522) erbaut worden, vermutlich unter Einbeziehung einer spätgotischen Kemenate. Die Heßberger waren zu dieser Zeit eine einflussreiche Familie. Speziell Eucharius galt als sehr wohlhabend und war im Adel seiner Zeit hoch angesehen. Er war fränkischer Reichsritter, Mitglied des legendären Schwanenritterordens, Gründungsmitglied der Turniergesellschaft Mit dem Einhorn und nahm nachweislich an zahlreichen Turnieren selbst teil. 44 Jahre lang ist Eucharius von Heßberg Schlossherr von Weitersroda gewesen. Ein halbes Jahrtausend und sehr viele Eigentümer und auch Eigentümerinnen später hatte ich diesen Posten übernommen.
Ein neuer Schlossherr, das ist von vornherein interessant. Ich tat, was ich konnte, dieses Interesse zu schüren. Mit Erfolg! Die Gerüchteküche war bald ununterbrochen am Brodeln. In den Lokalmedien wurde jede Petitesse aus meinem Leben publiziert, sofern ich das wollte. Kaum jemand konnte vermeiden, von mir Notiz zu nehmen.
Da die meine Person betreffenden Notizen in der Regel stark polarisierten, waren fast alle gezwungen, auch gleich eine Meinung über mich zu haben. Man war entweder für mich oder gegen mich, und die übergroße Mehrheit entschied sich für die zweite Option. Das ist auf Dauer gesehen eine wenig befriedigende Lage, weshalb ich erleichtert anmerken darf, dass sich das in der Zwischenzeit gründlich geändert hat.
Ich hatte die Gegend kräftig überfordert, gleich nachdem ich hier aufgeschlagen war. Junger Typ aus der Ex-DDR kauft sich in Niederbayern den fettesten Bauernhof im Ort … So was kommt nicht gut an. In meinem Fall war es noch übler: Junger Typ aus dem Westen kauft sich in Südthüringen das alte Schloss in der Dorfmitte.
Eine Geschichte, die von solchen Figuren handelt, gab es schon. Man musste nur noch meinen Namen einsetzen. Aber welchen? Florian Kirner? Oder Prinz Chaos, jene Alternatividentität, die ich seit mehr als zehn Jahren mit leidenschaftlicher Penetranz bespielte?
Die Geschichte, die so oder so meines Namens harrte, erzählt von träumerischen Spekulanten oder spekulierenden Träumern, von windigen Geschäftemachern oder blutig naiven Glücksrittern, die sich billig im Osten einkaufen und, so viel steht fest in dieser Erzählung, nach zwei, maximal drei Jahren wieder das westliche Weite suchen. Fuzzis. Labertaschen. Schauspieler. Leute, die den Himmel auf Erden versprechen und rein gar nichts hinkriegen. Die sich zu fein sind, selber hinzulangen. Zwei linke Hände und die dazugehörige politische Einstellung.
Eine Gelegenheit für den schlagenden Beweis, dass ich durchaus hinlangen kann, verschafften mir einige Monate nach dem Kauf jenes maroden Schlosses im Dörfchen Weitersroda drei PKWs und ein Großraumtaxi voller Nazis – wobei der eigentliche Anlass für diesen Überfall gar nichts mit mir zu tun gehabt hat.
Vielmehr hatte ich an jenem denkwürdigen Abend die alte Schänke im Erdgeschoss des Schlosses an die Dorfjugend vermietet, für ein Geburtstagsfest oder eine andere Feierlichkeit. Zu jenem Zeitpunkt hatte ich mit den Kids im Dorf noch ein ausgezeichnetes Verhältnis, und so war ich eingeladen und feierte mit.
Das war im Oktober 2008, der Kachelofen glühte. Enorme Mengen alkoholhaltiger Getränke waren im Nebenraum aufgestapelt. Es waren vielleicht 30 oder 40 Leute da, in bester Laune. Neben der eigentlichen Dorfjugend waren auch einige Dorfbewohner mittleren Alters anwesend. Die Stimmung war granatenmäßig gut. Ich war ebenfalls bester Laune und hatte mich an der Vernichtung der Tequila-Bestände beteiligt. Irgendwann ging ich in meine damalig bewohnten Zimmer. Als ich wieder nach unten kam, fand ich die Schänke leer vor. Alle, die kurz vorher ausgelassen gefeiert hatten, standen draußen herum.
Auf meine Frage, was denn los sei, erhielt ich zur Antwort: »Die Nazis kommen …«
Später wurde mir die Sache etwa so dargestellt: Ein Mädel war eingeladen worden, weil sich die – ich zitiere es lediglich, voller Abscheu, wie sich versteht, und erfüllt von sittlicher Empörung! – »weil die sich gut ficken lässt«. Diese Lady hatte einen Typen mitgebracht, der offenbar der hiesigen Faschoszene angehörte. Der fing Streit mit einem Bundeswehrsoldaten aus dem Dorf an und haute dem eine rein. Daraufhin vermöbelte die Dorfjugend den ungebetenen Gast nach allen Regeln der Kunst oder zumindest in so ausreichender Weise, dass jener sich gehalten sah, seinerseits Unterstützung anzufordern. Dies tat er durch einen Anruf beim örtlichen Nazi-Chef. Bei dem war ebenfalls gerade eine Feierlichkeit am Laufen. So war das Überfallkommando schnell zusammengestellt, das sich nunmehr auf dem Weg zu meinem Schloss befand, wie ich erfahren musste.
Was also tun? Wie vor allem, das kam mir tatsächlich als Erstes in den Sinn, die alten Fenster mit den beiden Bleiglaswappen schützen, welche sich in der Schänke des Schlosses befinden?
Ein etwas älterer Partygast aus dem Dorf, Sokrates spitzbenamt, wartete mit einem originellen Vorschlag auf: alle raus aus dem Schloss, die Lichter anlassen und die Türen offen! Mir ist in der Rückschau schleierhaft, wie ich auf diese Idee eingehen konnte. Mangels anderer Vorschläge vertraute ich auf den Instinkt des Sokrates. Wir taten wie geheißen. Die Polizei sei verständigt, erfuhr ich.
Kurz darauf fuhren besagte drei PKWs und das Großraumtaxi in der Schlossstraße vor und parkten vor dem ehemaligen Dorfkonsum. Es entstiegen junge Männer, ein paar Skinheads darunter, einige erkennbar bewaffnet, einer schwang eine Eisenkette.
Nun hatte ich in den Jahren zuvor in Köln eifrig Karate getrieben, bei der deutschen Shôtokan-Legende Horst Buschmann, bis zum violetten Gurt immerhin.
Kara Te bedeutet zu Deutsch: leere Hand.
Als ich das Aufgebot des Gegners sah, besann ich mich, dass so ganz und gar leere Hände womöglich gar nicht hinreichen würden. Ich rannte durch den Kneipeneingang zurück ins Haus und erneut den Turm nach oben, nicht, ohne zuvor die Turmtüre nach vorne raus abgesperrt zu haben. In meinen Zimmern angekommen, suchte ich hektisch und fand: meinen Trommelrevolver. Diese Gasknarre war ein Relikt aus der Zeit des Naziterrors und der Schülerbewegung dagegen Anfang der 1990er-Jahre, und ich glaube eher nicht, dass ich sie geladen herumliegen hatte. Eventuell dachte ich, dass sie auch ungeladen helfen könnte, denn das sah man ihr ja nicht an.
Schnell schob ich mir die Gaspistole in den Hosenbund. In die Hand nahm ich mein Bokutô, ein Übungskatana aus Bambusholz, wie es beim Kendô, dem traditionellen japanischen Schwertkampf, verwendet wird. So ausstaffiert machte ich mich im Laufschritt wieder auf den Weg nach unten.
Dort eingetroffen, fand ich den hell erleuchteten Raum der Schänke erneut leer. Ich trat durch die Tür nach draußen. Unter dem von Miniermotten zerfressenen Kronendach dreier mächtiger Kastanienbäume erwartete mich eine gespenstische Szene: Eine Gruppe von sechs Typen stand im Kreis, und ich sah hackende Bewegungen – Fußtritte auf einen leblosen Körper, der in der Mitte der Gruppe auf dem Boden lag.
Ich stieß einen Schrei aus. Gerne würde ich an dieser Stelle behaupten, es sei mein Kriegsschrei gewesen, jener Kiai, den ich mir bei Horst Buschmann zugelegt hatte. Ziemlich sicher war es nur ein entsetzter Aufschrei, und für solcherlei Gedanken blieb auch keine Zeit, denn die Gruppe ließ jetzt von ihrem Opfer ab und wendete sich mir zu, der ich im Türstock der Schloss-Schänke stand. Die Lust, sich mit jenem 1,93-Meter-Mann mit dem hölzernen Samuraischwert anzulegen, war bei einem Teil der Sechsergruppe unter den Kastanien übersichtlich ausgeprägt. Speziell einer jedoch biss sich an mir fest. Er war jung, vielleicht Anfang 20, und hatte lange lockige Haare. Flankiert von zwei anderen drängte er auf mich zu.
Ich muss nun gestehen, dass ich kein gelernter Schwertkämpfer bin. Das Bokutô hatte mir ein Kumpel kurz vor der Übersiedelung von Berlin nach Weitersroda geschenkt. Ich war gänzlich ungeübt in seiner Handhabung, weshalb es nun keineswegs so war, dass ich etwa mit wenigen gekonnten Schlägen die gesamte Faschotruppe auf die Laubmatratze geschickt hätte. Ich schlug vielmehr gar nicht zu, sondern hielt die Leute nur auf Distanz. »Weg vom Schloss! Die Bleiglasfenster schützen!«, war der Gedanke, der mich für die folgenden Handlungen motivierte. Ich bewegte mich rückwärts. Schritt für Schritt entfernte ich mich – und damit auch das Trio meiner Verfolger – vom Schloss.
Jener eine allerdings, der mich am offensivsten bedrängte, der junge Lockenkopf, war nicht überzeugt, dass mein Holzschwert eine nennenswerte Wirkung entfalten könnte. Somit sah ich mich gezwungen, argumentativ nachzulegen. Ich stach zu und traf zwischen Solarplexus und Magengegend, vielleicht auch im Bereich der Rippen. Das wirkte insoweit, als der Lockenkopfnazi mit sich selbst beschäftigt war und ich etwas Abstand zu der Dreiergruppe gewann. Zwischen dem Schlossbau und der Schlossstraße liegen gut 30 Meter Grundstück. Ich konnte einige flüchtige Blicke auf das übrige Geschehen werfen, während ich die Straße überquerte. Vor der kleinen Kirche konnte ich weitere Scharmützel erkennen. Später erfuhr ich, dass die Faschos dort den Dorfbäcker in der Mache gehabt hatten, der freilich kein einfacher Gegner gewesen sein dürfte. Und kurios: Direkt auf der Straße stand ein Polizeiwagen, in welchem die Beamten aber offenbar sitzen blieben.
Ich lief zum Autoschrauber hinüber und schrie seinen Namen. Er gab keine Antwort. Vor einer Doppelhaushälfte zwei Häuser neben seiner Kfz-Werkstatt sah ich eine Gruppe Nachbarn stehen. Ich rannte zu ihnen, und sie boten mir Schutz. Schon kamen meine drei Quälgeister angelaufen. Die Nachbarn hielten sie in Schach, während ich hinter der allerdings nur hüfthohen Hecke stand. Von dort aus sah ich jetzt, wie gegenüber einige Gestalten durch die Tür in die Schlossschänke traten. »Die machen das Schloss kaputt, die machen das Schloss kaputt!«, flippte ich aus und machte Anstalten loszurennen. So hatten die Nachbarn auch noch damit zu tun, mich von diesem Vorhaben abzuhalten – zum Glück, denn diese Aktion wäre nicht gut für mich ausgegangen. Hingegen sollte sich erweisen, dass der Plan des weisen Sokrates aufging: Lichter an, Türe offen, Raum menschenleer – so kamen die Angreifer rein, rannten ein bisschen in der Schänke herum, schmissen wohl auch ein paar Flaschen von den Tischen. Da sie niemanden vorfanden, zogen sie schließlich wieder ab. Die Wappenfenster blieben unbeschadet.
Unbeschadet blieb nicht: meine Nase. Die Lage rund um die nachbarliche Hecke hatte sich einigermaßen beruhigt. Die Nachbarn hatten die Sache im Griff und mein Bokutô dezent verschwinden lassen. Da kam es zu einem reichlich kuriosen Wortwechsel. Ein Nachbar ermahnte den Lockenheini, der immer wieder auf mich zu drängte, sich endlich zu beruhigen. Daraufhin klagte dieser empört, dass ich ihn mit dem Holzschwert geschlagen hätte! »Du bist gut …«, entgegnete ich, »ihr seid gerade dabei gewesen, zu sechst einen Typen zusammenzutreten!« Dies ließ der Lockenmann keineswegs gelten: »Weißt du überhaupt, wie weh das getan hat?«, jammerte er und meinte offenbar meinen Stich mit dem Bambuskatana.
Währenddessen war Polizeiverstärkung eingetroffen. Beamte mit Taschenlampen gingen um das Schloss herum und nahmen von uns auf der anderen Straßenseite keine Notiz. In dem Moment riss sich der Lockenköpfige von den Nachbarn los, machte einen Schritt auf mich zu und haute mir eins auf die Nase.
Die Lage wurde noch ungemütlicher, weil der Schlossherr mit dem Schwert den restlichen Nazis nicht entgangen war. »Die suchen dich«, sagte ein weiterer Dorfbewohner, der nun zu unserer Gruppe stieß. Daraufhin evakuierten mich die Nachbarn umgehend. Der Sohn führte mich in ein Haus. Zum Hinterausgang verließ ich es wieder und wurde durch den Garten in ein weiteres Haus verbracht, wo ich abwarten konnte: in Sicherheit, aber auch ohne die geringste Idee, was sich draußen abspielte.
Da saß ich nun. In diesem Moment kam ein sehr eigenartiger Gedanke in mir auf. Dieser Lockenkopfnazi … das war merkwürdig. Der entsprach absolut nicht meinem Klischee eines ostdeutschen Nazischlägers. Hätte ich den auf der Straße getroffen, wäre er ein ganz normaler, junger Typ gewesen. Seine selbstmitleidige Weinerlichkeit, die nichts dabei fand, zu sechst einen Einzelnen zusammenzutreten, meinen Stich mit dem Bokutô aber skandalös, die war natürlich schon sehr nazitypisch. »Mimimi, Bombenterror der Alliierten! Öhm, was? Krieg angefangen? Holocaust? War da was?«
Trotzdem: Der junge Lockenkopf war mir jetzt, als ich Gelegenheit hatte, der Situation nachzuspüren, weder so fremd noch so widerlich, wie ich mir das von einem waschechten Neonazi erwartet hätte. Er war mir noch nicht einmal unsympathisch. Sondern er war auf unerklärliche Weise:
ein Teil meiner selbst.
Seit frühester Kindheit bin ich burgen- und schlössernarrisch gewesen, wie meine Mutter sich erinnert. Ich war unermüdlich, wenn wir erneut eine Burg besichtigten. Nochmal runter ins Verließ, nochmal rauf auf den Turm. Meine allererste Lektüreerfahrung waren die Romane von Karl May gewesen. Dieser Karl May konnte schreiben, ein überragender Stilist. Mich packte vor allem das Heroische in seinen Abenteuererzählungen.
Folgte mein Lebensweg diesen frühen Kindheitsfantasien, als ich später Aktivist der radikalen Linken wurde? Auf den militanten Demos, an denen ich teilgenommen hatte, seit ich 16 Jahre alt war, zog es mich zuverlässig dorthin, wo es zu knistern und zu lodern begann. Ein volles Jahrzehnt verbrachte ich als Berufsrevolutionär an der Spitze einer sehr jugendlichen sozialistischen Organisation.
Nun also diese Szene! Ich mit dem Schwert – aus Holz, Eisen, aus Stahl oder ein Laserschwert, das war ganz egal, jedenfalls: ich mit Schwert vor meinem eigenen Schloss, kämpfend mit einer Horde Angreifer!
Selbstverständlich hatte der Lockenkopfnazi mit mir zu tun! War er womöglich nur ein Darsteller in der theatralischen Nachgestaltung meiner Kindheitsfantasien? Hatte er mir drehbuchgemäß geholfen, meine Träume von Burgen, einsamen Helden und politischem Radikalismus kompakt in jenem Kampfereignis zu bündeln, das sich zwar Realität nannte, aber schlussendlich nichts weiter war als ins Leben umgesetzte Traumenergie meinerseits?
Besonders eklatant erscheint mir, dass ich just im Umfeld des Nazi-Überfalls ziemlich engagiert gewesen war in einem Onlinestrategiespiel namens Stämme. Dort wankte mein noch kleines Reich seit Tagen unter dem Druck heftiger Angriffe einer weit stärkeren Allianz feindlicher Stämme. Einen Verbündeten immerhin hatte ich auf meiner Seite. Er nannte sich Blackchess. Eines Morgens musste ich ihm schreiben, dass ich mich aus dem Onlinespiel zurückziehen müsse, da mir etwas unserem gemeinsamen Digitalszenario ziemlich Ähnliches soeben im real life geschehen sei …
Der Vorfall hatte eine ganze Reihe mehr oder weniger dramatischer Folgewirkungen. Zu den weniger dramatischen gehörte, dass sich bei einer Röntgenaufnahme herausstellte, dass meine Nase gebrochen war. Wenigstens war der Knochen nur angeknackst, und der Arzt sagte mir, der werde von selber wieder gerade zusammenwachsen, was er auch brav tat. Die Krankenschwester seufzte, als sie Kunde von den Umständen meiner Verletzung erhielt: »Wieder einer …« Sie berichtete, dass recht häufig Leute in die Notaufnahme kämen, die von Nazis attackiert worden waren.
Natürlich berichtete Das Freie Wort, die hiesige Lokalzeitung, prominent von dem Ereignis. Hildburghausens Neonazi-Szene war berüchtigt, so wurde dieser Bericht auch von anderen Medien aufgegriffen. Der Vorfall bestätigte überdies die Ängste meiner linken Freunde im Westen. Einige hatten es für glatte Verrücktheit erklärt, dass ich vorhatte, in den bösen, braunen Osten zu ziehen. Rosi, eine bayerische, in Köln wohnhafte Freundin, hatte mir ausgemalt, wie Horden von Skinheads vor meinem Schloss auflaufen würden. Ich hatte das als paranoiden Wessi-Blödsinn abgetan. Jetzt fühlte sich nicht nur die gute Rosi bestätigt.
Im Dorf war der Überfall tagelang Gesprächsthema Nummer eins. Der Bäcker etwa hatte wohl nicht nur einstecken müssen, sondern auch ordentlich ausgeteilt. Einer der Jugendlichen musste sich verhöhnen lassen, weil er die Zeit der Kampfhandlungen in einem Gebüsch versteckt zugebracht hatte. Ein anderer hatte sich mit einem Hechtsprung durch ein Fenster gerettet, als ein Trupp Nazis ins Jugendzimmer eingedrungen war, also in jenen der Dorfjugend vorbehaltenen Raum direkt neben der Feuerwehr.
Der Dorfbewohner, den sie zu sechst zusammengetreten hatten, bedankte sich bei mir, wusste aber nur noch wenig von der konkreten Situation. Dieser sympathische, junge Mensch, der selbst keiner Fliege etwas zuleide tun konnte, hatte wohl zwischenzeitlich das Bewusstsein verloren gehabt.
Für Furore sorgte natürlich der neue Schlossherr, der sein Haus mit dem Schwert in der Hand verteidigt hatte. Zumal ich mich gegenüber der Lokalpresse unumwunden dazu bekannt hatte, mich mit Gewalt gewehrt zu haben. Diese Botschaft schien mir bei den in dieser Gegend offenbar vorherrschenden Verhältnissen sehr am Platz zu sein – und sie brachte mir aktive Solidarität ein. So saßen kurz darauf sieben, acht Jugendliche bei mir im Zimmer. Sie seien aus der nahen Kleinstadt Eisfeld und hätten gehört, was bei mir passiert sei. Sie seien vorbeigekommen, um mir zu sagen, dass es sie auch gäbe und ich mich auf sie verlassen könne, wenn ich Hilfe bräuchte. Ansonsten luden sie mich zu einer Party am Wochenende ein. Ich ging hin und fand gut 250 alternative Jugendliche in einer ehemaligen Eisenbahnhalle vor. Da sah das Kräfteverhältnis doch besser aus als befürchtet.
Den Höhepunkt der Theaterdramatik erreichte die ganze Episode im Stadtrat. Hildburghausens damaliger Bürgermeister Steffen Harzer eröffnete die Sitzung. Ein der Länge wie der Breite nach sehr großer Mann mit donnernder Stimme, ist dieser Steffen Harzer bis heute eine imposante Erscheinung. 1994 war er einer der allerersten Bürgermeister gewesen, die nach dem Zusammenbruch der DDR von der PDS gestellt werden konnten. Für seinen robusten Antifaschismus ist er zu Recht bekannt. Franz Josef Strauß der Linken taufte ich ihn.
Nach Harzers Begrüßung kam es zu jenem Tagesordnungspunkt, der Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, Fragen zu stellen oder ein Anliegen vorzubringen. Ich meldete mich und teilte mit, mich zu dem bekannten Vorfall äußern zu wollen. Bürgermeister Harzer bat mich nach vorne, ich nahm am ovalen Stadtratstisch Platz und legte los. Ich schilderte die Ereignisse aus meiner Sicht, äußerte mich dabei sehr kritisch über das Verhalten der Polizei in jener Nacht und endete damit, dass ich als Neubürger, der hier ein Denkmal erworben hatte, erwarte, vor derlei Angriffen wirkungsvoll geschützt zu werden.
Betretenes Schweigen.
Dann meldete sich ein Stadtrat der CDU zu Wort. Was ich da über die Polizei gesagt hätte, das sei ja unmöglich, das gehe ja mal gar nicht, echauffierte er sich. Ich entgegnete, dass ich ihm da nur beipflichten könne. Es sei in der Tat unmöglich gewesen, wie die zuerst eingetroffenen Polizisten feige in ihrem Wagen sitzen geblieben seien, während die Nazis feixend an ihre Autoscheibe geklopft hätten. Erst als die Verstärkung aus Suhl eingetroffen sei, hätten sich die Beamten aus ihrem Auto herausgetraut, aber bis dahin rein gar nichts unternommen, um den im Dorf marodierenden Nazis Einhalt zu gebieten.
Und wie es damit stehe, setzte der Stadtrat, den meine Person offenkundig mehr empörte als der infrage stehende Vorfall, bissig nach, was das Freie Wort zu berichten gehabt habe? Dass ich nämlich ebenfalls gewalttätig geworden sei, und zwar mit einem Baseballschläger!?
»Herr Stadtrat!«, mahnte ich in demonstrativ ruhigen Worten zur Ordnung: »Jetzt schaug’ns mich bitte amal an.« Ich muss dazu anmerken, dass der bayerische Dialekt in solchen Lebenslagen eine unfehlbare Waffe ist. Zweitens war ich an diesem Abend in würdige Eleganz gekleidet. Ich vertrat damals noch die Auffassung, der Hildburghäuser Stadtrat sei eine von heiligem Ernst erfüllte Einrichtung.
»Jetzt schaug’ns mich bitte amal an«, sprach also ich und fuhr, nach einer gewaltigen rhetorischen Pause, fort: »Schau’ ich aus wie einer, der mit dem Baseballschläger rausrennt? Ich bin ein Kulturmensch. Ich bin Geisteswissenschaftler! Baseballschläger … das hat die Zeitung völlig falsch berichtet. Das entspricht absolut nicht den Tatsachen.« Nach einer erneuten rhetorischen Pause vollendete ich staubtrocken:
»Das war ganz anders. Und zwar bin ich da mit einem japanischen Kampfschwert rausgegangen …«
Einen positiven, für die weitere Entwicklung des Schlossprojekts entscheidenden Effekt hatte der Nazi-Übergriff auch noch, und den hatte ich schon in der Nacht des Überfalls sofort auf dem Schirm gehabt. Als ich wieder nach oben gekommen und dort auf Baron von Stockhausen getroffen war, hatte ich meinen Schlossarchivar mit den Worten begrüßt:
»Wenigstens ist der Förderantrag damit durchgegangen …«
Dieser erste Förderantrag meiner Schlossgeschichte hing seit Wochen in der Schwebe. Eingefädelt hatte ihn besagter Steffen Harzer. Der hatte mir einige Wochen nach meiner Ankunft in Weitersroda einen Antrittsbesuch abgestattet. Ich hatte ihm zuvor mitgeteilt, dass es für mich als Prinzen nicht infrage kommen könne, meinerseits ihn aufzusuchen, der er ja nun lediglich Bürgermeister und auch noch durch eine allgemeine Volkswahl auf diesen Posten gekommen sei. Das hat der Mann eingesehen. Ich ließ es im Gegenzug nicht an gastgeberischer Aufmerksamkeit mangeln. Ich dachte mir, dass es einen Menschen, den als junges SED-Mitglied die Wende jäh aus den staatssozialistischen Träumen gerissen hat, peinigen müsse, somit nie in den Genuss gekommen zu sein, eine ordentliche Militärparade abzunehmen. Ich schloss da von mir auf ihn. Denn oft und oft stehe ich an den zur Straße hinausgehenden Schlossfenstern in Uniform und vollem Ornat, bereit zum Gruß – es kommt partout keine Militärparade daher, es ist zum Schwarzärgern!
In Ermangelung von mir befehligten Truppenteilen griff ich zu akustischen Hilfsmitteln, um dem Genossen Bürgermeister wenigstens eine Ahnung eines solchen Erlebnisses zu verschaffen. Ich hatte meine Lautsprecherboxen an die Fenster gestellt und im Turm auf die Ankunft des bürgermeisterlichen Dienstfahrzeugs gespechtet. Als Harzer vorfuhr, erschallte nach gewaltigem Orchestereinsatz der noch gewaltigere Einsatz des Chors, im Wechsel mit dem höchst proletarischen Sangesorgan des allerstimmgewaltigsten Ernst Busch. Ich weiß nicht mehr, was ich da über Straße und Dorf erschallen ließ, die Warschawjanka oder das Einheitsfrontlied, Vorwärts Bolschewik oder Linker Marsch. Meine Musiksammlung verfügt über eine stolze Auswahl solcher Kampfeshymnen.
Nun hatte Steffen Harzer einstmals etwas Vernünftiges gelernt, bevor es ihn in die Politik verschlagen hat. Als Bauingenieur war ihm, abgesehen von der Grundsympathie für den bayerischen Freak, der das einzige im Stadtgebiet noch vorhandene Schloss erworben hatte, wohl klarer als mir selbst, in welch aussichtslose Lage ich mich durch meine Unterschrift unter den Kaufvertrag manövriert hatte.
So trudelte zwei, drei Wochen nach seinem Antrittsbesuch ein Brief der Stadtarchitektin bei mir ein. Sie habe eine Fördermöglichkeit eruiert, ich solle mich doch bitte einmal mit ihr in Verbindung setzen. Der Antrag lief dann über die Städtebauförderung. An der Gesamtsumme von 37 100 Euro beteiligte sich die Stadt Hildburghausen mit gut 12 000 Euro. Im Stadtrat wurde dieser Beschluss parteiübergreifend gefasst. Überhaupt habe ich erleben dürfen, dass der Erhalt von Baudenkmalen keine Frage von Parteizugehörigkeiten ist.
Das bestätigte sich, als von der Städtebauförderung eine mündliche Ablehnung des Antrags übermittelt wurde. Da setzte ich zum großen Zangenangriff an. Ich mobilisierte den Landtagsabgeordneten der LINKEN, Tilo Kummer, und den Landtagsabgeordneten der CDU, Wolfgang Krapp. Beide setzten sich auf der Landesebene für meine Sache ein. Es war höchst fragwürdig, ob diesem Manöver Erfolg beschieden sein würde. Die Stadtbaumeisterin meinte: Dass eine mündlich erfolgte Ablehnung noch einmal gekippt würde, sei in ihrem Berufsleben noch nie vorgekommen.
Na! Dann kam es hiermit zum ersten Mal vor. Kurze Zeit nach dem Nazi-Überfall erreichte mich ein Anruf aus dem städtischen Bauamt. Die Stadtarchitektin berichtete mir so baff wie erfreut, dass ein Förderbescheid der Städtebauförderung eingegangen sei. Ob der landesweit bekannt gewordene Nazi-Übergriff bei diesem Gesinnungswechsel eine Rolle gespielt hat, kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich finde den Gedanken, dass die Faschos mir 37 100 Euro gerettet haben, überaus charmant.
Mein Eigenanteil an dieser Förderung lag übrigens bei null Prozent. Das entsprach präzise den Möglichkeiten meines Königlich-Chaotischen Staatsschatzes. Hauptziel der geförderten Baumaßnahmen sollte die Notsicherung des sandsteinernen Hauptgiebels sein. Dass dieser einen Riss aufwies, der für jeden Beobachter unübersehbar von oben bis unten durchging, war wohl einer der Hauptgründe für die jahrelange Unverkäuflichkeit des Objekts gewesen.
»Der Riss im Giebel? Ah! 300 000 Euro!«, schätzte der eine Dorfnachbar. »Eine halbe Million«, erwartete der nächste, bis ein Kumpel den Vogel abschoss mit der Auffassung, die Sanierung des Giebels würde 1,5 Millionen Euro verschlingen. Am Ende waren es 22 000 Euro, die ich zwar auch nicht hatte, aber eben durch die Förderung auftreiben konnte. Solch offenkundige Defekte an alten Gebäuden mobilisieren bei modernen Menschen nun einmal Irrationalitäten der ausgelassensten Art.
Dass ich keine Angst hatte, sondern vom Erfolg der Unternehmung überzeugt war, wundert mich im Nachhinein selbst. Seinerzeit war ich geborgen in der Gewissheit, von Schutzengeln und Göttern beschirmt zu sein. Das Lot meines Lebens hatte sich im November des Jahres 2007 über jenem ruinösen Schloss in diesem kleinen Dorf an der ehemaligen innerdeutschen Grenze gesenkt. Mein Weg nach Weitersroda war dabei so absurd gewesen, dass meine Überzeugung von der Richtigkeit meines Entschlusses keinen Zweifel duldete. Ich war Prinz Chaos II. – und das Chaos selbst hatte seinen wunderlichen Sohn mit der unabweisbaren Kraft grotesker Zufälle hierher gelotst.
Kapitel 2
Auf Umwegen zum Ziel
Unmittelbar vor dem Schlosskauf hatte ich in Berlin gelebt. Widerwillig war ich dorthin gegangen, denn seit einem Aufenthalt in Tokio in den Jahren 2004 bis 2006 war mir klar gewesen, dass meine Zeit in den Großstädten zu Ende gehen musste. Ich fand die Aussicht auf weniger massenhaft besiedelte Regionen äußerst attraktiv. Ich lechzte nach Natur und nach Platz und nach einem Flecken Heimat.
Leider nahm meine Suche bald den Charakter einer wilden Flucht an.
Zurück aus Tokio, zog ich zunächst bei meinem Vater ein, der allein mit meinem Bruder in seinem großen Haus im Dachauer Hinterland wohnte. Um mein Studium abzuschließen, musste ich ab und an für einige Wochen nach Köln. Hier kam ich in einer Wohnung am Mauritiuswall unter, die mein allerhöchstschwuler Kumpel Ritchy gerade nicht benötigte.
Zwischendurch war ich wiederholt in Berlin, um für meine Magisterarbeit zu recherchieren, wobei ich in der Universitätsbibliothek der FU sitzend vor allem auf dem Datingportal GayRomeo nach schnellen Abenteuern jagte.
Das Zimmer im Haus meines Vaters hatte ich mir eingerichtet, um dort die Magisterarbeit zu schreiben. Das Projekt, als Vater und Sohn unter einem Dach zu leben, scheiterte jedoch schnell.
Stinksauer zog ich weiter – und landete in einem kleinen Dorf im bayerischen Oberland, nahe des schönen Schliersees, wo mir meine selige Großtante Resi Prosel dankenswerterweise Aufnahme gewährte. Ihr denkmalgeschützter Hof aus dem 16. Jahrhundert war dereinst das Jagdhaus der Grafen Waldeck gewesen und mit antiken Möbeln äußerst stilsicher eingerichtet. Würde meine Heimatsuche hier zum Ziel führen?
Einige Monate lang eiferte ich dem Traum nach, diese bezaubernde Immobilie und vielleicht sogar der Kunsthandwerksbetrieb der Tante Resi – sie stellte Holz- und Rupfenpuppen her und produzierte ganze Heerscharen von Engeln – könnten eine Zukunfts- und Heimatperspektive für mich ergeben. Die Idee, mit meinen handwerklichen Fähigkeiten in diesem Traditionsbetrieb eine sinnvolle Rolle spielen zu können, bezeugt vor allem meine damalige Orientierungslosigkeit. Abgesehen davon wäre ich bei den niedrigen Decken des Gebäudes, wie ich heute weiß, von Bandscheibenvorfall zu Bandscheibenvorfall getorkelt. In meiner heutigen Wohnung ist dagegen alles erhöht. Der Küchentisch hat Sockel, die ihn zwölf Zentimeter nach oben setzen, die Spüle ist höher als normal, die Kloschüsseln ebenfalls. Kleine Menschen machen sich ja keine Vorstellungen, welche Torturen es uns Großwüchsigen beschert, ein Leben lang in die Maßstäbe der Zwergenwelt hineingezwungen zu sein …
Die Frist für die Abgabe meiner Magisterarbeit war nahegerückt, und ich war noch lange nicht fertig. Letztlich reichte ich ein wenig gelungenes Werk ein, das zu Recht schlecht bewertet, aber wenigstens angenommen wurde. Anschließend musste ich für die Magisterprüfungen wieder nach Köln. Die schloss ich mit sehr guten Zensuren ab und hatte damit ein Studium hinter mir, das mir längst auf die Nerven gegangen war.
Das Ende des Studiums machte meine Entwurzelung allerdings komplett. Ich hatte keinerlei Idee, was ich mit meiner neuen Freiheit anfangen und wohin ich mich wenden sollte.
So pumpte ich neues Leben in meine alte Rolle als Berufsrevolutionär. Direkt nach der schriftlichen Klausur in meinem Hauptfach (Thema war die Eskalation der Kriegführung in der Endphase des Amerikanischen Bürgerkriegs von 1861 bis 1865) stieg ich mit drei anderen Aktivisten ins Auto. Wir fuhren nach Heiligendamm, um gegen die dortige G8-Konferenz zu demonstrieren. Aus dem Protestlager der Globalisierungsgegner heraus schrieb ich täglich sogenannte Taktik-Kassiber, in denen ich erklärte, wie man als Demo aus einem Polizeikessel ausbrechen kann oder erfolgreich Straßen blockiert. Ich schrieb diese Kolumnen unter dem Namen Commander Shree Stardust und veröffentlichte sie in der Tageszeitung Junge Welt – jenem ehemaligen Zentralorgan der FDJ, das es als marxistische Tageszeitung in die BRD hinübergeschafft hatte. Als der G8-Gipfel vorbei war, war Der Commander in einigen Teilen der linken Protestbewegung zum Mythos geworden – und für die Junge Welt zu einem wertvollen, gerne gelesenen Feature.
Zwischen diversen abgebrochenen Anläufen zur Eroberung einer Heimat und jenem Anlauf in Weitersroda, der von Erfolg gekrönt sein sollte, lag folglich: Berlin.
Dass Berlin für mich als Heimat nicht funktionieren würde, hätte ich wissen können. Ein früherer Versuch, in der Hauptstadt zu ankern, war durch eine vierzehntägige Dauerdepression vereitelt worden. Das war Ende der Neunzigerjahre, als jeder Halbidiot in Berlin noch ruckzuck eine Wohnung finden konnte. Ich nicht. Zehn Jahre später ging ich erneut ohne übermäßigen Enthusiasmus in die Hauptstadt.
Wenigstens gestaltete sich die Suche nach einer Bleibe unkompliziert. Ich bezog als Nachmieter das Zimmer eines Kumpels in der Tucholskystraße in Berlin-Mitte. Das Zimmer war klein, teuer und bestens gelegen. Zur Redaktion der Jungen Welt konnte ich zu Fuß gehen. Das Regierungsviertel lag auch ganz in der Nähe. Dort gab es einige Freundinnen und Freunde aus alten Zeiten, die inzwischen Bundestagsabgeordnete geworden waren oder Büroleiter oder wissenschaftliche Mitarbeiter, typischerweise für die Linkspartei oder für die SPD.
Ich wurde nicht warm mit der Situation. Die Gegend rund um die Tucholskystraße war ziemlich angesagt. Beim Bäcker begrüßten sich die Leute des Morgens mit: »Na? Alles im grünen Bereich?« Dieses grüngroßdeutsche Neospießertum ging mir gegen den Strich.
In der Redaktion der Jungen Welt hingegen fand ich einige richtig gute Leute. Ich mochte die alten Militärschädel in Redaktion und Verlag, und Der Commander stand bei den früheren NVA-Leuten und Kundschaftern hoch im Kurs. In der Hauptsache schrieb ich aber Kulturkritiken für das Feuilleton, die wiederum unter meinem Tuntennamen Donna San Floriante.
Hartnäckig regte sich der Traum von einer festen Heimat auf dem Land. So googelte ich sporadisch nach Immobilien und las die diesbezüglichen Aushänge in den Schaufenstern von Banken und Maklern. Dass die meistens mit großer Verspätung eintreffenden Zahlungen der Marxistischen Tageszeitung keine Hilfe auf dem Weg zu meiner erträumten Heimat darstellten, war leider sonnenklar. So suchte ich nach lukrativeren Optionen.
Über einen alten Freund, der mich während meines Studiums bereits bei der Kommunikationsagentur BBDO in Düsseldorf untergebracht hatte, erfuhr ich von einem Stellenangebot der Agentur Die Argonauten. Er avisierte mich bei deren Berliner Chef. Das Vorstellungsgespräch im ausgebauten Dachgeschoss einer ehemaligen Ostberliner Fabrik verlief bestens. Fand zumindest ich. Im Raum stand ein Monatsgehalt von 5 000 Euro. Ich solle doch noch einige Textproben abliefern, dann werde man sich entscheiden.
Textproben, Textproben … Die waren gut. Ich hatte seit meiner BBDO-Zeit keinerlei Werbetexte mehr geschrieben. So packte ich blumige Kulturkritiken von Donna San Floriante und die schönsten Textbeispiele jener in linken Kreisen so gefeierten Bürgerkriegslyrik von Commander Shree Stardust in das Kuvert, das ich in der Argonautenzentrale abgab. Ich sagte mir: Wenn die so coole Socken sind, wie sie selber von sich glauben, werden sie erkennen, dass diese Texte exakt von jener Kreativität zeugen, die sie laut eigener Aussage im neuen Berlin schmerzlich vermissten. Waren sie dafür nicht cool genug, hatte es sowieso keinen Sinn.
Der Argonautenkapitän war dann nicht cool oder vielleicht auch einfach nicht doof genug, meine linksradikalen Straßenkampf-Anleitungen als starkes Argument für eine Einstellung auf diesem 5 000-Euro-Posten zu werten. Er schrieb mir per SMS, man habe sich für eine andere Kandidation entschieden.
Kandidation?
Das fehlerhafte Deutsch des Oberargonauten entschädigte mich für die Absage nur leidlich. Ich war geknickt, was keineswegs daran lag, dass der Agenturjob mein Lebenstraum gewesen wäre. Innerlich war ich auf dem Absprung vom Argonautenschiff, bevor ich es geentert hatte. Ich würde, so dachte ich mir, Monat für Monat so viel wie möglich von den 5 000 Euro auf die Seite räumen, die sechs Monate Probezeit plus X absolvieren und mich von Bord machen, sobald das Ersparte ausreichte, jenes Projekt in der Pampa zu finanzieren, von dem ich weiterhin träumte.
Während die lukrative Kaperfahrt auf der Argo nunmehr ausfiel, trieb mich die Junge Welt zur Weißglut. Binnen kurzer Zeit zum dritten Mal wurde ein von mir eingereichter Artikel nicht abgedruckt. Ich bin gewohnt, dass meine Texte, von Korrekturen abgesehen, ohne Eingriffe der Redaktion übernommen werden. Dieser dritte Fall dessen, was ich als Zensur empfand, empörte mich. Während mein Fluchtversuch in die Welt der Werber also gescheitert war, wurde mir die Unmöglichkeit einer dauerhaften festen Mitarbeit in der Redaktion eines poststalinistischen Blattes ebenfalls zur Gewissheit.
Plan B?
Plan C?
Nicht vorhanden.
So scoutete ich des Abends in der Tucholskystraße, mehr aus Frust als von draufgängerischem Pioniergeist beseelt, einmal mehr nach Immobilien. Auf www.immowelt.de gab ich in die Suchmaske folgende drei Vorgaben ein:
Bundesland: ThüringenKaufpreis: unter 100 000 EuroBesondere ImmobilieDie Suchmaschine spuckte zwei oder drei Seiten Ergebnisse aus. Eine Wassermühle war dabei, die ich im Verdacht hatte, eher den Titel Unterwassermühle verdient zu haben, ein Wasserturm, eine marode Fabrikanlage und eine ehemalige Kaserne der Nationalen Volksarmee. Auf die Kaserne sprang natürlich CommanderStardust an, aber das Objekt kam aus verschiedenen Gründen nicht infrage.
Außerdem fand sich unter den Suchergebnissen ein Schloss.
Schloss?
Jetzt meldete sich aus dem wabernden Durcheinander meiner Identitäten Prinz Chaos II. zu Wort. Er ordnete barsch an, ohne langes Fackeln die angegebene Maklerin zu kontaktieren. Eine gewisse Diana Gertloff antwortete postwendend auf meinen ausgefüllten Kontaktbogen. Wir telefonierten. Wir vereinbarten einen Besichtigungstermin. Drei Tage später sattelte ich meinen blauen Kombi und machte mich auf den Weg.
Dass ich übrigens nach besonderen Immobilien gesucht hatte und nicht nach Bungalows oder Doppelhaushälften, erklärt sich aus dem Trauma, bis zum Auszug in die erste, eigene WG mit 17 Jahren ausnahmslos in Reihenhäusern beheimatet gewesen zu sein. Dazu kam meine Vorliebe für historische Bausubstanz. Die Beschränkung des Kaufpreises war ökonomischen Zwängen geschuldet. Auch so wucherte die Vorstellung von meinem zukünftigen Projekt in Dimensionen, die jeden Bezug zu meinen finanziellen Möglichkeiten weit von sich weisen durften.
Wie kam ich auf den Trichter, ausgerechnet Thüringen als Destination anzugeben?
Der Grund trug den Namen Lacrosse, Vorname Alfred. Dieser Alfred Lacrosse hatte mich keine vierzehn Tage zuvor auf unnachahmliche Weise nach Thüringen auf ein Schloss gelotst.
Angefangen hatte es mit einer erbosten E-Mail an die Junge Welt. Ich hatte einen Artikel zum 50. Geburtstag des Filmemachers Rosa von Praunheim geschrieben. Der Auftrag war bei mir gelandet, weil ich der einzige Schwule in der Redaktion war. Dummerweise hatte ich keinen einzigen Film von Rosa von Praunheim je gesehen. Das Genre Film liegt mir nicht. Ich lese Bücher.
Ein autobiographisches Buch von Rosa von Praunheim hatte ich immerhin vor Jahren gelesen. Folglich schrieb ich eine dreiviertelte Zeitungsseite über einen Filmregisseur, ohne mich mit dessen Filmen zu beschäftigen.
Alfred Lacrosse nahm mich ob dieses Versäumnisses in einer ausführlichen E-Mail aufs Korn. Im Wissen, einen weniger als brillanten Artikel verfasst zu haben, antwortete ich mit einigen selbstkritischen, freundlichen Sätzen. Ich hoffte, dem berechtigt Empörten damit Genüge getan zu haben. Stattdessen erhielt ich eine noch längere, noch empörtere E-Mail. Dieser Herr Lacrosse hatte sich zwischenzeitlich über mich informiert, war durch meine lapidare Antwort nicht besänftigt worden und ging mich auf das Persönlichste an.
Jetzt wurde es mir doch zu bunt. Ich googelte zurück. Alfred Lacrosse war demnach Regisseur von Filmen und Opern und eine durchaus relevante Figur in der Schwulenbewegung der DDR. Demgemäß teilte ich ihm in knappen Worten mit, dass er als Kulturmensch mit einigen Verdiensten um die sexuelle Befreiung unter dem Verdacht ausreichender Satisfaktionsfähigkeit stehe, weshalb ich ihn aufgrund der von ihm geäußerten Unverschämtheiten hiermit zu einem Duell mit Schusswaffen seiner Wahl herausfordere!
Die neuerliche Antwort des Herrn Regisseur haute mich aus den Latschen. Er nannte mich jetzt: Donna Cara, sein Ton hatte sich vollständig verändert, und er lud mich ein, ihn am kommenden Samstag auf Schloss Friedenstein in Gotha zu treffen. Er arbeite derzeit an einem Film über Herzog August von Sachsen-Gotha-Altenburg. An diesem Tag stelle er das Filmprojekt einigen wichtigen Leuten der Stadt vor. Darüber hinaus ließ mich der plötzlich restlos von mir begeisterte Alfred Lacrosse wissen, oder zumindest habe ich es damals hoffnungsfroh so aufgefasst, dass er mich für die Hauptrolle des Films im Auge habe.
Die inspirierte Absurdität dieser Korrespondenz sowie die Stichworte Schloss, Herzog, Hauptrolle überzeugten mich, der Einladung nachzukommen. Ich fuhr nach Gotha. Wir besichtigten Schloss Friedenstein. Alfred erzählte mir von dem genialischen Herzog, der mit Goethe und Napoleon befreundet gewesen war und seinen Hof regelmäßig durch Auftritte in Frauenklamotten zu schockieren wusste. Ich wohnte der Vorstellung des Filmprojekts bei.
Bevor ich meinen blauen Opel bestieg, forderte Alfred kategorisch, ich müsse, müsse, müsse unbedingt die Gelegenheit nutzen, die nahe Wartburg aufzusuchen. Ich folgte diesem Rat, besuchte die Wartburg und auch das Richard-Wagner-Museum unterhalb.
Auf der Weiterfahrt entwickelte ich die flausenhaftesten Gedanken. Meine zweifellos enorme Filmgage würde ich mir vom Gothaer Bürgermeister, den ich ebenfalls getroffen hatte, in Form eines Stückes Land auszahlen lassen, da mir die Gegend ausnehmend gut gefiel. Hier, so dachte ich, in diesem Thüringen, könnte ich heimisch werden. Nur ein bisschen zu wenig Wald und zu viele Felder gab es rund um mein künftiges Gothaer Herzogtum. Auf meinen eigenen Latifundien würde ich das durch beherzte Baumpflanzungen korrigieren.
Inmitten dieser Tagträume erspähte ich ein blaues Autobahnschild mit Aufschrift Schweinfurt. Ich wollte von Eisenach weiter nach München, mobile Navigationssysteme waren noch eine Seltenheit, und ich operierte wieder einmal im weitestgehenden Blindflug. Schweinfurt liegt ja doch in Bayern, sagte ich mir. Das konnte so falsch nicht sein.
Ich nahm die betreffende Autobahnabfahrt, und mit jedem Kilometer wurde die Gegend rund um meinen Opel waldreicher und bergiger. Ich durchquerte erstaunlich lange, nagelneue Tunnel – bis die Autobahn auf einmal endete. Wie ich erst später lernte, war dieses 1996 begonnene Verkehrsprojekt Deutsche Einheit noch nicht fertiggestellt. So wurde ich von der Thüringer Waldautobahn geworfen und kurvte auf Landstraßen weiter gen Süden. Bei verringerter Fahrgeschwindigkeit besah ich mir die Umgebung genauer, und zugleich kam in mir ein höchst eigenartiges Gefühl auf. Irgendetwas hatte diese Gegend mit mir zu tun. Ich war noch nie zuvor hier gewesen, aber ich nahm eine vertraute Energiesignatur auf. Ich witterte ihr nach und musste feststellen, dass es meine eigene Energie war, die ich da auffing. Hatte ich ein früheres Leben hier verbracht, munkelte es in meinen Gedanken. Hatten Vorfahren hier gelebt? Oder war dies ein Ort meiner Zukunft? Meine sehnsüchtig erhoffte Heimat gar?
Diese Gedanken verflogen wieder. Ich überquerte die bayerische Landesgrenze. Ein Stück hinter Coburg brachte mich die Autobahnauffahrt Breitengüßbach wieder auf Touren und bald nach Hause oder wie auch immer ich das Haus meines Vaters nördlich von München nennen sollte.
Als ich mich vierzehn Tage später auf der Fahrt von Berlin zu jenem auf Immowelt gefundenen Schloss befand, erkannte ich zuerst diese Serie beeindruckender Tunnel wieder. Ich dachte mir dabei noch nichts weiter als: Thüringen! Das Land mit den sündhaft teuren Autobahntunneln mit knapp 50 Metern Berg oben drüber …
Diana Gertloff, die Maklerin, hatte mit mir vereinbart, mich an einer Autobahnabfahrt namens Schleusingen aufzugabeln. Die stellte sich als ebenjene Stelle heraus, an der ich bei der letzten Fahrt von der unfertigen Autobahn geworfen worden war. Ich fuhr hinter der Maklerin her, und umgehend stellte sich dieses eigenartige Gefühl wieder ein, dass diese Gegend fundamental mit mir zu tun habe. Mir dämmerte, dass ich mich auf dem Weg zu meinem verzweifelt gesuchten Heimatort befinden könnte.
Nun entstamme ich mütterlicherseits einer Künstlerfamilie, in welcher der Aberglaube eine feste Heimat hat. Die Zahl 13 etwa ist eine Unglückszahl, die wir peinlich vermeiden. Dass die schwärzeste Stunde meiner Schlosserlebnisse in Kapitel Nummer 13 verhandelt wird, ist dann auch kein Zufall. Somit war mir bei diesem ersten Schlossbesuch bewusst, dass ich unbedingt nach einem Omen Ausschau zu halten hatte.
Ich sollte mein Omen bekommen.
Als ich hinter der Maklerin in die Schlosseinfahrt einbog, parkte auf der gegenüberliegenden Straßenseite: ein Leichenwagen. Auf der Heckscheibe bezeichnete der Schriftzug Reich den Namen des Bestattungsunternehmens. Menschen in dunklen Gewändern sammelten sich. Eine Beerdigung fand statt in jenem kleinen Fachwerkhaus, das mir die Maklerin als die Kirche des Dorfes bezeichnete.
Die Bestattung gegenüber sowie das Schmuddelwetter im November dieses Jahres 2007 betonten den trostlosen Eindruck, den das Schloss vermittelte, ungemein. Wir traten durch eine kleine Tür in einen Turm und wendelten auf einer Sandsteintreppe nach oben. Wir erreichten den Dachstuhl, groß wie eine Kathedrale. Wir durchquerten danach die leeren Zimmer des zweiten Stocks. Irgendwo klaffte in der Decke ein großes Loch. Die Räume seien seit 19 Jahren unbewohnt, erklärte mir Diana Gertloff. Zu DDR-Zeiten sei das Schloss als Teil des VEB Gebäudewirtschaft bis unters Dach vermietet gewesen. Nach der Wende seien die meisten Leute dann ausgezogen: verunsichert von unklaren Eigentumsverhältnissen und angezogen von Wohnungen und Häusern mit westlichem Standard.
Wir durchquerten das Stockwerk und erreichten die Räume an der westlichen Giebelseite. Außen wies dieser Sandsteingiebel einen von oben bis unten durchgehenden Riss im Gemäuer auf. Innen durchzog die Decke sowie die Bögen zweier Fensternischen eine labyrinthische Landschaft kleinerer und größerer Risse, die die Maklerin als Haarrisse einstufte. Dies war eine Beschreibung, der man sich lediglich anschließen konnte, wenn man bei diesen Haaren an Dreadlocks dachte. Diese ganze Gebäudeseite war ein einziges, fettes Problem, dessen Behebung nicht viel Aufschub erlaubte, wollte man nicht mit einem Open-Air-Schloss dastehen. So viel war auch dem Laien, der ich in baulichen Fragen damals war, ersichtlich.
Im ersten Stock ging es weiter. Zimmer auf Zimmer. Alle leer. Die Böden waren ausgelegt mit PVC oder Linoleum, es roch muffig – und das ganze Schloss war komplett ausgekühlt, was mit der Dauer der Besichtigung unangenehm wurde.
Wir gingen unten zum Turm wieder hinaus. Diana Gertloff zückte einen gewaltigen Schlüsselbund, und wir traten durch eine andere Tür ins Erdgeschoss eines Gebäudeteils mit Fachwerk. Über eine nicht restlos vertrauenerweckende Holztreppe ging es nach oben. Im ersten Stock waren erneut leere Zimmer mit den üblichen Bodenbelägen, Wasserflecken an der einen oder anderen Decke und den Resten scheußlicher Tapeten an den Wänden. Wir stiegen die nächste Treppe nach oben und standen erneut in einem Dachboden: deutlich kleiner als der erste, dafür an vielen Stellen mit den Bohrmehlhäufchen einer Holzwurmkolonie übersät. In einer Gaube fehlte das Fenster. Das Dach hatte eine Schadstelle, durch die es hineinregnete, wie wir soeben erleben konnten.
Wieder unten gingen wir erneut hinaus und durch eine andere Tür wieder hinein in das Gebäude. Hier gab es oberhalb einer kurzen Treppe eine Einliegerwohnung mit dreieinhalb Zimmern und in besonders schlechtem Zustand zu sehen.