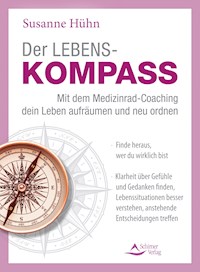Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schirner Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
remdvögeln geht gar nicht - was aber, wenn es doch passiert? Vier Frauen, allesamt erfolgreiche Einzelkämpferinnen, allesamt mit einem komplizierten persönlichen Hintergrund und allesamt mit einem unerfüllten Liebesleben ausgestattet, machen aus ihrer Not eine Tugend und gründen gemeinsam einen tantrischen Club, in dem sich Menschen sexuell erfahren und ausleben können. Sie beraten die Menschen, die kommen, bieten ihnen Möglichkeiten, sich selbst und ihr erotisches Erleben zu erforschen. Doch auch die Frauen selbst verändern sich, müssen altvertraute Schranken loslassen und sich für sich selbst und füreinander öffnen. Sie kommen sich näher, schließen Freundschaften, finden durch viele Verwicklungen hindurch Halt und Unterstützung beieinander. Sie beginnen, sich zu vertrauen, und alles scheint gut - bis das Undenkbare geschieht: Eine der Frauen schläft mit dem Mann einer anderen. Wird die Kraft der Freundschaft tragen, wird am Ende die Liebe siegen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Handlung und die Personen in diesem Buch sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlich lebenden, realen Personen ist zufällig oder ließ sich nicht vermeiden, weil das Leben manchmal einfach so ist.
Originalausgabe
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Funk, Fernsehen und sonstige Kommunikationsmittel, fotomechanische oder vertonte Wiedergabe sowie des auszugsweisen Nachdrucks vorbehalten
ISBN 978-3-8434-6113-9
© 2013 Schirner Verlag, Darmstadt
1. E-Book-Auflage 2014
Umschlag: Silja Bernspitz, Schirner,
unter Verwendung von #22029950 (anna Filitova)
und #11840123 (beaubelle), www.fotolia.de
Redaktion (unter Verwendung von #11840123
(beaubelle), www.fotolia.de): Tamara Kuhn, Schirner
E-Book-Erstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt, Germany
www.schirner.com
Inhalt
Fremdvögeln geht gar nicht.
»Fremdvögeln geht gar nicht. Meine Meinung.« Energisch drückte Monika ihre Zigarette aus. Sie trank einen Schluck ihres Smoothies – Grapefruit, Rote Bete, Gurke, Karotte –, den sie immer und überall mit sich führte. Konnte man süchtig werden nach dem Zeug? Wenn ja, war sie es, dachte sie.
»Ich wäre froh, wenn ich überhaupt vögeln würde, fremd oder nicht, ist mir egal.« Sylvya mit so vielen Y wie nur möglich sah versonnen dem aufsteigenden Rauch nach.
Christal blickte freimütig und irgendwie auch ein wenig besserwisserisch in Monikas Gesicht, so, wie sie schaute, wenn sie Vorträge hielt oder eine Lesung gab. Fehlte nur noch, dass sie eine Hand auf ihren Arm legte. »Bist du nicht der Meinung, dass wir alle freie, liebende Wesen sind, im Grunde alle eins? Was meinst du also mit ›fremdvögeln‹, hast du in einer Beziehung etwa Besitzansprüche?«
»Dieser Text. Schon wieder. Wohin darf ich kotzen?« Monika sah Christal so ernst an, dass diese gerade beginnen wollte, über einen dafür geeigneten Ort nachzudenken. »Doch, natürlich sind wir freie Wesen. Gerade deshalb kann ich ja wohl wählen, was mir gefällt und was nicht.«
Vor genau fünf Tagen hatte sie ihre Beziehung mit einem angesehenen Esoterikguru beendet. Endgültig. Laut ihm eine feste Beziehung, eine Seelenverwandtschaft, keine Affäre. Er war allerdings der Meinung, es gehörte zu seiner Erweckungsarbeit, mit so vielen Teilnehmerinnen seiner Gruppen wie möglich zu schlafen, immer im Dienst an der allumfassenden Liebe.
Schade nur, dass es sich für sie, Monika, so gar nicht liebevoll angefühlt hatte, wenn er mal wieder nach fremdem Parfüm riechend in ihr gemeinsames Hotelzimmer zurückgekehrt war. Sie hatten Seminare gegeben, sogar zusammen, und ihr Schmerz, wenn sie am Morgen das selbstgefällige Grinsen im Gesicht einer der Teilnehmerinnen gesehen hatte, war nicht auszuhalten gewesen. Das Drama war vorprogrammiert gewesen, spätestens zwei Tage später hatte sie sie trotz ihrer Wut und ihrer eigenen Schmerzen trösten müssen, wenn die Seminarteilnehmerin weinend erkannt hatte, dass sie schlicht und ergreifend ein altes Muster wiederholt hatte: den Versuch, einen unerreichbaren, gebundenen Mann für sich zu gewinnen, weil Papi nicht zur Stelle gewesen war. Als wäre dieser Schmerz nicht groß genug gewesen, hatte dieser Mann auch noch darin herumbohren und ihn wiederholen müssen, indem er sie in sein Bett geholt und sich in ihrer Anbetung gesonnt hatte. »Ich bin ihr Spiegel«, hatte er säuselnd kundgetan, wenn Monika ihn barsch darauf angesprochen hatte; man hatte ihrer Ansicht nach nicht unverantwortlicher sein können. »Haben diese Frauen kein Recht zu wählen, hältst du sie für schwach, für bedürftig?«, hatte er ihr vorgeworfen. »Wenn du mich wirklich liebst, dann lässt du mich meinen Weg gehen!« Und »Ja, natürlich sind sie das, deshalb brauchen sie ja Hilfe und kommen zu uns«, hatte sie jedes Mal erwidert, doch immer wieder hatte sie erkennen müssen, dass er an dieser Stelle unerbittlich war. »Und was ist mit mir, was ist mit meinen Schmerzen und deiner Liebe?«, hatte sie gar nicht erst zu fragen gewagt, sie hatte die Antwort gekannt: »Ich bin auch dein Spiegel« – was hätte sie dazu sagen sollen. Es hätte gestimmt.
Also hatte sie schließlich das getan, was sie mit jedem Spiegel tun würde, der ihr ein dermaßen verzerrtes Bild geben würde: Sie hatte ihn zum Sperrmüll gestellt und war gegangen. Es tat ihr sehr leid, sie fühlte sich für die Frauen verantwortlich, die auf diese Weise von ihm ausgenutzt wurden. Doch sie konnte einfach nicht mehr. Zu lange hatte sie sich seiner charismatischen Männlichkeit unterworfen, war immer wieder fasziniert und geblendet gewesen – wie all die anderen Frauen. Es war verrückt, ein Psychiater würde aus der Ärztekammer geworfen werden, wenn er seine Patienten flachlegte, und ein sogenannter Guru, der mindestens genauso viel Macht innehatte, durfte tun, was er tun wollte.
Sie seufzte. Diese ganze Esoterikszene mit ihren komischen Regeln ging ihr dermaßen auf den Geist, dass sie am liebsten eine Klempnerlehre begonnen hätte. Wer am überzeugendsten seelenvoll blicken und mit merkwürdigen Stimmen sprechen konnte, der hatte gewonnen. Die absurdesten Botschaften und Verhaltensweisen wurden gebilligt, wenn sie von der geistigen Welt kamen – was immer diese geistige Welt auch sein mochte. Reden konnte sie kaum darüber. Nachdem sie einmal zu oft das unsäglich arrogante »Du sollst nicht werten, und was hat das mit dir zu tun?« gehört hatte, beschloss sie, die Sache mit sich selbst und ihrer besten Freundin auszumachen. Diese war hoffnungslos unspirituell und herrlich bodenständig, einfach nur mitfühlend und den Rücken stärkend.
Dann mach’s doch einfach, und jammere nicht herum, riet ihr ihre freundliche innere Stimme, und natürlich hatte sie recht. Also die Klempnerlehre.
»Sex wird total überbewertet, das hält euch nur im Ego fest!«, erklang es gepresst. Mit nur ganz leicht gerötetem Gesicht erhob sich Shantipriya – »die vom Frieden geliebte« bedeutete ihr Name – aus ihrer Kopfstandposition, die sie eine halbe Stunde lang gehalten hatte, und setzte sich zu den anderen Frauen an den Tisch.
»Meinst du?«, fragte Christal. »Ich nutze Sex, um mein Ego zu transzendieren.«
Ach herrje. Was genau machte sie hier, fragte sich Monika. Ein paar Mal im Monat trafen sie sich, die erfolgreichsten Schriftstellerinnen und Künstlerinnen eines angesehenen spirituellen Verlags, um sich auszutauschen und sich gegenseitig zu ermutigen. Und jedes Mal verließ sie den Raum lädiert, so, als hätte sie eine weich gespülte Schlammschlacht hinter sich. Auf irgendeine Weise schafften sie es, sich gegenseitig unterschwellige Gemeinheiten reinzudrücken, warum auch immer. So viel zum Thema echte Liebe, dachte Monika, doch sie selbst war auch nicht besser. Doch weil sie alle so liebevoll daherkamen und so kluge Sätze kannten, war es unmöglich, die Karten einfach so auf den Tisch zu legen und die Wahrheit zu sagen, ihre Wahrheit. Nämlich »Sind wir eigentlich alle noch ganz dicht? Können wir nicht mit diesem bescheuerten Konkurrenzkampf aufhören und uns wahrhaftig unterstützen?« Vor allem aber: »Was ist nur aus uns geworden?«
Ernsthaft, warum kam sie zu diesen Treffen? Sie sah in die Gesichter der so unterschiedlichen Frauen. Und da erkannte sie es wieder, wie immer, wenn sie genau hinschaute: Sie alle waren auf dem gleichen Weg. Sie alle widmeten ihr Leben einer höheren Kraft, sie alle glaubten zutiefst daran, dass all das einen Sinn hatte und dass sich dieser Sinn offenbaren konnte, wenn man nur lange genug suchte, innig genug betete, sich selbst immer mehr von allem befreite, was nicht der Seele entsprach. Sie alle meinten es auf ihre Weise tief ernst, und das verband sie. Sie alle hatten mutig ihre ursprünglichen Berufe aufgegeben, lebten teilweise am Rande des Existenzminimums, investierten sehr viel Zeit und Geld in Ausbildungen und in Selbsterfahrungen, die für die meisten Menschen nichts als Spinnereien waren. Sie alle nahmen ihre Träume ernst und versuchten, das zu leben, was sie eben zutiefst glaubten. Und genau deshalb klangen sie manchmal dogmatischer, als sie es meinten.
Am liebsten mochte sie Sylvya. Sie schrieb über Engel und Elfen und malte zauberhafte Engelbilder und Kartensets, war so rosarot mit ihrem langen blonden Haar, den wallenden weißen Gewändern und den zarten Gelenken, dass niemand sie als Bedrohung empfand. Sie hatte einen wirklich großartigen Zugang zu den Botschaften der geistigen Welt, wirkte aber gerade dadurch immer etwas weltfremd. Man konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie jemals einen Reifen gewechselt hätte. Sie war einfach nett, wirklich und im besten Sinne des Wortes, dachte Monika.
»Ich sag euch mal was.« Ebendiese Sylvya schenkte sich, als niemand hinsah, ein weiteres Glas des ökologisch angebauten Weins ein, den Christal mitgebracht hatte, zum Glück hatte er genauso viel Alkohol wie konventioneller. Es war ihr viertes, und bei Gott, sie brauchte es. »Ich bräuchte einen Sexcoach. Meine Muschi kennt nur Mangel, Anstrengung und Leistungsdruck, sie soll super rasiert oder gewachst sein, darf nicht herumzicken, darf keine Liebe brauchen und muss funktionieren. Ich selbst übe mich in Loslassen, in Fülle und in Selbstfürsorge, aber die Arme da unten hat nicht mal einen Namen. Seit achtunddreißig Jahren nicht. Sie muss sich mit dem begnügen, was sie kriegt, hat keine Stimme und ist voller Scham, immer darauf bedacht, den Mann nicht zu verschrecken, weil sie sonst gar nichts kriegt. Sie darf nichts brauchen, und wehe sie hat eigene Bedürfnisse, die sie anmeldet. Mein inneres Kind ist superglücklich im Vergleich zu ihr, und ihr wisst, wie es dem oft geht. Habt ihr schon mal bemerkt, wie eure ganze sexuelle Energie zusammenbricht, wenn dieser Schamgedanke kommt: Bin ich zu gierig, zu schnell, zu langsam, sauber genug, blablabla? Wir reden von Kundalini und Schöpferkraft, aber letztlich will ich einfach nur echt guten Sex. Ist mir egal, wie das klingt. Sex ist definitiv ein Inkarnationsgrund.«
Die anderen Frauen sahen sie ungläubig an. Noch nie hatte eine dermaßen unverblümt ausgesprochen, was sie alle fühlten. Und schon gar nicht die zarte Sylvya.
»Wow. Weißt du was? Ich mach diesen ganzen Unsinn hier eh nur, damit ich endlich mal einen Orgasmus kriege! Natürlich im Dienst an der Erleuchtung. Klar.« Grinsend zog Shantipriya mit einer unfassbar geschmeidigen Bewegung ihre nackten Füße unter sich. Sie griff mit beiden Händen in ihr kinnlanges, lockiges, dunkelrotes Haar und strich es aus dem Gesicht. »Ich bin siebenundvierzig, Leute. Und ich habe noch nie einen Orgasmus gehabt, ist das zu fassen? Ich weiß, wenn ich ehrlich bin, nicht mal genau, ob ich überhaupt auf Männer stehe. Womöglich. Womöglich aber auch nicht.« Sie richtete sich auf, ihr hagerer Körper schien endlos.
»Ich hab im Moment ein bisschen die Schnauze voll – ehrlich, ist es so verkehrt, sich Treue zu wünschen? Seht ihr das wirklich so?« Monika war froh, aufrichtig sein zu dürfen.
»Nein. Du darfst dir wünschen, was du willst. Es ist ja deine Beziehung, und sie muss zu dir passen. Es ist nur ziemlich sinnvoll, wenn dein Partner sich das Gleiche wünscht, denn du kannst es nicht von ihm einfordern, wenn er einen anderen Weg gehen will. Und ich find’s wirklich super, dass du es geschafft hast, aus deiner Beziehung auszusteigen. Ehrlich gesagt, ich hab mir Gedanken gemacht«, sagte Shantipriya, und alle nickten.
»Ich hab ’ne Idee. Wir machen was zusammen.« Triumphierend sah Christal sich um. Sie war eine schamanische Tantralehrerin und schrieb gerade ein Buch über freie spirituelle Liebe, was immer das meinte. Wenn es bedeutete, mit jedem ins Bett zu gehen, der einem gerade gefiel, konnte Monika nicht viel Spirituelles darin erkennen, doch was wusste sie schon, dachte sie. Ihr Ex-Esoguru hatte ihr jeden Tag versichert, dass sie einfach noch nicht so weit sei und sich aus Angst vor dem Neuen an althergebrachten Besitzansprüchen festhalte. Er dagegen befand sich ganz knapp vor der Erleuchtung, es konnte sich nur noch um Tage handeln, bis er sich in Licht auflöste. Würde er es doch mal tun!
Monika mochte die sinnliche, üppige Christal, bewunderte sie für ihren Mut, doch sie hatte auch einen Höllenrespekt vor ihr. Die wusste immer so ganz genau, was sie wollte, und ließ Schwäche, Unentschlossenheit oder Wankelmut nicht gelten. Und sie war einfach ungeheuer sexy, auf diese ganz und gar selbstverständliche Art, bei der es egal war, ob sie ein paar Kilo zu viel hatte oder welche Kleidung sie trug. Schwarzes, kurzes, glatt nach hinten gestriegeltes Haar gab ein Gesicht frei, das nur aus dunklen Augen und einem sinnlichen Mund zu bestehen schien. Irgendwo in ihrer Ahnenreihe gab es indianisches oder mexikanisches Blut, dachte Monika, das verlieh ihr genau den Hauch Exotik, der sie so unwiderstehlich machte. Sie musste Tantralehrerin werden, das war der einzige Beruf, der ihrem Äußeren gerecht wurde – sie selbst war ihre allerbeste Werbung, und entsprechend hatten ihre Kurse auch immer eine lange Warteliste.
»Wir machen einen spirituellen Swingerclub. Mit Massagen, Coaching, Selbsterfahrungen, Meditationen, Tantrasex und Hardcore, so, wie jeder es will. Mit Rollenspielen, offenen Gesprächen, Tanzen und Paarberatungen. Sexuelles Disneyland für wahrhaft Suchende.«
»Wow. Meinst du das ernst?« Die berufliche Umorientierung würde noch einen Moment warten müssen, dachte Monika.
»Warum nicht? Also ich wäre Kunde bei uns!« Sylvyas Augen glänzten voller Vorfreude. Konnte man meinen. Ein bisschen glänzten sie auch vom Wein. »Jetzt mal wirklich. Das fehlt doch! Wie viele Frauen hätten gern echten, guten Sex, würden gern ihre Scham loslassen, sich befreien und sich selbst endlich als die wundervollen Frauen wahrnehmen, die sie sind? Und wie viele Männer würden gern ihr Mannsein erforschen, sich selbst als feurige, schöpferische Wesen erleben?«
Christal strahlte, endlich kribbelte es wieder! Der alte Weg des Lehrens war so mühsam geworden, etwas Neues, nie Dagewesenes musste her. Sie hatten alles gesagt, was sie hatten sagen wollen, hatten alle Werkzeuge beschrieben. Jetzt wollten diese Werkzeuge angewandt werden, auf leichte, lustvolle Weise. Der Zauber, die Begeisterung und das Staunen waren ihnen vergangen. Zu oft hatten sie spirituelle Weisheiten in vernünftige, unpoetische Worte gefasst, zu oft hatten sie Techniken vermittelt, zu oft waren sie von Klienten nach dem Namen des Schutzengels gefragt worden, anstatt diese unermesslich lichtvolle und zärtliche Präsenz einfach zu fühlen. Zu oft hatten sie ihre Klienten bedient, damit diese sich nicht aus ihrer kontroll- und logikgesteuerten Komfortzone herausbewegen mussten, statt von ihnen zu fordern, sich auf den Weg ins fraktale Labyrinth der spirituellen Weisheiten und Erkenntnisse zu begeben. Und ihre Suche genau damit wirklich ernst zu nehmen. Es gab einen unseligen Konkurrenzkampf, der nicht zuletzt von den Teilnehmern ihrer aller Kurse gestartet worden war – die Frage, wer erleuchteter war, wer die besten Antworten hatte, stand immer wieder im Raum. Sie alle waren müde. Es war nicht mehr das, was sie hatten vermitteln wollen, als sie sich aufgemacht hatten, die Wunderkraft der geistigen Welten zu erforschen, jede auf ihre Weise.
»Aber brauchen wir dazu nicht auch männliche Coachs?« Monika dachte sofort praktisch.
»Doch.« Shantipriya nahm die Hände der beiden neben ihr sitzenden Frauen, Christal und Monika. »Schließt mal bitte die Augen, und bildet einen Kreis, nehmt euch an den Händen. Und nun stellt euch dieses Zentrum so bildlich vor wie nur möglich, wie fühlt es sich an, was wollt ihr dort machen und erleben? Stellt euch bitte vor, wir sind umgeben von freien, leuchtenden und liebevollen, lustvollen Wesen, die voller Verantwortung ihre Sexualität leben. Du bist ein weiches, liebendes, sexuelles Wesen, das sich voller Achtsamkeit und ohne Scham auf sexueller Ebene mitteilen kann, ganz offen, leicht und selbstverständlich. Und nun lasst uns die lichtvollen Kräfte, die mit uns gemeinsam diese Energie auf Erden manifestieren wollen, zu uns in den Kreis bitten. Atmet die Kräfte und die Idee durch euer Herz tief in euren Schoßraum, in euren Hochzeitskorb, in die Gebärmutter. Lasst euch schwanger werden mit dieser Idee. Und dann sehen wir, ob sie lebensfähig ist, ob sie geboren werden kann und will, jede für sich und wir alle zusammen.«
Die Frauen atmeten ein paar Mal tief durch, sie waren darin geübt, Energien zu rufen, und jede wusste, was sie zu tun hatte. Nach einigen Minuten öffneten sie ihre Augen und sahen sich strahlend an.
»Ich habe unglaublich viel Kraft gespürt, die reine Freude. Also, ich bin dabei, wenn ihr mitmachen wollt.« Christal, die schon lange von einem Tantrazentrum träumte, glaubte, im siebten Himmel angekommen zu sein. Das war genau das, was sie sich ersehnt hatte, nur besser, denn sie würde es nicht allein machen müssen.
Sylvyas Augen waren wie verschleiert, als sie zu sprechen begann: »Ihr lehrt die Menschen, Liebe in Form zu bringen und auch die machtvollste Kraft, die sexuelle Schöpferenergie, in Liebe zu leben, in Liebe, in Freiheit und so, wie es für jeden einzigartigen Menschen auf Erden richtig ist. Wir sind bei euch und achten darauf, dass die Liebe immer wieder einen neuen Ausdruck findet.« Sie schüttelte den Kopf, ihre Augen blickten klarer. »Puh. Das sagen die Engel dazu.«
»Und du selbst?« Shantipriya misstraute sogenannten Durchsagen zutiefst, weil sich viele Menschen dahinter versteckten. »Was sagst du dazu, du ganz persönlich, Sylvya?«
»Ich find’s einfach cool. Echt super. Ich mach mit.« Sie strahlte und lachte.
»Na, dann ist das ja nun klar. Monika?«
Shantipriya zeigte definitiv Führungsqualitäten, dachten die anderen Frauen, sie würden klare Strukturen brauchen. Bis jetzt waren sie es gewöhnt, allein zu arbeiten, jede hatte ihr Fachgebiet, in das keiner hineinredete. Üblicherweise leiteten sie alle selbst Gesprächsrunden. Die Herausforderungen begannen bereits.
»Ich finde, wir sollten in diese Richtung weiterdenken, einen Businessplan aufstellen und einfach schauen, wie weit wir kommen – Energie spüre ich, ganz klar, aber es ist natürlich für uns alle ein riesiges Projekt, das Zeit, Geld und jede Menge Engagement braucht. Doch es fühlt sich machbar an, ich freu mich richtig drauf! Und du, Shantipriya, was fühlst du?«
»Ganz ehrlich?« Auf einmal traten Tränen in die Augen der sonst so beherrschten, sich selbst kontrollierenden Yogalehrerin. »Das ist für mich wie Nach-Hause-Kommen. Ich will nicht mehr alles allein machen müssen. Und wenn wir uns gegenseitig den Raum zugestehen, dass jede das macht, was sie am besten kann, wenn wir vernünftig und offen miteinander umgehen, dann ist es die Erfüllung meiner Träume.« Sie wischte sich die Tränen mit dem Handrücken weg.
Christal nahm ihre Hand und drückte sie kräftig. »Meiner auch. Ich bin dabei. Lasst uns das machen. Wer sonst, wenn nicht wir, könnte ein solches Zentrum auf die Beine stellen?«
»Apropos auf die Beine stellen. Lasst es uns aufstellen. Wollt ihr?« Monikas Fachgebiet war systemisches Familienstellen, das auch immer dann hervorragende Dienste leistete, wenn es um die Machbarkeit von Projekten ging.
»Klar, immer!« Christal sprang auf, ihre Idee wurde ernst genommen, das war großartig.
»Gut. Wer will mitmachen?«
Alle hoben die Hand.
»O.k. Dann stelle ich mich selbst auf den energetischen Platz unseres Clubs … Wartet … So.« Sie positionierte sich mitten im Raum, und es war, als strahlten auf einmal die Farben heller und als zöge Freude in die Herzen der Frauen ein. Endlich wurden sie gesehen, endlich wurden sie in ihren geheimsten Wünschen wahrgenommen!
»Ich sehe euch«, sagte Monika in ihrer Rolle als spiritueller Swingerclub. »Ich will euch nähren und euch Freiheit schenken, zu sein, was ihr eben seid. O.k. Und jetzt bitte ich euch, stellt euch nacheinander vor mich, wer beginnen will, beginnt.«
Christal hatte den Vortritt, schließlich war es ihre Idee. Sie stellte sich vor Monika, spürte den immensen Energiestrom und seufzte tief auf. »Angekommen. Am richtigen Platz, so fühle ich mich«, sagte sie, und es war, als fiele ihr ein Felsbrocken vom Herzen.
»Du bist das Herz und die Seele, du nährst den Club, gibst dein Herzblut hinein, dafür bekommst du eine Lebensaufgabe, eine Bestimmung, etwas, worin du aufgehen wirst. Du bist die Mitte, von dir kommt es, und zu dir kehrt es immer wieder zurück.« Monika spürte ganz deutlich, dass Christal hier ihre Seelenaufgabe erfüllen konnte, wie immer diese auch lautete.
»Wow. So fühle ich es auch. Ich danke dir.« Christal verließ den Platz.
Shantipriya trat vor und fühlte sich in die Aufstellung hinein, nahm ihren Platz wahr und betrat ihn.
»Das ist anders. Du wirst mit einer Menge Kontrolle konfrontiert werden, und du wirst dich zunächst besonders um die Strukturen und um die Verwaltung kümmern.« Monika sah Shantipriya fragend an, hatte sie etwas falsch verstanden? Sie war Yogalehrerin und sicher nicht besonders scharf darauf, Buchhaltung zu machen.
Doch Shantipriya nickte und sagte: »Das passt, ich habe früher als Managerin gearbeitet, wenn ich was kann, dann organisieren und Arbeitsprozesse anschieben und verwalten.«
»Warte, da kommt noch was. Du wirst deinen Platz finden und deine eigene Identität, du wirst herausfinden, wer du wirklich bist, und damit sehr viel Klarheit auch bei anderen ermöglichen. Denn du weißt, wie es ist, Kontrolle loslassen zu müssen und mit der Unsicherheit, die dann kommt, umzugehen. Das macht dich zu einer großen Inspiration für alle, die Schwierigkeiten haben, Kontrolle loszulassen, und das wird bei vielen eurer Klienten und Kunden so sein.« Monika schwieg, mehr gab es nicht zu sagen.
»Huh, super, das passt, und das will ich. Ich danke dir. Dahin geht also die Reise – o.k.« Shantipriya trat aus dem energetischen Kreis heraus und öffnete den Raum für Sylvya.
Diese stellte sich sehr unbefangen und beinah kindlich vor Monika, also in den Energiekreis des Clubs.
»Du hast eine so herzerfrischende Natürlichkeit, dass du jedem die Scham nimmst, du bist einfach frei und offen, du lebst zwar nicht alles, was du gern leben würdest, aber du bist nicht so beschämt wie die meisten, sondern hast dir einen sehr erdigen, sehr unbefangenen Zugang zu deiner eigenen Sexualität erhalten und mit auf die Erde gebracht.« Monika, die diese Worte sprach, war selbst einigermaßen verwundert, als sie diese Energien fühlte. Sie hatte Sylvya ganz anders wahrgenommen. Da sah man ihn mal wieder, den Unterschied zwischen Projektionen und echter Wahrnehmung. Durch das Aufstellen spürte sie die tatsächlich wirkenden Energien, unabhängig von ihren eigenen Vorstellungen.
Sylvya sagte nichts dazu. Sie strahlte nur. Selten hatte sie sich so liebevoll erkannt gefühlt, und sie umarmte Monika einfach stumm. »Und du?«, fragte sie schließlich. »Soll ich mich mal auf die Clubposition stellen?«
Monika nickte. Puh. Sie war nicht sicher, ob sie ihre eigene Rolle wirklich spüren wollte. Doch da kam es auch schon.
»Klarheit. Deine Aufgabe ist es, emotionale Klarheit zu bringen. Es werden sehr viele kommen, die nicht mehr wissen, was für sie stimmig ist und was nicht. Deine Erfahrungen mit Max« – das war der Esoterikguru – »machen dich zu etwas ganz Besonderem, du lässt dich nicht mehr blenden und kannst klar und deutlich sagen, was du willst und was du fühlst. Du kannst unterscheiden, was spirituelle Vorstellungen sind und was tatsächlich wahr ist. Damit hilfst du Menschen, in ihre emotionale Wahrheit zu kommen, und das ist beinah das Wichtigste für eine erfüllte Sexualität.«
Monika umarmte sie nun ihrerseits. Das fühlte sich vollkommen richtig und stimmig an, und damit ergab auch ihr wirklich schmerzhafter Weg einen echten Sinn. Sie war eine Art Vorbildfrau geworden. Indem sie dem angesagtesten spirituellen Lehrer der Szene eine Absage erteilt hatte, weil er sie verletzt hatte, hatte sie ein klares Zeichen gesetzt.
Die vier Frauen stießen mit Sekt an. »Auf uns, auf unseren Club und auf erfülltes Vögeln!«, rief Sylvya und machte ihrem neu erworbenen Status alle Ehre.
»Wie soll er heißen?« Christal wollte Nägel mit Köpfen machen.
Doch noch war es nicht so weit, zur richtigen Zeit würde ihnen auch der ideale Name einfallen. Jetzt durften die Spirits ihre Arbeit tun. Die Handlungsimpulse würden kommen, wenn es so weit war. Viel Arbeit wartete auf sie, doch sie alle waren müde geworden, brauchten neue Herausforderungen. Zeit, die Komfortzone zu verlassen. Zeit für echte Abenteuer.
Max knallte die Tür seines Apartments hinter sich zu. Es wirkte kleiner als sonst, war dunkel und roch muffig, klar, er war ja auch etliche Wochen unterwegs gewesen. Er hievte seinen Koffer mit der privaten Kleidung – die Bühnenoutfits wurden von zwei eigens dafür angestellten Mitarbeitern verwaltet – ins Wohnzimmer und sah sich um. Er hasste diesen Moment, immer wieder. Viele Wochen lang war er auf einer Welle der Anerkennung, des Erfolges und der Anbetung gesurft, nun wurde er auf sich selbst zurückgeworfen. Er kam sich vor, als sei er süchtig nach dieser Energie, die sich immer dann einstellte, wenn er die Massen bewegte. Er war der uneingeschränkte Herrscher im Saal, wenn er auf der Bühne stand und vor Hunderten von verzückten Männern und Frauen sprach. Seine Bücher verkauften sich wie warme Semmeln, und er brauchte bloß anzukündigen, dass er eine bestimmte Stadt besuchen wollte, schon rissen sich die Veranstalter um ihn. Sein Name wirkte wie eine Gelddruckmaschine. »MaxXXx ist in der Stadt!«, schrien die Plakate, mit sehr vielen X.
Nur war er ausgebrannt. Hatte keine Lust mehr. Ihm fiel nichts Neues mehr ein, das spürte er seit einiger Zeit. Er konnte sich mit den älteren Programmen sehr gut durchschummeln, doch immer öfter bemerkte er, dass die Energie nicht mehr ganz so elektrisierend wirkte wie früher. Das Feuer des Anfangs war erloschen, alle Versuche, es neu zu entfachen, fruchteten nur kurze Zeit. Wenn er es sich erlauben würde, dachte er, dann müsste er erkennen, dass ihn die alte, vertraute Existenzangst wieder eingeholt hatte. Aus Gewohnheit packte er sofort seine Koffer aus, das bedeutete, er kippte den Inhalt auf den Fußboden und sortierte die Schmutzwäsche. Er zog sein privates Handy aus der Tasche. Keine Nachrichten. Monika hatte ihn offensichtlich wirklich verlassen. Nun ja, das hatte er sich selbst geschaffen. Er war bis jetzt immer verlassen worden, das sollte wohl so sein, warum auch immer. Die geistige Welt schwieg hartnäckig zu dieser Frage, zu der einzigen, die ihn wirklich bewegte. Sein beruflich genutztes Handy hatte schon wieder einen vollen Speicher, dabei hatte er ihn erst gestern geleert.
Er war so müde. Max tappte zur Küchenzeile und lud die teure, komplizierte Kaffeemaschine. Er machte sich einen großen Latte macchiato und setzte sich in seinen Lieblingssessel, einen alten lederbezogenen Ohrensessel, in den er sich in einem schottischen Pub verliebt hatte. Der Besitzer des Pubs hatte ihn nur ungern verkauft, doch Max hatte seinen berühmten Charme spielen lassen. Er bekam immer, was er wollte. Seine Fähigkeit, Energie zusammenzuziehen und sich das zu erschaffen, was er begehrte, war legendär, beinah so, als hätte er einen Pakt mit dem Teufel geschlossen – was nicht der Fall war, er hatte es überprüft. Nur das Wichtigste konnte er nicht erschaffen: jemanden, der ihn wirklich liebte. Monika liebte ihn wahrhaftig, hatte sie gesagt, doch auch sie verstand ihn nicht. Er hatte sie nicht betrogen. War es so schwer zu verstehen, dass er auf der Erde war, um die verschiedensten weiblichen Energien zu erleben und zu spüren? Er machte Erfahrungen mit weiblicher Kraft in jeder Form, in sehr warmer, nährender, aber auch in verletzender und manipulierender. Das war es, was seine Seele sich vorgenommen hatte, und so sah das nun mal aus auf der Erde, in gelebter Form. Oder machte er es sich zu einfach? Max rieb sich mit der flachen Hand über das Gesicht. Woher kamen nur all diese Gedanken? Er sah gut aus, das wusste er. Noch wichtiger aber war seine Stimme, sie klang voll, warm, man konnte sich darin baden, ihm vertrauen.
Er stöpselte seinen Laptop ein und öffnete sein E-Mail-Programm. Hunderte von begeisterten Frauen und Männern, die ihm Beifall zollten. Max trank seinen Latte macchiato, las einige der E-Mails und schloss das Programm wieder. Sollte er noch ein Buch schreiben, noch eine CD aufnehmen, eine weitere Rundreise durch die verschiedenen Buchhandlungen planen? Riesige Säle mieteten sie, wenn er kam, er garantierte ein gutes Geschäft. Würden sie noch einen Pfifferling für ihn geben, wenn sein Stern sinken würde, was ja nun nicht ausgeschlossen war? Und war er bereit, das herauszufinden? Sein Erfolg schmeichelte ihm nicht, er wusste genau, was er zu tun hatte, um gut anzukommen, und er zahlte den Preis dafür. Erfolg war ein Ergebnis harter Arbeit, jeder Menge Marketing und dieser Fähigkeit, Menschen emotional aufzurütteln und tief zu berühren. Natürlich musste auch die Botschaft stimmen.
Er räusperte sich. Er war so müde. Wurde es jetzt Zeit für Plan B? Für seine Heimkehr? Er nahm ein mit seinem Logo bedrucktes Blatt Papier aus seiner Aktentasche, zerknüllte es. Das war viel zu geschäftsmäßig. Was er zu schreiben hatte, war höchst privat.
Max stand auf, brühte sich einen weiteren Kaffee auf und setzte sich an seinen zierlichen Sekretär, ein Erbstück seiner Tante. Er zog zwei Blatt eines kostbaren Büttenpapiers hervor, schraubte seinen Füller auf und begann:
Liebe Monika,
ich danke dir von ganzem Herzen für die vergangenen drei Jahre. Es tut mir sehr leid, wenn mein Weg dich verletzt hat, es war nie meine Absicht, dich zu demütigen. Doch du weißt, du hast dir diesen Weg mit mir erschaffen, und so kann ich keine Verantwortung für deine Gefühle übernehmen.
Max hielt inne. Stimmte das wirklich, fragte er sich zum ersten Mal ernsthaft. Warum hatte er immer, wenn er diesen Satz sagte, seine Großmutter vor Augen? Und warum sah er sich selbst jedes Mal als kleines Kind, ein Kind, das sich hinter dem Ofen versteckte, damit sein Großvater es nicht fand? »Du bist selbst schuld«, hatte der Großvater gesagt, wenn er ihn hervorgezogen und mit seinem festen Ledergürtel verdroschen hatte. Durch seine gesamte Kindheit hindurch. Und natürlich war auch der Klassiker gekommen: »Das schmerzt mich viel mehr als dich.« Mitfühlend hatte die Großmutter ihn angeschaut und ihm, wenn der Großvater fertig war, zugeraunt: »Glaub ihm nicht, du kannst nichts dafür, er ist schuld, er schiebt es auf dich. GLAUB IHM NICHT.« Gehindert hatte sie den Großvater nicht an den Schlägen. Und geglaubt hatte er es trotzdem.
Die Eltern? Welche Eltern? Sie reisten damals herum, zogen frei wie Vögel durch die Lande, konnten sich nicht mit so etwas Spießigem wie Kinderhüten abgeben. Freie Liebe, freier Geist, freier Sex waren ihre Credos, das waren die späten Sechziger, hey. Das musst du doch verstehen, sagten sie ihm immer wieder, als er sich weinend an das Bein seines Vaters klammerte, wenn sie zu einem der sehr seltenen Besuche kamen. Du bist hier gut aufgehoben, unser Leben ist nichts für ein Kind, viel zu bewegt, viel zu unsicher, zu wenig Geld. Dann fuhren sie fort in ihrem bunten Wohnwagen, hinaus in ein spannendes Leben, ein Leben in Freiheit, Liebe und bestimmt ohne Schläge.
Max hatte ihnen vergeben, es war ein langer Weg gewesen. Noch länger war der Weg, sich selbst zu vergeben, dass er sich diese Erfahrungen erschaffen hatte. Und doch war es genau das, was er oft beinah ungeduldig von seinen Anhängern forderte. Zum Glück klang es intensiv und ausdrucksstark, wenn er auf der Bühne stand und Selbstverantwortung predigte, nicht so, wie er sich tatsächlich fühlte. In Wahrheit nervte ihn das Gejammer seiner Klienten oft sehr. Mindestens so sehr wie das seines eigenen inneren Kindes. Wie oft hatte er es in den Arm genommen und getröstet, und doch musste er den Kleinen immer wieder hinter dem Ofen hervorziehen. Es war fast, als hätte er Angst vor ihm, dem erwachsenen Max.
Er zerknüllte das teure Büttenpapier, nahm das nächste Blatt.
Liebe Monika,
es tut mir leid. Ich kann dir nicht geben, was du brauchst. Ich brauche etwas anderes. Es hatte nichts mit dir zu tun, ich möchte einfach meine Energie mit vielen Frauen teilen, ohne eine Beziehung mit ihnen zu führen. Eine Beziehung wollte ich mit dir, aber ich kann nachvollziehen, dass mein Weg dich verletzt, und so muss ich dich loslassen.
Ich danke dir für die Zeit, und ich vermisse dich, du warst meine Gefährtin, das beinhaltet so viel mehr als Sex. Niemals warst du für mich leicht ersetzbar, wie du es immer befürchtet hast, und du, meine Gefährtin, mit der ich mich so lustvoll austauschen, so innig streiten und so wortlos verstehen konnte, fehlst mir sehr. Du hast dich nie beeindrucken lassen, hast hinter die Kulissen geschaut und mich als das genommen, was ich wirklich bin. Nicht als den Seminarleiter, der über allem steht und von dem das in gewisser Weise auch erwartet wird, sondern als den Mann mit Schwächen und Stärken. Dennoch muss ich meinen Weg gehen, wie ich ihn eben gehe, so, wie du den deinen. Dieser Brief ist nur für dich, bitte gib ihn nicht an die Presse, wenn dir das möglich ist. Es tut mir leid, mein Weg führt mich nun weiter. Es war schön hier auf Erden mit dir, mit euch. Ich bin müde, ich habe alles gesagt, ich gehe nach Hause.
In Liebe,
Max
Er faltete den Brief sorgfältig, stecke ihn in einen passenden Umschlag und – und jetzt, fragte er sich, wollte er noch mal raus zum Briefkasten? Eher nicht. Groß und deutlich sichtbar schrieb er ihren Namen auf den Umschlag, klebte ihn zu und legte ihn auf den Sekretär. Er schrieb noch einige weitere Briefe, es war eine Menge Verwaltungsarbeit liegen geblieben. Nein, entschied er. Es würde kein weiteres Buch geben. Er hatte alles gesagt, und vielleicht stimmte es nicht einmal.
Er war so müde. Er hatte sie betrogen, dachte er, das stimmte. Aber nicht so, wie sie glaubte. Vielleicht würde sie es nie herausfinden, aber falls doch, konnte er nur auf Gnade und einen guten Ausgang hoffen.
»In Liebe, Max«, hatte er geschrieben. Stimmte das? War er glücklich, wirklich in der Tiefe glücklich? Nein. Hatte er Liebe geschenkt bekommen? Ja. Ganz sicher. Viel Liebe. Echte Liebe. Konnte er sie erwidern? Nein. Eher nicht. Das war eine armselige Bilanz. All die Bücher. All die Menschen. Hatte er wirklich geliebt? Nicht in fulminanter Liebesenergie geschwelgt, sondern sich hingegeben, wahrhaftig vertraut, voller Mut und Verletzlichkeit? Es war einfach, Liebe zu verkünden, Energie zu rufen und den Raum mit Lichtkraft zu füllen, wenn es nicht um ihn persönlich ging. Ging es nicht um ihn, konnte er beinah alles. Aber hatte er sich zum Narren gemacht für Liebe, hatte er alles hinter sich gelassen und war ihr gefolgt, der Liebe, weil es nicht anders ging? Nein. Er hatte sie gesucht, über sie geredet, sie verkündet, hatte andere im Namen der Liebe verletzt. Nicht sich selbst. Doch echte Liebe erforderte, dass man über sich selbst hinauswuchs, seine eigenen Grenzen sprengte, nicht die der anderen bis zum Zerreißen strapazierte.
Er war unfassbar erfolgreich. Und würde nicht den geringsten Fußabdruck hinterlassen, wenn es um echte Liebe ging, um die Liebe, die alles abverlangte und die tiefste Hingabe an das eigene Herz lehrte. Die Liebe, die adelte und einen voller Würde dem eigenen Herzen folgen ließ, egal wie armselig und bedauernswert man dabei von außen aussehen mochte, dachte er. Wenn man der Liebe folgte, nicht der Abhängigkeit, sondern der Liebe, dann strahlte man in einer solch tiefen Würde, lebte in einem so tiefen inneren Frieden, dass sich niemand von den zeitweise geröteten Augen und den angespannten Schultern täuschen ließ. Das Leben mochte einem den Sturm der eigenen inneren Widerstände und Ängste ins Gesicht peitschen – wenn man liebte, wahrhaftig liebte, war man auch für das stärkste Unwetter gewappnet, dachte er. Er dachte es. Erlebt hatte er es nie. Der leiseste Windhauch hatte ihn üblicherweise gehen lassen, der geringste Gegenwind einer Frau – und schon war er weg. Die kleinste Konfrontation mit sich selbst, der Anflug eines Gefühls, seine kostbare Freiheit könnte eingeengt werden – weg war er. Nicht immer gleich körperlich, aber sein Herz verschloss sich. Dabei war diese so kostbare Freiheit nichts als der Versuch, die Kontrolle zu behalten, dachte er und vergrub den Kopf in den Händen. Abstand zu halten. Er erlaubte scheinbar so viel Nähe, war so offen und hielt sich doch jeden Menschen meilenweit vom Leib.
Nun ja. Ändern konnte und würde er es nicht. Sein letzter Plan hatte nicht gefruchtet. Er hatte die Liebe auf sein Banner geschrieben. Geld, viel Geld damit verdient. Doch gelebt hatte er sie nie. Niemals hatte er um der Liebe willen tief in sich selbst hineingeschaut, nie hatte er sich den Schmerzen seines eigenen Wesens gestellt, weil er liebte. Akademisch, zu Forschungszwecken, in kontrollierten Sitzungen und bewusst herbeigeführt – das ja. Er konnte in sein Gefühl ein- und aussteigen, wie es ihm beliebte. Aber die Kontrolle hatte er nie verloren, war nie ein echtes Wagnis aus Liebe eingegangen. Das größte Abenteuer hatte er immer vermieden: wahrhaftig und innig zu lieben.
Er nahm einen schweren Gegenstand aus einer Schublade – es wurde Zeit, dass er auch das Erbstück seines Onkels würdigte, indem er es zur Anwendung brachte. Und weil es schon spät war und er niemanden wecken wollte, benutzte er es mit Schalldämpfer.
Berlin-Prenzlauer Berg, Sommer 1992
Hol’s der Teufel
»Leute«, sagte der Teufel und ließ den Kopf hängen, »ich kann’s nicht mehr hören. Für allen möglichen Scheiß werde ich verantwortlich gemacht, dabei hat jeder immer die Wahl. Immer ist Jesus der Gute. Immer sind die Goldflügelträger die Tollen.«
»Hui, ist der mies drauf«, zischelten die Dämonen und hielten sich fern. Wenn der Große Meister Gift und Galle spuckte, lebten sie auf, aber diesen immer häufiger auftretenden Opfertrip fanden alle äußerst ermüdend. Sie hatten sogar schon eine Höllenselbsthilfegruppe gegründet, weil sie befürchteten, allzu sehr in den Sog der Depression seiner Unheiligkeit zu geraten – doch welcher höheren Macht sollten sie ihr Leben anvertrauen, wie das auf der Erde so erfolgreich gemacht wurde? Die Dämonen befürchteten, sie könnten sich in kleine Rauchwölkchen auflösen oder in eine Art Schleimklumpen verwandeln, wenn sie ihr Leben einer »Macht, größer als sie selbst« in die Hände legten, das war einfach nicht üblich in der Unterwelt. Wozu ein Risiko eingehen?
»Das nervt«, dröhnte ein besonders fies aussehender Dämon, der großen Wert darauf legte, furchterregend zu klingen.
Ein zu seinem eigenen Leidwesen wirklich putziger kleiner Drache ergriff die Initiative. »Du hast schwarze Flügel, die sind viel cooler, du kannst überall hin, du kannst den Menschen in die Seele sehen und wirklich alles erkennen, das Licht, aber auch die Schatten«, erinnerte er den Teufel an seine Macht.
»Ja. Aber das ist so ermüdend. Was für ein Schwachsinn in meinem Namen entschieden wird, ich hab echt keine Lust mehr. Kann nicht jemand anders meinen Job übernehmen? Kleiner Drache, willst du das für eine Weile erledigen?«
Der kleine Drache schaute Satan verdutzt an. »Was …« traute er sich fast nicht zu fragen. »Was … müsste ich denn dann so tun?« Der SATAN. Klar. Aber was genau machte er eigentlich?
»Nichts. Energie halten, böse sein, so tun, als seist du das Schlimmste, was es auf der Welt gibt. Nichts Besonderes, das kann jeder. Machen viele. Ist echt langweilig. Warte.«
Der Teufel griff zu einem klobigen schwarzen Telefonhörer. Es hing weder ein Telefon dran noch gab es eine erkennbare Leitung, der Teufel brauchte keine. Aber es war so wohltuend, das schwere schwarze Ding in der Hand zu halten.
»Chef, ich brauch Urlaub. Echt jetzt. Seit Tausenden von Jahren … Doch, ich fühl mich ausgebrannt, haha, ja, echt witzig, wer fühlt sich das nicht, hier unten.« Er lauschte ein paar Minuten, verzog das Gesicht. »Ja. Nein. Doch. Ja, ich hab einen Stellvertreter.« Er schaute den kleinen Drachen scharf an. Dieser versuchte, sich in einer Rauchwolke zu verstecken, doch der Teufel wie auch Gott sahen eh alles, was sollte er den beiden vormachen. »Ja, ich komm euch besuchen.« Satan lachte und sah auf einmal fünfhundert Jahre jünger aus, beinah war es, als leuchteten seine üblicherweise alle Energie in sich hineinziehenden mattschwarzen Flügel auf. Energie sprühte in der Hölle, und für eine Sekunde begannen die Dämonen freudestrahlend zu grinsen. Es war beängstigend. Glücklicherweise erhielten sie sehr rasch ihre ursprüngliche bösartige Ausstrahlung zurück.
Eine blaue Lichtsäule erschien, ein äußerst seltenes Phänomen in der Hölle. Seelen begannen, sich um diese Lichtsäule herumzudrängeln, doch die Dämonen hielten sie zurück. Als wäre Erlösung so einfach, eine Lichtsäule, und alles wäre gut. Bitte. Die Kirchen hatten selbst für einen langen Weg gesorgt, als sie die Hölle erfanden. Und alle Seelen, die sich hier herumtrieben, hatten darauf bestanden, diesen langen Weg zu gehen, sonst wären sie gar nicht hier. Des Menschen Wille war sein Himmelreich, und wer Lust hatte, an die Hölle zu glauben, der wurde gern bedient.
»Der Tag der Erlösung ist da!«, riefen einige besonders feinfühlige Menschen, als die Lichtsäule erschien, doch rasch verstummten sie. Nee, doch nicht. Denn auf der Stelle verschwand sie wieder. Kaum hatte Satan sich hineinbegeben, war sie auch schon weg.
»Alter!« Michael schlug ihm auf die Schulter. »Ist das lange her!«
Satan sah sich um. Er hatte ganz vergessen, wie verdammt hell es im Himmel war, und er war froh, dass er seine Himmelslichtbrille geschnappt hatte, bevor er in höhere Gefilde aufgefahren war.
»Mann, siehst du scheiße aus.« Michael sah ihm nun ins Gesicht.
»Entschuldigst du mal bitte? Solltest du nicht erzengelgleich freundlich und ermunternd sein?« Satan war wirklich beleidigt. Furchterregend. Schaurig. Grausam. Beklemmend und abscheulich. Aber doch nicht scheiße!
»Nee. Ich bin Michael, ich sag die Wahrheit. Soll ich dich rumführen? Hat sich einiges verändert.«
»Das ist ein Scheißjob da unten. Ich kann’s immer noch nicht fassen, dass ich verloren hab und runtermusste.« Satan atmete schwarzen Rauch aus.
Sofort kamen ein paar Unterengel, blickten Satan streng an und wedelten den Rauch mit ihren Flügeln aus Michaels Blickfeld. Satan zog die Augenbrauen hoch. War sich der Herr zu fein für ein bisschen irdische Erfahrung? »Weil du nicht pokern kannst, du bist zu ehrlich.«
Erzengel Michael setzte ein gleichmütiges, unnahbares Gesicht auf. »Siehst du? Pokerface. So verteile ich Schicksal, einfach so. Ohne Vorwarnung.«
»Das machst du jetzt auch?« Satan war beeindruckt.
Michael schüttelte seine riesigen blau schimmernden Flügel. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man ihn beinah für arrogant halten, dachte Satan, doch natürlich gab es im Himmel kein Ego.
»Die rufen immer mich, ich bin hier der Rockstar. Deshalb hab ich ein paar Funktionen dazubekommen. Glaub mir, Haniel und Sandalphon kotzen, weil sie fast keiner mehr kennt. Was anderes, wer vertritt dich unten?«
»Ein putziger kleiner Drache.« Satan richtete sich plötzlich auf, ein paar Engel waren herbeigeflogen und starrten ihn an. »Das ist er!« und »Coooool!« wisperten sie.
Erzengel Michael erstarrte. »Ein putziger kleiner Drache? Hast du vergessen, wie wichtig deine Aufgabe ist?«, fragte er ernst. »Ich sollte dich auf der Stelle in die Hölle zurückschicken, aber …«
»… so viel Macht hast du nicht, ich weiß. Was ist denn los, ich bin ein paar Tage nicht da, was mach ich schon groß?«
»Du hat es vergessen, richtig?« Erzengel Michael polierte sein blitzend blaues Schwert. »Du bist der Hüter des freien Willens, mein Lieber. Durch dich können die Menschen wählen, welcher inneren Stimme sie folgen.«
Huh. Satan verzog sein Gesicht. Kein Wunder, dass er so erschöpft war. »Na, das ist doch mal eine Aufgabe. Und wie mach ich das?« Der Teufel wusste es wirklich nicht. Er war einfach auch da, ein Teil der Schöpfung.
»Komm mit.« Michael breitete seine Flügel aus.
»Wie fliegt man noch mal?« Satan bewegte seine mattschwarzen Federn, sie waren ihm nichts als eine Last.
»Hey. Alter. Du hast es echt vergessen. Aber das wussten wir ja.« Michael schnippte mit den Fingern, und auf einmal erstrahlte Luzifer in den schönsten Farben, heller noch als Erzengel Michael.
»Na? Erinnerst du dich?«
»Und weiter?« Frank hatte den Kopf in die Hände gestützt und lauschte hingerissen.
»Das ist es. Weiter weiß ich nicht.« Monika seufzte. Schriftstellerin wollte sie werden, was hatte sie sich da nur in den Kopf gesetzt. Sie sollte lieber mal ein bisschen Geld verdienen gehen. Sie schaltete ihre schicke elektrische Schreibmaschine aus, Frank hatte sie ihr zu Weihnachten geschenkt.
»Also, ich find’s echt super. Richtig gut. Witzig, mal was Neues.« Er nahm sie in die Arme und küsste sie. »Das wird schon, du bist echt gut.«
»Anfänge sind immer leicht, aber die Energie dann zu halten, eine echt spannende Geschichte draus zu machen, das ist ’ne Kunst.« Vor allem, wenn man eine so unerbittliche innere Kritikerin hatte wie sie.
Monika schlüpfte in ihre schweren Springerstiefel, die sie zum zarten Blümchenkleid tragen würde. Sie war klein und sehr schmal, so sah sie aus wie eine Elfe, die sich durch die klobigen Schuhe auf der Erde zu halten versuchte. Doch das sah wirklich nur so aus. Sie war im Zeichen des Widders geboren, und ihr Aszendent stand im Stier, sie ging ihren Weg mit unnachahmlicher Sturheit, dessen war sie sich selbst bewusst. Manchmal mit zu großer Sturheit, denn ihr Wunsch, zu gewinnen und sich durchzusetzen, war ab und an größer als ihre innere Stimme, die in einigen Lebensbereichen zum Loslassen riet – doch sie hatte jede Menge Kraft. So langsam allerdings, dachte sie, kam ihr diese Kraft abhanden. Sie bürstete ihr langes aschblondes Haar, bis es glänzte, und band es zu einem Zopf. Es reichte bis zum Po und verhedderte sich leicht, so trug sie es meistens zusammengebunden. Ein wenig Wimperntusche, mehr brauchte sie nicht, die riesigen blaugrauen Augen beherrschten sowieso das Gesicht. Zartrosa Lippenstift, das war’s. »Ich muss los.« Sie nahm ihre Umhängetasche und verließ die gemeinsame Zweiraumwohnung.
Sie nahm die U-Bahn und stieg etliche Haltestellen weiter aus, betrat die beeindruckend weiträumige Buchhandlung, in der sie sich vorstellen wollte. Monika war in der DDR aufgewachsen, die Grenzen waren endlich geöffnet, und sie hatte sich auf der Stelle auf den Weg nach Westberlin gemacht. Ihr uneingestandener, unerfüllbarer und überdimensionaler Traum war Wirklichkeit geworden, und sie konnte es immer noch nicht fassen. Der Unterschied war immens, so unermesslich groß, dass sie wochenlang wie betäubt war von all den Möglichkeiten. Sie musste in den Westen, denn sie liebte, brauchte Bücher. In der DDR hatte es sehr, sehr gut sortierte Buchhandlungen gegeben, auf Bildung war großer Wert gelegt worden, aber natürlich war das Sortiment zensiert gewesen. Sie hatte eine umfassende Fachausbildung als Buchhändlerin gemacht, doch jene Bücher, die sie wirklich interessierten, waren in der DDR verboten gewesen. Sie konnte sich nichts Schöneres vorstellen, als in einer Buchhandlung zu arbeiten, in der sie Kunden zu spirituellen Ratgebern beraten dürfte. Sie war fasziniert von all den Energien, den wundervollen Lehrern, den Büchern über Engel, Elfen und das Höhere Selbst.
Eine Westkundin hatte ihr nach einem sehr spannenden Gespräch in der Buchhandlung, in der sie gearbeitet hatte, ein Buch geschenkt, heimlich natürlich. Es war darin um Lichtarbeit und höhere Energien gegangen. Monika war auf der Stelle hingerissen gewesen, und die nette Kundin hatte ihr von da an regelmäßig Bücher geschickt, auch wenn Monika sie nicht hatte bezahlen können. Es war überhaupt nicht zu fassen gewesen, wie freundlich das gewesen war, und Monika hatte ihr täglich Segen und Licht geschickt. Genauso wenig war es zu fassen gewesen, dass sie nicht kontrolliert worden war, als hätte das Universum einen Schutzengel abberufen, der sich nur um diese Buchsendungen gekümmert hatte. Oder aber – doch das war so absurd, dass es beinah paranoid klang –, oder aber die Stasi hatte sie im Blick gehabt und beobachtet, sie aber gewähren lassen, um zu schauen, ob sie irgendwann einen eigenen Staat im Staat, eine Sekte oder eine Kirche gegründet hätte, damit sie hätten zuschlagen können. Eines Tages würde Monika die Westdeutsche besuchen und ihr persönlich danken – und hoffentlich auch etwas so unglaublich Hilfreiches für sie tun können.
Buchhändlerin also, am liebsten in einer Buchhandlung, die eine Esoterikabteilung hatte. Davon gab es 1992 nur sehr wenige, und wenn sie sich dann auch noch als Ossi outete, verschlossen sich die Gesichter der Personalchefs. »Haben Sie denn Erfahrungen mit Westgeld und westlichem Klientel?«, fragten sie. Monika konnte nur verneinen, und damit war das Gespräch beendet. »Arrogante Schnösel«, fluchte sie regelmäßig, wenn sie mal wieder unverrichteter Dinge nach Hause fuhr.
Frank zahlte die Wohnung, das Essen, sogar die U-Bahn-Karte, das konnte doch wohl nicht wahr sein. In der DDR hatte sie einen Superjob gehabt, sie war angesehen gewesen und hatte nicht schlecht verdient, und jetzt stand sie auf der Straße. Doch die Fachbuchhandlung, für die sie tätig gewesen war, hatte aus finanziellen Gründen sehr schnell schließen müssen.
Seufzend betrat sie später ein schmuddeliges kleines Café in der Nähe des U-Bahnhofs Sophie-Charlotte-Platz. Auch heute hatte sie kein Glück gehabt. Sie befand sich mitten in Charlottenburg und hatte das Gefühl, in einem feindlichen Land zu sein. Sie bestellte einen Milchkaffee – und wenn sie noch so pleite war, das musste jetzt einfach sein. Sie musste ein wenig nachdenken, Zeit mit sich selbst verbringen. Denn sie brauchte einen neuen Plan. Entweder sie kam endlich runter von ihrem hohen Buchhändlerinnenross und ging putzen, oder sie musste die Sache ganz anders angehen.
Eine Frau betrat das Café und ging zielstrebig auf Monikas Tisch zu, dem einzigen Fensterplatz. Er lag in einer Nische und war wie geschaffen dafür, sich die Wunden zu lecken und eine Auszeit zu nehmen. Auf einmal stutzte sie und blieb unschlüssig stehen. Dann begann sie zu lachen. »Das ist verrückt. Ich komme jeden Tag hierher, und noch nie war dieser Tisch belegt, ich hätte mich fast auf Ihren Schoß gesetzt, weil ich Sie einfach nicht wahrgenommen habe. Gibt’s das.« Sie schickte sich an, einen der anderen, weitaus weniger gemütlichen Plätze auszuwählen.
»Setzen Sie sich doch zu mir!« Monika wunderte sich über sich selbst.
»Wirklich? Das ist nett. Ich heiße Sabine, mir gehört der Obst- und Gemüseladen gleich nebenan.« Damit zog sie ein Buch aus der Tasche und schlug es auf. »Ich brauche eine kurze Erholung von all dem Kundengequatsche, entschuldigen Sie bitte!«, sagte sie noch, dann spürte Monika förmlich, wie die Frau von der offensichtlich spannenden Geschichte ihres Buches aufgesogen wurde. Sie schielte auf das Cover: »Salz auf unserer Haut«, das Buch stand seit Monaten auf den Bestsellerlisten.
Sie trank einen Schluck ihres leider scheußlichen Kaffees und schaute aus dem Fenster. So ungenießbar der Kaffee auch sein mochte, die Aussicht in den Hinterhof war unbeschreiblich. Das musste das Paradies sein, dachte sie entzückt. Schaumig blühende Hortensien in Weiß, Rosa und Blau, prunkende Rosen und die schönsten Stockrosen, die sie je gesehen hatte, bildeten zusammen mit Unmengen von blühenden Kräutern einen so prachtvollen Bauerngarten, dass sie die Enge und die Schäbigkeit des Cafés völlig vergaß.
»Wundervoll, nicht wahr?« Sabine schaute auf. »Wenn ich genug Geld und Zeit hätte, würde ich dieses Café dazunehmen und ein wahres Schmuckstück daraus machen. Ich würde hier mein Gemüse kochen und Kurse für gesunde Ernährung geben. Im Hof könnte man Tische aufstellen und ein echtes Paradies erschaffen.«
Monika lachte auf. Das klang wie aus einem Roman, einem sehr vorhersehbaren. »Ich suche einen Job, ich bin Buchhändlerin«, sagte sie probehalber, vielleicht hatte das Universum ja ein kitschiges Schriftstellerhirn. Dann würde sie jetzt eine Erbschaft machen, sich wahnsinnig gut mit Sabine verstehen, die mit ihr zusammen ein unfassbar erfolgreiches Kochbuch schreiben würde, sie könnte dieses Café kaufen und den zauberhaften Hinterhof, in dem sich die schönsten Blüten der Sonne entgegenreckten, zu einem spirituellen Treffpunkt machen. Es gäbe gelaugte und geölte Holzmöbel – der gerade aufkommende Landhausstil traf genau ihren Geschmack –, Regale, in denen sich die besten Bücher stapelten, selbst gemachten Kuchen und von Hand aufgebrühten Kaffee und Tee. Sie würde neben den Büchern und vielleicht ein paar Edelsteinen auch schnuckelige Kleinigkeiten verkaufen, selbstverständlich von lokalen Künstlern, und den ganzen Tag mit den spannendsten Leuten verkehren. Sie selbst hätte ihren Stammplatz genau hier, und hier würde sie ihre Romane schreiben, wenn sie nicht gerade Unmengen von Geld verdiente oder tief greifende, einzigartig kluge Gespräche führte, während sie mit leichter Hand köstliche Kaffeespezialitäten servierte. Wenn sie Gott wäre, dann würde sie es genau so erschaffen.
Doch Gott kam leider nicht mit romantischen Flausen daher, und so sagte Sabine lachend: »Wenn du wüsstest, wie oft ich diesen Gesichtsausdruck schon selbst hatte. Das hier schreit doch geradezu nach einer Sanierung, wie zauberhaft könnte man dieses Café gestalten. Pink Hollyhock würde ich es nennen, das klingt echt witzig, finde ich, und heißt ›Rosa Stockrose‹. Wie die da draußen. Aber der Besitzer gibt es nicht her. Buchhändlerin, so? Aber die werden doch gesucht, oder?«
»Ja. Wessis. Entschuldige. Aber ich kann nicht mit westdeutschen Kunden und nicht mit D-Mark umgehen. Sieht man doch.« Monika trank ihren Kaffee aus. Sie legte zwei Mark fünfzig auf den Tisch und erhob sich. »Es war schön, dich kennenzulernen, ich wünsch dir heute noch sehr nette Kunden!«
»Moment mal.« Sabine hielt sie am Arm fest. »Du kommst von drüben?«
Monika schüttelte sie ab. Würde sie sich jetzt den westdeutschen Begrüßungstext anhören müssen, ein Loblied auf die friedliche Revolution und darüber, wie viel Glück sie doch alle gehabt hatten? Würde sie ihr einen Kaffee spendieren, als Willkommensgruß im Land der Schönen und Erfolgreichen? Oder ein Stück Bananentorte?
»Dann geht’s nämlich. Der Typ, dem dieses komische Café gehört, ist vor zwanzig Jahren geflüchtet und hat seine Familie in der DDR zurücklassen müssen, ganz nah an der Grenze zu Polen. Jetzt will er wieder zurück, weil er dort einen Hof hatte. Er will das Café abgeben, aber er misstraut allen Wessis. Im Stich lassen will er es aber auch nicht. Und so pendelt er jetzt hin und her. Verrückt, oder?«
Monika wurde auf der Stelle äußerst wachsam. Das klang völlig absurd. Kitschig. Beinah diskriminierend. Und unfassbar wundervoll. »Und was stellt er sich da so vor?«, fragte sie vorsichtig. Geld hatte sie ja immer noch keines.
»Johannes! Beweg deinen Arsch hierher, hier ist endlich ein Ossi, der dein Café haben will!« Sabine zwinkerte Monika zu, während sie in Richtung Theke schrie.
Ein älterer, müde aussehender Mann schlurfte auf sie zu. Er verkörperte genau die Energie dieses Cafés, dachte Monika beinah belustigt. Sie kam sich vor wie in einem Film, mal sehen, wie weit sie das Spielchen treiben konnten, bevor sie wieder in ihre enge Zweiraumwohnung im Osten der Stadt zurückkehrte.
»Warum?«, fragte Johannes und starrte Monika an. »Warum wollen Sie dieser dekadenten Leistungsgesellschaft Kaffee servieren? Warum kaufen Sie sich nicht ein paar schicke Klamotten im Westen und sehen zu, dass Sie nach Hause kommen, dahin, wo es echte Freundschaft und echten Zusammenhalt gibt?«
Monika schluckte. Da hatte wohl jemand einen Weichzeichner benutzt, auch wenn es sicher zum Teil stimmte. »Sie meinen Stasispitzel?«, wollte sie fragen, doch Sabine schnitt ihr das Wort ab.
»Jetzt hab dich nicht so, wir sind ganz nett, wenn man uns näher kennt. Monika will dein Café, mach mal ein Angebot.«
Jetzt wurde es Zeit, einzugreifen, dachte Monika, doch etwas schnürte ihr den Hals zu. Sag stopp, rief es in ihr, aber sie sah Johannes nur mit großen Augen an. Er nannte ihr eine lächerlich hohe Pachtsumme.
Sabine stupste sie an. »Nimm es, das ist geschenkt!«, flüsterte sie aufgeregt.
Monika, deren Miete im ehemaligen Osten gerade mal sechzig Mark betragen hatte, fand fünfhundert Mark Pacht pro Monat wirklich exorbitant, doch ihr war klar, dass hier andere finanzielle Sitten herrschten.
»Und wann wollen Sie hier raus?«, fragte Monika, als hätte sie den Vertrag bereits unterschrieben.
»So schnell wie möglich. Wissen Sie was? Sie denken ein bisschen darüber nach, und dann melden Sie sich, Sie wissen ja, wo ich bin.«
»Gehört denn der Hinterhof auch dazu?«, fragte Monika.
»Nein, natürlich nicht, sehe ich aus wie ein Gärtner?« Damit wandte er sich kopfschüttelnd ab und schlurfte zur Theke zurück.
»Dann ist das wohl gestorben, schade.« Erleichtert nahm Monika ihre Tasche und wollte sich gerade von Sabine verabschieden, als diese zu lachen begann. »Hey, wo willst du denn hin? Natürlich gehört der Hof nicht ihm. Das ist meiner. Der gehört zum Laden, ich hab aber keine Schankerlaubnis. Wir brauchen wirklich nur das Café.«
Monika schaute sie eine Weile prüfend an. »Was hältst du von Engeln?«, fragte sie dann nebenbei, so, als würde sie nur einen weiteren Kaffee bestellen. Was ganz sicher nicht passieren würde, die Kaffeesorte wäre das erste, was sie hier ändern würde.
»Nun, die wichtigere Frage ist doch, was die Engel von mir halten, oder?« Sabine lächelte und war auf einmal wunderschön.
Und plötzlich, als stünde sie neben sich, hörte Monika sich Ja sagen, sah sie sich einschlagen, als Johannes ihr die Hand hinstreckte – und fand sich im Hof wieder, mitten in den Blumen, wo sie in Freudentränen ausbrach.
Jede Menge Arbeit wartete auf sie, und sie hatte wirklich keine Idee, wie sie zu Geld kommen könnte, doch wenn sie etwas hatte, dachte sie, dann war es Durchhaltevermögen. Und sie war ja nicht allein, Sabine hatte längst einen Plan. Das alles war machbar, gar nicht so schwierig, sie brauchten nur Putzmittel, viele Eimer Farbe, ein paar Gartenmöbel und einige gute Ideen. Das Wichtigste hatten sie längst, Begeisterung und diese brennende Lust, etwas Neues zu beginnen. Und Johannes war so erpicht darauf, nach Hause zu kommen, dass er ihnen sogar anbot, das Ganze auf seinen Namen weiterlaufen zu lassen, bis sie sich etabliert hatten. Besser und einfacher ging es gar nicht.
»Ich muss heim, Liebe«, sagte Monika endlich. »Frank wartet auf mich, und ich kann ihn nicht erreichen. Ich komme morgen, dann besprechen wir alles.«
»Du hast was? Das ist ja super!« Frank nahm sie in die Arme und erdrückte sie fast. »Willkommen im vereinten Deutschland, meine schöne Unternehmerin!«
Monika sah ihn mit großen Augen an. Sollte er nicht ausrasten, ihr die Geschichte ausreden, tausend Gründe anführen, warum die Idee, ein Café im reichen, anspruchsvollen Westen zu eröffnen, einzigartig schwachsinnig war – oder den einen stichhaltigen, nämlich den, dass sie überhaupt kein Geld besaß und sowieso noch niemals selbstständig gearbeitet hatte?
»Ich kenn dich, meine Süße. Du brauchst einfach nur eine Aufgabe. Du hast unglaublich viel Kraft, du wusstest nur nicht, wohin damit. Du schaffst das, ich weiß es. Und ich bin ja auch noch da.«
Monika schwieg. Womit hatte sie nur diesen Mann verdient?
»Übrigens, da ist Post für dich.«
Monika öffnete den Umschlag mit der vertrauten Handschrift, schon lange hatte sie nichts mehr von ihrer so freundlichen westdeutschen Buchlieferantin gehört. Sie wohnte weit im Süden des Landes, so hatte Monika es noch nicht geschafft, sie zu besuchen und sich persönlich zu bedanken, doch sie dachte immer wieder voller Dankbarkeit an sie.
Liebe Monika,
ich bin für ein paar Tage endlich mal wieder geschäftlich in Berlin und habe deine Telefonnummer nicht – natürlich nicht, in der DDR war es nicht überall üblich, ein Telefon zu besitzen, und schon gar nicht für vertrauliche Gespräche in den oder aus dem Westen, denn es wurde sowieso abgehört –, würde dich aber sehr gern treffen. Ich wohne im Hotel Kempinski am Kurfürstendamm und freue mich sehr, wenn du mich dort anrufst, damit wir einen Zeitpunkt ausmachen können! Ich bin jeden Morgen bis halb elf beim Frühstück (die einzige Zeit, in der ich lesen kann …). Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen, und hoffe, du findest Zeit, mich zu besuchen,
viele liebe Grüße,
Suzanna
»Wow. Heute ist echt ein Glückstag. Stört es dich, wenn ich gleich hinfahre?«
»Nein, Schnecke. Ich muss eh zur Arbeit. Solange ich noch welche habe.«
»Wenn die Firma zumacht, darfst du bei mir putzen, Liebster. Oder für mich Gartenmöbel bauen. Die verkaufen wir dann in dem Paradiesgarten.« Monika küsste ihn zärtlich.
Frank arbeitete Schicht in einer großen, ehemals sehr angesehenen Tischlerei, doch täglich drohte sie pleite zu gehen. Sie hatten Büromöbel im großen Stil hergestellt, die Chefetagen der Parteigenossen in den Regierungsgebäuden ausgestattet, aber völlig veraltete Maschinen, Ideenlosigkeit und die Unfähigkeit des Chefs, sich auf die neuen Bedingungen einzustellen, ließen die Umsatzzahlen in den Keller rutschen. Am liebsten hätte Frank das ganze Ding gekauft und neu begonnen, doch woher sollte er das Geld nehmen?
Nun begann seine Monika also eine Westkarriere, er war unglaublich stolz auf sie. Zum Glück gab es diese Sabine, sie schien sich gut auszukennen. Und wie schnell all das vereinbart worden war! Es war wohl entschieden leichter, sich selbstständig zu machen, als er es befürchtet hatte. Und wenn Monika das schaffte, dann würde auch er einen Weg finden. Gartenmöbel. So verkehrt klang das gar nicht. Er hatte auch schon ein paar Ideen …
Monika machte sich erneut auf den Weg in den Westen der Stadt, stieg am Zoo aus und ging die Prachtstraße entlang. Entschlossen betrat sie das Nobelhotel und fragte nach Suzanna. Sie wollte ihr gerade einen Zettel schreiben und ihren Besuch für den folgenden Morgen um zehn Uhr ankündigen, als diese in die Hotellobby trat.
»Monika! Wie schön, dich zu sehen, ich freu mich wirklich sehr!« Suzanna nahm sie in die Arme, als wären sie beste Freundinnen.
»Ich kann dir nicht sagen, wie dankbar ich dir bin und wie unglaublich schön es ist, dass du hier bist!«, antwortete Monika.
Die beiden hielten sich an den Händen und sahen sich an. »Lass uns was trinken«, schlug Suzanna vor, »du bist natürlich mein Gast.«
Monika hatte wirklich kein Geld mehr, und schon gar nicht konnte sie sich die teuren Getränke dieses Hotels leisten, so ließ sie sich gern einladen. In der DDR hatte auch immer gerade der gezahlt, der Geld dabeihatte. Sie setzten sich, bestellten Tee und Kaffee.
»Und, wie ist es dir ergangen seit der Wende?«, fragte Suzanna. »Arbeitest du noch in der Buchhandlung? Dann hätte ich nämlich mal eine Frage.«
»Leider nicht.« Freimütig erzählte Monika ihr von ihrer gescheiterten Jobsuche, von Sabine und vom Pink Hollyhock. »Und du wirst es nicht fassen, gerade heute Morgen hat sich mein Schicksal gewendet. Jetzt brauch ich nur noch Geld, dann werden wir das Café renovieren und eine Art spirituellen Treffpunkt daraus machen, ich hoffe, dass ich dann auch endlich richtig zum Schreiben komme. Dann brauche ich einen Verlag, der mein Buch nimmt. Aber was machst du hier in Berlin?«