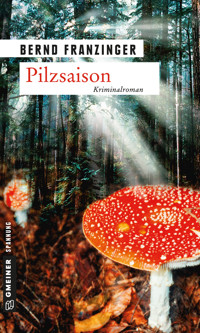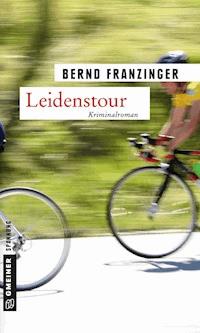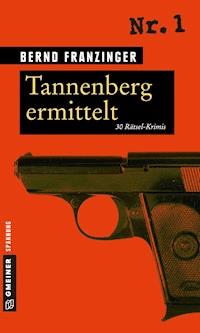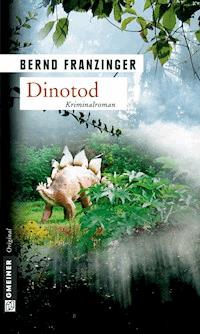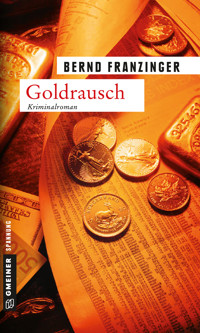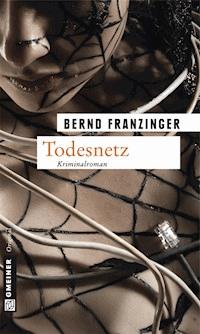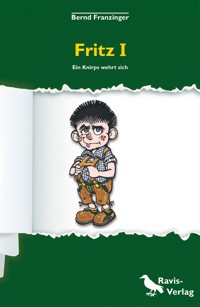
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Nachdem der Autor bereits mit 'NO auf Bildungsreise' eine satirische Kritik am Einheitsschulsystem präsentierte, feuert er nun erneut gegen die moderne Pädagogik … Friedrich Karl Eckstein, kurz Fritz, ist alles andere als ein gewöhnlicher Junge. Das deutet bereits sein Name zielsicher an. Einerseits klingen zwei veraltete Namen wie Friedrich und Karl für das moderne Ohr geradezu hochgestochen, konservativ, beinahe spießbürgerlich. Andererseits charakterisiert der Familienname Eckstein seinen Besitzer als unkonventionell, aufsässig, mit Ecken und Kanten. Ein gewollter Kontrast, der sich zu gleichen Teilen in Fritz' Persönlichkeit widerspiegelt. Er ist ein zeitweise kauziger Typ, der schon im Säuglingsalter gestelzt daherredet und die Erwachsenen in seinem Umfeld, die ihm eigentlich geistig überlegen sein sollten, ständig belehrt. Mit eben dieser Art eckt er an und wirkt wie die Ausnahme jeder Regel. Der Titel 'Ein Knirps wehrt sich' ist daher durchaus ernst zu nehmen. Der kleine Fritz sieht sich in eine Welt hineingeboren, in der alles und jeder durch pädagogische Maßnahmen geregelt wird. Er erkennt sich und seine Altersgenossen als Versuchskaninchen der Eltern, die einen Marathon um die bestmögliche Bildung und perfekte Erziehung ihrer Sprösslinge laufen – ohne Rücksicht auf deren Bedürfnisse. Der frühreife und spitzbübische Protagonist trotzt diesen Gegebenheiten. Schon bei seiner Geburt lehnt er sich gegen das System auf: Er schreit nicht – und zwar aus Prinzip. Stattdessen entwickelt er eine enorme frühkindliche Sprachkompetenz. Mit gerade mal einem Jahr frotzelt er widerspenstig gegen die Beleidigungen seiner Erzeuger und analysiert messerscharf die geistige Entwicklung seiner Altersgenossen. Kein Wunder also, dass Franzinger den Knirps nicht direkt nach dem ersten Buch beerdigen wollte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernd Franzinger
Fritz I
Ein Knirps wehrt sich
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ravis-verlag.de
© 2014 – Ravis-Verlag
Oberer Rossrück 24, 67661 Kaiserslautern
Tel.: 0 63 06 / 99 16 45
Fax: 0 63 06 / 99 16 44
Alle Rechte vorbehalten
E-Book-Ausgabe 2015
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht, Gmeiner-Verlag
Umschlaggestaltung: Matthias Schatz, Gmeiner-Verlag
unter Verwendung einer Karikatur von: © Günther Sterk
ISBN 978-3-9815857-3-5
Widmung
Für meine Enkel
Gedicht
Es war einmal ein kleiner Junge.
Er hieß Friedrich Karl Eckstein.
Fritz war anders als andere Kinder.
Ein eckiger Stein eben.
Und da ein eckiger Stein nicht schwimmen kann,
schwamm auch er nicht.
Vor allem nicht auf den Wellen des Zeitgeistes.
1. Kapitel
»Trofnih, ho Tiehleknud, ho Tiehleknud«, presste Friedrich Karl Eckstein mitten in einer Presswehe über die zahnlosen Kiefer.
Er war sehr ungehalten. Kein Wunder, denn es ging kaum voran. Wie ein Pfropfen steckte er im Geburtskanal fest. Bei jeder Wehe durchlitt er Höllenqualen. Und dazu auch noch diese unerträglichen, animalischen Laute seiner Mutter. Wo doch gerade er so sehr die Stille liebte. Wie gerne hätte er an die fleischigen Wände getrommelt. Aber er konnte noch nicht einmal eine Faust ballen, so eng war es in seinem Gefängnisschlauch.
Plötzlich spürte er einen kalten Gegenstand an seinem Kopf, dann ein lautes Knacken. Dieses Geräusch hatte er schon einmal gehört. Und zwar an Weihnachten, als Hubi einen Truthahn zerlegte.
Endlich gab der Muskelring über seiner Schädeldecke nach und das Köpfchen glitt hinaus ins Freie. Doch der Rest des Körpers blieb in der engen Höhle eingesperrt. Der kleine Fritz fühlte sich wie eine neugierige Schildkröte. Allerdings steckte sein faltiger Kopf nicht in einem Panzer, sondern im blutenden Schoß der Mutter.
Fritz schlug die Augen auf und schaute sich verwundert um.
»Riw nebeil neseid nenielk Mruw, re driw nedrew sersnu Snebel Mrut«, brabbelte er.
Wie oft hatte er diesen Spruch in den letzten Wochen gehört. Nun musste er ihn einfach zum Besten geben. Seine biologischen Erzeuger hatten dieses Mantra mehrmals täglich heruntergeleiert.
Zweck: Aufbau einer positiven Emotionalität.
Zielperson: Er, Friedrich Karl Eckstein, die ungeplante Leibesfrucht.
Diese Autosuggestion war auch bitter nötig gewesen. Denn je näher der Geburtstermin heranrückte, umso weniger euphorisch blickten Bea und Hubi ihrem Nachwuchs entgegen.
Von Gewissensbissen zermartert, hatten die beiden Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe aufgenommen. Dort erhielten sie den entscheidenden Tipp: Konsultation eines Psychotherapeuten, seines Zeichens ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der pränatalen Elternprogrammierung.
Fritz bekam bei diesen Sitzungen Kopfweh, der Therapeut einen dicken Geldbeutel.
Das als Gedankenstopp konzipierte Mantra fand stets dann seine litaneiartige Anwendung, wenn die beiden Zellenspender wieder einmal ein gemeinsames Klagelied anstimmten. Und das passierte recht häufig, um nicht zu sagen andauernd.
Die werdende Mutter jammerte oft und sorgte sich um vieles, auch um ihre knackige Figur.
Der werdende Vater dagegen trauerte eher still, vor allem um das schöne Cabrio.
»Haben Sie das eben gehört?«, stieß die feiste Hebamme aus.
Niemand reagierte, auch der Arzt nicht, der war mit seinen Gedanken schon auf dem Fußballplatz. Und die niederkommende Erstgebärende vernahm lediglich ihr eigenes, brunftähnliches Stöhnen.
Doch der kreidebleiche Mann neben ihr hatte kein offenes Ohr für diesen emphatischen Auswurf. Er saß auf einem Hocker und schnaufte synchron mit der Frau, mit der er zwar nicht verheiratet war, die er aber trotzdem als seine Frau bezeichnete.
Tapfer hatte er das solidarische Mithecheln in einem Geburtsvorbereitungskurs eingeübt. Aber nun geriet das rhythmische Schnauben aus dem Rhythmus und löste einen Sauerstoffüberschuss aus.
Dr. Hubert Wollenweber begann zu zittern, Gänsehaut spross auf seinem dichtbewaldeten Arm. Vor seinen zuckenden Augen baute sich eine riesige schwarze Wand auf. Sein Oberkörper neigte sich bedrohlich zur Seite.
Zu Hubis großem Glück schielte der Arzt. Denn so wurde er auf ihn aufmerksam, obwohl er eigentlich seinen Blick auf Fritz gerichtet hatte. Geistesgegenwärtig stürzte er sich auf den ohnmächtig werdenden, werdenden Vater. Er fing ihn noch rechtzeitig ab und schleppte ihn zu einer Liege.
»Herr, Herr Doktor, der, der Kleine hat eben etwas vor, vor sich hingestammelt«, stammelte die Hebamme.
Gemessenen Schrittes begab sich der Arzt zu der korpulenten Frau und legte ihr eine Hand auf die Schulter.
»Beruhigen Sie sich, meine Liebe. Mir scheint, Sie sind ein wenig überarbeitet«, säuselte er. Sanft tätschelte er die teigige Speckwulst in ihrem Nacken. »Schon die fünfte Geburt hintereinander. Und dann auch noch Zwillinge dabei. Da hört jeder irgendwann einmal Stimmen.«
Die Hebamme rieb ihre feuchte Stirn und schüttelte den Kopf. »Daran muss es wohl liegen, Herr Doktor. Das kann ja auch überhaupt nicht sein.«
Der Stationsarzt lachte auf. »So ist es, meine Liebe.«
Angesichts dieser offenkundigen Ignoranz seiner frühkindlichen Sprachkompetenz entschloss sich Friedrich Karl Eckstein dazu, fortan zu schweigen.
»Wie ich sehe, mag sich unser neuer Erdenbürger noch nicht so recht hinaus in die Freiheit wagen«, meinte der Arzt schmunzelnd. »Schon merkwürdig. Das hab ich wirklich noch nie erlebt: Das Köpfchen ist draußen …«
Er stockte, beugte sich hinunter zum Ohr der Hebamme und fuhr wispernd fort: »Aber trotz Dammschnitt geht es nicht weiter. Der Kleine hat anscheinend stocksteife Schultern – wie eine Vogelscheuche.«
Das war nun aber wirklich zu viel des Guten, fand jedenfalls der kleine Fritz und erbrach sich.
Es sollte nicht das letzte Mal in seinem Leben sein.
»Oh Gott, Herr Doktor, was ist denn das?«, keuchte die Hebamme. »Das sieht ja aus wie Kindspech.«
Der Gynäkologe setzte eine skeptische Miene auf. »Kindspech aus dem Mund?«, flüsterte er. »Unmöglich! Dieses Sputum kann kein Mekonium sein.«
Mutups? Muinokem? Ehetsrev niek Trow!, kommentierte Fritz tonlos. Anschließend drückte er mit der Zungenspitze den Rest der zähflüssigen schwarzen Masse über seine Lippen hinweg.
»Dies käme wohl einem anatomischen Wunder gleich«, erklärte der Arzt unterdessen. »Jedenfalls muss die Sache dringend diagnostisch abgeklärt werden.«
Ein weiterer Schnitt mit der Geflügelschere – und Friedrich Karl Eckstein flutschte hinaus in eine Welt, die noch sehr viel Freude an ihm haben sollte.
Nachdem Beatrice Eckstein den sperrigen Quälgeist nun endlich ausgespien hatte, verschwanden die verhärmten Züge aus ihrem Antlitz. Zum ersten Mal nach vielen Leidensmonaten feuerte sie sogar ein kleines Lächeln in Richtung ihres eingeborenen Sohnes ab. Sie hob ein wenig den Kopf, spähte durch ihre zum Victoryzeichen gespreizten Beine. Trotzdem konnte sie ihn nicht sehen.
Er sie auch nicht – was der frischgebackene Erdenbürger Friedrich Karl Eckstein nicht sonderlich bedauerte.
Hören konnte sie ihn ebenfalls nicht. Denn Fritz schrie nicht. Fritz schrie nie – aus Prinzip. Schreien verabscheute er zutiefst. Er empfand diese nervtötende Kräherei als primitiv, disziplinlos und vulgär. Deshalb verzichtete er gänzlich darauf.
Dann sollte der kleine Fritz abgenabelt werden.
Hubi war dazu nicht in der Lage, lag er doch regungslos auf der Liege.
Und Bea wollte nicht. Das sei ihr zu eklig, meinte sie angewidert.
Nun wurde es der Hebamme zu blöd. Sie nahm die Sache, besser gesagt die Schere, selbst in die Hand und kappte ritsch-ratsch die Versorgungsleitung. Anschließend packte sie Friedrich Karl Eckstein in eine kuschelweiche Decke und trug ihn weg.
Diese überhastete Maßnahme missfiel Fritz sehr, denn eigentlich wollte er sich noch in aller Ruhe von seiner Plazenta verabschieden. Schließlich hatte ihn der Mutterkuchen seiner Mutter monatelang ernährt. Er war ihm in dieser Zeit regelrecht ans Herz gewachsen.
Den obligaten Lungenfunktionstest bestand er auf Anhieb, weil er wie ein Miniaturwalross ein paarmal kräftig schnaubte. In Anbetracht dieser beeindruckenden Vorführung blieb er von weiteren Foltermaßnahmen verschont. Allerdings nicht lange, denn die moderne Postnataldiagnostik wetzte bereits ihre Messer – im übertragenen Sinne versteht sich.
Das Ultraschallgel war glibberig und kalt. So kalt, dass sich alles an und in ihm zusammenkrampfte. Aber Friedrich Karl Eckstein weinte nicht. Er presste die zahnlosen Kieferchen aufeinander und ließ die Tortur tapfer über sich ergehen.
Selbst als ihm ein verkleideter Vampir brutal in die winzige Ferse stach und mehrere Tropfen dringend benötigten Lebenssaftes herausquetschte, schrie er nicht. Obwohl er wirklich allen Grund dazu gehabt hätte.
Irgendwann brachte man ihn zurück in den Kreißsaal, in dem sich aber zum Glück keine Kreissägen befanden.
Seine Mutter war noch da. Von Plazenta und Kindsvater jedoch keine Spur. Ersteres bedauerte er.
Obwohl er dem akademischen Oberrat Dr. Hubert Wollenweber die Hälfte seiner genetischen Grundausstattung verdankte, hegte er ihm gegenüber ein recht angespanntes, um nicht zu sagen feindseliges Verhältnis. Denn auch er hatte nach ihm gestochen. Sogar häufig, beinahe täglich. Zwar nicht mit einer Kanüle, aber trotzdem hatte er dabei Todesängste ausgestanden.
Normalerweise konnte sich Fritz durch eine geschickte Körperdrehung vor diesen Attacken rechtzeitig in Sicherheit bringen. Nur ein einziges Mal hatte er so tief und fest geschlafen, dass er den Eindringling zu spät bemerkte.
Ohne jegliche Rücksicht hatte ihm dieser lustmolchige Kerl die Spitze seines langen Gummiknüppels in die Fontanelle hineingerammt, obwohl dies anatomisch angeblich gar nicht möglich war. Aber Hubi hatte es irgendwie geschafft. Damals war in Friedrich Karl Ecksteins Kopf einiges durcheinandergeraten. Seitdem dachte und sprach er die Worte rückwärts.
Zumeist war der werdenden Mutter das forsche Drängen des werdenden Vaters unangenehm gewesen. Doch dieser triebgesteuerte Wüstling hatte es immer wieder geschafft. Bis zuletzt. Selbst gestern noch.
»Das Tier in mir, es lechzt nach dir«, hatte er mit lüsterner Stimme geraunzt. Und das mehrmals hintereinander!
Bea zierte sich nur kurz, dann gewährte sie ihm Einlass. Auf Friedrichs Bedürfnisse nahm niemand Rücksicht. Er wurde heftig durchgeschüttelt – und dann auch noch diese tierischen Geräusche. Wie gerne hätte er zugebissen.
Als die ekstatischen Leibesübungen endlich beendet waren, tastete die werdende Mutter den prallen Bauch ab und forschte nach einem Lebenszeichen ihrer Leibesfrucht. Aus Wut über diesen barbarischen Akt bewegte sich Friedrich Karl Eckstein keinen Millimeter mehr.
Aber nur so lange, bis Beas Herz losraste. Dann sandte er Klopfzeichen und planschte ein bisschen im Wasser herum. Schließlich wollte er jegliche Panik vermeiden.
Aus gutem Grund, denn seine Mutter war psychisch nicht sonderlich belastbar. Das hatte er in den letzten Monaten oft genug mitbekommen. Während der gesamten Schwangerschaft war sie in psychotherapeutischer Behandlung. Und Fritz war stets dabei, obwohl er das gar nicht wollte. Aber danach hatte keiner gefragt.
Offensichtlich wurde er der Hebamme lästig, denn sie legte ihn auf dem schwabbeligen Bauch der Mutter ab. Fritz öffnete die Augen. Was er sah, begeisterte ihn nicht sonderlich. Also schlug er die Lider wieder nieder. Trotzdem begann er zu schmatzen. Denn er hatte Hunger, Bärenhunger.
Beatrice Eckstein jedoch machte keinerlei Anstalten, sein dringliches Bedürfnis zu stillen. Statt ihres Klinikleibchens schob sie ihren Sohn beiseite.
»Seine spitzen Knochen drücken mir ganz doll in den Bauch«, klagte sie mit Blick auf Fritzchens stocksteife Schultern. Danach begann sie zu jammern. Und zwar eine ganze Weile.
Die Hebamme konnte dieses Drama nicht länger mitansehen und erlöste die Wehleidige, indem sie den Neugeborenen auf den Arm nahm – im ursprünglichen Wortsinne.
Nun lag Fritz nur wenige Zentimeter von ihrer Achselhöhlenkloake entfernt. Ein unerträglicher Schweißgeruch kroch ihm in die Nase und setzte sich wie eine modrige Klette darin fest. Der Gestank war kaum zu ertragen.
Notgedrungen stellte Friedrich Karl Eckstein auf Mundatmung um. Am liebsten wäre er in einen Bottich mit warmem Fruchtwasser gesprungen und nie mehr aufgetaucht. Auch wünschte er sich sehnlichst seine Plazenta herbei. Doch die blieb weiterhin verschollen.
Anstelle des Mutterkuchens kehrte der Vater zurück.
Sogleich wollte die Hebamme Fritz an den fast zwei Meter großen Samenspender weiterreichen. Aber der zeigte ihr abwehrend die Handflächen und tönte:
»Nein, nein, das lassen wir mal lieber bleiben. Ich hab Angst, dass ich ihm wehtun könnte. Der sieht so mickrig aus. Und dann diese abartigen Schultern.« Der frischgebackene Spätvater bedachte den Arzt mit einem fragenden Blick. »Das ist doch nicht normal, oder?«
Friedrich Karl Eckstein hatte genau hingehört. Zur Strafe übergab er sich – mitten hinein in Hubert Wollenwebers fliederfarbenes Seidenhemd.
In Hubis Gesicht frästen sich tiefe Gräben der Abscheu. »Igitt, was ist denn das für ein ekliges Zeug?«, spuckte er angewidert aus.
Der Medizinmann klatschte sich an die Stirn »Ach, das hätte ich ja fast vergessen«, erklärte er. »Bei der Ultraschalluntersuchung haben wir eine ungewöhnliche Ausstülpung entdeckt. Quasi so etwas wie einen Appendix, allerdings an der falschen Stelle.«
Xidneppa? Saw tsi sad?, fragte sich der kleine Fritz.
Anscheinend konnte dieser Arzt nicht nur Geflügelscheren bedienen, sondern auch Gedanken erraten, denn er übersetzte sogleich: »Ein Wurmfortsatz – zwischen Magen und Zwölffingerdarm. Allerdings können wir noch nicht mit Bestimmtheit sagen, ob diese ungewöhnliche Anomalie«, er stockte, schürzte angewidert die Lippen und zeigte auf Huberts besudeltes Hemd, »für die Produktion dieser merkwürdigen Substanz verantwortlich ist.«
Mit einem verstohlenen Blick taxierte Fritz die beiden Männer. Auch sie begutachteten ihn, allerdings wie einen Aussätzigen. Aber das war ihm zu diesem Zeitpunkt ziemlich egal. Es gab etwas viel Wichtigeres für ihn: Er hatte nämlich noch immer nichts zu essen bekommen. Demonstrativ begann er zu schmatzen, und zwar so laut es ging.
Die Hebamme reagierte postwendend. »Wollen Sie Ihren Kleinen denn nicht endlich stillen?«, forderte sie mit Nachdruck. Offensichtlich hatte sich gerade ihr Mutterinstinkt zu Wort gemeldet.
Ganz im Gegensatz zu seiner eigenen Mutter, die nicht reagierte, nur weiter vor sich hin wimmerte. Während der gesamten Schwangerschaft war sie nie in einen Brutrausch verfallen, nicht eine einzige Sekunde lang.
»Geben Sie ihm jetzt endlich die Brust!«, befahl die korpulente Frau.
Beas Kinnlade fiel herunter. Aus Schock vergaß sie sogar einen Moment lang ihre postnatale Depression. »Stillen? Oh nein, mein schöner Busen.«
»Oh nein, ihr schöner, schöner Busen!«, pflichtete der akademische Oberrat Dr. Hubert Wollenweber eiligst bei, um die Katastrophe noch zu verhindern.
Kopfschüttelnd stürmte die Hebamme aus dem Kreißsaal. Kurz darauf kehrte sie mit einem Plastikfläschchen zurück. Ohne Vorwarnung drückte sie dem kleinen Fritz den Latexsauger zwischen die Lippen.
Reflexartig saugte er daran, schließlich hatte er noch immer einen Bärenhunger. Aber der Geschmack war so widerlich, dass er die Kunstnahrung umgehend wie mit einem Wasserzerstäuber aussprühte – direkt auf die Brillen der beiden Fleischbeschauer.
Der anschließende Kampf um die Mutterbrust währte den gesamten restlichen Tag. Friedrich Karl Eckstein obsiegte.
Es war nicht der letzte Sieg in seinem Leben.
Fritz verstand nicht, weshalb seine Mutter unbedingt im Krankenhaus bleiben wollte. Er jedenfalls hatte die Nase gestrichen voll. Dieses öde Zimmer, dieses ständige Wehklagen – und diese fette Hebamme, die immer so grob an ihm herumhantierte.
Vor allem, wenn er nackend war.
Einmal wurde es ihm zu bunt und er schoss ihr einen gelben Strahl ins Gesicht.
Während Bea am liebsten nie mehr aus ihrem Bett gekrochen wäre, wollte er so schnell wie möglich weg von hier. Er war unheimlich gespannt auf sein neues Zuhause – das ja zugleich sein altes war. Denn gelebt hatte er dort ja bereits mehrere Monate, aber gesehen hatte er es noch nicht. Genauso wenig, wie er darin herumgeschnüffelt hatte, worauf er sich besonders freute.
Doch Beatrice Eckstein weigerte sich. Obwohl sie maßgeblich dafür verantwortlich war, musste er als Begründung herhalten. Zuerst waren es weitere diagnostische Maßnahmen, mit denen man ihn drangsalierte.
Und dann begann ihre linke Brustwarze zu bluten.
Einfach so!
Das beeinträchtigte seine materielle Grundversorgung. Aus Wut darüber bekam er Gelbsucht. Ihm gefiel die neue Hautfarbe. Den Ärzten dagegen weniger.
Die Probleme mit seiner dauerpiensenden Nahrungsquelle verschärften sich. Bea begann sofort zu weinen, wenn sie Friedrich Karl Eckstein erblickte. Deshalb musste er unzählige Stunden in einem Säuglingsgefängnis verbringen.
In diesem Wartesaal des Lebens standen viele Babyställe herum. Manche waren sogar verglast und sahen aus wie Aquarien. Wasser war aber keins darin. Was Fritz zutiefst bedauerte. Denn seine Altersgenossen schrien, was das Zeug hielt. Warum, wusste er nicht. Aber der Lärm störte ihn gewaltig.
Nur im benachbarten Gitterkäfig war es still. Der darin eingesperrte Kollege trug ein roséfarbenes Armbändchen am rechten Arm, einen linken hatte er nicht. Er glotzte zu ihm herüber. Aber dieses Glotzen war anders, irgendwie unsymmetrisch. Der kleine Fritz schloss die Augen, er mochte keine Gaffer.
Beatrice Eckstein bekam Antidepressiva verabreicht. Die Medikamente schlugen an. Das freute die Ärzte, Fritzchen dagegen weniger. Denn das Psycho-Doping wirkte auf seine Mutter wie ein Regenguss auf verdörrtes Brachland.
Bei ihr sprossen allerdings keine Blumen, sondern Affenliebe. Und das mit all ihren lästigen Begleiterscheinungen: Urplötzlich fummelte sie überall an ihm herum, streichelte ihn, roch an ihm, küsste ihn. Einmal leckte sie ihn sogar am Arm. Da musste sich der kleine Fritz übergeben.
Die unerwünschten Liebkosungen hatten aber auch ihr Gutes: Sie verschafften Fritz endlich die Möglichkeit, seine Mutter einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Zum ersten Mal übrigens.
Denn vor Einnahme der Psychopharmaka hatte sie ihm beim Stillen stets eine Stoffwindel über den Kopf gelegt. Warum sie ihm den Blickkontakt verweigerte, wusste er nicht. Aber es hatte ihn auch nicht sonderlich gestört. Vielmehr empfand er das gedämpfte Licht und die Geborgenheit unter dem weichen Baldachin als ausgesprochen angenehm.
Nun war das Tuch weg. Dafür waren jetzt zwei riesengroße Rehaugen da, die ihn verzückt begafften. Fritz hatte Angst, in den samtbraunen Bambi-Moloch hineingezogen zu werden. Deshalb schloss er die Augen.
Er öffnete sie erst wieder, als er im Auto saß. Auf der Rückbank versteht sich, denn er hatte ja noch keinen Führerschein. Er lag in einer nagelneuen BSS, einer Baby-Safety-Schale.
Der akademische Oberrat Dr. Hubert Wollenweber hatte fast eine Stunde benötigt, um sie einzubauen. Das Handwerkliche war nicht so sein Ding. Er dachte lieber nach – und zwar über alles Mögliche.
Vor allem über die Möglichkeit, sich so oft wie möglich seinen väterlichen Pflichten zu entziehen.
Seit dem PISA-Schock suchte Hubi mit Inbrunst nach Konzepten, mit denen man die angebliche deutsche Bildungsmisere kurieren konnte. Und dazu musste man sich im Ausland umschauen, einen mutigen Blick über den eigenen Tellerrand werfen – wie er immer wieder mit erregter Stimme in seinen Seminaren betonte.
»Wir werden Hilfe in Finnland finden«, fand er.
Ja, Hubi war oft erregt. Nicht nur im Kopf, nein, auch dort, wo sein Gummiknüppel die meiste Zeit des Tages wie ein schlaffer Gartenschlauch herumbaumelte. Und nicht nur zu Hause, nein, auch an der Universität. Besonders im Sommer, wenn er von den leichtgeschürzten Studentinnen magisch angezogen wurde. Ach, welch ein Schlaraffenland!
Aber zurück zu seinem eingeborenen Sohn: Wie ein zusammengekrümmter Wurm kauerte der kleine Fritz neben seiner Mutter und spähte durch die Kopfstützen. Retreisarnu Legelf, dachte er, als er den Mehrtagesbart seines Zellenspenders entdeckte.
»Wie geht es dir, mein Schatz?«, flötete Hubi mit brünftigem Unterton.
»Gut«, hauchte Bea. Dabei lächelte sie wie ein bekifftes Honigkuchenpferd in den Rückspiegel.
»Ich hab für uns beide heute Abend einen Tisch bei Franco bestellt«, verkündete Hubi strahlend.
»Fein. Das ist eine ganz tolle Idee«, lobte Beatrice Eckstein. Doch plötzlich schürzte sie die Lippen und wies mit sorgenvoller Miene auf Fritz. »Aber, was ist mit ihm?«
»Kein Problem, der stört uns nicht. Ich hab deine Eltern angerufen. Sie kümmern sich um den kleinen Balg.«
»Sprich nicht so abschätzig über ihn«, maßregelte Bea. »Fritzchen ist schließlich auch dein Kind.«
»Ja, sicher, mein Schatz, entschuldige«, zog Hubi den Schwanz ein. »Wir kriegen das mit ihm schon irgendwie gebacken.«
Entsetzt riss Fritz die Augen auf, denn gebacken wollte er nun wirklich nicht werden.
»Hoffentlich«, seufzte Beatrice Eckstein unterdessen. »Vielleicht hätte ich damals doch besser den kleinen Eingriff machen lassen sollen.«
»Ach, was«, bemerkte Hubi mit einer wegwerfenden Handbewegung. »Dafür ist es eh zu spät. Ist auch besser so, sonst müssten wir jetzt mit einem schicken Cabrio durch die Gegend fahren und die Osterferien in Sri Lanka verbringen.« Diese Worte schmeckten bitterer als die dunkelste Schokolade, die er jemals gegessen hatte.
Bea wischte sich eine Träne von der Wange.
Wem sie diese Träne nachweinte, war Fritz nicht so ganz klar.
»Da müssen wir jetzt wohl durch, mein Schatz. Schließlich sind wir beide gleichermaßen für diese fleischgewordene biologische Eskalation verantwortlich.«
»Du aber bedeutend mehr als ich«, meinte Bea vorwurfsvoll. »Wer von uns kann sich denn nie beherrschen?« Sie spitzte die Lippen. »Vor allem, wenn er zu viel Rotwein getrunken hat. Und das ist ja leider meistens so.«
»Von wegen, meine Liebe«, höhnte er. »Wenn ich dich an unseren letzten Toskanaurlaub erinnern dürfte. Da hast du nachweislich mehr gebechert als ich.« Hubi seufzte tief. »Aber es stimmt ja, was du sagst, Bea-Schatz. Nur kann ich leider nichts dagegen tun. Es ist dieser fürchterliche Furor, der allzeit in mir wütet. Mutter Natur hat es mir wirklich nicht leicht gemacht, als sie mich mit diesem unbändigen Fortpflanzungstrieb geknechtet hat.«
»Ach, du mein armer, armer Hubi«, säuselte Bea und warf ihm einen lasziven Blick zu.
»Wenn du willst, könnten wir ihn zur Adoption freigeben«, sagte Dr. Hubert Wollenweber. Seine Stimme war kalt wie ein eisiger Nordwind.
Fritz jagten Frostschauer den Rücken hinunter.
»Was?«, zischte Bea mit entgeisterter Miene.
»War nur ein kleiner Scherz am Rande«, ließ Hubi umgehend die Luft aus seinem Versuchsballon entweichen.
Für derart makabere Scherze war Fritz ganz und gar nicht zu begeistern, ging es doch um nichts Geringeres als um seine Zukunft. Und da verstand er nun mal absolut keinen Spaß. Schließlich hatte er sich viel vorgenommen für sein Leben. Er wollte einiges erreichen, wollte berühmt und vor allem steinreich werden.
Nach alldem, was er durch die Bauchdecke vernommen hatte, schienen die Voraussetzungen dafür durchaus gegeben zu sein. Zumindest, was die bildungsnahen, akademischen Sozialisationsbedingungen betraf, in die ihn die unergründlichen Mächte des Schicksals hineingeworfen hatten – dankenswerterweise.
Die Tatsache, dass er kein Wunschkind war, ignorierte er großzügig. Fritz war froh, überhaupt das Licht der Welt erblickt zu haben. Zudem: Was nutzte es einem, wenn man von einer prekariären Patchwork-Family wegen der pekuniären staatlichen Transferleistungen zwar geplant worden war, man dafür aber in einem bildungsfernen Elternhaus aufwachsen musste? Wo blieben denn da die intellektuellen Anregungen? Wo die maßgeschneiderten Fördermaßnahmen? Und wo die Karrierechancen?
Dann doch lieber bildungsnah-ungeplant!
Friedrich Karl Eckstein hatte großes Glück, denn seine Eltern waren ausgewiesene Bildungsexperten. Sie beschäftigten sich sogar hauptberuflich mit der Erziehung und Bildung von Menschen. Zwar nur theoretisch, aber immerhin! Bea schrieb Elternratgeber, und der akademische Oberrat Dr. Hubert Wollenweber arbeitete am Lehrstuhl für innovative Erziehungswissenschaft an der Münchner Universität.
Kigogadäp – eid Sisab red Noitasiliviz!, rief sich Friedrich Karl Eckstein einen Spruch seiner Eltern ins Gedächtnis. Er hatte ihn jeden Morgen gehört. Ob er nun gewollt hatte oder nicht. Immer beim Frühstück. Seine Chromosomenspender hatten sich an den Händen gefasst und im Chor diese rituellen Worte in den neuen Tag gehaucht. Immer genau fünfmal hintereinander.
Den mehrgeschossigen Neubau hatte man mitten in die Innenstadt hineingepfropft, exakt dort, wo früher das alte Theater stand. Das klotzige Gebäude war trist und kalt, dafür aber konnte es mit einer Tiefgarage aufwarten – und mit einem Aufzug! Was Fritz egal war, den Babysherpas dagegen nicht.
Gleich nachdem sich die Lifttür mit einem schmatzenden Geräusch geschlossen hatte, begann auch Hubi zu schmatzen. In der Wohnung schmatzte er weiter. Ob aus Lust auf ein Stück Fleisch oder aus Fleischeslust vermochte der kleine Fritz zunächst nicht einzuschätzen.
Hubi stellte die Baby-Safety-Schale im Flur ab, direkt neben den Schirmständer. Fritz tat so, als ob er schlief. Dem war aber nicht so.
Während der akademische Oberrat Dr. Hubert Wollenweber stöhnte und grunzte, schnupperte der kleine Fritz. Es roch moderig. Der üble Geruch strömte ihm aus Hubis Halbschuhen entgegen. Voller Abscheu stieß Fritz Luft durch die Nase und drehte den Kopf zur Seite – doch da stand der Eimer mit Biomüll.
Irgendwann kehrte Bea zu ihm zurück. Sie war puterrot und sah ziemlich zerrupft aus. Fritz wurde auf den Küchentisch gehievt. Dort roch es nach Hundefutter. Obwohl es hier überhaupt keinen Hund gab. Denn das hätte er in den letzten Monaten ja wohl mitbekommen müssen.
Oder vielleicht war es auch Katzenfutter? Das wiederum hätte Sinn gemacht, denn eine Katze wohnte hier. Jedenfalls hatte sie hier gewohnt, als er hier als Untermieter seiner Mutter gewohnt hatte.
»Ow tsi eid Eztak?«, brabbelte er vor sich hin.
»Was hast du eben gesagt?«, fragte Bea.
»Ich habe nichts gesagt«, versicherte Hubi.
»Doch, natürlich hast du eben etwas gesagt«, beharrte Bea.
»Und was soll ich gesagt haben?«, fragte Hubi.
»Ich habe nicht verstanden, was du eben gesagt hast.«
»Klar, weil ich nichts gesagt habe.«
Bea fing an zu weinen. »Warum sagst du mir nicht, was du eben gesagt hast?«, jammerte sie.
»Ich habe nichts gesagt, mein Schatz«, stellte Dr. Hubert Wollenweber unmissverständlich klar. Er klatschte in die Hände. Und zwar so unvermittelt und laut, dass Fritz wie vom Blitz getroffen zusammenfuhr.
Sein Oberkörper schnellte nach vorne. Er glitt aus der Baby-Safety-Schale, die allerdings zu diesem Zeitpunkt keine Baby-Safety-Schale mehr war. Wie auch, denn Hubi hatte vorhin den Sicherheitsgurt geöffnet – und nicht wieder verschlossen!
Kopfüber rutschte Friedrich Karl Eckstein über die Tischkante hinweg und stürzte mit den geöffneten Fontanellen voran auf einen ungepolsterten Küchenstuhl. Der Rest seines Leibes folgte den Fontanellen wie ein nasser Sack.
Er weinte nicht. Sie schon – und wie! Obwohl sein Kopf schmerzte, nicht ihrer!
Er bewegte sich auch nicht. Sie schon – wie ein aufgescheuchtes Huhn.
»Bitte, lieber Herrgott, lass ihn nicht sterben«, schrie Bea wie von Sinnen.
Was für ein Unsinn, kommentierte der kleine Fritz tonlos, denn das hatte er nun wirklich nicht vor. Demonstrativ schlug er die Augen auf. Glotz nicht so blöd, schimpfte er, als er das bleiche Gesicht des Gummiknüppelträgers über sich auftauchen sah.
Schlagartig wurde ihm bewusst, dass dieser Sturz etwas ausgesprochen Positives bewirkt hatte: In seinem Kopf war nun wieder alles in Ordnung, und er musste fortan nicht mehr rückwärts denken und sprechen.
»Er lebt!«, stieß Bea erleichtert aus. »Wir müssen ihn sofort zum Arzt bringen.«
Das wollte Fritz unbedingt vermeiden, deshalb strampelte er, was das Zeug hielt. Zudem riss er die Ärmchen hoch und quiekte dazu wie ein Ferkel.
»Quatsch«, meinte Hubi. »Den Sprit können wir uns sparen. Der ist doch quietschfidel. Das sieht doch jeder Blinde.«
Diesen Satz verstand Fritz nicht.
»Vielleicht hat er innere Verletzungen«, setzte Bea nach.
»Mach dir keine Gedanken, mein Schatz, Babys passiert bei solchen Stürzen nie etwas«, behauptete Hubert, der Theoretiker.
Und wenn doch?, dachte Fritz, dem sein triebgesteuerter Erzeuger immer suspekter wurde. Mit funkelnden Augen blickte er ihn an.
Genau in diesem Augenblick läutete es an der Tür. Paula und Karl, beide mit Nachnamen Eckstein, schneiten in die Wohnung herein, und das, obwohl der Winter schon längst vorüber war.
Karl und Paula waren seine Großeltern, mütterlicherseits. Sonst hatte er keine. Denn Hubis Eltern hatten sich bereits vor vielen Jahren bei einer Wüstenexpedition aus dem Staub gemacht.
»Mama, Mama, Fritzchen ist vom Tisch gefallen«, rief Bea und fiel ihrer Mutter schluchzend in die Arme.
»Ist er verletzt?«, fragte Paula Eckstein mit sorgenvoller Miene.
»Nein – ähm, ich weiß nicht.«
»Wie, du weißt nicht? Hast du ihn denn noch nicht untersucht?«
»Nein, Mama. Hubi meint, es sei alles in Ordnung.«
»Na, wenn Hubi meint.« Paulas spöttischer Unterton war nicht zu überhören.
»Per Ferndiagnose, oder wie?«, knurrte es hinter Paulas Rücken.
Fritz wusste, dass diese Laute nicht von einem Hund stammen konnten, denn Hunde konnten ja nicht sprechen. Aber Menschen konnten knurren. Und das tat Opa Karl oft. Vor allem, wenn Hubi in der Nähe war. Denn er mochte Hubi nicht leiden. Und das war Fritz ausgesprochen sympathisch.
Außerdem war er quasi hautnah mit seinem Opa verbunden, schließlich hatte er von ihm seinen zweiten Vornamen erhalten. Gott sei Dank! Sonst würde er nur Friedrich Eckstein heißen. Und das klang ja bei weitem nicht so aristokratisch wie Friedrich Karl Eckstein, nicht wahr?
Opa Karl führte einen Katzenkorb mit sich, den er nun auf dem Küchentisch abstellte. Fritz beobachtete ihn dabei. Hinter dem Metallgitter blitzten zwei gelbe Augen, und aus dem Maul des Ungeheuers fauchte es ihm bedrohlich entgegen.
Vielleicht ist dieses blöde Tier ja eifersüchtig auf mich, dachte der kleine Fritz, der sich eigentlich tierisch auf die Katze gefreut hatte. Oder es hat Angst, dass ich ihm seine Premium-Thunfisch-Häppchen wegesse. Nee, nee, Fisch erinnert mich zu sehr an Hubi.
Oma Paula befreite ihren einzigen Enkel von Strampelanzug und Windel. Anschließend tastete sie ihn vorsichtig ab. Überall. Und das kitzelte – und wie! Fritz konnte diesen taktilen Overkill kaum ertragen. Er krümmte sich und gluckste. Und das alles unter den Augen dieses bösartigen Stubentigers.
Mit dem ist garantiert nicht gut Kirschen essen, sagte Fritz zu sich selbst, obwohl er noch nie Kirschen gegessen hatte. Diese Redewendung hatte er schon oft gehört. Sie gehörte zu Hubis rhetorischem Standardrepertoire.
Wegen dieser Kirschen ist es an der Zeit, rechtzeitig ein abschreckendes Exempel zu statuieren, entschied Friedrich Karl Eckstein. Als Oma Paula ihn auf den Bauch drehte, spie er dem schwarzen Monster einen Schwall Kindspech ins Gesicht. Die Katze schrie Zeter und Mordio. Dabei sollte sie durch diese Aktion gar nicht ermordet werden – noch nicht.
Die Katze war eigentlich ein Kater und hieß Rousseau. Ein komischer Name für eine Katze, fand Fritz, obwohl er strenggenommen nur eine einzige Katze kannte, eben Rousseau. Rousseau war fett und verfressen – und litt unter Depressionen. Manchmal stierte er stundenlang in ein und dieselbe Ecke. Darunter litt Bea beträchtlich.
»Jetzt kotzt dieser Kerl schon wieder«, zeterte Hubi. »Das lasse ich mir nicht weiter bieten. Der muss dringend operiert werden.«
»Aber die Ärzte haben von einer Operation abgeraten, weil sie viel zu gefährlich sei«, wandte Bea ein.
»Quatsch«, zischte Dr. Hubert Wollenweber. »Die sollen mal nicht so’n Gedöns machen. Der übersteht diesen Eingriff garantiert. Der ist zäh wie Leder.«
Diesen Satz verstand der kleine Fritz nicht.
Hubi polterte weiter. »Was für eine Granatensauerei! Mein armer, armer Rousseau.«
»Jetzt reiß dich aber mal zusammen«, donnerte eine tiefe Stimme zurück. »Fritzchen hat das garantiert nicht mit Absicht getan.«
Darin irrte Opa Karl.
Während sich Bea und Hubi liebevoll um Rousseau kümmerten, drehte Paula ihren Enkel wieder auf dem Rücken. Fritz nahm nun seine Großeltern mütterlicherseits etwas genauer unter die Lupe.
Beide hatten Haare auf dem Kopf, Opa Karl jedoch nur an den Seiten. Auf seiner endlosen Stirn spiegelte sich die Deckenlampe. Oma Paulas dichtes graues Haar verschluckte dagegen das Licht. Sie hatte eine kleine Brille, aber eine große Nase. Ihr Mann hatte eine große Nase und eine große Brille – und große Ohren, fast wie Rhabarberblätter. Die beiden sahen ziemlich verwelkt aus und rochen nach ranziger Butter.
Sie sind viel älter als Bea und Hubi, stellte Fritz in Gedanken fest. Aber Opa Karl ist Beas Vater. Um Bea zu machen, muss er mit Oma Paula das Gleiche gemacht haben, das Hubi andauernd mit Bea macht. Damals. Aber heute machen die das bestimmt nicht mehr. Das kann ich mir nun beim besten Willen nicht vorstellen. Er musterte noch einmal seine Großeltern.
Nein, nein, wirklich nicht.
In den ersten drei Lebensmonaten ließ Bea ihrem Sohn lediglich die notwendige materielle Grundversorgung zuteilwerden. Zum einen, weil sich nach dem völligen Ausbleiben jeglicher Schwangerschafts-Brutlaune auch kein postnataler Nestrausch einstellen wollte.
Und zum anderen, weil sie schlicht und ergreifend keine Zeit hatte, sich intensiver um das eigene Gelege zu kümmern. Der Verlag kannte kein Erbarmen und beharrte eisern auf dem vertraglich festgelegten Abgabetermin, an dem sie das Manuskript ihres neuen Elternratgebers vorlegen musste. Es trug den Titel ›Baby-Turbo-Tuning – maximale Förderung bei minimalem Aufwand‹.
Obwohl Friedrich Karl Eckstein nie schrie und deshalb als ausgesprochen pflegeleichtes Baby zu bezeichnen war, wurde er trotzdem fast täglich zu Beas Eltern abgeschoben.
»Wenn er da ist, kann ich mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren«, argumentierte seine Mutter.
Der kleine Fritz trug ihr dies nicht weiter nach. Er vermisste sie nicht, Hubi ebenfalls nicht – und Rousseau sowieso nicht. Diesem heimtückischen Stubentiger traute er nämlich nicht über den Weg.
Aus gutem Grund, denn eines Morgens, als er im Flur auf Oma Paula wartete, sprang das haarige Monster auf ihn und erstickte ihn fast mit seinem schweren, massigen Körper. Einfach so, mir nichts, dir nichts. Heimtückische Bestie!
Was tun, was tun?, pochte es unter Friedrich Karl Ecksteins Schädeldecke.