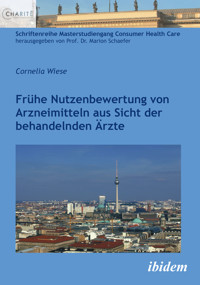
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Schriftenreihe Masterstudiengang Consumer Health Care
- Sprache: Deutsch
Die frühe Nutzenbewertung von Arzneimitteln nach § 35a SGB V ist seit 2011 für die pharmazeutische Industrie und die gesetzlichen Krankenkassen in deren täglichen Arbeit nicht mehr wegzudenken. Doch wie steht es mit den behandelnden niedergelassenen Ärzten, die sich – neben der Umsetzung der zahlreichen gesetzlichen Änderungen der letzten Jahre – auch noch mit den Ergebnissen der frühen Nutzenbewertung auseinandersetzen müssen? Cornelia Wiese legt mit ihrer Studie einen ersten Überblick über das Hintergrundwissen und die Erfahrungen der Ärzte zur frühen Nutzenbewertung vor. Ihr Buch liefert wertvolle Ansatzpunkte, um die in der Studie gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis zu übertragen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 86
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhlatsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Zusammenfassung
1. Einleitung
2. Ziel- und Aufgabenstellung
3 Material und Methode
Fragebogen zur Masterarbeit „Die frühe Nutzenbewertung aus der Sicht der Ärzte“
4. Darstellung der Ergebnisse
4.1 Antwortverteilung der Befragung
4.2 Testung der Hypothesen
4.2.1 Generelle Hypothesen
4.2.2 Hypothesen zum Wissensstand der Ärzte
4.2.3 Hypothesen zur Einstellung der Ärzte
4.2.4 Hypothese zur Clusterbildung
5. Diskussion der Ergebnisse
5.1 Fragen im Zusammenhang mit den Ergebnissen
5.2 Sicherheit bei der Verordnung
5.3 Clusterung von Ärzten nach ihrer Einstellung zur FNB
5.4 Kritische Auseinandersetzung mit dem Studiendesign
6. Schlussfolgerungen
Anhang
Literaturverzeichnis
Schriftenreihe Masterstudiengang Consumer Health Care
Impressum
Cornelia Wiese
FRÜHE NUTZENBEWERTUNG VON ARZNEIMITTELN AUS SICHT DER BEHANDELNDEN ÄRZTE
Abkürzungsverzeichnis
AM Arzneimittel
AMNOG Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes
AMNutzenVO Arzneimittelnutzenverordnung
API Allgemeinmediziner, Praktiker und Internisten
BÄK Bundesärztekammer
BMG Bundesministerium für Gesundheit
bspw. beispielsweise
bzgl. bezüglich
FNB frühe Nutzenbewertung
G-BA Gemeinsamer Bundesausschuss
ggf. gegebenenfalls
ggü. gegenüber
GKV Gesetzliche Krankenversicherung
IQWiG Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
KBV Kassenärztliche Bundesvereinigung
KV Kassenärztliche Vereinigung
LÄK Landesärztekammer
MVZ Medizinisches Versorgungszentrum
SGB V Sozialgesetzbuch Fünftes Buch
u.a. unter anderem
u.ä. und ähnlichen
u.U. unter Umständen
v.a. vor allem
vgl. vergleiche
z.B. zum Beispiel
Abstract
Since 2011 the practice of the early benefit assessment of pharmaceuticals is a fixed part of the German health care system. Influencing not only pharmaceutical companies, as well as health insurances but also registered doctors. While guidelines and attitudes are explicitly regulated (by law) for health insurances and pharmaceutical companies, there is a variety of insecurities on the practitioner’s side. Furthermore practitioners often display a lack of knowledge regarding the procedure.
This study provides a first overview of the practitioner’s perspective and background knowledge regarding the early benefit assessment.
The study’s most important outcomes in summary: •
• 70% of the interviewed practitioners (n=100) stated to have benefited by the early benefit assessment
• According to practitioners, patients also benefited by the early benefit assessment but to a lesser extent
• Interviewees who have benefited from the early benefit assessment display a rather positive attitude towards it
• All in all it can be differentiated between 5 clusters of practitioner types, varying in their opinion about the early benefit assessment and having gained different experiences
• Many practitioners are not aware of subcategory analysis or do not use it
• for the majority of practitioners the safety in regards to their therapy decision and to stay within the budget is an important perceived advantage of the early benefit assessment
In summary there is a lot of potential regarding the knowledge transfer and optimisation of the early benefit assessment for the practitioners based on the available study. Especially referring to the available time of the practitioners to deal with this circumstance. Therefore the effectively incoming and perceived bureaucracy costs should be held as small as possible.
Zusammenfassung
Das Verfahren der frühen Nutzenbewertung (FNB) von Arzneimitteln ist seit 2011 fester Bestandteil des deutschen Gesundheitswesens: Die FNB beeinflusst neben den pharmazeutischen Unternehmen sowie den gesetzlichen Krankenkassen auch die vertragsärztlich tätige Ärzteschaft. Während die (gesetzlichen) Vorgaben und Verhaltensweisen für die Pharmaindustrie und die GKV klar geregelt sind, gibt es auf Seiten der Ärzte eine Vielzahl von Unsicherheiten. Darüber hinaus gibt es bei den Ärzten oft auch unzureichende Kenntnisse über das Verfahren. Diese Studie liefert einen ersten Überblick über die Sichtweise und das Hintergrundwissen der Ärzte zur FNB. Es wird gezeigt, wie die Ärzte zum Verfahren stehen. Ebenso werden die Zusammenhänge zwischen dem Wissen der Ärzte und ihrer alltäglichen Arbeit erläutert und Schlussfolgerungen daraus gezogen.
Die wichtigsten Ergebnisse der Studie lassen sich wie folgt zusammenfassen:
• 70% der befragten Ärzte (n=100) haben ihrer Ansicht nach von der FNB profitiert.
• Patienten profitieren nach ihrer Meinung ebenfalls von der FNB, aber in geringerem Maße.
• Die befragten Ärzte, die bereits von der FNB profitiert haben, haben auch eine positive Meinung dazu.
• Insgesamt können fünf Cluster von Ärztetypen unterschieden werden, die unterschiedliche Auffassungen zur FNB haben und auch verschiedene Erfahrungen gesammelt haben.
• Vielen Ärzten sind Subgruppenanalysen nicht bekannt oder sie nutzen sie nicht.
• Für die Mehrzahl der Ärzte ist die Sicherheit bei der Therapieentscheidung bzw. Budgetschonung ein wichtiger wahrgenommener Vorteil aus der FNB.
Zusammenfassend gibt es auf Grundlage der vorliegenden Studie noch viel Potenzial bzgl. der Wissensvermittlung und -optimierung über die FNB von Arzneimitteln bei den Ärzten. Gerade auch in Bezug auf die dem niedergelassenen Arzt zur Verfügung stehenden Zeit sich mit diesem Sachverhalt zu beschäftigen. Deshalb sollte auch hier der tatsächlich anfallende und wahrgenommene Bürokratieaufwand für den Arzt so gering wie möglich gehalten werden.
1. Einleitung
Infolge des medizinischen Fortschritts hat das deutsche Gesundheitssystem seit Jahren mit steigenden Kosten bei den Arzneimittelausgaben zu kämpfen. In den letzten Jahrzehnten wurden deshalb eine Vielzahl von Steuerungsinstrumenten und Rahmenbedingungen für die Arzneimittelversorgung in der GKV geschaffen. Hierbei ging es vorrangig um eine Regulierung der Arzneimittelverordnungen bezüglich Preis und Menge sowie der Verordnungsstruktur. Seit 2011 gilt für neu zugelassene Arzneimittel das so genannte Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes (AMNOG). Grundlegendes Ziel des AMNOG ist die Eindämmung von Arzneimittelkosten in der gesetzlichen Krankenversicherung. Dieses Ziel gilt insbesondere für neue Arzneimittel, da deren Ausgabenanstieg durch die freie Preisfestsetzung der Hersteller bis dato am höchsten ausfiel (Vgl. Internetseite BMG, Glossar AMNOG, 2015). Konkretisiert ergeben sich daraus die drei Kernpunkte:
1. „Den Menschen müssen im Krankheitsfall die besten und wirksamsten Arzneimittel zur Verfügung stehen.
2. Die Preise und Verordnungen von Arzneimitteln müssen wirtschaftlich und kosteneffizient sein.
3. Es müssen verlässliche Rahmenbedingungen für Innovationen, die Versorgung der Versicherten und die Sicherung von Arbeitsplätzen geschaffen werden.“ (May/Bauer 2011, S. 4)
Hiermit wird der Sinn und Zweck des AMNOG einerseits an den § 12 SGB V (Wirtschaftlichkeitsgebot) geknüpft und andererseits der konträre normativ-moralische Anspruch nach bestmöglicher Patientenversorgung gestellt. Aufgrund der generalistischen Zielformulierung ergeben sich zum einen für den Gesetzgeber, in diesem Fall das BMG und dessen ausführende Organe, Spielräume bei der Gesetzesauslegung im Einzelfall und zum anderen Unsicherheiten auf Seiten der praktizierenden Ärzteschaft. Letztere können sich sowohl auf die Frage nach der besten und wirksamsten Therapie, als auch auf die grundsätzliche Definition von „bester Therapie“ sowie „Kosteneffizienz/Wirtschaftlichkeit“ und deren Vereinbarkeit miteinander beziehen.Mand spricht in diesem Zusammenhang auch von „einem zunehmenden Spannungsverhältnis mit komplexen wechselseitigen Interdependenzen [… und daraus] resultieren[den] Entscheidungskonflikte[n] für Ärzte“ (Mand 2012, S. 106f). Der Arzt trägt neben der medizinischen Verantwortung für den Patienten auch die finanzielle Verantwortung gegenüber den Kostenträgern. Dieses Spannungsverhältnis kann bis heute durch keine Gesetzesanpassung aufgelöst werden.
Auf Seiten der Hersteller ergeben sich Fragen hinsichtlich verlässlicher Rahmenbedingungen und der Interpretation von „verlässlich“ selbst. Beispielsweise ist das Beratungsgespräch zwischen G-BA und Hersteller zur zweckmäßigen Vergleichstherapie1 für die spätere Nutzenbewertung nicht notwendiger Weise verbindlich (Vgl. Burgardt 2012, S. 17). In der Konsequenz besitzt die genannte Zielkonkretisierung eine eingeschränkte Aussagekraft zugunsten des Gesetzgebers. Daraus resultieren Unklarheiten für die praktische Anwendung des Gesetzes auf Seiten der anderen Akteure. Hinzu kommt, dass das AMNOG nicht nur an einer Stelle im Gesetz verankert ist. Es stellt ein Geflecht aus verschiedenen Paragraphen in unterschiedlichen Gesetzestexten dar (u.a. SGB V, AMNutzenVO, G-BA-Verfahrensordnung). Dies erschwert die Übersichtlichkeit, Nachvollziehbarkeit und Eindeutigkeit bei den Anwendern.
Im Rahmen des AMNOG müssen die Hersteller innovativer Arzneimittel seit 2011 mit der Markteinführung auch einen Nachweis über den Zusatznutzen ihres neuen Präparates - im Vergleich zur zweckmäßigen Vergleichstherapie - für die Patienten vorlegen (Vgl. Internetseite BMG, Glossar AMNOG, 2015). Diese so genannte „frühe Nutzenbewertung“, ist im § 35a SGB V näher beschrieben und gesetzlich festgelegt. Sie gilt für „erstattungsfähige[…] Arzneimittel[…] mit neuen Wirkstoffen“ (§ 35a Abs. 1 Satz 1 SGB V) und umfasst dabei sowohl „die Bewertung des Zusatznutzens gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie, [als auch] d[a]s Ausmaß[…] des Zusatznutzens und seine[…] therapeutische[…] Bedeutung“(§ 35a Abs. 1 Satz 1 SGB V). Die FNB kann vom G-BA selbst oder vom IQWiG bzw. Dritten durchgeführt werden (Vgl. § 35a Abs. 2 SGB V).
Das IQWiG muss drei Monate nach Inverkehrbringen des neuen Medikamentes seine Nutzenbewertung abgeschlossen und im Internet veröffentlicht haben. Gleichzeitig hat der Hersteller sein Nutzendossier ebenfalls öffentlich vorzulegen (Vgl. Burgardt 2012, S. 41). Die medizinischen Fachkreise können nach § 19 Abs. 3 VerfO (des G-BA) den anschließenden G-BA-Beschluss im Vorfeld in Form von Stellungnahmen zur Nutzenbewertungsempfehlung des IQWiG/Dritten mit beeinflussen. Am Ende obliegt es allerdings allein dem G-BA zu entscheiden, inwiefern ein neues Arzneimittel einen Zusatznutzen besitzt oder nicht (Vgl. Internetseite BMG, Glossar AMNOG, 2015). An dieser Stelle kann der Meinung von Burgardt gefolgt werden, dass aufgrund der Fülle an zu bearbeitenden Informationen und der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit (3-Wochen-Frist für die Stellungnahme) eine Beteiligung der Ärzte (medizinischen Fachkreisen) am Verfahren der Nutzenbewertung unrealistisch erscheint (Vgl. Burgardt 2012, S. 42).
Laut BMG sollen mit Hilfe des AMNOG und der damit verbundenen FNB ca. 2 Mrd. Euro im Jahr an Einsparungen bei den Arzneimittelausgaben der GKV erzielt werden. Dafür verhandeln der Hersteller und die GKV innerhalb des ersten Jahres nach der Markteinführung gemeinsam einen Erstattungsbetrag für das neue Arzneimittel aus (Vgl. Internetseite BMG, Glossar AMNOG, 2015). Dies erfolgt auf Grundlage des zugesprochenen Zusatznutzens. Eine erste Verordnungs- und Kostensteuerung erfolgt jedoch u.U. nach § 92 SGB V bereits ein halbes Jahr nach Markteinführung (Zeitpunkt des G-BA-Beschlusses), und zwar wenn der G-BA infolge der Nutzenbewertung eine Verordnungsbeschränkung in Form von Therapiehinweisen (z.B. Qualifikation des Arztes, zu behandelnde Patientengruppen) oder Verordnungsquoten für das neue Arzneimittel vorschreibt (Vgl. Burgardt 2012, S. 47). Es bleibt festzuhalten, dass der G-BA-Beschluss zur Nutzenbewertung für Vertragsärzte nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V verbindlich ist (Vgl. Scriba 2012, S. 38).
Abb. 1: AMNOG-Prozess, Quelle: GKV-Spitzenverband 2015
In der Literatur gibt es bisher nur eine theoretische Auseinandersetzung mit der FNB und deren möglichen Auswirkungen auf die Ärzteschaft. Aus diesem Grund wird in der folgenden Studie geklärt, welchen praktischen Einfluss die mit dem AMNOG einhergehende FNB für die Ärzteschaft hat. Des Weiteren soll geklärt werden, inwieweit das Verfahren knapp vier Jahre nach dessen Einführung der Ärzteschaft überhaupt bekannt ist und ob und bzw. wie es in der täglichen Arbeit von den Ärzten wahrgenommen und umgesetzt wird.
1Wird nach „internationalen Standards der evidenzbasierten Medizin“ bestimmt und muss die „dem allgemein anerkannten Stand der med. Erkenntnis zweckmäßige Therapie im Anwendungsgebiet sein“. (§ 6 Abs. 1 und 2 AM-NutzenV)
2. Ziel- und Aufgabenstellung





























