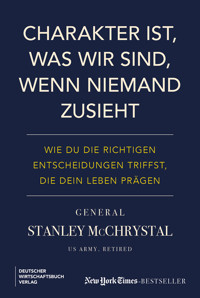2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Als ehemaliger General und Kommandeur der Afghanistantruppen kennt sich Stanley McChrystal bestens mit Führung aus. Er zeigt, dass Führung nicht das ist, was man gemeinhin denkt – das es das auch nie war! Führung ist dann herausragend, wenn sie einen unkonventionellen Weg einschlägt. 13 bekannte Führungspersönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen und Epochen belegen dies in seinem Buch: Walt Disney und Coco Chanel erschufen beide auf ihre Weise Unternehmensimperien. Margaret Thatcher gelangte an die Spitze von Großbritannien und die Geistlichen Martin Luther und sein Namensvetter Martin Luther King jr. führten beide zu ihrer Zeit weltverändernde Bewegungen an. Anhand der einzigartigen Erfolgsgeschichten räumt der Autor mit gängigen Mythen auf und zeigt, was gute Führung in der Praxis tatsächlich ausmacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 817
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
1. Auflage 2019
© 2019 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
© der Originalausgabe 2018 by McChrystal Group LLC
Die englische Originalausgabe erschien 2018 bei Portfolio, einem Imprint der Penguin Publishing Group, einer Abteilung von Penguin Random House LLC unter dem Titel Leaders: Myth and Reality.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Almuth Braun, Ammersee
Redaktion: Bärbel Knill, Landsberg am Lech
Umschlaggestaltung: Sonja Vallant, München
Umschlagabbildung: shutterstock_124443730
Satz und E-Book: Daniel Förster, Belgern
ISBN Print 978-3-86881-756-0
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96267-134-1
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96267-135-8
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.redline-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Für John Lewis und John McCain, die uns daran erinnern, dass es möglich ist, couragiert und engagiert zu führen und dabei menschlich zu bleiben.
Inhalt
Vorwort
Der Mythos
»The Marble Man«: Robert E. Lee
Die Gründer
Walt Disney
Coco Chanel
Unternehmertum und Egoismus
Die Genies
Albert Einstein
Leonard Bernstein
Das Genie von nebenan
Die Fanatiker
Maximilien de Robespierre
Abu Mussab Al-Sarkawi
Die Verführungskraft fanatischer Überzeugungen
Die Helden
Zheng He
Versklavung
Harriet Tubman
Menschen brauchen Helden
Die Machtmenschen
William Magear »Boss« Tweed
Margaret Thatcher
Die Hallen der Macht
Die Reformatoren
Martin Luther
Dr. Martin Luther King Jr.
Minenarbeiter, Mönche und Minister
Drei Mythen
Eine Neudefinition von Führung
Nachwort
Dank
Vorwort
And when our work is done,
Our course on earth is run,
May it be said, »Well Done«
Be thou at peace.
Aus der West-Point-Hymne »Alma Mater«
Das Buch ist nur 35 Zentimeter lang und 20 Zentimeter breit und hat einen zerschlissenen orangefarbenen Leineneinband. Einige Seiten fehlen, aber nachdem es über zwei Generationen hinweg tüchtig strapaziert wurde, ist es in auffallend gutem Zustand. Ich kann mich glücklich schätzen.
Das abgegriffene Kinderbuch Greek Tales for Tiny Tots1 wurde 1929 ursprünglich in Chattanooga, Tennessee für ein junges Mädchen namens Mary gekauft, die es hütete wie einen Schatz. Ende der 1950er-Jahre las mir Mary, inzwischen meine Mutter, daraus vor. Ich wiederum las meinem Sohn daraus vor, und vor Kurzem warf meine älteste Enkeltochter, Emmylou, ihren ersten Blick auf die vergilbten Seiten.
Dieses Büchlein liegt mir sehr am Herzen. Mit seinen schlichten Zeichnungen und kurzen Texten erzählt es die Geschichten griechischer und römischer Helden: Theseus, Herkules, Odysseus, Ariadne und anderer, die mit der Natur, dem Schicksal und manchmal miteinander rangen. Natürlich waren es Sagen aus der Mythologie, aber die Erzählungen von Menschen, die mit ihrem Heldentum, ihrer Vision oder Genialität, oft gepaart mit unerschütterlicher Beharrlichkeit, aufregende Abenteuer bewältigten, beeindruckten mich tief.
Als ich alt genug war, um längere Bücher zu lesen, gab mir meine Mutter Bücher über Roland, Julius Cäsar, William Wallace und Robin Hood. In der Bibliothek meiner Grundschule fand ich Biografien, die für junge Leser geschrieben waren, und ich erinnere mich, dass ich in der zweiten Klasse im Rechenunterricht von meinem Lehrer dabei erwischt wurde, wie ich ein Buch über John Paul Jones las. Ich war viel zu sehr in die Geschichte vertieft, um so zu tun, als würde ich aufpassen. Später im Leben bekam ich ein Schachspiel geschenkt, das die Inschrift trug: »Die Bauern sind die Seele des Schachspiels.« Für mich als Junge schien Geschichte jedoch ein Spiel zu sein, in dem die Anführer König, Dame, Turm, Läufer und Springer waren, deren Macht, Status und Bedeutung in krassem Gegensatz zu den niederen Bauern stand.
Meine ersten Lektionen in Führung stammten nicht aus der Geschichte der Antike. Mein Vater war Soldat, und ich war zehn, als er seinen ersten Einsatz in Vietnam hatte. Auch wenn ich noch sehr jung war, las ich viel, um das geopolitische Labyrinth zu verstehen, in das sich mein Vater und mein Land begeben hatten. Und so betrachtete ich die Ereignisse in erster Linie als Handlungen von militärischen und politischen Führungsfiguren, die erfolgreiche Helden sein würden, falls das Schicksal kooperierte. Das tat es nicht, aber mein Glaube war dennoch ungebrochen.
»West Point«, wie die United States Military Academy im Volksmund genannt wird, wurde 1802 an einer malerischen Krümmung des Hudson River gegründet. Während des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges war es die wichtigste strategische Stellung, da es den Briten den Zugang zu den lebenswichtigen Wasserwegen nördlich von New York City versperrte. Im Juli 1942 trat mein Vater, der selbst Sohn eines Berufssoldaten war, ins Kadettenkorps von West Point ein, und dreißig Jahre später trat ich in seine Fußstapfen.
Die Academy erinnert Besucher daran, dass »ein Großteil der Geschichte, die wir lehren, von Führungspersönlichkeiten geschrieben wurde, die wir selbst ausgebildet haben«. Heute beansprucht sie, die wichtigste Rolle in Amerikas Vergangenheit zu spielen, und noch immer bringt sie die militärischen Führer der Zukunft hervor. West Points Mission besteht unter anderem darin, »das Kadettenkorps mit dem Ziel auszubilden, zu schulen und zu inspirieren, dass jeder Absolvent ein prädestinierter Führer von großem charakterlichem Format ist«.
Was die Erfahrung der zukünftigen Soldaten prägt, ist jedoch nicht das Leitbild von West Point. Vom ersten Tag an werden die Erwartungen, die Kadetten an sich selbst und an ihre Führer stellen, von der ständigen, intensiven und physisch präsenten Erinnerung an vergangene Führungspersönlichkeiten geprägt. Die in traditionellem Grau uniformierten Kadetten bewegen sich zwischen Ikonen, die einst die gleiche Uniform trugen. Ich lebte in Pershing Barracks, benannt nach dem Offizier, der die Amerikanischen Expeditionsstreitkräfte (American Expeditionary Forces, AEF) im Ersten Weltkrieg nach Frankreich geführt hatte. Immer wenn ich zum Unterricht in die Thayer Hall ging – benannt nach dem Offizier, der den Kurs der Academy in ihren Anfängen bestimmte – kam ich an einer Bronzestatue von George Patton, dem angriffslustigen General aus dem Zweiten Weltkrieg vorbei. Bei jeder Mahlzeit blickten die Porträts berühmter Offiziere auf uns herab – eine ständige Mahnung und Erinnerung, dass West Points Daseinszweck darin bestand, uns zu Führungspersönlichkeiten zu formen.
Gleichzeitig wurden wir aber auch daran erinnert, dass es nicht um uns selbst ging. Wir wurden ausgebildet und geformt, um der Nation zu dienen und die »Long Gray Line« von West Point – so werden die Ehemaligen bezeichnet, die ihr Leben der Academy und den Idealen der Nation verschrieben haben – fortzuführen.
Wir wurden über die Überzeugungen und Verhaltensweisen herausragender Militärführer unterrichtet, und zwar nicht von Theoretikern, sondern zum größten Teil von jungen Offizieren, die erst kurz zuvor von den Schlachtfeldern Südostasiens zurückgekehrt waren. Wir saugten ihre Erzählungen über die Kampfhandlungen auf wie ein Schwamm und beneideten sie um ihre Leistungen. Wir bewunderten ihre Integrität, ihren Mut und ihr Pflichtgefühl, und wir richteten unser Denken, unser Verhalten, unsere Ausdrucksweise und unser Auftreten danach aus. Indem wir das taten, so sagte man uns, würden aus uns vielleicht keine berühmten Führungspersönlichkeiten, aber gute Soldaten – und das glaubten wir auch. Wir selbst vermuteten, wenngleich darüber nie offen gesprochen wurde, dass einige von uns wahrscheinlich einmal die Geschichte schreiben würden, die zukünftige Kadetten später in West Point studieren würden.
Kurz nach meinem Abschluss wurde mir die erste Führungsaufgabe übertragen: Als Zugführer war ich in den 1970er-Jahren für 20 Fallschirmjäger verantwortlich. Zwar hatte die Armee als Institution nach dem Vietnamkrieg einige Probleme, aber die Mehrheit der Soldaten verrichtete ihre Arbeit wie die Generationen vor ihnen mit stoischem Gleichmut. Und wie Generationen von Militärführern vor mir erklomm ich die Karriereleiter vom Captain (Kommando über 150 Mann) über den Bataillonskommandeur (Kommando über 600 Mann) und Regimentskommandeur (rund 2.200 Mann) bis zum General.
An diesem Punkt führte mich meine Erfahrung auf ein Gebiet, das ich nicht in West Point studiert hatte. In der vom 11. September geprägten Atmosphäre verbrachte ich fast fünf Jahre im Irak und in Afghanistan als Kommandeur des Joint Special Operations Command (JSOC) – einer speziellen Task Force, die sich aus den besten Eliteeinheiten der Nation zusammensetzt. Im Alter von über 50 Jahren, geprägt von den Führungsmodellen vergangener Zeiten, war das für mich eine große Herausforderung. Ich stellte fest, dass das Kommando in einem technologiebestimmten militärischen Konflikt nicht nur traditionelle Kompetenzen, sondern auch Intuition und Anpassungsfähigkeit erforderte.
Während meines ganzen Berufslebens als Militärführer habe ich immer viel gelesen. Ich hatte eine ausgeprägte Vorliebe für Geschichte und las viele Biografien, zum Beispiel von George Washington und George Marshall, sowie die Memoiren von Ulysses S. Grant. Gelegentlich schafften es auch Romane auf meinen Nachttisch, allerdings hatten sie oft einen historischen und militärischen Hintergrund. Ich erinnere mich, dass ich von The Killer Angels fasziniert war, in dem der Autor Michael Shaara mir das Gefühl gab, ein Vertrauter der allseits bekannten Kommandeure der Schlacht von Gettysburg zu sein.
Zwar las ich sehr gerne über Geschichte und Militärführer, aber als ich älter wurde, stellte ich fest, dass die Führungskonzepte, die ich übernommen hatte, ohne sie zu hinterfragen, immer stärker den Erfahrungen widersprachen, die andere gemacht hatten und von denen ich gelesen hatte, und außerdem standen sie auch im krassen Gegensatz zu meinen eigenen Erfahrungen.
Der großbürgerliche Kriegsheld Robert E. Lee unterlag dabei dem unscheinbaren »Sam« Grant.2 Thomas Jeffersons inspirierende Ideen standen in krassem Gegensatz zu seiner Eigenschaft als Sklavenhalter. Und die neuen Erkenntnisse über die erfolgreiche Dechiffrierung des Enigma-Codes durch die Alliierten machen deutlich, dass die Siege, die einst einer überlegenen militärischen Kampfstrategie zugeschrieben wurden, in Wahrheit das Ergebnis einer Kombination aus anderen Faktoren waren.
Ich stellte fest, dass Militärführer, die all die »richtigen« Führungseigenschaften aufwiesen, oft versagten, wohingegen andere, die keine der traditionellen Führungseigenschaften besaßen, erfolgreich waren. Die Qualitäten, die wir in Führern suchten und feierten, hatten irritierend wenig mit den Ergebnissen zu tun, die sie erzielten. Der Begriff der Führungskompetenz schien zunehmend zum Mythos zu werden, und zwischen den traditionellen Konzepten und den tatsächlichen Erfahrungen tat sich eine riesige Kluft auf.
Im Herbst 2010 wurde dieser Führungsmythos für mich sehr persönlich. Zusammen mit Sam Ayres, einem frisch gebackenen Yale-Absolventen, der später in die Armee eintreten und als Sergeant im 75th Ranger Regiment3 dienen sollte, machte ich mich daran, meine Memoiren zu schreiben. Da ich weder Aufzeichnungen gemacht noch Tagebuch geführt hatte (um keine als geheim eingestuften Informationen aufzubewahren), musste ich bei null anfangen und Jahrzehnte meines Lebens chronologisch ordnen.
Das war ein Prozess von unschätzbarem Wert und eine Lektion in Demut. Während wir meine Lebensereignisse rekonstruierten und analysierten, entdeckten wir, dass selbst die Dinge, an die ich mich genau erinnern konnte, historisch betrachtet oft verblüffend unvollständig waren. Oft war mir überhaupt nicht bewusst, welche Handlungen, Entscheidungen und Dramen tatsächlich das Endergebnis einer Situation bestimmt hatten. Erfolge, die ich meinen Entscheidungen zugeschrieben hatte, schienen plötzlich weit weniger beeindruckend, als mir klar wurde, dass unzählige Faktoren und Akteure an der Situation beteiligt waren, die oft viel mehr mit dem Ergebnis zu tun hatten als ich. Daraufhin begann ich mich von der Vorstellung zu verabschieden, dass meine Memoiren eine Geschichte erzählen würden, in der ich die zentrale Figur war. Ich war für den Verlauf der Ereignisse zwar wichtig, aber nicht in dem Ausmaß, wie ich gedacht hatte. Das war der letzte Anstoß, durch den ich mir eingestehen musste, dass meine führerzentrierte Weltsicht im Lauf des Lebens zunehmend mit unbequemen Fragen in Konflikt geraten war.
***
Im Jahr 2013 hielt der Autor und Journalist David Brooks einen Vortrag in Yale mit dem Titel »Über wen würde Plutarch heute schreiben?« Die Lebensbilder (Bíoi parálleloi)4 des griechischen Schriftstellers der Antike Plutarch (um 45 bis ca. 125 n. Chr.), in denen er 48 Persönlichkeiten der Antike porträtierte, gehörten bis vor gar nicht langer Zeit noch zur Standardlektüre kultivierter Leser. Der Verweis auf Plutarch mag heutigen Lesern, die nicht mehr mit ihm vertraut sind, angeberisch oder überheblich vorkommen, aber Brooks Frage, über welche Führungspersönlichkeiten Plutarch heute schreiben würde, war faszinierend und beschäftigte mich sehr.
Man könnte seine Frage auch anders formulieren, nämlich: »Was macht heute echte Führung aus?« Führer werden ständig unter die Lupe genommen und analysiert, doch vor lauter Verblendung durch die Mythen über das, was traditionell als gute Führung galt, entgeht uns dabei oft die Realität. Zwar wissen wir intuitiv, dass Führung in der modernen Welt unerlässlich ist, aber wir wissen nicht genau, was gute Führung ausmacht.
Im Jahr 1905 definierte Albert Einstein das Verhältnis neu, in dem Zeit, Raum und Bewegung zueinanderstehen. Er widerlegte das Newton’sche Konzept von der Absolutheit von Zeit und Raum, allerdings war seine Spezielle Relativitätstheorie unvollkommen, weil sie die Beschleunigung nicht berücksichtigte. In den folgenden zehn Jahren grübelte Einstein so lange über dieses Problem, bis er schließlich seine Allgemeine Relativitätstheorie veröffentlichte, die die Realität unseres Universums vollständiger abbildet.
Es gibt keine Entsprechung zur Allgemeinen Relativitätstheorie, die sich auf das Thema Führung anwenden ließe – das heißt, eine Theorie, die umfassend und korrekt vorhersagt, welche Führungsqualitäten und -strategien zum Erfolg führen. Ein solches Modell haben wir noch nicht, und es würde den Rahmen dieses Buches auch sprengen, aber ein Schritt in diese Richtung ist möglich. Der erste Schritt besteht darin, zu lernen, an welchen Punkten sich die Kluft zwischen Realität und Mythos auftut.
Als Autoren haben wir uns an dieses Vorhaben mit der Erfahrung und der Neugier der Praktiker gewagt, die wissen, dass ein tieferes Verständnis möglich ist. Jeder von uns hat seine Karriere beim Militär begonnen. Jason Mangone hält einen Abschluss vom Boston College und diente als Infanterieoffizier des Marinekorps der Vereinigten Staaten im Irak, bevor er die Graduiertenfakultät von Yale besuchte und anschließend zwei Jahre als Director der Service Year Alliance tätig war, einer Nonprofit-Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, junge Amerikaner und Amerikanerinnen für ein bezahltes soziales Jahr zu gewinnen. Jeff Eggers hat die United States Naval Academy besucht, ist ehemaliger Offizier der Spezialeinheit United States Navy Seals und hält einen Abschluss der Universität von Oxford. Außerdem hat er an Kampfeinsätzen im Irak und in Afghanistan teilgenommen und als Angehöriger des Nationalen Sicherheitsrats der Vereinigten Staaten mehr als sechs Jahre im Weißen Haus gearbeitet. Ich selber habe mehr als 38 Jahre in Uniform verbracht – von meiner Ausbildung in West Point bis zum Kommando über alle US- und NATO-Truppen in Afghanistan bis zu meiner Pensionierung im Jahr 2010. Seitdem konzentriere ich mich auf das Thema Führung, unterrichte am Jackson Institute von Yale und habe zwei Bücher geschrieben.
Jeder von uns bringt aus seiner jahrelangen Führungserfahrung Erfolge, Niederlagen, Lektionen und Narben mit. Aber was wir vor allem anderen mit uns herumtragen, sind unbeantwortete Fragen. Wir alle teilen die Faszination und Leidenschaft für Menschenführung, zusammen mit dem Gefühl, dass wir trotz aller theoretischen Erkenntnisse aus Forschung und Wissenschaft noch immer nicht wirklich verstehen, wie Führung geht.
Das vorliegende Buch ist unser Versuch, den ersten Schritt in Richtung einer allgemeinen Führungstheorie zu wagen. Inspiriert von Brooks’ Frage haben wir Plutarchs Ansatz der Gegenüberstellung von Führungspersönlichkeiten imitiert, indem wir dreizehn berühmte Führungspersönlichkeiten in sechs Doppelporträts und ein Einzelporträt – Robert E. Lee – gruppiert haben. Wie Plutarchs Lebensbilder beginnt auch jedes unser Doppelporträt-Kapitel mit einer kurzen Einführung und endet mit einem Vergleich der beiden porträtierten Führungspersönlichkeiten, in der Hoffnung, die Gegenüberstellung möge die Komplexität des Themas Führung deutlich machen und erklären, wie es kommt, dass die meisten von uns am Ende den Mythos sehen, und nicht die Realität. Den Lesern wird auffallen, dass die Autoren gelegentlich Personalpronomen verwenden. Immer wenn von »ich« die Rede ist – zumeist in der Einführung zu den jeweiligen Porträts – bin ich, Stan, gemeint. Immer wenn im Text »wir« steht, sind alle drei Autoren, inklusive meiner Person, gemeint.
Die Porträts wurden so ausgewählt und dargestellt, dass sie lehrreich und unterhaltsam zugleich sind. Nicht alle der von uns ausgewählten Persönlichkeiten waren gute Führer, und manche nicht einmal gute Menschen. Einige waren erfolgreich, weil sie talentiert waren; andere, weil sie sich bedingungslos für ihre Sache engagierten; wieder andere, weil sie Glück hatten, und einige kamen nie wirklich in den Genuss eines Erfolgsgefühls. Ob sie richtig oder falsch lagen, erfolgreich oder erfolglos waren, jeder dieser Faktoren spielte für die Ergebnisse, die wir heute als Geschichte bezeichnen, eine erhebliche Rolle. An ihrer Relevanz gibt es keine Zweifel, aber sie bilden nicht die ganze Geschichte ab.
Wir haben die Erfahrungen von dreizehn Führungspersönlichkeiten ganz bewusst als Brille gewählt, durch die wir das Thema Führung betrachten. Bei diesen Persönlichkeiten handelt es sich jedoch nicht um Versuchstiere, die man am besten aus klinischer Distanz betrachtet. Ihre Geschichten sind menschlich, daher ist es besser, sich ein Stück weit emotional auf die Erlebnisse der Porträtierteneinzulassen, als ihre Porträts mit analytischer Nüchternheit zu lesen. Kein Leben wird gelebt und keine Krise bewältigt in der möglichen Überlegung, man könne damit für nachfolgende Generationen zu einer interessanten Fallstudie werden. Lassen Sie sich also auf die Welt dieser Persönlichkeiten und ihre subjektiven Erfahrungen ein.
Suchen Sie im Text nicht nach Checklisten für Führung. Die Porträts dienen dazu, traditionelle Führungskonzepte infrage zu stellen, aber wir maßen uns nicht an, vorzugeben, wie geführt werden sollte. Wir hoffen, dass wir ein paar der üblichen Mythen entlarven können, damit Sie sowie andere Führungskräfte die Realität erkennen, wie sie ist, und Herausforderungen mit klarem Denken und Bescheidenheit entgegentreten.
Und noch etwas: Dieses Buch allein wird aus Ihnen keine herausragende Führungspersönlichkeit machen. Sie werden damit weder einen Mangel an Werten oder Selbstdisziplin noch die eigene Dummheit überwinden. Anstatt die Herausforderung »Führung« zu simplifizieren, wird das vorliegende Buch die Komplexitäten dieses Themas aufzeigen. Führung ist schon immer schwierig gewesen, und angesichts der hoch dynamischen Umgebung, in der wir heute leben, wird sie nur noch schwieriger. Führung ist aber möglich – und zudem unentbehrlich.
General a. D. Stan McChrystal, US Army
1 ungefähr: »Griechische Sagen für kleine Knirpse« (A.d.Ü.)
2 Ulysses S. Grant, Oberbefehlshaber der US-Armee im Sezessionskrieg und 18. Präsident der Vereinigten Staaten (1869–1877). (A.d.Ü.)
3 Das 75th Ranger Regiment (Airborne) ist Teil des Führungskommandos für die Spezialeinheiten der US-Armee, United States Army Special Operations Command. (A.d.Ü.)
4 Die großen Griechen und Römer 1: Doppelbiografien, Wunderkammer Verlag (2008) (A.d.Ü.)
Der Mythos
Die Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen; der erste Eindruck täuscht oft.
Phaedrus, römischer Dichter, um 15 v. Chr. bis 50 n. Chr.
Im Jahr 49 v. Chr. traf Julius Cäsar mit dem dramatischen Ausruf »Die Würfel sind gefallen« die schicksalsträchtige Entscheidung, an der Spitze seiner 13. Legion den Rubikon zu überqueren.1 Das war deswegen so bedeutsam, weil das Flüsschen Rubikon die Grenze zwischen Italien und der Provinz Gallien markierte, dessen Prokonsul Cäsar war. Der Senat, der dessen wachsende Macht mit Misstrauen beäugte, befahl ihm, sein Heer aufzulösen und nach Rom zurückzukehren. Cäsar bot dem Senat jedoch die Stirn und beschloss, zwar zurückzukehren, jedoch nicht mit gesenktem Haupt, sondern in offener Rebellion, und marschierte mit seiner Legion auf Rom zu. Mit dem Überschreiten der italienischen Grenze in Begleitung eines bewaffneten Heeres war Cäsar unwiderruflich zu einem Verräter geworden. Trotz aller Berühmtheit war die Überschreitung des Rubikon eine relativ bescheidene Angelegenheit, in der der zukünftige Herrscher und seine Legionäre nichts anderes taten, als durch wadenhohes Wasser zu waten.2 Nichtsdestotrotz brachte ihn dieser Akt in eine unversöhnliche Opposition zum römischen Senat und machte den Ausdruck »den Rubikon überschreiten« für alle Ewigkeit zu einem Synonym für die nicht rückgängig zu machende Überschreitung eines Wendepunktes.
Die Geschichte, wie Cäsar und seine Legion auf Rom zumarschierten, ist auf den Pergamenten von Plutarchs Lebensbildern festgehalten, einer Reihe an Porträts berühmter Männer, die der griechische Schriftsteller der Antike verfasste. Plutarch schrieb auch, der Senat habe Cäsar fünf Jahre später »in der Hoffnung, die Herrschaft einer einzigen Person gebe ihnen die Zeit, nach so vielen Bürgerkriegen und anderen Kalamitäten Luft zu holen«, zum dictator perpetuus – Diktator auf Lebenszeit – bestimmt.3 Und dennoch wurde Cäsar innerhalb von zwei Monaten ermordet, wobei ausgerechnet viele jener Senatoren, die ihm zu dieser Machtposition verholfen hatten, zu den Messerschwingern gehörten. Wie Plutarch erklärt, hatten Cäsars »Hochmut« und die »Extravaganz« seines neuen Titels die Gruppe, zu der auch sein enger Freund Marcus Junius Brutus gehörte, zur Konspiration gegen ihn motiviert.4 Heute kennen die meisten von uns, die mit Cäsars Geschichte vertraut sind, diese wahrscheinlich nicht aus der Lektüre Plutarchs, sondern aus Shakespeares Bühnenstück Julius Cäsar.
Das berühmte Gemälde »Washington überquert den Delaware«.
(Foto von vcg Wilson/Corbis via Getty Images)
In der Mordszene in Shakespeares Drama wehrt sich Cäsar, bis er Brutus unter den Mördern entdeckt und das wahre Ausmaß des Verrats erkennt. Seine berühmten ergreifenden letzten Worte lauteten: »Auch du, mein Sohn Brutus? Dann, Cäsar, falle!«5
***
Fast zwei Jahrtausende später erlangte ein weiterer General Berühmtheit, indem er einen Fluss überquerte. Anders als das Flüsschen Rubikon, konnte der Fluss Delaware nicht zu Fuß durchwatet werden. George Washington hatte keine andere Möglichkeit, als ihn mit einem Boot zu überqueren – eine Szene, die der deutsch-amerikanische Historienmaler Emanuel Leutze 1851 in einem der berühmtesten Ölgemälde Amerikas verewigt hat. Auf der Leinwand, die 3,79 × 6,48 Meter misst, hielt Leutze den Wagemut von Amerikas Gründungsvater und erstem Präsidenten für die Nachwelt fest. Die Parallelen zwischen Cäsar und Washington reichen weit über ihre Rolle als Generäle bei einer Flussüberquerung hinaus. So wie Cäsars Sturz von Shakespeare im Versmaß des fünfhebigen Jambus nachvollzogen wurde, wurde der letzte Akt von Washingtons Führerschaft von dem Schauspieler, Komponisten, Songwriter und Rapper Lin-Manuel Miranda beschrieben, der vier Jahrhunderte später in seinem Musical Hamilton Washingtons Rückzug mithilfe des Hip-Hops dramatisierte. Und wo Shakespeare auf Plutarchs Lebensbilder zurückgriff, fand Miranda seine Inspiration in der Biografie AlexanderHamilton von Ron Chernow.
Das Musical endet mit dem Rap Song »One Last Time«, in dem George Washingtons 1796 getroffene Entscheidung, nach seiner zweiten Amtszeit zurückzutreten, auf einen ungläubigen Hamilton trifft:
Hamilton: Why do you have to say goodbye?
Washington: If I say goodbye, the nation learns to move on. It outlives me when I´m gone.67
Miranda sagte später, er habe Washingtons »Menschlichkeit« und »Zerbrechlichkeit« darstellen und das seltene Beispiel eines Führers feiern wollen, der sich freiwillig von der Macht verabschiedet.8 In seinem Musical stellt Washington selbstlos und im Einklang mit seinem Führungsvermächtnis die noch sehr junge Demokratie der Nation über seine persönliche Macht.
Für alle angehenden Führer sind die oft erzählten Geschichten kühner Flussüberquerungen und des dramatischen Falls beziehungsweise Abschieds Julius Cäsars und George Washingtons inspirierend und einschüchternd zugleich. Sie wären allerdings hilfreicher, wenn Führung tatsächlich so funktionieren würde, wie die Legenden es suggerieren. In Wahrheit aber war Führung weder für Cäsar noch für Washington einfach.
Die Geschichte hat Cäsars Ausruf »Die Würfel sind gefallen« als eine Manifestation von Mut und Entschlossenheit kodifiziert, allerdings markierte dieser Ausruf auch einen Moment tiefer Zweifel. Plutarch erzählt uns, was die Populärgeschichte oft vergisst, nämlich, dass Cäsar bei Erreichen des Rubikons seinen Truppen zunächst befahl, innezuhalten, und dass er »sehr unschlüssig war ... und seine Meinung oft in die eine oder andere Richtung änderte«. Bevor er seinen Marsch fortsetzte, suchte er Rat, als »sein Wankelmut am größten war«.9 »Innehalten«, »Unschlüssigkeit« und »Wankelmut« sind aber keine Begriffe, die wir mit Führung assoziieren, und auch die Führer selber möchten nicht damit assoziiert werden. Wirklich effektive Führer, so glauben wir, empfinden niemals auch nur den Hauch eines Zweifels; vielmehr handeln sie stets entschlossen und stellen sich mutig den Konsequenzen ihres Handelns. In Wahrheit entspricht aber kaum ein Führer diesem Bild.
Und so waren auch Cäsars letzte Worte, »Auch du, mein Sohn Brutus?« wahrscheinlich eine dramatische Freiheit, die sich Shakespeare und andere Dramatiker des elisabethanischen Zeitalters nahmen.10 Plutarchs Version von der Ermordung Cäsars zeichnete hingegen ein eigenes Drama.
Als Caesar angegriffen wird, ruft er keineswegs zitierfähige Bedeutsamkeiten aus, sondern – was uns natürlicher erscheint – packt zunächst seinen Angreifer und versucht, die Messerstiche abzuwehren. Anstatt Brutus anzurufen, ruft er, »Niederträchtiger Casca, was hat das zu bedeuten?« Der Rest des Kampfes ist eine scheußliche Angelegenheit, in deren Verlauf sich der große Cäsar windet, um den Messerstichen seiner Angreifer auszuweichen, die sich in ihren stümperhaften Bemühungen schließlich gegenseitig Messerstiche versetzen: »Es heißt, er habe gekämpft und sich gegen seine Angreifer gewehrt, indem er sich wand, um den Stichen auszuweichen, und um Hilfe rief. Als er jedoch Brutus’ gezücktes Schwert erblickte, bedeckte er sein Gesicht mit seiner Robe und ergab sich in sein Schicksal ... Während sie ihre gemeinsamen Attacken gegen eine Person richteten, hatten sich die Verschwörer zuhauf gegenseitig verletzt.«11
Während sich Shakespeares Drama auf die Spannung und den Konflikt zwischen zweien der Hauptfiguren konzentrierte, fokussierte Plutarchs Erzählung auf Cäsars Verhalten, während er einen gewaltsamen Tod erleidet.
In Wahrheit kannten weder Plutarch noch Shakespeare die genauen Ereignisse, und wir kennen sie auch nicht. Wir haben keine andere Möglichkeit, als sie mithilfe der überlieferten Texte zu interpretieren. Sowohl der Biograf als auch der Dramatiker haben sich sehr bemüht, die Komplexität auf ihre individuelle Weise festzuhalten. Und dennoch ist das, was in unserem selektiven Gedächtnis haften geblieben ist, die Geschichte, dass Cäsar kühn den Rubikon überschritt und im Sterben den berühmten Satz ausrief, den er wahrscheinlich nie gesagt hat.
Wenn man beide Versionen der Geschichte, die des griechischen Biografen und die des englischen Dramatikers, miteinander vergleicht, erkennt man, dass Cäsars Führung gar nicht so heldenhaft war, wie wir es oft in der Erinnerung haben. Das Gleiche gilt für Washington.
***
In der Lobby im Westflügel des Weißen Hauses hängt eine Reproduktion des berühmten Ölgemäldes Washington Crossing the Delaware. An dieser Stelle machen die Angestellte des Weißen Hauses, die die Führungen durch das Gebäude machen, besonders gerne Halt. Die Broschüren, die die Besucher ausgehändigt bekommen, zählen sämtliche historischen Fehler des Werkes auf: Der Delaware River fror nie so stark zu, außerdem ist er in Wirklichkeit nicht so breit; die Boote steuern in die falsche Richtung, die Flagge ist nicht die richtige für die damalige Zeit, und so weiter. Der interessanteste Fehler sind aber die Boote selbst. Statt der klapprigen Walfänger-Ruderboote, wie Leutze sie malte, geht man davon aus, dass Washington einen circa 20 Meter langen floßartigen, flachen Kahn mit Artillerie verwendete, der viel besser für eine winternächtliche Flussüberquerung mit einer ganzen Armee geeignet war.
Mort Künstlers modernere und realistischere Darstellung von Washington Crossing the Delaware.
(nach dem Originalgemälde von Mort Künstler, Washington’s Crossing ©2011 Mort Künstler, inc.)
Im Jahr 2011 wurde in der New Yorker Historical Society, die sich für den Erhalt der Stadtgeschichte einsetzt, eine völlig andere Darstellung der Überquerung enthüllt, auf der ein solcher flacher, floßartiger Kahn zu sehen ist. Das Gemälde war eine Auftragsarbeit, die von dem Maler Mort Künstler angefertigt wurde. Auftraggeber war ein Herr namens Thomas R. Suozzi, der das Werk mit den Worten bestellt hatte: »Ich möchte dem existierenden Gemälde etwas entgegensetzen. Es ist großartig, aber die Darstellung ist nicht realistisch.«12 Abgesehen von den Booten liegt der auffälligste Unterschied in der Person Washingtons selbst. Im Original steht der General in dem kleinen Boot aufrecht, aber scheinbar leicht nach vorne geneigt, mit einem Bein auf dem Bootsrand, als sitze er auf einem kleinen Eisberg. In dem neuen Gemälde steht er auch, aber seine Körperhaltung ist ausbalanciert, wobei er seine rechte Hand auf dem Rad der mitgeführten Feldkanone abstützt, um sich einen besseren Halt zu verschaffen.
Künstlers Werk korrigierte nicht nur die historischen Ungenauigkeiten, sondern beseitigte zugleich einen kritischen Fehler in der Art und Weise, wie wir Führung oft beschreiben. Es ist nur natürlich, dass ein Mensch, der nachts auf einem Boot steht, um einen festen Stand bemüht ist, denn der menschliche Gleichgewichtssinn ist nicht perfekt. Allerdings würden sich nur wenige echte Führer, von Militärgenerälen ganz zu schweigen, ohne jede Unterstützung auf einem wackligen Ruderboot präsentieren, ganz so, als posierten sie für die Nachwelt. Und dennoch erscheint den meisten Betrachtern die Darstellung Washingtons, der bei einer nächtlichen Überfahrt über einen halb zugefrorenen Fluss auf einem kleinen Boot thront, nicht eigenartig. Stattdessen halten wir eine derart absurde Darstellung heroischer Führerschaft oft für normal.
Mirandas Beschreibung von George Washington als amerikanischem Gründungsvater, der zu selbstlos war, um sich eine Krone aufzusetzen, war ähnlich verzerrt und idealisiert. Wie der Washington-Biograf Ron Chernow erklärt, litt Washington zum Zeitpunkt seines Rücktritts »unter Rückenschmerzen, schlechten Zähnen und Rheumatismus; Besuchern fiel seine verhärmte, sorgenvolle Miene auf«.13 Amerikas Gründungsvater war einfach ein Mensch. Bestimmt war er von dem Prinzip der Zivilregierung durchdrungen, aber er war auch körperlich und geistig erschöpft.
Eine schnelle Durchsicht dieser sehr unterschiedlichen Erzählungen über zwei Führungspersönlichkeiten lehrt uns genauso viel über die Methoden des Geschichtenerzählens wie über die Führer selbst. Biografen schildern üblicherweise das Leben von Führungspersönlichkeiten, indem sie besonders die Bedeutsamkeit von deren individuellen Entscheidungen betonen. Daher ist es wenig überraschend, dass Führer, die den Großteil ihrer Führungskonzepte aus Biografien ziehen, ihre eigene Geschichte gern so erzählen, dass sie selbst stets im Mittelpunkt stehen. Die Geschichten, die sie sich selbst und anderen erzählen, sind insofern irreführend, als sie unser menschliches Bedürfnis nach Vereinfachung in einer komplexen Welt befriedigen. Biografien vereinfachen die Komplexität kollektiver menschlicher Systeme auf leichter steuerbare Elemente von Einzelpersonen.
Ein Dramatiker nimmt oft eine andere Perspektive ein; er konzentriert sich auf die Beziehungen zwischen den Individuen, vor allem, wenn diese Beziehungen Konflikte oder komödiantische Aspekte beinhalten. Während ein Biograf die Leser über die Eigenschaften einer Führungspersönlichkeit informiert, geht es dem Dramatiker darum, dass die Theaterbesucher das Drama der Beziehungen der Hauptfigur erleben.
In Wahrheit brauchen wir beides, die biografische und die dramatische Perspektive. Als Individuen schätzen wir die Fokussierung des Biografen auf die Akteure, und als Sozialwesen genießen wir die dramatische Darstellung ihrer Beziehungen. Dennoch haben beide Erzähler zum Führungsmythos beigetragen. Während der Biograf unsere Konzentration auf Führungsfiguren lenkt, beleuchtet der Dramatiker (oder Maler) die Romantik der Führungsrolle. Zwischen beiden Effekten denken wir uns Geschichten aus, die die Rolle der Gefolgsleute vernachlässigen und komplexe Ergebnisse und Auswirkungen fälschlicherweise Einzelpersonen und ihren Entscheidungen zuschreiben: Cäsars Stärke war Anfang und Ende seines Imperiums, und Washington gewann den Revolutionskrieg und gründete die Vereinigten Staaten. In Wahrheit sind die Führungslektionen nicht diejenigen, die wir wie selbstverständlich aus den Legenden ziehen. Der Rubikon erinnert uns daran, dass echte Führer Zweifel verspüren und sich mit anderen beraten. Dem vergleichbar lautet die Lektion aus der Überquerung des Delaware nicht, dass gute Führer in ihrer Überheblichkeit unnötige Risiken eingehen. Ein echter Führer gibt im Moment seiner brutalen Ermordung vermutlich keine druckreifen Sätze für die Nachwelt ab, sondern verblutet wahrscheinlich einfach stumm. Wenn sich ein echter Führer von der Macht verabschiedet, tut er das womöglich im Respekt vor den demokratischen Prinzipien; es kann aber auch sein, dass er einfach nur erschöpft ist.
***
»Führung« ist ein Begriff, der sich bekanntermaßen nur sehr schwer definieren lässt. Wie The Bass Handbook of Leadership anmerkt, »beginnt ein zweitägiger Führungs-Workshop mit einem ganzen Tag, an dem über die Definition dieses Konzepts gestritten wird.«14 Bass weist auch darauf hin, dass der Führungsexperte Joseph Rost in 587 untersuchten Publikationen 221 Definitionen gefunden hat.15
Natürlich macht sich kaum eine Führungspersönlichkeit so viele Gedanken über Definitionen. Nach unserer Erfahrung betrachten die meisten Menschen Führung als den Prozess, eine Gruppe zu beeinflussen, damit diese ein bestimmtes Ziel erreicht. Diese Definition suggeriert, dass Führung der Prozess ist, mit dem eine Person eine Gruppe auf ein bestimmtes Ziel ausrichtet, und dass die Führer an der Spitze die Richtung bestimmen und die Gruppe lenken. Doch was vielleicht noch schlimmer ist: unsere Bemühungen, das Wesen der Führung zu verstehen, sind stets demselben, ungenügenden Muster gefolgt. Wir haben einzelne Führer studiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass Führung einfach das ist, was Führer tun – sprich, ihre individuellen Entscheidungen und Handlungen.
Und genau hier liegt der Ursprung des Mythos Führung: Diese Betrachtungsweise fokussiert ausschließlich auf die Person des Führers. Seit vielen Jahren wird nach dem Geheimnis der Führung gesucht, indem analysiert wird, warum bestimmte Führungspersönlichkeiten beneidenswerte Ergebnisse erzielen und andere nicht. Dabei wurde aber nie auf die Personen im Dunstkreis der Führer geachtet. Wir gehen immer davon aus, dass er derjenige ist, der den Prozess steuert, und unterschätzen die Rolle der Gefolgsleute und des situativen Kontextes. Außerdem gehen wir davon aus, dass Führung zielorientiert ist, und dass sich durch die Anwendung der korrekten Formel für effektive Führung überzeugende Ergebnisse erzielen lassen. Wir glauben fälschlicherweise, dass sich die Dinge, die sich in einer bestimmten Führungssituation ereignen, in einem anderen Moment ohne Weiteres wiederholen lassen.
Wenn dieses weit verbreitete Führungsverständnis den tatsächlichen Führungsmechanismen gegenübergestellt wird, zeigt sich, dass hier drei Mythen am Werk sind, auf die wir in den letzten beiden Kapiteln dieses Buches ausführlicher eingehen werden:
Der Mythos der starren Führungsformel: Im Bemühen, den Prozess zu verstehen, sind wir versucht, das Konzept Führung in eine statische Checkliste zu pressen, und ignorieren die Tatsache, dass Führung ausgesprochen kontextbezogen und immer von den situationsspezifischen Umständen abhängig ist.Der Mythos der Führungseigenschaften: Wir schreiben Führern zu viele Eigenschaften zu und betrachten das Thema mit einem verzerrten Tunnelblick, der nur die Person des Führers sieht. Wir sind versucht zu glauben, dass Führung das ist, was der Führer entscheidet und macht. In Wahrheit lassen sich die Ergebnisse auf eine Vielzahl von Faktoren jenseits der Person des Führers zurückführen.Der Ergebnismythos: Wir sagen, Führung ist der Prozess, Gruppen von Menschen auf ein bestimmtes Ziel hin zu lenken. Das trifft bis zu einem gewissen Punkt zu, aber es ist viel mehr als das. In Wahrheit beschreibt Führung eher, was Führer symbolisieren, als das, was sie erreichen. Produktive Führung verlangt, dass die Gefolgsleute Sinn und Zweck in dem erkennen, was ihre Führer repräsentieren, zum Beispiel soziale Identität oder Zukunftschancen.Die Macht und die Dominanz dieser Führungsmythen sind fast mit religiösen und romantischen Mythen vergleichbar; sie scheinen universell und untrennbar mit unserer menschlichen Existenz verbunden zu sein. Sie spiegeln die Entkoppelung zwischen der Realität und unseren Wunschvorstellungen wider. Wir sind uns dieser Entkoppelung bewusst, haben uns aber mit ihr arrangiert. Führungskräfte von Wirtschaftsunternehmen sprechen zum Beispiel oft von der Bedeutung guter Führung, aber wenn sie die Bedrohungen aufzählen sollen, denen ihr Geschäft ausgesetzt ist, nennen sie im Allgemeinen nur exogene Faktoren, vergessen aber regelmäßig, ihr eigenes Führungsverhalten als Risikofaktor zu berücksichtigen.16
Zum Teil leben wir mit diesen Mythen, weil sie eine nützliche Funktion erfüllen. Wie für die Religion gilt auch für die Führung, dass sie Werte bietet, indem ein Narrativ – eine zusammenhängende Geschichte – entwickelt wird, das der Welt, in der wir leben, einen Sinn verleihen soll, selbst wenn er uns verschlossen bleibt. Wenn alles gut läuft, führen wir das Verdienst auf die Führung zurück, und bei Misserfolg kann man dem Führenden dafür die Schuld zuweisen. Durch unsere romantischen Vorstellungen fesselt das Thema Führung unsere Aufmerksamkeit und Fantasie und weckt Gefühle, die wir selber nicht immer verstehen.
Auch wenn sie nützlich sein können, führen uns Mythen oft auf Abwege, mit negativen Folgen und Risiken für die Gesellschaft. Wenn wir Mythen glauben, verlieren unsere Führungsmodelle an Effektivität; wir denken uns ausgefeilte Prozesse zur Selektion, Bewertung und Schulung von Führungskräften aus, die dann nichts anderes tun, als bestehende Schwächen aufrechtzuerhalten. Gefährlicherweise entwickeln und hegen wir dann auch falsche Erwartungen an Führer. Gelegentlich nutzen Führer Mythen aus, um sich persönlich zu bereichern – zum Schaden der Organisationen, die sie leiten. In anderen Fällen werden Mythen aufgedeckt, was Enttäuschung und Zynismus über Führung zur Folge hat.
Wir können also fragen, warum wir mit diesen Mythen leben und wie sich Führung neu definieren lässt. Handelt es sich wirklich um einen Prozess oder eher um eine Eigenschaft? Welche Rolle spielt Führung in menschlichen Systemen, und warum erscheint sie überhaupt so wichtig?
Anhand der in diesem Buch vorgestellten Porträts erkennen wir, dass Führung in Wahrheit wesentlich mehr ist als nur ihre Ergebnisse; bei Führung geht es auch darum, wie komplexe menschliche Gruppen ihre Kooperation optimieren und Menschen Symbole für die Bedeutung und den Sinn des Lebens finden. Diese Optimierung und dieses Gefühl der Sinnhaftigkeit entstehen aus dem Zusammenspiel von vielen veränderlichen Variablen, die weitaus mehr beinhalten als nur eine einzige Führungsfigur. Führung wird gemeinsam von Führern und Gefolgsleuten erzeugt; sie entsteht zwischen den Einflussreichen und Charismatischen, die nach Führung streben, und den Hoffnungsvollen und Furchtsamen, die nach Führung verlangen.
Der Führungsmythos entspringt der Dualität, die uns zu menschlichen Wesen macht: Einerseits sind wir Teil eines sozialen Kollektivs, andererseits sind wir autonome Individuen, und beides verleiht uns unseren Wert. Als menschliche Wesen sind wir außerdem in der Lage, die Diskrepanz wahrzunehmen zwischen dem, was tatsächlich ist, und dem, was sein sollte, und wir besitzen die kognitive Gabe, uns die Zukunft und das Irreale vorstellen zu können. Die Kehrseite der Medaille ist, dass die Dinge nie genau so sind, wie wir sie gerne hätten. Und vielleicht gilt das auch für Führung, von der wir geneigt sind, immer mehr zu erwarten und zu wollen, als sie tatsächlich leisten kann.
***
Ende des Jahres 1777, ein Jahr nach seiner berühmten Überquerung des Delaware, sandte General Washington Captain Alexander Hamilton ins Hinterland nach New York, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Anfang 1778 kehrte sein treuer Assistent ins Winterquartier von Valley Forge, Pennsylvania, zu Washington zurück.17
Für Hamilton war es ein arbeitsreicher Winter gewesen. Neben seiner Mission im Norden hatte er seinem Oberbefehlshaber dabei geholfen, einen Brief an den Kontinentalkongress zu schreiben, in dem er den desolaten Zustand der Armee beschrieb.18 Und so, erschöpft von der Kälte und den Strapazen der Reise und inmitten eines Krieges, den seine Seite zu verlieren drohte, konzentrierte er seine Gedanken auf die Zukunft – indem er zurückblickte.19
Am Ende des Tages in einem Raum, den er mit mehreren anderen teilte, nahm Hamilton an einem schmalen Schreibtisch Platz und holte ein kleines, abgegriffenes Notizbuch aus seiner Tasche. Das Buch trug den Aufdruck »Pay Book of the State Company of Artillery« – ein Verweis auf die Artilleriekompanie von New York, die er befehligt hatte, als er im August 1776 erstmals seine Notizen in dieses Büchlein eingetragen hatte. Das Notizbuch und sein Eigentümer beschäftigten sich inzwischen jedoch mit größeren Dingen. Hamilton legte das zweckentfremdete Notizbuch auf den Schreibtisch, öffnete es auf der Seite seines letzten Eintrags, zückte seine Feder und richtete seine Aufmerksamkeit auf einen 1700 Jahre alten Text: Plutarchs Lebensbilder.
Im Winter des Jahres 1777/78 trug Hamilton in seinem Versteck in Valley Forge umfangreiche Notizen über die Lebensbilder in sein Büchlein ein und analysierte die Geschichten von Theseus und Romulus, den mythischen Gründern der Städte Athen und Rom, sowie von Lycurgus und Numa, den Gesetzgebern von Sparta und Rom. Die Lektüre der Lebensbilder war damals üblich und sollte es auch in den folgenden 150 Jahren bleiben. Teddy Roosevelt trug eine Ausgabe davon in seiner Brusttasche: »Ich habe dieses Büchlein fast tausend Mal gelesen«, sagte er, »aber es bietet immer wieder Neues.«20 Plutarchs Arbeiten waren an Machiavellis Florentiner Hof zu finden, in den Briefen des Präsidenten John Adams, in den Bibliotheken und Schriften von Montaigne, Montesquieu, Rousseau und Emerson.21 Während eines Großteils des frühen 20. Jahrhunderts waren Plutarchs biografische Porträts berühmter Griechen und Römer ein Standardbegleiter für Führungspersönlichkeiten.
Plutarch war ein griechischer Schriftsteller der Antike, der ungefähr von 45 v. Chr. bis zum Jahr 120 n. Chr. lebte. In seinen Lebensbildern porträtierte er 48 Führungspersönlichkeiten – Römer und Griechen –, die er zu Paaren gruppierte, die eine gemeinsame Eigenschaft hatten oder eine Erfahrung teilten, zum Beispiel Theseus und Romulus. Jedes dieser Lebensbilder beginnt mit einer informellen Einführung über die Motive, gefolgt von dem Porträt eines Römers und eines Griechen, und endet mit einem Vergleich der Lebensläufe beider Persönlichkeiten. Vier Porträts haben keine Parallelentsprechung. Das vorliegende Buch ahmt mit dreizehn berühmten Führungspersönlichkeiten, die in sechs Doppelbiografien und eine Einzelbiografie strukturiert sind, die Struktur von Plutarchs Lebensbildern nach. Wie bei Plutarch beginnt jede Doppelbiografie mit einer kurzen Einleitung und endet mit einem Vergleich der beiden porträtierten Persönlichkeiten. Plutarch schrieb Biografien, keine Geschichte. Er war stärker an der Frage interessiert, welche Art Mensch der Porträtierte war, und weniger an seinen eigentlichen Taten.22
Der Buchdeckel von Hamiltons Notizbuch sowie die erste Seite seiner Notizen über Plutarchs Lebensbilder.
(Kongressbibliothek, Abteilung Manuskripte, Dokumente von Alexander Hamilton)
(Kongressbibliothek, Handschriftenabteilung, Alexander Hamilton Papers)
Plutarch konzentrierte sich auf Fragen des persönlichen Charakters. Er wollte die Tugend studieren, damit sie imitiert werden konnte. In seiner Einführung zum »Leben des Perikles« schreibt er:
»Tugend, die sich in Handlung manifestiert, kann eine so große Wirkung auf den menschlichen Geist haben, dass sie augenblicklich Bewunderung für das Getane auslöst, sowie den Wunsch, dem Handelnden nachzueifern [...] Das moralisch Gute ist ein praktischer Anreiz; kaum, dass es entdeckt wird, löst es den Impuls aus, Gleiches zu tun, und beeinflusst den Verstand und den Charakter nicht nur durch die reine Imitation, die wir betrachten, sondern indem es durch die Schaffung von Tatsachen einen moralischen Zweck erzeugt, den wir formen. Und so haben wir beschlossen, Zeit und Mühe auf die Beschreibung des Lebens berühmter Personen zu verwenden.«23
Zwar ist die Struktur unseres Buches ähnlich, aber unsere Absicht ist eine andere. Wir schildern das Leben von Persönlichkeiten, die geführt haben, aber auch – und das ist wichtig – den Kontext und die Umgebung, in der sie führten. Wir hoffen, durch diese Porträts verständlich zu machen, was es bedeutet, zu führen, und was wir mit Führung meinen. Wo Plutarch fragte, »Welche Sorte Mensch war er oder sie?«, lautete unsere Ausgangsfrage, »Welche Art Führungspersönlichkeit war er oder sie?«
Was Plutarch mit seinen Vergleichen bezweckte, und warum er ausgerechnet Griechen und Römer miteinander verglich, wird nach wie vor diskutiert.24 Wir sind transparent, was unseren Zweck und die Methode angeht. In diesem Sinne möchten wir den Lesern einige einleitende Anmerkungen mitgeben.
Erstens sind wir mit unseren Doppelbiografien, anders als Plutarch, keiner formalen Struktur gefolgt, wie zum Beispiel der Gegenüberstellung von Römern und Griechen. Wir haben sie auch nicht nach bestimmten Kriterien ausgesucht oder diejenigen ausgewählt, die eine bestimmte These bekräftigen, die wir zu beweisen versuchten. Unser Auswahlprozess hat sich natürlich ergeben, und wir haben nur einige wenige, einfache Kriterien angelegt. Ausgangspunkt war die Idee, eine Gruppe von Führungspersönlichkeiten zu präsentieren, die eine interessante Lektüre versprachen, und aus deren Geschichte wir wahrscheinlich etwas über die Realitäten der Führung erfahren könnten.
Zweitens waren wir im Gegensatz zu Plutarchs eher beschränkter Auswahl an Rednern und Feldherren in unserem Auswahlprozess weitaus weniger eingegrenzt. Unsere sechs Führungsgenres – Fanatiker, Gründer, Machtmenschen, Genies, Reformer und Helden – umfassen mehrere unterschiedliche Führungstypen, ohne dass dies beabsichtigt war. Das soll nicht heißen, dass wir Führung mit politischer Führung gleichsetzen wollen, oder dass die Führung eines Start-ups mit der Führung zur Erfüllung einer Mission vergleichbar wäre. Vielmehr verfolgen wir deshalb einen so breiten Ansatz, weil wir hoffen, mehr über Führung als breites Konzept erfahren zu können, anstatt dieses bereits fragmentierte Forschungsgebiet weiter zu segmentieren. Damit haben wir uns unsere Aufgabe weiter erschwert, weil diese Breite das Problem widerspiegelt, dass Führung oft ein unzureichend definiertes, loses Mosaik an Disziplinen ist. Und letztlich spiegelt sie auch die mangelnde Fassbarkeit des Begriffs Führung und ihrer Ausübung wider; Führung ist etwas, das einerseits überall zu finden ist, sich aber andererseits nur schwer greifen lässt. Natürlich gibt es alternative Wege, um Führung in unterschiedliche Typen und Genres zu unterteilen, aber dieses Buch will vor allem auf die Mythen aufmerksam machen, die das Thema Führung beherrschen.
Drittens war es angesichts der Fülle bemerkenswerter Führungspersönlichkeiten, die die Menschheitsgeschichte aufweist, alles andere als leicht, sich auf dreizehn Führungsfiguren festzulegen. Bei der Durchsicht vieler Hundert möglicher Kandidaten suchten wir nach Persönlichkeiten, die über mehrere Dimensionen repräsentativ wären: Beruf, Region, Geschlecht, Rasse und so weiter. Dabei überraschte uns die Tatsache wenig, dass Frauen und Minderheiten im Kanon der Führungspersönlichkeiten extrem unterrepräsentiert waren. Am Ende einigten wir uns auf Führungsfiguren, die im Hinblick auf ihren Führungsstil die größte Vielfalt boten, wobei wir uns aber immer vor Augen hielten, dass die Geschichte der Führer zum größten Teil eine patriarchalische ist.
Viertens hoffte Plutarch, dass die von ihm porträtierten Führer ein nachahmenswertes Beispiel bieten würden, oder, wo er sich für unmoralische Beispiele entschied, uns lehren würden, »die Wildheit der Extreme zu vermeiden«.25 Die Leser werden anhand der Miteinbeziehung von Führungsfiguren, die eher verabscheuungswürdig sind, jedoch bemerken, dass wir durchaus glauben, dass man von unmoralischen Führern viel lernen kann. Solche Menschen haben schon immer geführt und werden es auch weiterhin tun, daher muss unsere Studie auch diese Realität berücksichtigen. Gute Führer, so möchten wir glauben, sind tugendhaft. Unmoralische Führer sind jedoch genauso effektiv gewesen wie die am meisten bewunderten Persönlichkeiten.
Und schließlich lautet die größte historische Kritik an Plutarchs Werk, dass er Führer, die ein ganzes Jahrtausend an Geschichte abdecken, nach einem einzigen moralischen Standard beurteilte, anstatt im Kontext ihrer jeweiligen Zeit. Plutarch berücksichtigte den Kontext zumeist im Hinblick auf die Verdienste, die dem Führer für seine Erfolge zukamen – oder, in seinen eigenen Worten, »ob sie ihre größten Leistungen dem günstigen Schicksal verdankten oder ihrer eigenen Klugheit und ihrem Verhalten«.26 Nach unserer Auffassung ist effektive Führung sehr stark von Verhalten bestimmt, aber nicht zwangsläufig tugendhaft, daher betrachten wir den Kontext als eine zentrale Determinante – viel mehr als die moralische Integrität – für die Frage, ob ein Führer gefeiert wird beziehungsweise in Erinnerung bleibt. Wenn man die Geschichte eines Wendepunkts allein auf die Handlungsweise eines Einzelnen zurückführt, wird man den dahinterstehenden Netzwerken, dem kollektiven Handeln und den Zwängen des jeweiligen Kontextes nicht gerecht. Entsprechend willkürlich ist unser Glaube an die Macht individueller Führungspersönlichkeiten.
Diese Methode birgt allerdings einen Widerspruch in sich. Wenn Führung mehr ist als die Gesamtheit des Führungsverhaltens, wie lässt sich dann mit einer Sammlung von dreizehn Führerporträts ein hilfreicher Überblick erstellen? Wo es möglich war, haben wir die von uns ausgewählten Persönlichkeiten aus der Perspektive ihrer Gefolgsleute betrachtet und haben besonders intensiv auf ihre Umgebung und die Rolle des Kontextes geachtet. Es ist allerdings zugegebenermaßen schwierig, sich aus der Falle der Fokussierung auf die Führerfigur zu befreien, und zwar selbst für Autoren, die bestrebt sind, Führung als ein Konzept zu definieren, das sich nicht allein auf die Person des Führers konzentriert. Zum Schluss wurde dieses Buch zu einer Erforschung der Gründe dafür.
Wir sagen »zum Schluss«, weil sich die grundlegenden Fragen, die unsere Untersuchungen leiteten, im Verlauf der Manuskripterstellung veränderten. Auch Plutarch räumte ein, seine Motivation habe sich im Verlauf der Entwicklung seiner Lebensbilder verändert, als er seinen Lesern sagte, er habe »anderen zuliebe damit begonnen, Biografien zu verfassen; aber nun stelle ich fest, dass ich um meiner selbst willen mit Eifer fortfahre«.27 Jeder der Koautoren des vorliegenden Buches begann mit selbstzentrierten Motivationen; wir wollten in der Lage sein, Führung zu erklären, wie wir sie selbst erlebt haben. Wir begannen die Porträts mit der einfachen Frage, »Wie führten sie?« Im Verlauf der Zeit gingen wir jedoch wesentlich aufschlussreicheren Fragen nach, zum Beispiel, »Warum wurden sie zu einem Führer?« und »Was an dieser Situation machte diesen Führungsstil so effektiv?«
Wir treffen einige Schlussfolgerungen und schlagen im letzten Kapitel des Buches sogar eine neue Definition für Führung vor – eine, die die oben beschriebenen Annahmen thematisiert. Es gibt Gründe, warum sich die drei Mythen so hartnäckig halten, und deshalb kehren wir in den letzten beiden Kapiteln zu ihnen zurück, um die Kluft zwischen Mythos und Wirklichkeit noch einmal deutlich zu machen.
Die Lektüre von Plutarchs Lebensbilderninspirierte uns dazu, Führung zu porträtieren, wie sie erlebt wurde. Sie öffnete uns aber auch für die Tatsache, dass sich Ursache und Wirkung nie ausschließlich anhand individueller Führer erklären lassen. Daher verlagert sich unser Fokus auf das Ökosystem, das Führungspersönlichkeiten umgibt und dessen Teil sie sind. Wir sind bestrebt, die Handlungen dieser Führer in den Kontext der chaotischen Realitäten zu stellen, mit denen sie konfrontiert waren, wobei wir erneut darauf hinweisen, dass ein weniger mythenbehaftetes Modell keine Handlungsanleitung sein kann und Führung stattdessen im Kontext der Variabilität und Dualität der menschlichen Kondition beschreiben sollte.
Dementsprechend ist unser Glaube an eine individuelle Führerfigur rein willkürlich, denn wie gesagt, wenn man die Geschichte eines Wendepunkts allein auf die Handlungsweise eines Einzelnen zurückführt, wird man den dahinterstehenden Netzwerken, dem kollektiven Handeln und den Zwängen des jeweiligen Kontextes nicht gerecht. Führung ist viel eher Teil einer Feedbackschleife innerhalb eines Systems, anstatt an der Spitze einer einseitigen Befehlskette zu stehen. Der uralte Führungsmythos lässt sich vielleicht sogar am besten durch die moderne Linse komplexer adaptiver Systeme verstehen, in denen Ergebnisse ebenso vom Zusammenspiel der Gefolgsleute und des Kontextes getrieben sind wie von einem visionären, privilegierten Führer.
Wenn wir besser verstehen würden, was Führung eigentlich ist, würde uns das zwar weniger abhängig von unseren Führern machen und unsere Erwartungen an sie wären weniger hoch. Dennoch bleiben sie unverzichtbar. Sie spielen eine enorm wichtige Rolle, aber eben nicht in dem Sinne, wie wir immer glauben.
1Plutarch, Plutarch’s Lives, Hrsg. Arthur Hugh Clough, Modern Library Paperback Edition, Bd. 2 (Toronto: Random House, 1992), 221.
2 Fernando Lillo Redonet, »How Julius Caesar Started a Big War by Crossing a Small Stream«, National Geographic History, April 2017, www.nationalgeographic.com/archaeology-and-history/magazine/2017/03–04/julius-caesar-crossing-rubicon-rome/.
3Plutarch, Plutarch’s Lives, 2:235.
4Plutarch, Plutarch’s Lives, 2:235.
5 William Shakespeare, Julius Caesar, Hrsg. David Daniell, The Arden Shakespeare, Dritte Serie (London: Thomson Learning, 2000), 3. Akt, Szene I, Zeile 77.
6 (frei ins Deutsche übertragen): Hamilton: Warum müssen Sie gehen? Washington: Damit die Nation lernt, auf eigenen Füßen zu stehen. Sie lebt nach meinem Abschied weiter.
7 Christopher Jackson und Lin-Manuel Miranda, »One Last Time«, Hamilton (Original Broadway Cast Recording), aufgerufen am 11. Juni 2018, https://genius.com/Lin-manuel-miranda-one-last-time-lyrics.
8 The Rockefeller Foundation, Lin-Manuel Miranda: »The Tough Lesson of Leadership«, Insight Dialogues, aufgerufen am 10. Juni 2018, www.youtube.com/watch?v= ku9z 0tAkF3c.
9Plutarch, Plutarch’s Lives, 2:221.
10 Shakespeare, Julius Caesar, 3. Akt, Szene I, Zeile 77. Der Literaturwissenschaftler David Daniell merkt dazu an, dass in Suetonius´ Schriften ein ähnlicher Satz auf Griechisch auftaucht und dass Et tu, Brute erstmalig im Jahr 1595 verzeichnet ist.
11Plutarch, Plutarch’s Lives, 2:242.
12 Corey Kilgannon, »Crossing the Delaware, More Accurately«, The New York Times City Room (Blog), 23. Dezember 2011, https://cityroom.blogs.nytimes.com/2011/12/23/a-famous-painting-meets-its-more-factual-match.
13 Ron Chernow, Alexander Hamilton (New York: Penguin Books, 2005), 505.
14 Bernard M. Bass und Ruth Bass, The Bass Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications, 4. Auflage (New York: Free Press, 2008), 15.
15 Joseph C. Rost, Leadership for the Twenty-First Century (New York: Praeger, 1991), 44.
16 David Reimer, »For the Board, Leadership Is a Risk Factor«, Medium (blog), 13. September 2016, https://medium.com/@david.reimer/for-the-board-leadership-is-a-risk-factor-why-that-matters-now-more-than-ever-d005d32bfcdf
17Alexander Hamilton, »To Major General Horatio Gates«, 5. November 1777, U.S. National Archives, https://founders.archives.gov/documents/Hamilton/01-01-02-0335.
18Alexander Hamilton, »To George Washington«, 29. Januar 1778, U.S. National Archives, http://founders.archives.gov/documents/Hamilton/01-01-02-0353.
19Alexander Hamilton, »Alexander Hamilton Papers: Miscellany, –1820; Military Papers; By Period; American Revolution, 1775 to 1783; New York Artillery Company Pay Book. Beinhaltet Aufzeichnungen von Hamilton über verschiedene Themen, 1776, Aug.–1777«, 1776, Kongressbibliothek, https://www.loc.gov/item/mss246120811/, Abbildung 146.
20 Thomas H. Russell, Life and Work of Theodore Roosevelt (L. H. Walter, 1919), 260, www.theodore-roosevelt.com/images/research/scholars/trlifeandworkrussell.pdf
21 Erica Benner, Be Like the Fox: Machiavelli’s Lifelong Quest for Freedom (New York: W. W. Norton, 2017), 34, 165–66.; G. J. Barker-Benfield, Abigail and John Adams: The Americanization of Sensibility (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 230; John Adams, »John Adams to John Quincy Adams«, 4. Oktober 1790, http://founders.archives.gov/documents/Adams/04–09–02–0067; Thomas Jefferson, »To John Quincy Adams«, 1. November 1817, US-Nationalarchiv, http://founders.archives.gov/documents/Jefferson/03–12–02–0120.; »Plutarch & the Issue of Character«, New Criterion, Dezember 2000, https://www.newcriterion.com/issues/2000/12/plutarch-the-issue-of-character.
22 D. A. Russell, Plutarch (New York: Charles Scribner’s Sons, 1973), 103.
23Plutarch, Plutarch’s Lives, Hrsg. Arthur Hugh Clough, übers. v. John Dryden, Modern Library Paperback Edition, Bd. 1 (Toronto: Random House, 1992), 202.
24 Russell, Plutarch, 113. Laut Russell: »Wie die Paare ausgesucht und der Plan entwickelt wurde, muss im Wesentlichen ungewiss bleiben.« Russell argumentiert überzeugend, Plutarch habe über Griechen und Römer geschrieben, weil er wollte, dass die kulturellen Ideale der Griechen die politische Macht der Römer beeinflussen, da er seine Parallelbiografien auf der Höhe des Römischen Reiches geschrieben habe. Russell schreibt: »Gemäß Plutarchs Sichtweise war Humanität etwas, das die griechische Bildung einer Welt vermitteln konnte, die von der potenziell zerstörerischen Kraft der römischen Armeen beherrscht wurde.« (98).
25Plutarch, Plutarch’s Lives, 1:291.
26Plutarch, Plutarch’s Lives, 1:326. In den Worten von D. A. Russell, »Das Wichtigste ist der richtige Einsatz von Bildung und Umfeld, selbstverständlich nicht, um das Böse zu verstecken, sondern um die guten Tendenzen zu stärken und alles Schädliche auszumerzen.« (87).
27Plutarch, Plutarch’s Lives, 1:325.
»The Marble Man«: Robert E. Lee
In uns allen, so gewöhnlich wir auch sein mögen, schlummert ein Rätsel, etwas, das weder wir selber noch andere verstehen. Wir nennen es Persönlichkeit, ein vager Begriff, der vieles bedeutet, zum Beispiel Mut, gesunder Menschenverstand, schnelle Auffassungsgabe, Entschlossenheit, Selbstbeherrschung und viele andere Qualitäten, die sich nicht offenbaren, bis die entsprechende Gelegenheit kommt und die Umstände günstig sind. Die meisten von uns leben und sterben in einem Verlies und das Rätsel stirbt mit uns. Einigen wenigen gelingt es zu entkommen, zumeist per Zufall, und wenn wir eine starke Persönlichkeit besitzen, leisten wir etwas Nennenswertes, und dann wird aus dem Rätsel oft ein Mythos. Wir hören auf zu sein, wer wir wirklich sind, und werden zu etwas, was wir nie sein könnten – etwas, das dem gewöhnlichen Geist schmeichelt.1
Major-General J. F. C. Fuller
Das Bild
An einem Sonntagmorgen im Jahr 2017 nahm ich sein Bild ab, und am Nachmittag stand es mitten unter dem ganzen anderen Sperrmüll auf dem Gang und wartete darauf, zur nahe gelegenen Müllhalde abtransportiert zu werden. Ein wenig heldenhaftes Ende.
Das Gemälde besaß keinen ökonomischen Wert; es war nur ein Kunstdruck, der mit einigen Pinselstrichen versehen war, damit er irgendwie echt aussah. Vierzig Jahre zuvor hatte eine junge Frau ihrem Ehemann im Rang eines Leutnants dieses Bild geschenkt, als der Preis von 25 Dollar (gerahmt) noch gewisse Kompromisse in unserem Haushaltsbudget erforderte. Das würdevolle Porträt von General Robert E. Lee in seiner Uniform der Konföderierten Armee war stets eines meiner besonders geschätzten Besitztümer gewesen. Ich war nicht weit von dem Herrenhaus der Familie Custis-Lee aufgewachsen und war zur Hundertjahrfeier der Beendigung des amerikanischen Bürgerkriegs noch ein sehr leicht zu beeindruckender siebenjähriger Junge. In West Point warf Lee, der nahezu perfekte Kadett, Held des Mexikanischen Kriegs, Direktor der Militärakademie West Point und schließlich Kommandeur der Konföderierten Armee in North Virginia, einen langen und stets präsenten Schatten. Später, in den Armeequartieren von Fort Benning, Georgia, bis Fort Lewis, Washington, spiegelte das Gemälde meine Faszination für das Thema Führung wider und vermittelte für mich die Werte Pflichterfüllung und selbstloser Dienst an der Nation.
Zwar war es letztlich nur ein Porträt, aber bei vielen weckte es eine ganze Bandbreite an Ideen und Gefühlen. Denn wie ein Gegenstand, der ins Licht der untergehenden Sonne getaucht ist, wuchs Robert E. Lees Schatten zu übernatürlicher Größe, die ständig zunahm, je weiter der Sezessionskrieg in den weichen Glanz der Geschichte rückte.
Um Lee und die Sache, der er gedient hatte, begann sich ein Mythos zu spinnen. Für viele nahmen Lees Qualitäten und Leistungen, die für sich genommen schon beeindruckend waren, gottähnliche Proportionen an. Das war der Lee, den ich kennenlernte: eine Führungspersönlichkeit, deren Schwächen und Misserfolge in der kollektiven Erinnerung wegpoliert waren; die sehr menschliche Figur umgestaltet zum zweidimensionalen Helden, dessen Schatten den Mann, in dem das Heldenimage seinen Ursprung hatte, vollkommen verdeckte.
Im Verlauf der Zeit wurde der Mythos jedoch neu untersucht. Die dunkleren Seiten an Lees Vermächtnis und das Bild in meinem Büro kommunizierten nun Vorstellungen über Rasse und Ungleichheit, mit denen ich mich nicht identifizieren konnte. Das Bild musste weg.
Das war keine einfache Entscheidung. Seit fast 150 Jahren war Lee Gegenstand des Studiums und der Bewunderung gewesen, und zwar nicht nur wegen seiner außerordentlichen Fähigkeiten, sondern auch als Symbol eines unerschütterlichen Pflichtgefühls – »duty«, ein Begriff, den er angeblich einst als »edelstes Wort in der englischen Sprache« bezeichnet hatte.2 Zwar konnte ich die instinktive Assoziation mit Sklaverei und Ungerechtigkeit nachvollziehen, die die Bilder des berühmtesten Befehlshabers der Konföderierten ein Leben lang weckten, allerdings war das nicht die Assoziation, die ich dabei hatte. Ich hatte Winstons Churchills Sätze gelesen und geglaubt, dass »Lee einer der ehrenwertesten Amerikaner war, die je gelebt haben, und einer der großartigsten Befehlshaber in den gesamten Kriegsannalen«.3 Präsident Franklin Roosevelt zollte Lee 1936 anlässlich der feierlichen Enthüllung einer Statue, die ihm zu Ehren aufgestellt wurde, mit den folgenden Worten Tribut:
»In den gesamten Vereinigten Staaten schätzen wir ihn als herausragenden Führer und großartigen General. Ich glaube aber, dass wir ihn in den gesamten Vereinigten Staaten darüber hinaus als etwas weitaus Wichtigeres anerkennen. Wir schätzen Robert E. Lee als einen unserer größten amerikanischen Christen und einen der herausragendsten amerikanischen Gentlemen.«4
Ironischerweise erkannte ich im Alter von 63 Jahren – dem gleichen Alter, in dem Lee verstarb –, dass ich mich geirrt hatte – in gewisser Hinsicht über Lee als Führer, aber ganz gewiss in Bezug auf die Botschaft, die Lee als Symbol vermittelte. Und wenngleich mir das erst spät klar wurde, hatte ein erheblicher Teil der amerikanischen Gesellschaft, die zum großen Teil noch von den Nachwirkungen der Sklaverei geprägt war, dies schon lange verspürt.
Dennoch wusste ich, als ich über Plutarch nachdachte und selbst begann, mich aus der Perspektive bedeutender Führungspersönlichkeiten mit dem Thema Führung auseinanderzusetzen, dass jede Liste, auf der Lees Name fehlte, unvollständig sein würde. Nicht weil Lee der intelligenteste, mächtigste oder erfolgreichste Führer gewesen wäre, sondern weil seine Geschichte gewisse Ähnlichkeiten mit meiner eigenen aufwies. Ich hatte ein Soldatenleben geführt, hatte einen ähnlichen Weg eingeschlagen und hatte mich oft auf den gleichen Pfaden bewegt und versucht, die Kunst und Wissenschaft des Führens zu meistern. Wie Lee hatte ich den Geschmack des Erfolgs ausgekostet, aber auch bittere Niederlagen einstecken müssen. Das Vorbild, an dem ich mein Verhalten maß – manchmal bewusst, manchmal unbewusst – war der Soldat Robert E. Lee.
Das Porträt des Soldaten Robert E. Lee, das in zahlreichen Armeequartieren hing, in denen Annie und ich mehr als dreißig Jahre lebten.
(Foto von Buyen Large/Getty Images)
Lee in eine Untersuchung über Führung aufzunehmen, birgt das Risiko der Fehlinterpretation, der Kontroverse und sogar des wütenden Protests. Als Plutarch den römischen General Coriolanus porträtierte, der die Volsker5 besiegt hatte, nur um seine ehemaligen Feinde später gegen Rom zu führen, bot ihm das die Möglichkeit, dessen Tugenden eingehender zu studieren. Dem vergleichbar bietet uns die Untersuchung von Lees Persönlichkeit die Gelegenheit, unser Verständnis von Führung zu vertiefen. Es ist eine bewusste Entscheidung, diese Untersuchung mit einer Führungsfigur zu beginnen, von der ich dachte, dass ich sie sehr gut kannte, und sie mit einem neuen, unverstellten Blick zu betrachten – vor dem Hintergrund einer reichen Lebenserfahrung, die meine Auffassung von Führung im Lauf der Jahre geformt hat.
Die meisten Schilderungen über Lee als Mann und Führungspersönlichkeit – seine äußere Erscheinung, sein Auftreten, seine Werte und seine scheinbare Abgeklärtheit – spiegeln im Wesentlichen alle erstrebenswerten Führungseigenschaften wider. Wenn man in gleißendes Licht blickt, kann man jedoch nicht gut sehen. Mehr als die meisten Führer wird Lee entweder im hellen Schein der Heldenverehrung oder, wie in jüngerer Zeit, im dunklen Schatten der Geringschätzung porträtiert. Oft fällt es schwer, den Führer von dem Mythos zu trennen, der ihn umgibt, und Lee bildet hier keine Ausnahme. Bei näherer Betrachtung weicht der Mythos hinter der Realität seiner Geschichte zurück. Für uns ist er einer der maßgeblichen Protagonisten des amerikanischen Bürgerkriegsdramas, allerdings waren viele Ergebnisse dieses Krieges die Folge einer Kombination aus anderen Faktoren und nicht das Ergebnis seiner Handlungen. Und sein Charakter? In mancher Hinsicht war er ein guter Mann, in manch anderer ein schlechter. Das sollte jedoch unser Urteil über seine Führung nicht beeinflussen. Führung selbst ist weder gut noch schlecht. Böse Führer gibt es genauso häufig wie gute. Man sollte Führung eher daran bemessen, ob sie effektiv ist oder nicht. War Lee effektiv? In vielerlei Hinsicht ja, in mancherlei Hinsicht nein.
Die Weggabelung
»Mit meinem gesamten Kommando«, sagte der jüngere General bestimmt und damit waren die Würfel gefallen.6
Die beiden Männer, der 56-jährige General Robert E. Lee und der 39-jährige Thomas Jonathan Jackson, der seit Ausbruch des Bürgerkriegs den Spitznamen »Stonewall« trug, hatten sich spätabends zu Pferd zu einer Lagebesprechung getroffen, bei der sie die Gefechte des Tages analysierten und Pläne für den folgenden Tag schmiedeten.7
Ich erinnere mich gut an die Szene. Diese Zusammenkunft war in einem romantischen Ölgemälde von 1869 dargestellt, das ein Immigrant aus St. Helena namens Everett B. D. Julio angefertigt hatte. Ein Schwarzweißdruck hing an prominenter Stelle in meiner Grundschule in Virginia. Auf dem Bild schienen die beiden berittenen Generäle in ihren makellosen Uniformen bereit zum Gefecht.
Ein Druck von Everett B. D. Julios romantischer und größtenteils ungenauer Darstellung von dem letzten Treffen der Generäle Lee und Jackson auf dem Schlachtfeld in Chancellorsville von 1863. Eine Kopie hing in der Stonewall-Jackson-Grundschule in Arlington, Virginia. Zu dieser Zeit besuchte ich die vierte Klasse besuchte.
Die scharfe Linie eines Bergrückens im Hintergrund, die im Gelände von Chancellorsville in Wahrheit nicht existiert, verleiht dem Bild eine dramatische Note.